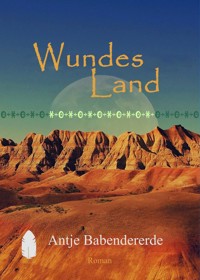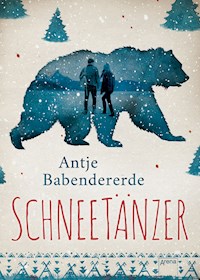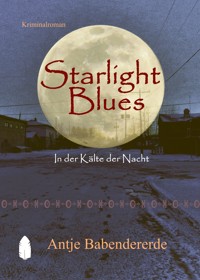
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Adam Cameron ist Journalist und Privatdetektiv in Seattle – ein indianischer Privatdetektiv. Als Dreijähriger wurde er von einem weißen Ehepaar adoptiert, das ihm seine Herkunft vorenthielt und das Wissen darum mit ins Grab nahm. Als ihn in seinem Büro ein Telefonanruf aus Winnipeg erreicht, ist er wie elektrisiert: Der Nachname des Anrufers ist Blueboy, und das ist auch Adams indianischer Name. Robert Blueboy bittet ihn herauszufinden, warum sein siebzehnjähriger Bruder Daniel vor zehn Jahren den Kältetod sterben musste. Daniel war aus einer Besserungsanstalt abgehauen und ein paar Tage später fand man ihn außerhalb der Stadt: leicht bekleidet im Schnee, war er jämmerlich erfroren. Alles deutete auf einen tragischen Unglücksfall hin. Doch warum trug der tote Junge nur einen Schuh? Obwohl Adam für Kanada keine Lizenz als Privatdetektiv besitzt und noch dazu eine unerklärliche Schnee- und Kältephobie hat, fliegt er im Januar nach Winterpeg, wie die Winnipegger ihre Stadt nennen. Bei seinen Recherchen trifft er auf übellaunige Polizisten, einen kurzsichtigen Pathologen und eine Mauer des Schweigens. Plötzlich befindet er sich selbst in größter Gefahr und will nur noch eins: zurück. Doch dafür ist es längst zu spät ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antje Babendererde
Starlight Blues
In der Kälte der Nacht
Kriminalroman
Impressum
Antje Babendererde „Starlight Blues - In der Kälte der Nacht“ Kriminalroman
Copyright: © 2015 Antje Babendererde
Gewidmet Neil Stonechild 1973-1990
We want to be Indian
We want to be red,
We want to be free
Or we want to be dead.
Anonymous Native American who committed suicide
1. Kapitel
Meine Detektei stand nicht im Branchenverzeichnis und war auch nicht im Internet zu finden. Meine Telefonnummer kursierte jedoch schon seit jener Zeit in den Indianerreservaten, als ich noch ausschließlich als Journalist arbeitete. Inzwischen gab es Tage, da klingelte das Telefon ohne Unterlass.
Dieser Freitag war jedoch ungewöhnlich ruhig gewesen. Niemand hatte angerufen oder war in mein Büro gekommen, um mich zu bitten, der Gerechtigkeit auf die Sprünge zu helfen. So hatte ich endlich die Kolumne über Seattles Stadtindianer geschrieben, damit meine Schwester Alice sie in die Montagsausgabe des Olympic Independent setzen konnte. Ich saß über den Korrekturen des Artikels, als das Klingeln des Telefons mich aus meinen Gedanken schreckte.
Susan war am Apparat, sie rief aus dem Northwest Hospital & Medical Center an. Unsere Tochter Amina war mit ihrer Schulklasse beim Schlittschuhlaufen gewesen und hatte sich den Arm gebrochen.
„Kein schlimmer Bruch“, beruhigte mich Susan. „Aber komm bitte nach Hause, Amina braucht dich.“
Eilig schickte ich die fertige Kolumne per E-Mail an meine Schwester und war im Begriff meine Bürotür abzuschließen, als das Telefon erneut klingelte. Ich wollte nicht rangehen, aber der Anruf konnte wichtig sein, deshalb blieb ich in der Tür stehen und wartete. Nach dem fünften Klingeln schaltete sich der Anrufbeantworter ein.
Zuerst blieb es still, das war nicht ungewöhnlich. Viele meiner Klienten kostete es große Überwindung, mich anzurufen. Wenn sich dann auch noch der Anrufbeantworter einschaltete, konnte es passieren, dass sie aufgaben, ohne mit mir gesprochen zu haben. Manchmal blinkte das rote Licht, wenn ich in mein Büro kam, aber das Band war bis auf ein Pfeifen und Piepsen leer.
Doch diesmal war anders. Nach kurzem Zögern meldete sich ein Mann, der offensichtlich völlig durcheinander war. Er redete unzusammenhängend, sprach von einem toten Bruder, der erfroren sei und ihm nun im Traum erscheinen würde. Ich hatte keine Ahnung, was er von mir wollte. Das alles erschien mir seltsam wirr und ich musste an meine Tochter denken, doch als der Mann seinen Namen nannte, jagte ein Adrenalinstoß durch meine Adern. Robert Blueboy, das konnte kein Zufall sein. Mit drei großen Schritten war ich beim Schreibtisch und riss den Hörer ans Ohr.
„Mr Blueboy, ich bin jetzt dran.“
Wieder war es still in der Leitung. Hatte der Anrufer den Mut verloren und aufgelegt? „Hallo, sind Sie noch da?“
„Ja“, meldete sich Robert Blueboys verunsicherte Stimme. „Sie sind doch der Adam Cameron? Ich meine, ich bin doch richtig, oder?“
„Ja“, sagte ich, „sind Sie. Bitte erzählen Sie mir noch einmal langsam, was genau passiert ist.“
Blueboy holte tief Luft. „Es geht um meinen Bruder“, sagte er. „Man hat ihn erfroren auf einem freien Feld am Stadtrand gefunden. Seit einigen Nächten erscheint Dan in meinen Träumen. Er will, dass seine Mörder gefunden werden.“
„Moment mal, das verstehe ich nicht. Sie sagten doch gerade, er wäre erfroren.“
„Ja, das stimmt. Aber ich kann nicht glauben, dass er von alleine dort hingekommen ist, wo man ihn fand. Niemand von uns glaubt das.“
So ist es immer. Man will nicht glauben, dass jemand, den man liebt, tot ist.
„Von wo aus rufen Sie überhaupt an, Robert?“
„Aus Winnipeg, Manitoba.“
Kanada , auch das noch. Ewig dauernder Winter, bittere Kälte und viel, viel Schnee. Mein Magen zog sich zusammen.
„Hören Sie“, sagte Robert Blueboy nach kurzem Schweigen, „ich weiß, dass zehn Jahre eine lange Zeit sind, aber ...“
„Zehn Jahre?“, unterbrach ich ihn. „Ihr Bruder ist vor zehn Jahren gestorben?“
„Ja, sagte ich das nicht? Verzeihen Sie, aber ich bin ziemlich durcheinander. Daniel war erst siebzehn und hatte sein ganzes Leben noch vor sich. Ich will nicht, dass er umsonst gestorben ist.“
„Verstehe. Aber kommt dieser Wunsch nicht etwas spät?“ Zehn Jahre waren eine verdammt lange Zeit. Nahezu aussichtslos, nach so vielen Jahren noch brauchbare Zeugen zu finden, Leute, die sich an den Jungen erinnern würden. Ich zögerte. Gerechtigkeit ist keine Frage des Zeitpunkts, hatte mein Vater immer gesagt.
„Bitte helfen Sie mir“, sagte Blueboy. „Ich bin es meinem Bruder schuldig.“
Ich unterdrückte ein Seufzen. Es war eine traurige, wenn auch keine weltbewegende Geschichte: Ein erfrorener Indianerjunge, der zehn Jahren nach seinem Tod dem Bruder im Traum erschien und Gerechtigkeit verlangte. Solche Dinge passieren: Dass Leute im Winter erfrieren. Oder dass tote Angehörige einem im Traum erscheinen. Ich träumte heute noch manchmal von meinen Adoptiveltern.
Es wäre fair und vernünftig gewesen, Robert Blueboy die Wahrheit zu sagen. Nämlich, dass ich als Privatdetektiv keine Lizenz für Kanada besaß. Ich hätte bedauern und auflegen sollen. Aber ich konnte nicht mehr so tun, als ob ich den Hörer nicht abgenommen hätte, denn dieser Mann hatte einen Trumpf in der Hand. Einen, von dem er nichts ahnte, ein Zufall, der mein Inneres in Aufruhr versetzte: Blueboy, das war auch mein Name.
Dass Carl und Margret Cameron nicht meine richtigen Eltern waren, hatte ich erst nach ihrem Tod erfahren. Mein Geburtsname lautete Adam Lee Blueboy und meine Mutter hatte mich weggegeben, als ich drei Jahre alt war. Die Camerons hatten mich adoptiert und das Wissen um meine Herkunft mit ins Grab genommen. Seither versuchte ich, Licht ins Dunkel meiner Herkunft zu bringen.
Vielleicht war Robert Blueboy mein Cousin oder gar mein Bruder. Bei diesem Gedanken schlug mein Herz schneller. Bisher war jede Spur, der ich nachgegangen war, im Sande verlaufen. Aber ich dachte nicht daran, aufzugeben. Es ließ mir keine Ruhe, dass meine Adoptiveltern ein Geheimnis um meine Herkunft gemacht hatten. Jahrelang hatten sie mir die Wahrheit verschwiegen und ich wollte herausfinden, warum. Ich würde mich also um den toten Daniel Blueboy kümmern, auch wenn ich dafür mitten im Winter in ein Flugzeug steigen musste, und mein Detektivausweis auf kanadischem Boden so viel wert war wie ein Stück Toilettenpapier.
„Ich komme, sobald ich kann“, sagte ich.
Robert schien einen Moment zu brauchen, bis er begriff, dass er mich überzeugt hatte. „Eine Frage noch. Ist es wahr, dass Sie manchmal ... ich meine, stimmt es, dass Sie ... ich habe nicht viel Geld, Mr Cameron.“
„Machen Sie sich darum mal keine Gedanken“, beruhigte ich ihn.
Blueboy gab mir seine Adresse und die Telefonnummer durch. Ich versprach mich zu melden, sobald ich wusste, wann ich in Winnipeg eintreffen würde.
Ich ging zur Karte an der Wand und schätzte die Entfernung zwischen Seattle und Winnipeg. Ein Seufzen kam aus meiner Kehle. Seit meine Adoptiveltern in einem Flugzeug zu Tode gekommen waren, hatte sich aus meiner latenten Aversion gegen das Fliegen eine ernst zu nehmende Flugangst entwickelt. Manchmal ließ es sich allerdings nicht vermeiden, in ein Flugzeug zu steigen. Natürlich hätte ich mich auch in meinem alten Jeep Cherokee auf den Weg nach Winnipeg machen können, aber dann hätte ich mindestens zwei Tage für die Strecke gebraucht und wäre unterwegs vielleicht in einem Schneesturm stecken geblieben. Ich entschied also, meine Furcht zu überwinden und das Vernünftige zu tun, auch, wenn es mir schwer fiel.
Beherzt wählte ich die Nummer vom Ticketservice des Sea-Tac Airport und erwischte noch eine Flugverbindung nach Winnipeg für den Sonntag. Nachdem ich mir die Flugdaten notiert hatte, rief ich Robert Blueboy zurück und sagte ihm durch, wann mein Flieger landen würde. Er versprach, mich am Flughafen abzuholen.
Wie ich ihn erkennen würde, wollte ich wissen.
Er würde mich erkennen, sagte er.
Seattle im Januar ist eine Zumutung. Und wie jeden Winter hegte ich den Gedanken, mit meiner Familie der Stadt am Pudget Sound den Rücken zu kehren und uns eine Bleibe im sonnigen Süden zu suchen. In Santa Fé beispielsweise, denn die Kultur der ältesten Stadt Amerikas fasziniert mich und das milde Klima New Mexicos war eine große Verlockung.
Ich dachte dauernd daran wegzuziehen, aber Seattle hielt mich fest. Oder besser, meine Familie hielt mich fest. Mein Kinder Amina und Mike, die hier geboren und zuhause waren. Meine Frau, die ihren Job als Dozentin an der University of Washington liebte und nicht zuletzt Alice, meine kleine Schwester, die drei Jahre nach dem Tod unserer Eltern die Leitung des Zeitungsverlages übernommen hatte, der uns zu gleichen Teilen gehörte.
Der Verlag, ein paar Aktien und eine große viktorianische Villa auf Mercer Island waren das Erbe von Carl und Margret Cameron. Nach ihrem plötzlichen Tod hatte ich mein Jurastudium abgebrochen und mich in verschiedenen Teilen des Landes herumgetrieben. Ich ließ meine Haare lang wachsen, um von vorne herein keine Zweifel mehr an meiner Herkunft aufkommen zu lassen. Damals war ich dreiundzwanzig und mir stand auf einmal nicht mehr der Sinn danach, zu studieren, geschweige denn, ein Unternehmen zu leiten.
Alice war erst zwanzig und studierte Journalistik in San Francisco. Sie beendete ihr Studium als eine der Besten in ihrem Jahrgang, doch bis es so weit war, wurde der Verlag treuhänderisch von einem Freund unseres Vaters geführt. Als meine Schwester das Regionalblatt schließlich übernahm, war es arg in Bedrängnis geraten. Das Internet hatte als Informationsquelle schnell an Bedeutung gewonnen und die Konkurrenz schlief nicht. Die Auflagen des Olympic Independent befanden sich im Sinkflug - Alice musste sich etwas einfallen lassen.
Sie stöberte mich in einem Indianerreservat in South Dakota auf und bat um meine Unterstützung. Da ich ohnehin an einem toten Punkt angelangt war auf meinem Selbstfindungstrip, und dazu noch in einer verteufelten Beziehungskrise steckte, kehrte ich meinem Vagabundenleben den Rücken und ging mit Alice nach Seattle zurück.
Ich belegte Collegekurse in Journalistik und gemeinsam päppelten wir den Zeitungsverlag wieder auf. Mit Hilfe eines befreundeten Designers erarbeiteten wir ein neues Layout und stellten zwei junge Journalisten ein, die in der Lage waren, das Lebensgefühl des Nordwestens zu erfassen und die Themen originell umzusetzen. Wir setzten gut recherchierten Journalismus gegen dumpfen Sensationalismus und das Konzept ging auf.
Aber die Zeitung war und blieb Alices Kind. Der Verlag war ihr Lebensinhalt. Meine Schwester war eine harte Arbeiterin und gute Redakteurin. Sie hatte nie eine Familie gegründet, weil sie sich aus Männern nichts machte. Ihr Coming out mit vierzehn war schwierig gewesen, die Suche nach einer Partnerin, mit der sie zusammenleben konnte, schien ein erfolgloses Unterfangen zu sein. Alices Liebesgeschichten endeten immer unglücklich.
Ich selbst hatte nach meiner Rückkehr in die Stadt einige Jahre für den Olympic Independent geschrieben und mich – was naheliegend war - für die Belange der amerikanischen Ureinwohner eingesetzt. Zunächst regional, denn im Bundesstaat Washington lag vieles im Argen: Immer wieder bedrohte Öl aus Tankerunglücken die Küste und die Fischgründe der dort ansässigen Indianerstämme. Einige Stämme wehrten sich gegen die Überfischung ihrer Küstengewässer durch weiße Sportfischer; die Makah hatten unter heftigen Protesten von militanten Tierschützern den Walfang wieder aufgenommen und es gab Landstreitigkeiten im Nationalpark.
Meine Artikel wurden zunehmend auch in überregionalen Zeitungen abgedruckt und immer mehr Indianer aus allen Teilen des Landes nahmen Kontakt zu mir auf. Es galt, alte und neue Ungerechtigkeiten publik zu machen. Ich verbrachte also wieder viel Zeit auf der Straße, obwohl ich inzwischen verheiratet war und Kinder hatte.
Da ich bei meinen Recherchen nicht selten in großen Misthaufen herumstocherte, geriet ich immer wieder in gefährliche Situationen. Einige Menschen in diesem Land hatten keine Hemmungen, einen Indianer ohne mit der Wimper zu zucken ins Jenseits zu befördern, wenn er ihren Interessen auf irgendeine Weise in die Quere kam. Vermutlich war das ein angeborener Reflex der Angloamerikaner, ein Relikt aus den Zeiten der Indianerkriege.
Trotzdem recherchierte ich weiter. Hin und wieder gelang es mir, mit meinen Reportagen etwas zu bewirken. In den meisten Fällen änderten meine publik gemachten Wahrheiten jedoch überhaupt nichts. Nämlich immer dann, wenn Geld und Macht am größeren Hebel saßen.
Deshalb gelangte ich vor zwei Jahren an den Punkt, an dem das Schreiben allein nicht mehr ausreichte: Ich wollte mehr tun.
Als privater Ermittler hatte ich viel mehr Möglichkeiten, deshalb entschied ich, eine Detektei zu eröffnen. Susan und Alice waren entsetzt, aber ich ließ mich nicht beirren. Ich konnte einfach nicht mehr tatenlos zusehen, wie dieses Land die Rechte seiner Ureinwohner mit den Füßen trat.
Zuerst holte ich meinen Bachelor in Strafjustiz nach, im Anschluss durchlief ich ein paar Tests der Sicherheitsbehörden des Bundesstaates Washington, bestand eine zweistündige schriftliche Prüfung und erwarb eine Lizenz als Privatdetektiv sowie einen Waffenschein.
Mein Sohn Mike war begeistert.
Allerdings trage ich meinen halbautomatischen Revolver nur, wenn es unbedingt sein muss, denn ich habe mehr als einmal gesehen, was eine Waffe für furchtbaren Schaden anrichten kann.
2. Kapitel
Aus praktischen Gründen befand sich mein Detektiv-Büro im Verlagsgebäude des Olympic Independent, einem zweistöckigen Bau mit gelber Bretterverkleidung am Pier 54, gegenüber dem Seattle Fire Departement. Der Raum im ersten Stock hatte zwei große Fenster. Eines mit Blick auf die Elliott Bay und eines, von dem aus ich bei klarem Wetter den Mount Rainier am südlichen Horizont sehen konnte.
Mein Adoptivvater, der aus dem sonnigen Kalifornien stammte, kam 1965 nach Seattle, erwarb das Gebäude und gründete zwei Jahre später seinen Zeitungsverlag – gleich mit großem Erfolg. Er lernte Margret kennen, eine Kanadierin aus der Provinz Manitoba, die als Studentin nach Seattle gekommen war und sich als Sekretärin bei ihm beworben hatte. Laut meinen Adoptiveltern war es Liebe auf den ersten Blick. Die beiden heirateten wenig später und erwarben eine viktorianische Villa auf Mercer Island, in der Alice und ich aufwuchsen.
Das Haus war viel zu groß für vier Menschen und für zwei erst recht. Nach dem Tod unserer Eltern verkauften wir die Villa und Alice lebte seitdem in einem Apartment im Norden von Seattle.
Kurz nach meiner Rückkehr in die Stadt lernte ich Susan kennen, wir heirateten ein Jahr später und kauften uns ein Haus in der Nähe des Uni-Geländes. Susan konnte zur Arbeit laufen, ich fuhr jeden Tag mit dem alten Jeep Jerokee in mein Büro am Hafen.
Nasser Schnee flog mir ins Gesicht, als ich das Verlagsgebäude verließ. Auf dem schwarzen Wasser des Pudget Sound tanzten weiße Schaumkronen. Ich fasste mein langes Haar im Nacken zusammen und sah zu, dass ich zu meinem Wagen kam. Mein Parkplatz lag gleich gegenüber, unter dem Viadukt, einem hässlichen grauen Betonbau, der den Hafen vom Stadtzentrum trennte, und auf dem jetzt der Nachmittagsverkehr rollte.
Ich warf den Motor an und drehte sofort die Heizung hoch. Unterwegs machte ich einen Zwischenstopp am Pioneer Place, um für Amina ein Buch und bei Lilly’s Sweets an der Ecke zwei Tüten Salzwasser Toffees zu kaufen. Es war spät geworden, und auf dem restlichen Heimweg dachte ich darüber nach, wie ich Susan die Verspätung erklären sollte.
Unser einstöckiges Holzhaus stand am Capitol Hill, ein paar Blocks hinter dem Universitätsgelände. Auf dem Weg dorthin war das Schneetreiben dichter geworden. Ich parkte in der Einfahrt und eilte die Stufen zum überdachten Eingang hinauf. Noch bevor ich den Schlüssel ins Schloss stecken konnte, öffnete sich die Tür und Mike sprang mir an den Hals. „Hi, Daddy“, sagte er mit leuchtenden Augen. „Hast du heute wieder einen Killer gejagt?“
Ich lachte und drückte meinen Sohn an mich. „Nein Mike, heute war gar nichts los. Bei diesem Wetter bleiben die Leute in ihren warmen Häusern, gucken Fernsehserien und kochen gutes Essen. Da haben sie keine Lust, Dummheiten zu machen.“
Natürlich erwartete mein Sohn eine brandneue Verbrechergeschichte von mir, aber ich hatte keine. Stattdessen kreisten meine Gedanken um Daniel Blueboy, den erfrorenen Indianerjungen aus Winnipeg.
„Wie geht es deiner Schwester?“, fragte ich.
„Sie sitzt in ihrem Zimmer und redet mit niemandem.“ Mike verdrehte gelangweilt die Augen. Er war acht und manchmal fiel es ihm schwer, mit seiner zwei Jahre älteren Schwester auszukommen. Amina war ein stilles, zurückhaltendes Mädchen, der alles, was sie anfing, gelang. Mike hingegen war ein Unglücksrabe, oft machte er sich selbst das Leben schwer. Dass seine perfekte Schwester sich den Arm gebrochen hatte, tat ihm durchaus leid, aber die Tatsache, dass auch bei ihr mal etwas schiefgegeangen war, schien ihn zu erleichtern.
Susan begrüßte mich mit einem enttäuschten: „Ich hatte dich eher erwartet.“
„Ich war noch in der Stadt, um Amina ein Buch zu besorgen“, brachte ich zu meiner Entschuldigung hervor.
„Und das hat so lange gedauert?“ Skeptisch blickte sie mich an. „Amina steht vermutlich noch unter Schock. Sie spricht nicht.“
Das tat Amina immer, wenn sie wollte, dass ihr Vater auf der Stelle zu ihr kam, um sie zu trösten. „Ich kriege das schon hin“, beruhigte ich sie und legte Mike die Hände auf die Schultern. „Geh schon mal in euer Zimmer“, bat ich ihn. „Ich komme gleich und lese euch etwas vor.“
Mike huschte davon und ich sah meine Frau an. Ihre Augen hatten diesen traurigen, unnahbaren Blick, den ich erst seit ein paar Monaten kannte und der mich verunsicherte, wenn ich ihm begegnete.
Vor elf Jahren hatte ich Susan bei Recherchen für einen Artikel über indianische Studenten kennengelernt und mich auf der Stelle in sie verliebt. Ich hatte mich in ihr Lachen verliebt. Susan hatte dunkles Haar und einen dunklen Teint und als ich sie fragte, von welchem Volk sie abstamme, lachte sie. Es gab keine indianischen Vorfahren in ihrer Familie, Susans Wurzeln lagen auf Sizilien – und darauf war sie stolz.
Ihre unbändige Lebenslust faszinierte mich, ihre unkomplizierte Art. Natürlich gab es noch andere, denen es genauso erging, und ich litt darunter, dass Susan ihr Lachen so freigiebig verschenkte. Umso überraschter war ich, als ich herausfand, dass ich der erste Mann war, mit dem sie schlief. Susan war damals dreiundzwanzig.
Zehn Jahre waren wir inzwischen verheiratet und obwohl ich mir geschworen hatte, dass Susan von nun an die Einzige sein würde, war ich im vergangenen Jahr gleich zweimal vom Wege abgekommen. Ich liebte meine Frau und hatte mich so bemüht, treu zu sein. Es war einfach passiert. Ich wollte meine Ehe nicht aufs Spiel setzen und hoffte, Susan würde niemals von diesen Entgleisungen erfahren. Aber sie war meine Frau und wusste alles, was es über mich zu wissen gab. Vielleicht ahnte sie auch, dass es andere Frauen gab, denn in letzter Zeit war sie ungeduldiger mit mir als sonst, und in ihren Augen entdeckte ich manchmal diese tiefe Traurigkeit, die mein schlechtes Gewissen auf Hochtouren brachte.
Ich machte einen Schritt auf sie zu, um sie in den Arm zu nehmen, aber Susan sagte: „Geh schon. Amina wartet auf dich.“
Im Kinderzimmer steckte ich Mike eine der beiden Toffee-Tüten zu, obwohl ich wusste, dass seine Mutter etwas gegen die bunten, klebrig-süßen Dinger hatte. Ich hoffte, es würde keine neue Grundsatzdiskussion auslösen, wenn sie die Bonbonpapiere entdeckte. Meine Kinder liebten diese Toffees nun mal.
Amina saß mit Kopfhörern im Ohr auf ihrem Bett. Die große Ähnlichkeit mit ihrer Mutter war immer wieder verblüffend: Dasselbe schmale Gesicht, die großen braunen Augen, das leicht lockige Haar.
Ihre stumme Umarmung fiel durch den Gips recht kläglich aus. Ich setzte mich neben sie, wickelte einen weiß-blauen Toffee aus dem Papier und schob ihn in ihren Mund. Ein winziges Lächeln huschte über ihr Gesicht. Und als ich ihr und Mike aus dem Buch vorlas, das von einem einsamen Wal handelte, der auf abenteuerliche Weise eine neue Familie fand, begann Amina wieder zu sprechen.
Nachdem ich ihr den kleinen Wal mit schwarzem Filzstift auf den schneeweißen Gips gemalt hatte, umarmte sie mich ein zweites Mal. Ich mochte den kindlichen Duft ihrer Haare, liebte ihre Umarmungen. Nicht mehr lange, und die Pubertät würde über meine Tochter hereinbrechen.
Am Abend saßen wir alle zusammen in der Küche und im ganzen Haus duftete es köstlich nach Lasagne. Susan kochte gerne. Und owohl ihr Job als Dozentin für Kunst und Amerikanische Geschichte an der University of Washington sie ziemlich auf Trab hielt, verwöhnte sie uns regelmäßig mit köstlichen Gerichten.
Für eine Weile schien alles im Lot zu sein. Mike stocherte mit vorgeschobener Unterlippe in seinem Essen herum, weil Amina unsere volle Aufmerksamkeit hatte, während sie vom Krankenhaus erzählte. Ihre Wangen glühten rot, die Augen leuchteten. Sie hatte den Schock überwunden.
Nachdem die Kinder den Tisch verlassen hatten, um ihre Lieblingssendung „Die Flintstones“ anzusehen, eröffnete Susan mir, dass ich am kommenden Montag allein zur Elternversammlung gehen müsse, weil sie eine Abendveranstaltung mit einem Archäologieprofessor hatte. Sie hatte den Mann eingeladen, also müsse sie auch anwesend sein und sich um ihn kümmern.
„Das wird schwierig“, wandte ich ein. Meine Hoffnung auf einen friedlichen Abend schwand schlagartig. Susans Begeisterung über meinen neuen Beruf hatte sich von Anfang an in Grenzen gehalten. Oft war ich für mehrere Tage oder sogar Wochen im Land unterwegs, um meine Fälle zu lösen. Ich wusste, dass Susan Angst um mich hatte, auch wenn ich ihr nie in vollem Umfang berichtete, in welche Gefahr ich mich hin und wieder brachte.
Es nützte nichts, ich musste ihr beibringen, dass ich am Montag nicht mehr hier sein würde. Also erzählte ich ihr von diesem Anruf aus Winnipeg.
„Du hast einen Fall angenommen, der zehn Jahre zurückliegt?“ Verwundert sah sie mich an. Vermutlich hatte sie die Verbindung zwischen meinem Fall und den Schwierigkeiten in Sachen Elternversammlung noch nicht hergestellt.
„Nun, dieser Robert Blueboy ist der festen Überzeugung, dass sein Bruder ermordet wurde.“
Susan, die gerade dabei war, den Tisch abzuräumen, hielt abrupt inne. Mit Sicherheit klingelten bei ihr nun sämtliche Alarmglocken. „Wie, sagtest du, ist der Name des Mannes?“
Ich zögerte einen Moment. „Du hast mich schon richtig verstanden.“
Die Teller in der Hand, musterte meine Frau mich eindringlich. „Du hast den Gedanken immer noch nicht aufgegeben, stimmt’s?“
„Nein“, erwiderte ich verdrossen. „Ich werde den Gedanken, meine Familie zu finden, nicht aufgegeben.“
„Du verlässt uns also wieder einmal.“
Wie sie das sagte, klang es tatsächlich so, als würde ich meine Familie verlassen, um verwerfliche Dinge zu tun. Dabei tat ich nur, was ich tun musste. Doch mit Susan darüber zu diskutieren, führte zu nichts. Ich verdiente kein Geld mit diesem Job und meine Familie brauchte mich ebenso, wie diese Menschen mich brauchten. Punkt.
„Ich fliege übermorgen nach Winnipeg und werde vermutlich ein paar Tage weg sein.“
„Übermorgen schon?“ Hart stellte sie die Teller auf den Tisch zurück, dass es klirrte. „Aber Amina braucht dich jetzt. Hättest du das Ganze nicht ein paar Tage verschieben können? Dieser Junge ist seit zehn Jahren tot, es hätte ihm sicher nichts ausgemacht, noch ein bisschen länger zu warten, bis du dich seiner annimmst.“
Ich dachte daran, wie durcheinander Robert am Telefon gewirkt hatte. „Das ist mein Job, Susan und außerdem hatte ich meinen Flug schon gebucht, als du mich heute wegen Amina angerufen hast.“
Ich griff ungern zu dieser Notlüge, aber ich hatte auch keine Lust, als schlechter Vater hingestellt zu werden. „Und wir haben ja auch noch Kathy.“
Kathy Sloan war eine von Susans Studentinnen. Sie passte auf die Kinder auf, wenn meine Frau und ich ausgehen wollten oder wir beide noch am Abend beruflich zu tun hatten, was hin und wieder vorkam.
„Soll Kathy auf die Kinder aufpassen oder zur Elternversammlung gehen?“, fauchte sie mich an und verließ die Küche.
Ich räumte das Geschirr in den Spüler und wischte den Tisch ab. Anschließend schickte ich die Kinder ins Bad. Susan saß an ihrem Schreibtisch. Vermutlich korrigierte sie Arbeiten ihrer Studenten.
Amina ließ sich von mir beim Waschen helfen und ich fragte mich, wie lange ich das wohl noch durfte. Es war mühsam, den Gipsarm im Schlafanzugärmel unterzubringen.
Schließlich saß ich mit beiden Kindern auf Aminas Bett und erzählte ihnen Geschichten. In der Zeit, in der ich in verschiedenen Reservaten gelebt hatte, waren mir an nächtlichen Lagerfeuern unzählige Geschichten zu Ohren gekommen. Einige davon waren zu hart, die behielt ich für mich. Aber es gab andere, Geschichten, die gut ausgingen und Hoffnung gaben.
Amina hatte immer ein offenes Ohr für Storys aus dem Indianerleben, weil sie sich auf ihre kindliche Art damit identifizierte. Mike hingegen wollte lieber Verbrechergeschichten aus erster Hand hören. Indianergeschichten, in denen Menschen mit Tieren sprachen, fand er langweilig. Nur die Geschichte vom Windigo, dem kannibalischen Geist aus der Wildnis, fazinierte ihn. Den Windigo fand Mike toll.
Vor ein paar Tagen erst, war Amina in der Bibliothek auf dieses Buch über das Volk der Cree mit der bebilderten Geschichte des Windigo gestoßen und hatte sie Mike gezeigt. Beide waren damit zu mir gekommen. Natürlich kannte ich die Windigo-Geschichte, sie war für mich jedoch mit einem unerklärlichen Grauen behaftet. Ich mochte sie nicht, denn der menschenfressende Unhold geisterte seit ich denken konnte durch meine Nächte und verursachte mir Albträume. Aber das wollte und konnte ich vor meinen Kindern nicht zugeben. Also erzählte ich ihnen an diesem Abend zum wiederholten Mal, was ich über den Windigo wusste.
„Einst war der Windigo ein Mensch wie du und ich. Es war im tiefen Winter, als er schon einige Tage hungrig durch die Wälder streifte, auf der Suche nach einem Tier, das er erlegen konnte. Da begegnete er einer wilden Kreatur, die hatte Haare im Gesicht, an den Armen und Beinen, und besaß ein Herz aus Eis. Da wurde auch sein Herz zu Eis, und von diesem Moment an war er unfähig, menschliche Gefühle zu empfinden. Er irrt umher auf der Suche nach neuen Opfern. Und wer nicht aufpasst, den erwischt er und verspeist ihn.“
Ich packte Mike, zeigte meine Zähne und knurrte wie ein Ungeheuer. Mein Sohn quietschte und lachte vor Vergnügen. Amina verdrehte die Augen. Für meine Kinder war der Windigo ein Märchenwesen - und vor einem Märchenwesen fürchtete man sich nicht.
Ich blieb bei ihnen, bis sie eingeschlafen waren. Nachdenklich betrachtete ich meinen Sohn, der mir sehr ähnlich sah, mit seinem glatten Haar und den schrägen Augen. Mike wollte kein Indianer sein, nicht einmal ein halber. Wie würde er in ein paar Jahren damit klarkommen? Es verletzte mich natürlich, dass Mike mit seiner indianischen Hälfte ein Problem hatte, aber ich wusste, wie er sich fühlte.
Im Alter von acht Jahren hatten auch für mich die Probleme begonnen. Ich sah anders aus als die Kinder, mit denen ich auf Mercer Island zur Schule ging. Aber was noch schlimmer war, ich sah auch anders aus als meine eigene Schwester. Ich fand mich hässlich und litt darunter. Bis Mom mir von ihrer Großmutter erzählte. Granny Arlette war zu drei Vierteln Cree-Indianerin und meine Mutter begründete mein Aussehen mit dieser Blutsverwandtschaft. Sie erzählte mir, dass es genetische Merkmale gibt, die manchmal ganze Generationen überspringen und dann unversehens wieder auftauchen - so wie bei mir. Sie besaß ein vergilbtes schwarz-weiß Foto von Granny Arlette, das sie als junge Frau zeigte, und die verblüffende Ähnlichkeit mit mir überzeugte mich letztendlich.
Doch vor vierzehn Jahren stürzte die Cessna ab, mit der Mom und Dad zum Angelurlaub in Kanada unterwegs waren. Als Alice und ich den Nachlass unserer Eltern sichteten, fielen mir zwischen ihrer Heiratsurkunde, verschiedenen Versicherungspolicen und den Übertragungsurkunden für Verlag und Haus, meine Adoptionspapiere in die Hände. Die Tatsache, dass sie mich belogen hatten, war ein Schock für mich und wirbelte mein Leben mächtig durcheinander. Was heute wahr ist, kann morgen schon nicht mehr wahr sein - das war die Lektion, die ich damals lernte.
Seit dem Tod der beiden war ich auf der Suche nach meiner Vergangenheit. Ich wollte sie finden, meine leibliche Mutter, meinen Vater. Vielleicht hatte ich Brüder und Schwestern, Onkel und Tanten. Menschen, deren genetisches Muster zu meinem passte. Und obwohl meine Nachforschungen bisher ohne Erfolg geblieben waren, konnte ich nicht aufgeben. Das hatte wohl etwas mit Identität zu tun, mit meinen Wurzeln oder auch nur mit der einfachen Wahrheit, die man mir aus unerfindlichen Gründen verweigert hatte.
Auf leisen Sohlen schlich ich aus dem Kinderzimmer, setzte ich mich an meinen Schreibtisch und fuhr den Computer hoch. Es war an der Zeit, etwas über Daniel Blueboy herauszufinden.
Obwohl ich verschiedene Suchmaschinen benutzte, war die Ausbeute unbefriedigend. Zuerst fand ich einen kurzen Zeitungsbericht vom 28. November 1997. Der siebzehnjährige Cree-Indianer Daniel Blueboy - ein jugendlicher Straftäter - war in den Morgenstunden des 27. November 1997 dreizehn Kilometer außerhalb der Stadt von zwei Gleisarbeitern tot aufgefunden worden. Der Pathologe hatte Alkohol im Blut des Jungen festgestellt und eine gewaltsame Todesursache ausgeschlossen. Blueboy starb an Unterkühlung. In der Nacht seines Todes war die Temperatur auf -28°C gesunken, und der Junge hatte nur T-Shirt, Flanellhemd, einen einfachen Jeansanzug und Sommerschuhen getragen. Die Winnipegger Stadtpolizei vermutete, dass Daniel Blueboy auf dem Weg in das fünf Kilometer entfernte Stony Mountain-Gefängnis gewesen war, um sich dort freiwillig zu stellen.
Diese Zeitungsnotiz - ein Polizeibericht im Lokalteil der Winnipeg Sun - war keine zehn Zeilen lang. Trotzdem wusste ich nun etwas mehr. Und ärgerte mich. Warum hatte Robert Blueboy mir nicht erzählt, dass sein kleiner Bruder in der Nacht, in der er starb, betrunken war und zudem polizeilich gesucht wurde? War Daniel ein Herumtreiber und Krimineller gewesen? Vielleicht hatte er mit Drogen gedealt, hatte versucht, ein kleines Geschäft nebenher zu machen, und war in einem Bandenkrieg zwischen die Fronten geraten. Auf diese Weise waren schon viele Jugendliche unter der Erde gelandet.
Wie auch immer: Niemand hatte es verdient, so zu sterben.
Bei meinen Recherchen stieß ich schließlich auf einen Artikel, den ein Reporter der Winnipeg Free Press am 8. Dezember, also rund zwei Wochen nach Daniels Tod geschrieben hatte. Mark Flanagan äußerte Zweifel an der Darstellung der Polizei, Blueboy wäre auf dem Weg ins Stony Mountain Gefängnis gewesen, als er starb. Der Junge war aus einem Wohnheim für Jugendliche ausgebüchst und wurde deshalb polizeilich gesucht. Betty Blueboy, Daniels Mutter, schwor Flanagan gegenüber felsenfest, ihr Sohn wäre niemals mitten in der Nacht bei – 28°C zu diesem berüchtigten Gefängnis gelaufen, um sich freiwillig zu stellen.
Obwohl ich nur verschwindend wenig über Daniel Blueboy wusste, hatte auch ich Zweifel an der Theorie der Polizei. Wenn der Junge aus diesem Wohnheim abgehauen war, und später beschlossen hatte, sich zu stellen, wäre er dann nicht dorthin zurückgegangen?
Ich machte mir einige Notizen und checkte noch ein paar preiswerte Hotels in Winnipeg. Es gab freie Zimmer zur Genüge in der Stadt, die zu dieser Jahreszeit ganz offensichtlich keine Touristen anzog.
Irgendwann stand Susan in der Tür und wünschte mir mit vorwurfsvollem Blick eine gute Nacht. Ich holte mir noch ein Bier aus dem Kühlschrank, sah mir die Spätnachrichten an und danach ging auch ich schlafen.
Ich lauschte Susans gleichmäßigen Atemzügen, rückte an sie heran und schob meine Hand so weit vor, dass ich den Stoff ihres Nachthemdes berühren konnte.
Am nächsten Morgen wachte ich wie üblich vor Susan auf. Die stillen Morgenstunden, wenn alle noch schliefen, hatten etwas Magisches für mich. Meine Familie war in Sicherheit. Natürlich wusste ich, dass alle Sicherheit trügerisch ist, aber in diesen Momenten glaubte ich daran.
Ich hatte mir angewöhnt, zeitig aufzustehen und joggen zu gehen. Auf meiner üblichen Runde um den Campus sammelte ich meine Gedanken. Unser Hirn arbeitet auch in der Nacht. Der Hippocamus, eine kleine, nussförmige Region unseres Gehirns, ist ein Detektor für Neuigkeiten. Er verarbeitet Fakten, Ereignisse und Situationen des Tages sehr schnell, hat aber keine große Speicherkapazität. Nachts gibt der Hippocamus an die Großhirnrinde weiter, was von ihm als wichtig heraussortiert wurde. Beim Joggen versuchte ich herauszufinden, was für mich wichtig war und ob sich im „off-line“ Zustand meines Gehirns neue Verbindungen geknüpft hatten, die mir bisher verschlossene Gedankengänge eröffneten.
Diesmal öffneten sich keine neuen Türen, dafür wusste ich einfach noch zu wenig über meinen neuen Fall. Wieder zurück, ging ich unter die Dusche und legte auf meinem Laptop einen Ordner für Daniel Blueboy an. Es dauerte zwanzig Minuten, bis ich alle Informationen eingegeben hatte. Danach checkte ich meine Mails, aber es war nichts Wichtiges dabei.
Nach dem gemeinsamen Frühstück beschäftigte sich jeder von uns auf andere Weise: Susan bereitete ihren Vortrag mit diesem Archäologieprofessor vor, Amina hatte Besuch von ihrer Freundin Jo, Mike baute ein Piratenschiff aus Legosteinen und ich erledigte lästigen Papierkram.
Am Nachmittag saßen wir alle zusammen im Wohnzimmer am großen Tisch und spielten „Siedler von Catan“, etwas, das Mike und Amina mit Begeisterung stundenlang tun konnten. Susan war einsilbig, aber sie versuchte sich vor den Kindern nicht anmerken zu lassen, dass sie mir grollte.
Am Abend packte ich ein paar Sachen für meine Reise zusammen: Wechselkleidung, Waschzeug, einen Schal, ein Paar Handschuhe und lange Unterhosen, die würde ich im kalten Norden mit Sicherheit brauchen.
Winnipeg, die Stadt in der kanadischen Prärie, deren Name vom Cree Begriff Win-nipi - Trübes Wasser - kam, war nichts weiter als ein Name, ein weißer Fleck für mich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Wetterkanal im Internet sagte für die nächsten Tage Schneefall und mehr als fünfzehn Minusgrade für die Region um Winnipeg vorher.
Ich hasste Kälte und hatte schon seit meiner Kindheit eine stark ausgeprägte Schneephobie. Ich war fünf, als meine Eltern das erste Mal mit mir und meiner zweijährigen Schwester auf den Mount Rainier fuhren. Diesen fast 4400 Meter hohen Vulkanberg südwestlich der Stadt nannten die Indianer früher Tacoma – Schneespitze. Heute war er für die meisten Bewohner von Seattle jedoch einfach nur The Mountain.
Damals war Sommer und ich konnte mich noch gut an den plötzlichen Übergang von Wärme und üppigem Grün in kaltes Weiß erinnern. Auf dem Pass angekommen, stiegen meine Eltern mit Alice aus, aber ich war durch nichts dazu zu bewegen, das Auto zu verlassen. Ich hatte panische Angst vor dem Schnee, diesem kalten Weiß. Ich schrie und machte mich steif. Meine Mutter setzte sich zu mir auf den Rücksitz und ich vergrub schluchzend mein Gesicht in ihrem Schoß. Als sie mich dazu brachte, wieder aus dem Fenster zu sehen, war ihr Kleid nass und draußen alles grün. Mein Vater war wieder nach unten gefahren, ohne, dass wir die grandiose Aussicht genossen hatten.
Seither war ich nicht wieder auf dem Berg gewesen. Lieber betrachte ich ihn aus sicherer Entfernung – zum Beispiel von meinem Bürofenster aus.
Nachdem ich gepackt hatte, rief ich Alice an, um ihr zu sagen, dass ich für ein paar Tage weg sein würde.
„Winnipeg?“, fragte sie zutiefst verwundert. „Du? Das muss ja ein besonders spannender Fall sein.“
„Wie man’s nimmt. Ich soll einen zehn Jahre alten Todesfall aufklären.“
„Und wieso tust du dir das an?“
„Das erzähle ich dir bei einem Glas Wein, wenn ich zurück bin, okay?“
Eine Weile blieb es still, dann sagte sie: „Ich hatte mal eine Kommilitonin, die kam aus Winnipeg. Weißt du, wie sie ihre Heimatstadt nannte? Winterpeg.“
Ich seufzte leise. „Du ermutigst mich ungemein.“
„Pass auf dich auf, Adam.“ Das klang sehr ernst. Alice machte sich ständig Sorgen um mich. Ich war zwar nicht ihr richtiger Bruder, aber ihr einziger. Familie. Unsere Mutter hatte keine lebenden Verwandten mehr und der Bruder unseres Vaters galt seit zwanzig Jahren als verschollen. Er hatte sich als Goldsucher am Yukon versucht.
„Keine Angst, Schwesterchen, mir passiert nichts. Das weißt du doch. Der große Manitu hält seine Hände schützend über mich.“
„Dass will ich hoffen“, sagte sie. „Du bist der beste Journalist, den ich habe.“
„Ich liebe dich auch“, sagte ich lächelnd. „Und wir sehen uns in ein paar Tagen.“
3. Kapitel
Am Sonntagmorgen trank ich nur Kaffee und verzichtete wohlweislich darauf, feste Nahrung zu mir zu nehmen. Susan und die Kinder brachten mich zum Flughafen. Amina war traurig, dass ich flog, aber sie jammerte nicht. Mike nahm mir meine Reise nicht krumm. Er wusste, dass ich mit einer spannenden Geschichte wiederkommen würde.
Susan hatte Tränen in den Augen, als ich sie umarmte.
„Ich rufe dich an, okay?“, war alles, was ich herausbrachte.
Sie nickte. „Pass auf dich auf, Adam.“
Ich checkte ein und durchlief die Sicherheitskontrollen. Nachdem ich meine Sachen wieder in Empfang genommen hatte, lief ich zum Terminal. Noch dreißig Minuten bis zum Abflug, sagte der Blick auf die digitale Uhr am Schalter.
Unruhig begann ich, hin- und herzulaufen. Es war deprimierend: All die Menschen um mich herum schienen überhaupt keine Angst vorm Fliegen zu haben. Sie tranken Kaffee, lasen Zeitung, lachten und schwatzten und waren dabei völlig entspannt. Als wäre es für sie das Selbstverständlichste, in ein Blechding zu steigen, das sich wenig später in die Lüfte erhob. Sogar die Kinder schienen das normal zu finden. Sie tollten herum und jagten einander lachend durch die Bankreihen, während ich mich immer mehr verkrampfte und schon jetzt kaum noch atmen konnte. Nein, es half alles nichts: Ich war nur dann Mensch, wenn ich festen Boden unter den Füßen hatte. Allein der Gedanke, dass ich ihn in wenigen Minuten aufgeben musste, trieb mir kalten Schweiß auf die Stirn.
Bisher hatte ich noch kein wirksames Mittel gegen meine Flugangst gefunden. Die Pillen, die man in der Apotheke kaufen konnte, versagten bei mir. Auch Alkohol half nicht, im Gegenteil: Er verstärkte das Gefühl der Bodenlosigkeit nur noch und nahm mir das letzte bisschen Sicherheit.
Eine halbe Stunde später ging es an Bord und ich versuchte, mir meine Panik nicht anmerken zu lassen. Es war mindestens ein Jahr her, dass ich das letzte Mal geflogen war, und immer, wenn es lange her war, war es besonders schlimm. Dabei wusste ich schon im Voraus, was nun kommen würde: Kaum hatte sich die Kabinentür geschlossen, zog sich mein Magen zusammen. Während die Maschine zur Landebahn rollte, begannen meine Hände zu zittern und ich versteckte sie unter meinen Oberschenkeln. Schließlich packte die Stewardess die Sauerstoffmaske aus, um vorzuführen, was die Passagiere bei Druckabfall zu tun hatten, und mein Herz begann zu rasen. Als der Flieger endlich abhob, klapperten meine Zähne und ich war nassgeschwitzt.
Erstaunlicherweise überstand ich den Flug von Seattle nach Vancouver ohne Peinlichkeiten. Das Wetter war gut und die Zeit verging schneller als erwartet
In Vancouver blieb mir eine Stunde Zeit, bevor mein Anschlussflug ging. Mein Magen grummelte vor Hunger, aber ich gönnte mir nur einen weiteren Kaffee. Ich hatte noch einmal zwei Stunden Flug vor mir und fastete weiterhin in weiser Voraussicht.
Während ich am Terminal auf den Anschlussflieger nach Winnipeg wartete, beobachtete ich zwei Sicherheitspolizisten der Royal Mounted Canadian Police bei ihrem Rundgang und musste unwillkürlich an den tödliche Zwischenfall denken, der sich letzten November auf diesem Flughafen ereignet hatte. Ein polnischer Immigrant, der englischen Sprache nicht mächtig, wurde stundenlang von RCMP Sicherheitsbeamten festgehalten, weil er sich ihnen nicht verständlich machen konnte. Seine Mutter, die ihn abholen wollte, hatte mit ihm als Treffpunkt die Gepäckausgabe vereinbart, in Unwissenheit darüber, dass die im Sicherheitsbereich des Flughafens lag und sie dort gar nicht hin durfte.
Als der Mann nach zehn Stunden, in denen kein Dolmetscher aufgetrieben werden konnte, die Nerven verlor, herumschrie und in seiner Panik einen Stuhl durch die Gegend schleuderte, wurde er von einem der Polizeibeamten mit einer Taser-Pistole beschossen. Der Pole brach zusammen und wurde überwältigt. Nur Minuten später war er tot.
Beim Einsatz dieser als vollkommen ungefährlich gerühmten Taser-Pistolen, werden zwei an hauchdünnen Drähten hängende Miniharpunen abgeschossen, die sich in der Haut des Opfers oder in seiner Kleidung festhaken. Eine elektrische Impulsfolge von fünf Sekunden Dauer bei 50.000 Volt, die bis zu sechs Zentimeter dicke Kleidung durchschlägt, legt den Getroffenen zuverlässig um und setzt ihn für eine Weile außer Gefecht.
Wenige Tage nach dem tragischen Tod des Polen erzählte mir Susan voller Entrüstung, dass Sicherheitsbeamte einen ihrer Studenten mit einer Taser-Pistole aus der Universitätsbibliothek vertrieben hatten, weil er keinen Studentenausweis vorweisen konnte. Später berichtete er ihr von den extremen, folterartigen Schmerzen, die er empfand, als sich unter den Stromstößen seine gesamte Körpermuskulatur verkrampfte. Da der junge Mann sportlich und kerngesund war, blieben bei ihm keine körperlichen Schäden zurück. Der Pole hingegen hatte Pech. Die Tragik seiner Geschichte hatte mich noch lange verfolgt.
Ich zwang mich, an etwas anderes zu denken, bis ich ein zweites Mal an Bord gehen konnte. Zu allem Unglück hatte ich auf diesem Flug einen Fensterplatz zugeteilt bekommen, was die Sache nicht einfacher machte. Gleich als ich saß, schnallte ich mich an – nur zur Sicherheit. Der Platz neben mir blieb zunächst leer und ich hegte die Hoffnung, noch wechseln zu können, doch schließlich setzte sich eine junge Frau neben mich.
Das war zuviel, mir blieb die Luft weg. Wie, zum Teufel, sollte ich diesen Flug überstehen? Eingeklemmt zwischen dem Grauen der Tiefe da draußen und einer kühlen Schönheit, die Ähnlichkeit mit einem unirdischen Wesen hatte. Solche eisblauen Augen hatte ich bisher nur bei einem Huskie gesehen.
Blonde Kringel umrauschten das blasse, feingeschnittene Gesicht meiner Sitznachbarin, als sie mir ein distanziertes „Hallo“ zuraunte.
Ich rang mir ein Lächeln ab, sagte: „Hi“, und sah aus dem Fenster. Den Gedanken, sie um einen Platzwechsel zu bitten, verwarf ich. Manchmal ist es hart, ein Mann zu sein.
Die Kabinentür wurde geschlossen und mein Panikprogramm lief ab. Beim Start wurde ich in den Sitz gedrückt und schloss die Augen. Es war diesmal nur eine kleine Maschine, die mächtig holperte und wackelte, als sie nach oben ging. Später, als die Stewardess einen kleinen Snack und ein Getränk brachte, sackte der Flieger plötzlich in ein Luftloch und ich klammerte mich an den Armlehnen fest. Der Kaffee verließ meinen Magen und wanderte die Kehle hinauf. Nur mit größter Mühe schaffte ich es, den Beutel rechtzeitig zu öffnen, der für derartige Notfälle vorgesehen war. Viel kam nicht, nur ätzende Flüssigkeit, aber das Ganze war mir entsetzlich unangenehm.
Die Stewardess nahm mir die Tüte mit einem pflichtbewussten Lächeln ab und reichte mir ein feuchtes Tuch, damit ich meinen Mund abwischen konnte. Verstohlen warf ich einen Blick auf meine Sitznachbarin mit den arktischen Augen, vor der ich mich so elend blamiert hatte. Mein Unglück schien sie kalt zu lassen. Vollkommen ungerührt blätterte sie in einem bunten Werbeprospekt.
Die nächsten anderthalb Stunden überstand ich in einer Art Wachkoma. Als die Maschine beim Landeanflug über dem Winnipeg International Airport Schräglage annahm, machte ich den unverzeihlichen Fehler, einen Blick aus dem Fenster zu werfen. Über der Stadt tobe ein schwerer Schneesturm, ließ uns der Pilot in diesem Moment wissen, es könne zu Turbulenzen kommen.
Mein Herz raste und meine Zunge klebte am Gaumen. Die Maschine schaukelte wie ein Boot auf Hochseewellen, sie holperte hin und her und als sie erneut absackte, rechnete ich mit dem Schlimmsten.
Ging es schnell, bis der Flieger auf dem Boden aufprallen und ein gewaltiger Rums allem ein Ende setzen würde? Reichte die Zeit, um hinter geschlossenen Augenlidern mein ganzes Leben zu sehen, abgespult wie ein Film? Würde ich mich wimmernd an die Schneekönigin mit den Eisaugen klammern?
Schweiß perlte von meiner Stirn, während Hände und Füße eiskalt waren. Mein Unterkiefer vibrierte und meine Hände krampften sich um die Armstützen, dass die Fingerknöchel weiß hervortraten. Meine Knie zitterten wie bei einem Junkie, der auf Entzug war.
Du wolltest noch eine Menge tun in deinem Leben, Adam. Zum Beispiel herausfinden, ob Daniel Blueboy dein Cousin oder Bruder ist. Ich biss die Zähne zusammen. Wer meine richtige Mutter war und warum sie mich weggeben hatte, würde ich vielleicht nie erfahren. Susan fand gewiss schnell wieder jemanden, klug und schön wie sie war. Meine Kinder würden ohne ihren Vater aufwachsen müssen, ein Gedanke, der mir beinahe das Herz zerriss. Nur ich konnte Amina zum Sprechen bringen, wenn sie mal wieder aus irgendeinem Grund schwieg. Und Mike ... mein Sohn hielt mich für einen unsterblichen Helden. Ein gequälter Seufzer entwich meiner Kehle und plötzlich spürte ich eine warme Hand auf meinem schlotternden Knie.
„Nur keine Angst“, sagte meine Sitznachbarin mit sanfter Stimme. „Der Pilot hat Erfahrung mit solchem Wetter.“
„Woher wollen Sie das wissen?“, stieß ich hervor, ohne meine Augen zu öffnen.
„Er ist mein Mann“, antwortete sie in einem amüsierten Tonfall.
Nun schlug ich doch die Augen auf und sah sie lächeln. Ich schöpfte wieder Hoffnung. Tatsächlich landete der Pilot die Maschine sicher, obwohl er meiner Ansicht nach nicht einmal die Landebahn erkennen konnte, so dicht wie das Schneetreiben da draußen war.
„Sagen Sie Ihrem Mann schöne Grüße von mir, er hat das wirklich hervorragend gemacht“, sagte ich mit unendlicher Erleichterung zu ihr, als wir den Flieger verließen.
Die Frau mit den Huskyaugen drehte sich lächelnd zu mir um. „Tut mir leid, ich bin gar nicht verheiratet. Aber Sie sehen schon viel besser aus, junger Mann.“
Verblüfft blieb ich stehen und blickte ihr nach, bis ich von hinten weitergedrängt wurde.
In der Halle sah ich mich nach Robert Blueboy um, konnte allerdings niemanden entdecken, auf den meine Vorstellung passte. Als ein Mann im blauen Anorak auf mich zukam, dachte ich zuerst an einen Irrtum. Er hatte hellbraunes, gelocktes Haar, das ihm bis auf die Schultern fiel. Als der Mann direkt vor mir stand, sah ich, dass seine Augen grau waren und die Augenlider gerötet. Sein kantiges Kinn war frisch rasiert.
„Adam Cameron?“, fragte er.
Ich nickte stirnrunzelnd.
Er streckte mir die Hand hin: „Robert Blueboy. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind.“ Robert hatte einen kräftigen Händedruck und war einen halben Kopf kleiner als ich, vielleicht einsfünfundsiebzig. Ich schätzte ihn auf Anfang dreißig. „Wie war Ihr Flug, Mr Cameron?“
„Reden wir nicht davon“, brummte ich. „Und Adam reicht völlig aus.“ Er nickte und bückte sich nach meiner Tasche, aber ich kam ihm zuvor.
„Macht es Ihnen etwas aus, bei mir zu wohnen?“, fragte Robert verlegen. „Meine Frau ist vor vier Wochen mit unserem Sohn auf und davon und ich habe viel Platz im Haus.“
Um ehrlich zu sein: Ich hatte wenig Lust, mir die Klagen eines verlassenen Ehemannes anzuhören, und das war auch nicht mein Job. Aber so wie es aussah, würde mich die Lösung des Falles einiges kosten - schon für den Flug hatte ich 500 Dollar bezahlen müssen. Deshalb hatte ich nichts dagegen, die Hotelkosten zu sparen.
Zwar kannte ich keine Geldsorgen, aber meine Mutter hatte mir beigebracht, sparsam zu sein. Sie hatte Alice und mir dazu geraten, immer erst darüber nachzudenken, ob das Geld, das wir gerade ausgeben wollten, nicht noch sinnvoller eingesetzt werden konnte.
„Ich brauche einen ungestörten Platz zum Arbeiten und ich muss kommen und gegen können wann ich will.“
„Klar.“ Robert nickte.
Ich nahm seine Einladung an.
Als wir den Terminal verließen, wehte der Schnee wie ein kalter Fluch in mein Gesicht. Eisiger Wind biss in meine Haut. Ich zog mir die Kapuze über den Kopf, aber der Wind kam von vorne, deshalb nützte das reichlich wenig. Ich schluckte einen Schwall Kälte, die im Hals brannte und mir den Atem nahm. Meine Knie wurden auf der Stelle zu Frostbeulen. Ich bereute, meine langen Unterhosen nicht schon am Morgen angezogen zu haben.
Robert Blueboy verschwand im Flockenwirbel und ich stand orientierungslos da. Für einen Augenblick war ich kurz davor, in Panik auszubrechen. Doch plötzlich tauchte er aus dem Nichts wieder auf, packte mich am Arm und zog mich mit sich fort. „Der Blizzard war angekündigt“, rief er. „Ich dachte schon, Ihr Flieger würde gar nicht landen.“
Nicht landen? Ich weigerte mich, weiter darüber nachzudenken.
Robert fand seinen roten Subaru Kombi kurze Zeit später wieder und fegte mit dem Arm den Schnee von den Scheiben und Türen. Er lud meine Tasche in den Kofferraum und öffnete mir die Beifahrerseite. Ich sprang hinein und zog die Tür zu.
„Tja“, sagte Robert, als er neben mir saß, „das ist übliches Januarwetter bei uns. Sie im Süden sind da sicher anderes gewöhnt.“ Er versuchte einige Male vergeblich, den Motor anzuwerfen, der dabei grässliche, wenig vertrauenerweckende Geräusche von sich gab.
„Süden ist vielleicht ein bisschen übertrieben“, erwiderte ich, „aber es ist wahr: So viel Schnee und Kälte gibt es in Seattle nur alle paar Jahre einmal. Trotzdem bin ich jeden Winter drauf und dran, mit meiner Familie nach New Mexico umzusiedeln. Ich mag den Winter nicht.“
Der Motor heulte auf und Blueboy fuhr los. „Dann werden Sie sich hier nicht sonderlich wohlfühlen, Mr ... äh, Adam. Winnipeg hat den Ruf, die kälteste Stadt Nordamerikas zu sein. Bei uns dauert der Winter fünf Monate.“
„Winterpeg, ich weiß. Aber ich werde schon klarkommen.“ Zumindest redete ich mir das ein.
Das Schneetreiben blieb dicht und draußen sah alles gleich aus. Wir befuhren breite, autobahnähnliche Straßen, die gesäumt waren von gesichtslosen grauen Häusern. Wir überquerten Gleise, kamen durch eine verqualmte Industriegegend mit Lagerhallen, Schrottplätzen und Autohöfen. Einmal hätte uns beinahe ein großer Schneepflug erwischt. Auto fahren war also nicht weniger gefährlich als Fliegen – jedenfalls in dieser Stadt und bei diesem Wetter.
Inzwischen befanden wir uns im Nordteil von Winnipeg, erklärte mir Robert, im Bezirk West Kildonan. Er lebte in einer dieser typischen Siedlungen, in denen Menschen aus der Unterschicht meist unter sich sind. Kleine, heruntergekommene Häuser, die dicht gedrängt nebeneinander standen. Er fuhr den Kombi in eine freigeräumte Einfahrt unter einen offenen Carport. Der gelbe Ziegelbungalow, zu dem die Einfahrt gehörte, war auf den ersten Blick gut in Schuss.
„Ich arbeite für eine Baufirma“, erklärte mir Blueboy, als wir auf der Veranda standen und er seine Haustür aufschloss. „Im Augenblick ist Flaute, die meisten Leute wurden entlassen. Aber ich denke, Ende März geht es wieder los. Zwischendurch halte ich mich mit Aushilfsjobs über Wasser.“
„Nettes Haus“, bemerkte ich.
„Ja. Nur ein bisschen groß für einen allein.“
Ich schwieg.
Drinnen war es angenehm warm, und das von mir befürchtete Chaos im Haushalt eines frisch verlassenen Ehemannes herrschte auch nicht. Offenbar kam Robert ganz gut klar. Wir hängten unsere Jacken an die Garderobe und er führte mich in eine freundlich wirkende Küche: Einbauschränke mit einer Oberfläche aus heller Holzimitation, ein Kiefernholztisch mit sechs Stühlen und ein Regal, in dem vielleicht einmal Kochbücher gestanden hatten. Jetzt war es ausgeräumt, bis auf ein altes Radio und ein paar Fotos in Stellrahmen. Neben der Spüle standen ein umgestülpter Kaffeebecher, ein Teller und ein Glas. Auf dem Fensterbrett kümmerten zwei Grünpflanzen vor sich hin.
„Früher war es immer sehr gemütlich bei uns. Nora hatte ein Händchen dafür. Ich habe das nicht. Ist ziemlich mühsam, alles in Ordnung zu halten. Nichts macht sich von allein. Eine Menge Dinge musste ich erst lernen.“
Schon wieder das leidige Thema. Aber ich konnte Roberts Worte nicht erneut ignorieren. „Wie ich sehe, haben Sie alles bestens im Griff.“
Robert musterte mich einen Augenblick nachdenklich. Ich hatte das Gefühl, dass er froh war, mich da zu haben, jedoch nicht wusste, wie er mit mir umgehen sollte. Es war anzunehmen, dass er bisher noch nie mit einem Privatdetektiv zu tun hatte.
Ich wollte Susan anrufen, um ihr zu sagen, dass ich gut angekommen war, aber Roberts Einsamkeit war so offensichtlich, dass ich es nicht in seiner Gegenwart tun wollte. Ich fragte ihn nach der Toilette und er zeigte mir das Bad.
Auf dem Badewannenrand sitzend, berichtete ich Susan, dass ich den Flug überstanden hatte und bei Robert wohnen würde. Ich erkundigte mich nach Amina und Susan versicherte, dass es ihr gut ging. Aminas Freundin Jo war da und die Mädchen spielten zusammen.
„Groll mir nicht mehr“, bat ich sie. „Ich liebe dich.“ „Komm bald zurück“, sagte sie. „Ich brauche dich.“ Und legte auf.
Ich würde zurückkehren, wenn der Fall abgeschlossen war. Susan wusste das.
„Möchten Sie einen Kaffee, Adam?“, fragte Robert, als ich wieder in die Küche trat.
„Tee wäre mir lieber, wenn das möglich ist.“ Für heute hatte ich genug Kaffee getrunken. Mein Magen hätte jetzt etwas Handfestes vertragen können, aber ich wollte meinen Gastgeber nicht in Verlegenheit bringen.
Robert füllte den Wasserkessel auf und setzte ihn auf den Herd. Während er sich um Tee und Kaffe kümmerte, betrachtete ich die Fotos im Regal. Eines zeigte Robert mit einer hübschen, etwas molligen Indianerin und einem sieben- oder achtjährigen Jungen. Jeder der drei hielt einen Luftballon in der Hand und lachte in die Kamera. Ein Schnappschuss aus glücklichen Zeiten.
Das zweite war ein großes Familienfoto, auf dem mehr als ein Dutzend Leute abgebildet waren. In der Mitte eine strahlende Mittfünfzigerin, daneben ein etwas älterer Mann.
„Der 54. Geburtstag unserer Mutter“, sagte Robert, als er mich das Foto betrachten sah. „Das war im August 1997. Damals war die Welt noch halbwegs in Ordnung.“
Ich musste wissen, wer jede einzelne Person auf diesem Gruppenbild war, aber das konnte ich auch später noch fragen.
Auf dem dritten gerahmten Foto schaute mich ein Junge mit schulterlangem, leicht gelocktem Haar, vollen Lippen und großen schwarzen Augen herausfordernd an. Keine Frage, wer das war. Mir kam sofort in den Sinn, dass die Mädchen Daniel Blueboy gemocht haben mussten, denn er war ein ausgesprochen gutaussehender junger Mann gewesen.


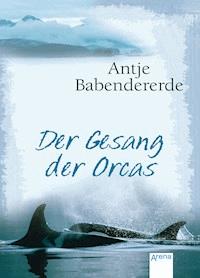
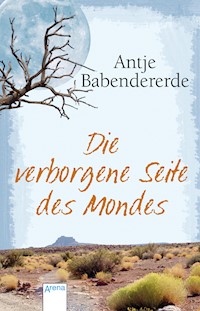


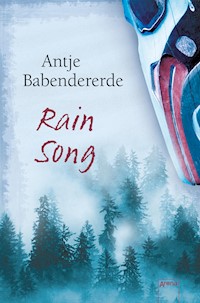

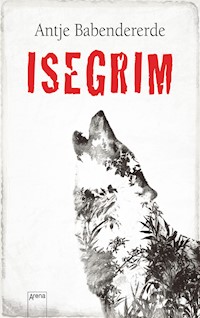
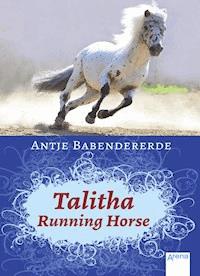

![Triff mich im tiefen Blau [Ungekürzt] - Antje Babendererde - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/75f072b5b02089501721ce263e658ce1/w200_u90.jpg)