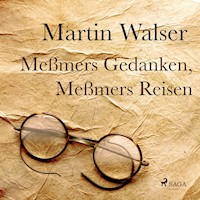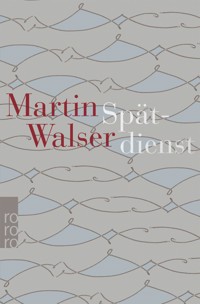9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Der Höhepunkt in Martin Walsers Alterswerk – ein neuer Roman als Summe und Bilanz «Mit der Unwahrheit ein Glückskunstwerk zu schaffen, das ist die menschliche Fähigkeit überhaupt.» Wer sagt das? Seine Frau nennt ihn mal Memle, mal Otto, mal Bert, er versucht zu erkennen, wie aus Erfahrungen Gedanken werden. Den Widerstreit von Interessen hat er hinter sich gelassen, Gegner und Feinde auch, sein Wesenswunsch ist, sich herauszuhalten, zu schweigen, zu verstummen. Am liebsten starrt er auf eine leere, musterlose Wand, sie bringt die Unruhe in seinem Kopf zur Ruhe. «Mir geht es ein bisschen zu gut», sagt er sich dann, «zu träumen genügt». «Statt etwas oder Der letzte Rank» ist ein Roman, in dem es in jedem Satz ums Ganze geht – von größter Intensität und Kraft der Empfindung, unvorhersehbar und schön. Ein verwobenes Gebilde, auch wenn es seine Verwobenheit nicht zeigen will oder sogar versteckt. Ein Musikstück aus Worten, das dem Leser größtmögliche Freiheit bietet, weil es von Freiheit getragen ist: der Freiheit des Denkens, des Schreibens, des Lebens. So nah am Rand der Formlosigkeit, ja so entfesselt hat Martin Walser noch nie geschrieben. Das fulminante Porträt eines Menschen, ein Roman, wie es noch keinen gab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 153
Ähnliche
Martin Walser
Statt etwas oder Der letzte Rank
Roman
Über dieses Buch
Der Höhepunkt in Martin Walsers Alterswerk – ein neuer Roman als Summe und Bilanz
«Mit der Unwahrheit ein Glückskunstwerk zu schaffen, das ist die menschliche Fähigkeit überhaupt.» Wer sagt das? Seine Frau nennt ihn mal Memle, mal Otto, mal Bert, er versucht zu erkennen, wie aus Erfahrungen Gedanken werden. Den Widerstreit von Interessen hat er hinter sich gelassen, Gegner und Feinde auch, sein Wesenswunsch ist, sich herauszuhalten, zu schweigen, zu verstummen. Am liebsten starrt er auf eine leere, musterlose Wand, sie bringt die Unruhe in seinem Kopf zur Ruhe. «Mir geht es ein bisschen zu gut», sagt er sich dann, «zu träumen genügt».
«Statt etwas oder Der letzte Rank» ist ein Roman, in dem es in jedem Satz ums Ganze geht – von größter Intensität und Kraft der Empfindung, unvorhersehbar und schön. Ein verwobenes Gebilde, auch wenn es seine Verwobenheit nicht zeigen will oder sogar versteckt. Ein Musikstück aus Worten, das dem Leser größtmögliche Freiheit bietet, weil es von Freiheit getragen ist: der Freiheit des Denkens, des Schreibens, des Lebens. So nah am Rand der Formlosigkeit, ja so entfesselt hat Martin Walser noch nie geschrieben. Das fulminante Porträt eines Menschen, ein Roman, wie es noch keinen gab.
Vita
Martin Walser, 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren, war einer der bedeutendsten Schrifststeller der deutschen Nachkriegsliteratur. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche Preise, darunter 1981 den Georg-Büchner-Preis, 1998 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2015 den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis. Außerdem wurde er mit dem Orden «Pour le Mérite» ausgezeichnet und zum «Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres» ernannt. Martin Walser starb am 26. Juli 2023 in Überlingen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH,
Reinbek bei Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung Umschlagabbildung: ClausAlwinVogel/Getty Images
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-00102-2
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
rank, m. wendung, drehung
1. schweiz.rank, wendung, krümmung des weges
2. rank, namentlich auch im wettlaufe und bei der jagd, die wendung, die der verfolgte nimmt, um dem verfolger zu entgehen
aus: Deutsches Wörterbuch von JACOB und WILHELM GRIMM
1
Mir geht es ein bisschen zu gut. Seit dieser Satz mich heimsuchte, interessierte ich mich nicht mehr für Theorien. Alles Besitzergreifende mied ich mühelos. Das war mein Zustand: Ich merkte, dass mich auch das Umständliche nicht mehr interessierte. Dazu war ich von selbst gekommen. Glaube ich. Genau weiß ich nichts. Zum Glück war das Bedürfnis, etwas genau wissen zu wollen, erloschen. Molière habe gegen die Jesuiten geschrieben, sagte der berühmte Professor. Dann der weniger berühmte Professor: Molière habe nicht gegen die Jesuiten geschrieben, sondern gegen die Jansenisten. Und ich habe das nicht gemerkt, nicht gewusst. Das war die Erzverführung zu allem: etwas genau wissen zu wollen. Damit hat die Welt sich eingenistet in dir. Du warst nicht mehr du, sondern der, der alles genau wissen wollen musste. Es kommandierten die Theorien, jede mit einem Extra-Erlösungsversprechen. Allmählich waren diese Verführungsfeuerwerke der Theorien erloschen.
Dass mir dieses Geständnis entschlüpft, kommt mir nachgerade mutig vor. Kann etwas, das einem passiert ist, mutig sein?
Auch wenn ich mich nicht mehr für Theorien interessierte, konnte ich doch sagen: Theorien sind großartig. Eine Theorie, das ist ein Gebäude mit vielen Zimmern, und in allen Zimmern brennt Licht. Und in allen Zimmern tanzt der, der das alles erdacht und gemacht hat. Ich hätte den Schöpfer einer Theorie nie einen Theoretiker genannt. Er tanzt doch, um angeschaut zu werden. Obwohl er mit jeder Theorie etwas beweist, will er noch mehr als etwas sich beweisen. Jede Theorie musste so tun, als meinte sie mich. Und das um meinetwillen. Wenn die Theorie zugegeben hätte, dass sie sich meint, hätte ich mich, weil sie mir dann geglichen hätte, wieder für sie interessieren können. Wenn ich’s mir leichtmachen wollte, sagte ich einfach: Theorie ist eine zweite Sprache für eine erste. In der ersten Sprache gibt es alles von selbst. Die zweite Sprache ist die Lebenseinschränkung durch das Für-wahr-halten-Müssen. Das Wahrheitsgewerbe! Der Inbegriff dieses Gewerbes: die Theorien.
Ich habe das nicht beobachtet, gar registriert. Nur sehr nachträglich kam es mir vor, als sei alles so allmählich vor sich gegangen, dass ich es nicht bemerken konnte. Irgendwann musste ich feststellen, dass ich nicht mehr so lebte, wie ich immer gelebt hatte.
Auf einmal hatte ich nichts mehr gegen Wunder. Das war auch so eine Empfindung, die ich nicht immer gehabt haben kann. Ich wartete nicht darauf. Aber ich hätte jedes Wunder begrüßt. Das empfand ich deutlich. Da meldete sich ebenso deutlich die Empfindung, dass ich nicht auf Wunder wartete. Wenn ich mir das nicht glauben konnte, rutschte ich einen steilen Hang hinab, ein Objekt der schlimmsten Anziehungskraft, die man Sehnsucht nennt. Da hörte ich mich aber gleich sagen: Zu träumen genügt.
Das ist der Satz, den ich mich öfter sagen hörte. Zu träumen genügt.
Mir geht es ein bisschen zu gut.
Dass ich noch Sätze brauchte, war kein gutes Zeichen. Erstrebenswert wäre gewesen: Satzlosigkeit. Ein Schweigen, von dem nicht mehr die Rede sein müsste. Und ich hörte mich sagen: Unfassbar sein wie die Wolke, die schwebt.
Das war einer der Sätze, die mir den Wesenswunsch zu verstummen aufschiebbar machten.
Unfassbar sein wie die Wolke, die schwebt.
Das ist der Zustand, der unter irdischen Bedingungen als der höchste Zustand empfunden wird. Von mir.
Sobald aber etwas, was ich dachte, den Rang oder den Charakter eines Gebots oder eben eines Wunsches annehmen wollte, reagierte mein von Notwendigkeiten erzogenes oder auch gedrilltes Wesen mit: Zu träumen genügt.
Unfassbar sein wie die Wolke, die schwebt.
Und fühlte mich gebettet auf alle Blütenblätter des Organuniversums, also in der trügerischsten Leichtigkeit, in der Schwerelosigkeit selbst. Eine erdachte Schwerelosigkeit. Ich lebte, soweit ich lebte, von Erdachtem.
Unfassbar sein wie die Wolke, die schwebt.
Ich will nicht so tun, als hätte ich dann aus großer Höhe niedergesehen auf das Interessengewusel. Aber dass ich für die da drunten gegen einander um mich kämpfenden Interessen nicht mehr erreichbar war, erlebte ich doch. Und ich musste dann zugeben: Mir geht es ein bisschen zu gut.
Wenn mir daraus ein Vorwurf erwachsen wollte, schaltete das System, das ich war, sofort um auf: Zu träumen genügt. Dann allerdings atmete ich auf. Atmete ich durch. Atmete ich.
Das Geständnis, dass ich atmete, habe ich bisher vermieden. Das heißt nur, dass ich nicht vorstellbar werden will. Das ist mein Dilemma. Einerseits nicht verstummen können, andererseits nicht vorstellbar werden wollen. Kein Interesse erwecken. Dann wäre ich ja auch so eine Möchtegern-Attraktion gewesen wie jede Theorie.
2
Ich weiß nicht, ob es für oder gegen mich spricht, dass ich nicht mutlos war.
Ich hoffe mehr, als ich will.
Das war dann doch mein nächster Satz: Ich hoffe mehr, als ich will.
Ich konnte mich nicht zusammenfalten wie ein Blatt Papier, das man wegwerfen darf. Auch wenn ich mich deutlich genug sah als ein Blatt Papier, auf dem nichts stand, dachte ich: Ich bin ein Blatt Papier, auf dem noch nichts steht.
Das war mein bis dahin undurchschaubarstes Geständnis, weil es verriet, dass ich glaubte, es könne noch etwas geschehen. Deshalb dieses mit allen Lügen der Welt wetteifernde Geständnis: Ich bin ein Blatt Papier, auf dem noch nichts steht.
Wenn ich das NOCH hätte weglassen können, wäre die Lüge weniger krass gewesen. Das NOCH war die Luft in den Reifen des Gefährts, das ich war. Ohne das NOCH wäre ich auf einem Platten gepoltert. Das NOCH war utopisch. Und Utopie ist die Erzlüge. Das NOCH machte mich zum Lügner. Das NOCH zwang mich zum Geständnis, dass ich das war, dieser Lügner.
Mir geht es ein bisschen zu gut.
Zu träumen genügt.
Unfassbar sein wie die Wolke, die schwebt.
Ich hoffe mehr, als ich will.
Jetzt drängt sich auf das Geständnis schlechthin: Seit ich utopielos war bzw. sein wollte, fehlte mir nichts mehr.
Ich starrte auf eine leere, musterlose Wand und vermisste nichts. Mir hatte immer etwas gefehlt. Jetzt wartete ich auf nichts mehr. Ich war weder glücklich noch unglücklich. Schon diese einem aufgedrängte Unterscheidung, sich glücklich oder unglücklich zu fühlen! Ich war jetzt das lebendigste Weder-noch.
Genau so mit der Zeit. Immer verging sie zu schnell oder zu langsam. Immer war es zu früh oder zu spät. Zeit, das Element der Ablenkung schlechthin. Sie hat mich immer am Dasein gehindert. Schön das verfügte Fremdwort: existieren. Manchmal habe ich es gern gesagt: Ich existiere. Der Segen des Fremdworts: Ich musste nichts verstehen. Schlimm nur das Hauptwort: Existenz. Das war nur noch Kulisse bzw. Gebäude bzw. Mausefalle. Existieren, die Illusion einer sich von selbst vollziehenden Tätigkeit. Die Illusion überhaupt.
3
Die leere, musterlose Wand. Meine letzte Abhängigkeit. Sobald ich die Augen schloss, wurde es unangenehm. Sobald ich die Augen öffnete und auf die leere, musterlose Wand schaute, wurde mir wieder wohl. Ich gebe zu, dass ich mir nachts, sobald es dunkel war, undeutlich wurde. Machte ich das Licht an, starrte auf die leere, musterlose Wand, war ich gleich wieder da. Es ging mir allerdings noch nach, ich verdankte dieses Gefühl, da zu sein, nur dem Umstand, dass ich das Licht angemacht hatte. Im Dunkel zu liegen, ohne darauf zu warten, dass es wieder hell wird, das musste ich noch üben. Im Dunkel zu liegen mit offenen Augen und nichts zu sehen, das musste möglich sein. Und schon stellten sich möglich und unmöglich vor. Wieder so ein Unterschied, den es nicht gibt. Das machen die Theoretiker. Ihre Theorien stiften Unterschiede, dass wir vor lauter Nachbeterei von Erdachtheiten nicht dazu kommen, da zu sein!
Mit offenen Augen im Dunkel zu liegen, das musste ich üben. Sobald ich die Augen aufmachte, meldete sich nämlich der Hustenreiz. Und zwar so, dass ich ihn nicht wegatmen konnte. Ich musste husten.
Ich huste, also bin ich.
Mir geht es ein bisschen zu gut.
Zu träumen genügt.
Unfassbar sein wie die Wolke, die schwebt.
Ich hoffe mehr, als ich will.
Nachts half das oft nicht mehr. Meinetwegen ging es anderen schlecht. Ich müsste … Ja, was, bitte? Ich müsste barfuß zum Nordpol laufen. Und zurück. Dann? Dann wäre dieses Problem gelöst. Ganz sicher. Aber eben nur dann. Man bremst sich andauernd im Vorgehen gegen sich selbst; man stellt das Verfahren ein, weil man fürchtet, es könnte zu weit gehen.
4
Geschenkt wurde mir nichts. Was habe ich geübt, Hilferufe nicht zu hören, so zu tun, als hörte ich sie nicht. Da man nichts tun kann, muss man so tun, als hörte man sie nicht, die Hilferufe aus Afrika und sonst woher. Ich darf sagen, ich habe eine Methode entwickelt, die es wert wäre, unter meinem Namen praktiziert zu werden. Sobald ich Hilferufe hörte, fing ich selber an, um Hilfe zu rufen. Peinlich wäre es gewesen, wenn mir jemand zu Hilfe gekommen wäre. Das ist zum Glück nicht passiert. Ich musste ja, je nachdem, wie laut die Hilferufe von da und da herkamen, selber immer noch lauter um Hilfe rufen. So habe ich noch jeden Hilferuf überstanden. Und die Hilferufe nahmen zu an Dringlichkeit und Elendsglaubwürdigkeit. Also wenn ich nicht sofort, also schon nach den ersten Tönen, dagegengehalten hätte, wäre ich unfähig gewesen, den Hilferuf zu übertönen. Die aus Afrika waren am schwersten zu übertönen. Aber auch da macht Übung den Meister. Übertönbar waren sie alle.
5
Ich riet dir, iss mehr, als du brauchst. Trink bis zur Bewusstlosigkeit. Rauch Kette und denk, dass du dich bestrafst. Ich riet dir: Sei, wohin du kommst, unerträglich. Rede laut und lang schlecht über dich. Bis sie dich unterbrechen. Lass es nicht zu. Sag, dass dir nicht zu helfen sei, solange es anderen deinetwegen schlechtgehe.
Ich gab mich extremer Zerknirschung hin. Verurteilte, beschimpfte mich so, dass ich mir unwillkürlich leidtat. Immer vor Zeugen. Und ich sagte, dass das eine Masche zur Erlösung sei, sich so zu beschimpfen. So, wie man sich da gebe, könne man nicht sein, so mies, so verbrecherisch egoistisch! So bemitleidenswert böse. So hässlich böse. So abstoßend böse. So erlösend böse.
Die, die dich erlebten, applaudierten dir schließlich. Du spucktest aus vor dir. Aber ins Taschentuch. Du sagtest: Es gibt keine Grenze der Nachsicht mit sich selbst. Und fuhrst fort mit deiner Selbstbeschimpfungsorgie. Sie tränkten dich mit Champagner. Sie tranken auf dich. Du trankst auf die, denen es schlechtgeht durch dich. Du fragtest dich: Wem gehört der Mantel, den du trägst? Wer friert statt deiner? Dann bedauertest du eher leise als laut, dass du nicht hassen könnest. Von deiner Mutter habest du nur lieben gelernt. Hassen können. Dich selbst hassen zu können, das wäre jetzt dran. Und eben dazu seist du nicht imstande. Dich selber hassen zu können, das wäre, nach allem, was du bewirkt hast, die Erlösung. Dir bleibe aber nur die Liebe. Die zu dir selbst. Und fürchterlicher könne nichts sein, als einen Menschen wie dich lieben zu müssen. Dann, nur noch flüsternd: Pfui Teufel. Und wieder spucktest du deutlich ins Taschentuch. Applaus.
Und rundum eine Debatte, als habe man im Theater einer Aufführung beigewohnt.
Mir geht es ein bisschen zu gut.
6
Dass ich nicht aufhören kann zu atmen, habe ich schon gestanden. Aber dreimal täglich trainierte ich alle Arten von Muskeln und die Lunge und das Herz usw. Gegen den, der das dreimal täglich exekutierte, war ich ohnmächtig. Das Körperprogramm stammte von ganz früher. Da hatte ich noch nichts zu sagen gehabt. Da sind eingesenkt worden in mich die Programme für immer. Weiter gehen, als du kannst! Du kannst bergauf rennen! Dir kommen Kräfte, die du nicht hast! Es wird eine Genugtuung, dich zu übertreffen, dich zurückzulassen, dich zu besiegen. Dieses Gefühl, zugleich der Sieger und der Besiegte zu sein! Das ist das Leben selbst.
Das Körperprogramm war ein Zwang, dem ich mich zu gern fügte. Gegen besseres Wissen.
Ich konnte mich ans Klavier setzen und die Hände Beethovens Pathétique spielen lassen. Mit allen einmal eingeübten Nuancen. Aber was ich zu hören bekam, war ein Schattengetön.
Das Leben ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Zum Glück.
Mir geht es ein bisschen zu gut.
Zu träumen genügt.
Unfassbar sein wie die Wolke, die schwebt.
Ich hoffe mehr, als ich will.
Ich huste, also bin ich.
7
Anwandlungen. Dass ich es nicht weitersagen werde. Das hatte ich versprochen. Und sie haben gedroht, wenn ich es weitersagte, würden sie das nächste Mal schlimmer mit mir umgehen als je. Tatsächlich war es schon bis jetzt jedes Mal schlimmer geworden. Und zwar, ohne dass ich etwas weitergesagt hätte. Also war es eine leere Drohung. Da sie doch jedes Mal schlimmer mit mir verfuhren, ohne dass ich etwas weitergesagt hätte, konnte mir, wenn ich etwas weitersagen würde, nicht mehr passieren, als mir jedes Mal, wenn sie kamen, passiert ist. Und trotzdem wirkte diese, rein logisch gesehen, leere Drohung. Ich sagte nichts weiter. Aber sie könnten mit mir auf eine noch nicht vorstellbar harte Art umgehen und sich darauf berufen, dass sie das nur täten, weil ich etwas weitergesagt hätte. Also sagte ich nichts weiter. In dieser Situation lebte ich.
Ich musste andauernd damit rechnen, dass sie wiederkommen und mich so und so, eben so, wie ich es nicht weitersagen darf, behandeln würden.
Offenbar konnten sie nicht wirklich denken. Offenbar waren sie von dem, was sie mir zufügten, selber so beeindruckt, dass sie glaubten, wenn ich das weitersagte, passiere Wunder was gegen sie.
Dabei hätten sie, wenn sie denken könnten, darauf vertrauen können, dass ich überhaupt keine Möglichkeit hatte, etwas weiterzusagen, weil mir kein Mensch geglaubt hätte, was ich hätte sagen wollen. Der Rechtsstaat hat für das, was sie mit mir machten, keine Kategorien. Es gibt innerhalb der bürgerlichen Welt keine Sprache für das, was sie mit mir machten, keine Paragraphen oder Ähnliches. Weder Verbote noch Lizenzen. Was sie mit mir machten, ist nicht in Klage oder Anklage unterzubringen. Und wenn schon, dann eher in Klage als in Anklage. Aber für Klagen gibt es keine Instanzen.
Also, sie hätten wirklich keine Angst haben müssen, dass ich etwas weitersage. Also war ihre Drohung, dass sie mit mir noch härter verfahren würden, wenn ich etwas weitersagte, nichts als eine Lust, mir Angst zu machen.
Ich hatte angefangen, alles, was mir passierte, aufzuschreiben. Dadurch bemerkte ich, dass ich mich in einem kreisrunden Gefängnis befand. Das ist ein bildlicher Ausdruck für einen Bewusstseinszustand. Ich durfte mich bewegen, aber ich durfte dadurch, dass ich mich bewegte, nicht weiterkommen. Nirgendwohin.
Ein Ende war nicht vorstellbar. Aber wünschbar. Erschöpfung. Das wär’s gewesen. Leider fühlte ich mich kein bisschen erschöpft. Ich wartete darauf, dass sie wieder kommen und mich … Eben das darf ich nicht weitersagen. Aber ich darf sagen oder schreiben, es sei erträglicher, von ihnen so und so behandelt zu werden, als nachher darüber nachzudenken, was sie mir wieder zugefügt haben.
Jetzt aber diese Erfahrung: Ich schrieb nicht auf, was ich nicht weitersagen darf, aber dass ich etwas nicht weitersagen darf, das schrieb ich auf. Und konnte und wollte mich nicht daran hindern, dass sich daraus etwas ergebe. Und wie leichtfertig ich doch sein konnte! Kaum schrieb ich auf, dass ich es aufschreibe, hagelten Wörter herein, gegen die ich immun sein müsste. Erfahrung! Was für ein Unwort! Überhaupt so genannte Hauptwörter! Was für ein durch Herrschen und Beherrschtwerden entstandenes Sprachzeug. Auch nur durch das Aufschreiben entstanden: nachdem die da waren und bevor sie wiederkamen. Als gäbe es ein Nachher und ein Vorher! Nicht einmal, woher solches Sprachzeug kommt, interessierte mich. Ich kann nicht existieren in einer Welt, in der es eine Rolle spielt, dass etwas nachher und etwas vorher stattfindet. Als gäbe es zwischen dem Nachher und dem nächsten Vorher etwas, was benannt werden könnte. Oder sollte. Und schon hagelte herein: Zeit! Warum nicht gleich auch noch: Verlauf! Nichts entspricht mir so wenig wie dieser Zählzwang. Wie oft? Als fände nicht alles ununterbrochen statt. Und wenn schon Zeit, dann: alles gleichzeitig. Zugleich. Simultan.
Ich schrieb auf, dass ich etwas nicht weitersagen durfte.
Jetzt verfiel ich in etwas, was die Draußen-Sprache Geständnis nennt: Es lag an mir, dass ich etwas, was mir passierte, nicht weitersagte.
Und was habe ich unwillkürlich getan? Ich, auch Sklave üblicher Ausdruckstradition, ich habe, was mir passierte, in etwas Figürliches verschoben. Und komme jetzt dazu, gestehen zu müssen, dass das, was ich als Besucher erscheinen ließ, meine Geschöpfe