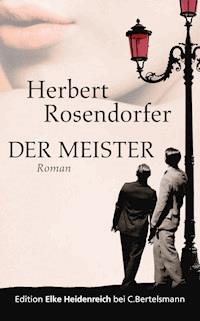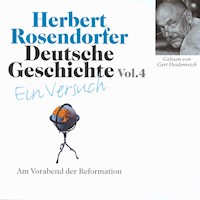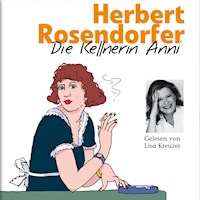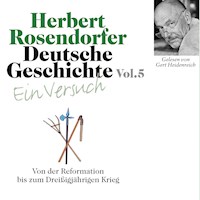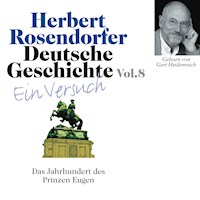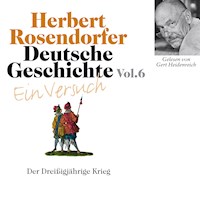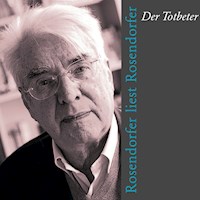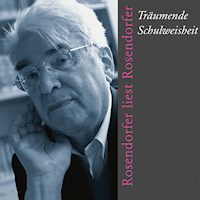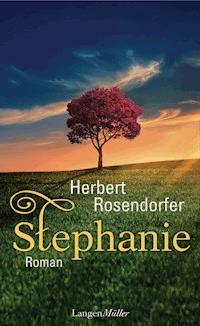
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Welten stehen im Mittelpunkt dieser phantastischen Geschichte: die reale Welt und die Traumwelt Stephanies. Sie träumt, mitten in der Nacht aufzuwachen - an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit, in einem anderen Leben. Dieser Traum kehrt immer wieder, das andere Leben nimmt mehr und mehr Gestalt an, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie nicht mehr in ihre reale Welt zurückkehren kann. Stephanie macht den Schritt vom Heute ins Gestern, vom 20. ins 18. Jahrhundert, von Deutschland nach Spanien. Ihr neues "voriges" Leben bürdet ihr eine schwere Schuld auf, mit der sie fertig werden muß, es bringt sie in schwierige Situationen, die sie alle meistert - bis auf die letzte ... Ein faszinierender Roman von Herbert Rosendorfer meisterhaft erzählt - mit einem Realismus, der auch das Phantastische immer wieder auf den Boden des psychologisch Überzeugenden herabholt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Herbert Rosendorfer
Stephanie
und das vorige Leben
Roman
LangenMüller
Meinem Freund Herbert Asmodi in alter Verbundenheit und Verehrung gewidmet.
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langen-mueller-verlag.de
© für das eBook: 2017 LangenMüller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
© für die Originalausgabe: 1987 nymphenburger in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel
eBook-Produktion: F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
ISBN 978-3-7844-8329-0
I
Vor einer Stunde bin ich von der Beerdigung meines Schwagers gekommen. Ich habe ihn, gebe ich zu, nie gemocht. Ich habe mehrere Schwäger, denn alle meine Schwestern sind verheiratet. Hier ist die Rede von Ferdi, dem Mann meiner jüngsten Schwester Stephanie. Ferdi, auch Ferdl genannt, eigentlich hieß er Ferdinand, war mir unangenehm schon von dem Moment an, in dem Stephanie ihn mit nach Hause gebracht hat. Ich gestehe jetzt, daß ich damals ganz vorsichtig und selbstverständlich erfolglos versucht habe, auf dem Umweg über unsere Eltern die Verbindung zwischen Stephanie und Ferdi zu hintertreiben. Er sei nichts für Stephanie, sagte ich. Welcher Meinung unsere Mutter war, konnte ich nie herausbekommen. Für unsere Mutter zählten allein Tatsachen, nicht Meinungen, auch nicht ihre eigene Meinung. Unser Vater hegte hier wie in allen Dingen die bequeme und für seine Umgebung manchmal aufreibende Ansicht, daß in jedem Menschen ein guter Kern stecke.
Die Ereignisse, die ich hier niederschreibe, liegen lange zurück. Stephanie war damals etwa zehn Jahre mit Ferdi verheiratet, als sie mir das erste Mal von ihren Träumen erzählte. Mit gutem Grund erzählte sie ihrem Mann nichts davon. Er hätte sie mit seinem eher bescheidenen Verstand für verrückt gehalten. Ferdi hat überhaupt nie etwas davon erfahren, obwohl, um das vorauszuschicken, nichts in der Sache war, was eine Ehefrau ihrem Mann verbergen müßte. Ich habe nie daran gedacht, diese Dinge niederzuschreiben, auch nach Stephanies Tod nicht. Erst jetzt, vor einer Stunde, als ich am Grab Ferdis stand, ist mir der Gedanke an die Niederschrift gekommen. Es war, als ob ein Tor aufgehe und den Weg freigebe. Ich weiß jetzt auch: ich wollte nicht, daß Ferdi jemals von diesen Dingen erfahre.
Dabei bin ich mir im Klaren darüber, daß ich Ferdi in gewisser Weise Unrecht getan habe. Er war ein einfacher Mensch, aber das, was man eine gute Haut nennt. Nach Stephanies Tod hat er zurückgezogen und ganz allein draußen in seinem Haus gelebt, auf das er so stolz war, hat auch nicht mehr geheiratet. Kinder hatten Stephanie und Ferdi nicht. Ich habe ihn selten gesehen, zuletzt bei der Hochzeit einer Nichte, der Tochter meiner ältesten Schwester. Das ist auch schon vier Jahre her. Er war ein alter Mann geworden. Damals habe ich zum ersten Mal gedacht: vielleicht tue ich ihm Unrecht. Auch der Charakter primitiver Menschen kann sich durch einen echten Schmerz vertiefen. Ferdi war gute zehn Jahre älter als meine Schwester. Als ich ihn damals bei der Hochzeit der Nichte gesehen habe, war er schon weit über fünfzig, er hat aber ausgesehen wie ein Greis, wie siebzig. Er hat mir fast leid getan, und ich habe mir vorgenommen, ihn einmal zu besuchen, aber wie es eben so kommt: die Jahre gehen ins Land, und man hat anderes zu tun. Ich bin nie mehr hinausgefahren nach G-d-a. Um genau zu sein: ich bin schon hinausgefahren, aber ich bin vorbeigefahren, auf dem Weg irgendwohin, nicht hingegangen, habe mir gedacht: das nächste Mal. Ich habe das Haus von weitem gesehen. Es war noch genau wie damals, nur etwas mehr zugewachsen mit Bäumen und Büschen, auch vielen Rosen. Vielleicht waren diese Rosen Ferdis Steckenpferd nach dem Tod meiner Schwester.
Und jetzt lebt er nicht mehr. Wem er das Haus wohl vermacht hat? Ich glaube, er hatte Neffen und Nichten auch von seiner Seite. Ich habe mich für die Leute nie interessiert.
Ich bin der Einzige, der von diesen Träumen meiner Schwester erfahren hat. Das Merkwürdige daran war nicht, daß Stephanie, meine jüngste Schwester, die tüchtige, prosaische (meine Mutter behauptete von ihr: sie sei redlich, aber nüchtern wie trockenes Brot), solche Träume hatte. Das Merkwürdige war die Art, wie sie es mir erzählte. Ich war bei ihr draußen. Ihr Mann war nicht da. Sie saß in ihrem vorfabrizierten Eigenheim, in dem alles, wenn es irgend ging, auf Plastikbasis eingerichtet war, und wo als oberstes Qualitätsprinzip die leichte Waschbarkeit galt. Sie saß in einem Stuhl und strickte oder häkelte. Wir sprachen von Dingen, die mit Träumen und dergleichen nichts zu tun hatten, da ließ sie auf einmal ihre Handarbeit sinken und sagte:
»Weißt du, ich träume so komisch.«
Sie sagte es so, als habe sie lange über ein zwar auffallendes, aber im Grunde abwegiges, sie kaum berührendes Phänomen nachgedacht, so etwa, als hätte sie gesagt: »Sieh einmal, haben wir einen neuen Pfarrer, oder trägt der alte jetzt eine Perücke?«
»Wie komisch?« fragte ich.
Sie hatte ihre Handarbeit wieder aufgenommen, ließ sie jetzt aber erneut sinken.
»Vor einem Monat. Nicht ungefähr vor einem Monat, heute genau auf den Tag vor einem Monat. Ich habe geträumt, ich wache auf. Das gibt es, daß man träumt, man wacht auf. Ich wache auf. Es ist Nacht, es ist ganz finster. Ich liege im Bett, selbstverständlich. Wir haben Steppdecken…« (Vollwaschbar, dachte ich.) »… ich fahre, im Traum, über die Steppdecke, aber es war nicht die Steppdecke. Es war ein Plumeau, mit einem Überzug aus Damast. Kannst du dich an den dunklen Schrank mit den Greifen erinnern? Auf dem Treppenabsatz?«
Sie meinte das Haus unserer Großeltern. Selbstverständlich konnte ich mich an die häßlichen Greifen erinnern.
»Dort in dem Schrank ist die Aussteuer unserer Großmutter gewesen. Sie hat sie mir einmal gezeigt. Es waren damastene Bettbezüge, alles handgenäht mit gestickten Monogrammen – so groß wie ein kleiner Teller. Es hat Stücke darunter gegeben, die hat sie nie verwendet. Die hebe ich auf, hat sie gesagt. Wofür …? Für unsere Mutter, hat sie gemeint. Aber wie unsere Mutter geheiratet hat, waren solche schweren, damastenen Bettbezüge schon nicht mehr das, was ein junges Paar haben wollte. Wo die wohl hingekommen sind?«
»Und wie ist der Traum weitergegangen?«
»Überhaupt nicht. Ich habe vorsichtig über den damastenen Bettbezug gestrichen. Es war feinerer Damast, nicht so schwerer wie der von der Großmutter, das merkt man auch im Finstern. Ich habe gewußt, daß ich nicht in meinem Bett bin. Und dann muß ich wieder eingeschlafen sein, das heißt, ich muß geträumt haben, daß ich wieder eingeschlafen bin.« Stephanie nahm die Handarbeit wieder auf. Eine Zeitlang sagte sie nichts, dann: »Und es war etwas sehr Unangenehmes dabei: ich habe im Traum und auch nachher, wie ich in der Früh aufgewacht bin, das Gefühl gehabt, daß ich gar nicht geträumt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war wirklich wach. Ich war wirklich woanders.«
(Sie sagte nicht: etwas sehr Geheimnisvolles oder etwas sehr Unheimliches, sie sagte: etwas sehr Unangenehmes.)
Es wurde mir schwer zu fragen, weil man auf so etwas nicht gern eine Antwort bekommt. Ich bin anders als meine Schwester.
Ich fragte: »Und – ist der Traum dann wieder gekommen?«
»Ja«, sagte sie, »schon in der nächsten Nacht. Wieder habe ich geträumt, ich wache auf. Wieder habe ich die feindamastene Tuchent gespürt, aber diesmal war es nicht mehr ganz finster. Ein großer, schwerer Vorhang vor einem Fenster war einen kleinen Spalt offen. Es muß schon Tag gewesen sein, ich meine: früher Morgen, ganz früher Morgen. Es war kein Mondlicht mehr, es war Tageslicht, fahles frühes Tageslicht, eher noch die Dämmerung, graues Licht. Es war ganz still, nur die feine, damastene Tuchent hat geknistert, wie ich darübergefahren bin. Der Streifen von grauem Licht ist quer durch das große Zimmer gefallen, es war ein ganz großes Zimmer, viel größer als unser Schlafzimmer. Der Lichtstreifen ist vom Vorhang her quer durch das Zimmer gefallen, schräg durch das Zimmer, und seitlich vom Bett ist ganz matt etwas Goldenes aufgeblitzt, wie der Rahmen von einem großen Bild.«
»Sonst hast du nichts gesehen?«
»Ich… ich habe Angst gehabt. Ich schwöre es dir: ich habe wieder das Gefühl gehabt, ich träume nicht, daß ich aufgewacht bin, ich bin wirklich aufgewacht. Ich habe mich nicht zu rühren gewagt, und auch sonst hat sich gar nichts bewegt. Ich hätte es nicht gewagt, mich zu rühren. Und dann bin ich wieder eingeschlafen.«
»Bist du sicher, daß es am nächsten Tag war? Daß das nicht ein und derselbe Traum war?«
»Ich bin ganz sicher. Ich habe es am dritten Tag wieder geträumt. Ich habe schon beim Einschlafen Angst gehabt, aber ich konnte ja Ferdi nichts sagen. Der hält mich für verrückt. Bin ich verrückt?«
»Wie war der dritte Traum?«
»Genau wie die zwei anderen, der Vorhang aber war noch ein wenig weiter aufgezogen. Ein breiterer Streifen von grauem, dämmerigem Licht ist in das große Zimmer gefallen. Wieder ist das Gold aufgeblitzt. Ich habe die Augen ein wenig gewendet, soviel habe ich mich getraut: es war ein Bild mit einem schweren, geschnitzten, vergoldeten Rahmen. Das Bild selber konnte ich nicht sehen. Unter dem Bild ist eine dunkle Kommode gestanden mit Messingbeschlägen, die auch geblitzt haben. Wie ich eine Zeit wach gelegen war, hat draußen ein Vogel zu singen angefangen. Ich habe noch nie einen Vogel so singen hören. Gesehen habe ich den Vogel nicht. Bewegt hat sich nichts, auch ich habe mich nicht bewegt, außer daß ich ganz vorsichtig über den damastenen Bettbezug gestrichen und die Augen, nur die Augen, nicht den Kopf, gewendet habe. Du hättest dich auch nicht bewegt, in der Situation. – Ein paar Tage ist dann nichts gekommen. Ich habe schon gedacht, der Unsinn ist vorüber, aber eine Woche nach dem dritten Traum war es wieder da. Der Vorhang war vom halben Fenster weggezogen. Ein leichter Musselinstore hat sich im Wind gekräuselt. Zum ersten Mal habe ich das Bett gesehen. Ich bin in meinem Leben noch nie in so einem Bett gelegen: ein ganz breites, riesiges Bett. Ich war auf der linken Seite. Bei Gott und allen Heiligen, ich habe es nicht gewagt, nach rechts zu schauen.«
»Hat der Vogel wieder gesungen?«
»Der Vogel hat nicht mehr gesungen, aber wie der Wind ein wenig stärker wurde, ein kleiner, sanfter Windstoß, in dem der Musselinstore geflattert hat, da hat es plötzlich nach Orangen geduftet. Ich habe mir ein Herz genommen und habe mir gedacht: und wenn ich zu Tod erschrecke, und habe nach oben, hinter mich geschaut. Nach rechts habe ich nicht zu schauen gewagt, noch nicht, aber nach oben, also nach hinten. Dort habe ich ein riesiges geschnitztes Kreuz gesehen. Es ist über dem Bett gehangen. Es hat sich dann in den folgenden Nächten nicht mehr viel geändert. Ab und zu sang der Vogel, wenn ein Wind ging, kräuselte sich der Store, und es duftete nach Orangen. Gestern war ich so weit. Ich konnte ja nicht aus. Der Mensch muß ja einschlafen. Ich habe schon überlegt, ob ich hier im Wohnzimmer in einem Sessel schlafen soll, aber, um Gottes willen, wo wache ich dann vielleicht auf? Dann lieber noch im Bett. So habe ich mir vorgenommen: wenn ich das noch einmal träume, dann richte ich mich auf. Ich habe mich aufgerichtet. Ich habe nach rechts geschaut. Neben mir in dem großen Bett lag ein Mann. Es war nicht Ferdi. Es war ein Mann, der tot war.«
II
Unser Vater war ein kleiner Beamter. Sein Lebenslauf spricht der gängigen Meinung über die Beamten hohn. Unser Vater starb an einem Herzversagen, noch bevor er das sechzigste Lebensjahr erreicht hatte. Die damastenen Bettbezüge gehörten in die Linie der mütterlichen Großeltern, die väterlichen Großeltern hatten allerhöchstens leinene Bettbezüge. In der Nazizeit mußte unser Vater, weil er Beamter war, einen sogenannten »arischen Nachweis« erbringen. Vater hat entsprechende Dokumente gesammelt, die später noch bei uns herumgelegen sind. Ich habe sie einmal gesehen. Die väterlichen Ahnen waren Handwerker, Kleinhäusler, so unbedeutend, daß ihre Spur schon um die Wende des achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert im Dunkel der Personenstandsarchive und Pfarrmatrikeln unlesbar versickerte. Bei den mütterlichen Ahnen war es etwas besser, da waren Bauern dabei, »Hausherren« und »Grundbesitzer«. Unser Vater hatte ein wenig über seinen Stand geheiratet. Nicht, daß das in der Ehe unserer Eltern ein Problem gewesen wäre, soweit ich mich erinnern kann. Wir haben alle, wie man so sagt, einen ordentlichen Beruf erlernt. Stephanie war gelernte Heilgymnastikerin. Sie war tüchtig, und überall, wo sie gearbeitet hat, war sie beliebt und bekam die besten Zeugnisse. Sie war übrigens auch eine Musterschülerin gewesen, in der Volksschule, im Gymnasium, immer. Ich habe mir damals gedacht – später habe ich es auch ausgesprochen –, als ich in die letzten Klassen der Oberschule ging und sie gerade in die ersten Volksschulklassen, sie lauter Einser nach Hause brachte, als gäbe es nichts anderes, und ich gut durchwachsene, nicht besorgniserregende, aber auch nicht begeisternde Zensuren: gut, daß sie jünger ist. Wenn eine ältere Schwester solche Prachtnoten vorzuweisen hätte, das wäre ein entnervendes Vorbild. Aber Stephanie war keine Streberin. Sie war auch kein braves, hausbackenes Kind. Als junges Mädchen hatte sie durchaus ihre Abenteuer. Da sie hübsch, vielleicht sogar schön war – der Bruder kann das weniger beurteilen –, hatte es an Verehrern nicht gemangelt. Bei einigen verdichtete sich die Sache fast bis zur Verlobung. Sie machte allerhand Schickes: spielte Tennis, nahm Reitstunden, spielte mit einem Verehrer vom Sportwagentyp sogar einen Sommer lang Golf und war eine Zeitlang ein ausgesprochenes Nachtlicht. Sie wandte sich aber nie von der Familie ganz weg, nabelte sich nicht ab, wie die anderen Schwestern, die schon vor ihrer Heirat von daheim wegzogen, eine eigene Wohnung nahmen und ein erwachsenes Leben führten. Sie blieb daheim, bis sie in dem Krankenhaus, in dem sie damals arbeitete, Ferdi kennenlernte, der dort die Folgen eines Autounfalls auskurierte.
Ich bestreite nicht, daß ich von Anfang an das Gefühl hatte, meine Schwester habe sich auch… nein, nein, das sagt man heute nicht mehr, unter dem Stand verheiratet. Sie hat sich, glaubte ich, glaube ich eigentlich auch heute noch, unter ihrem Wert verkauft. Ferdi war kein schlechter Mensch, kein Windhund oder so etwas – im Gegenteil. Ferdi war ein kleiner Geist. Ferdi war dumm. Ich bestreite auch nicht – heute nicht mehr, damals hätte ich es getan, und wie laut –, daß ich den neuen Schwager deswegen nicht mochte, weil er für unsere Verhältnisse ziemlich viel Geld hatte. Nicht daß ich anderen Leuten ihr Geld nicht gönne, ich halte es aber für fehl am Platze, wenn so Leute wie Ferdi mit ihrem kleinen Geist das Geld verdienen, das anderen – um Mißverständnissen vorzubeugen: ich meine nicht mich – mit größerem Geist abgeht. Ferdi war Kraftfahrer. Einmal hat ihm ganz entschieden das Glück gelacht, und, das muß man ihm lassen, er hat das Glück unter den Umständen erkannt, die ein anderer als Pech empfunden hätte. Ferdi war eines Tages mit einem Lastwagen auf einer größeren Fahrt unterwegs. Als er wegfuhr, war die Spedition, bei der er angestellt war, noch in Ordnung, scheinbar. Als er nach zwei Wochen zurückkam, war die Firma zu. Der Fuhrunternehmer war in Konkurs gegangen, eine Seltenheit in der damaligen Wirtschaftswunderzeit. Ferdi ließ den Lastwagen nicht vor dem versiegelten Hoftor der fallierten Spedition stehen, sondern nahm ihn mit nach Hause. Er meldete alles, ganz korrekt. Und der Konkursverwalter bot ihm als Ausgleich für den ausstehenden Lohn den Lastwagen an. Ferdi griff zu. So wurde er sein eigener Fuhrunternehmer. Als er meine Schwester heiratete, hatte er längst mehrere Lastwagen und angestellte Fahrer. Fleißig war Ferdi, aber er war einer von den Männern, die abends von nichts mehr etwas wissen wollen außer von ihren Pantoffeln, und ein wenig in den Fernsehapparat schauen, wenn etwas läuft, was sie nicht beunruhigt; die nicht wissen, was sie tun sollen, wenn es am Samstag regnet; und die, wenn es am Sonntag nicht regnet, mit einem Rucksack auf nicht zu unbequemen Wegen durch das Oberland laufen, wo sie und ihresgleichen die Kühe erschrecken, in einem Rasthaus Kuchen essen und abends, nachdem sie nichts gesehen und nichts erlebt, sagen: das war wieder einmal schön.
Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn Ferdi und Stephanie Kinder gehabt hätten. Warum sie keine hatten, ob sie keine wollten, oder ob es an ihm oder an meiner Schwester lag, weiß ich natürlich nicht. Eins muß man sagen: Ferdi wäre bestimmt ein guter Vater gewesen. Leute wie er, die ihren Horizont mit Händen greifen können, sind oft sehr kinderlieb. Ich hatte früher, vor Stephanies merkwürdigem Tod, hie und da Gelegenheit, ihn zu beobachten, wie er mit unseren Neffen und Nichten spielte. Da war man fast geneigt, ihm heimlich abzubitten. Ob Stephanie eine gute Mutter gewesen wäre – mag sein, weil sie so nüchtern und perfekt war, mag sein, grad deswegen wieder nicht. Jedenfalls waren keine Kinder da, und so saß Stephanie draußen in G-d-a- in ihrem vorgefertigten Konfektionshaus mit der Plastikausrüstung und dem sozusagen waschbaren Garten und hatte nichts zu tun. Sie hat nie über Langeweile geklagt, im Gegenteil; ich habe sie einmal gefragt, und sie hat gesagt, nein, sie langweile sich keineswegs. Sie tue dies und tue das… Möglicherweise hat sich diese gewaltsam verdrängte Langeweile in den rätselhaften Träumen Luft gemacht. Es wäre eine Erklärung, wenn nicht alles das andere, Äußere dazugekommen wäre, was kein Traum war.
»Ich war wie gelähmt, natürlich«, sagte Stephanie damals, »und ich war sicher, wie nie zuvor, daß ich nicht träume, daß ich wach war.«
»Woher weißt du, daß der Mann tot war?«
»Das möchte ich nicht sagen.«
»Hast du nur angenommen, daß er tot war, oder hast du es zu wissen geglaubt?«
»Nein, nein. Er war tot. Ich habe es gesehen. Ich will gar nicht daran denken. Ich habe lange genug in einem Krankenhaus gearbeitet. Der Mann war nicht der erste Tote, den ich gesehen habe. Ganz langsam habe ich mich in das Kissen zurückgelegt. Ich wollte nachdenken, was ich machen soll… und so muß ich wieder eingeschlafen sein.«
»Du hast Ferdi etwas davon erzählt?«
»Nein.«
»Du hast natürlich doch geträumt.«
»Natürlich.«
»Du hast geträumt, daß du das sichere Gefühl hast, du träumst nicht.«
»Ja.«
»Hast du Angst vor…«
»Ich habe schreckliche Angst.«
»Du mußt Ferdi davon erzählen.«
»Und was soll Ferdi machen?«
»Er soll dich wecken…«
»Wann? Alle halbe Stunde? Alle zehn Minuten?«
»Du hast recht, das ist natürlich Unsinn. Woanders schlafen… du hast schon selber gesagt, da besteht die Gefahr…«
»Ich habe vor etwas ganz anderem Angst.«
»Wovor?«
»Daß ich – daß ich einmal dort bleiben muß. Dort ist nicht ganz richtig. Ich bin nicht nur woanders, ich bin, wenn ich das träume, irgendwann anders, zu einer anderen Zeit. Und ich fürchte, ich bin auch jemand anderes.«
»Das ist nicht ganz einfach zu verstehen«, sagte ich. »Im Traum geht alles«, sagte Stephanie und lachte. Bei Tag konnte sie sogar über die Träume lachen. (Genauer: am Vormittag und bis gegen vier Uhr, wie sie sagte, dann, von vier Uhr ab, würde es anders, dann könne sie nicht mehr darüber lachen.) »Im Traum geht alles.«
»Was hast du denn angehabt?«
»Im Bett? – Ein Nachthemd, wie immer.«
»Dort auch?«
»Da habe ich nicht darauf geachtet. Aber wenn ich mich zu erinnern versuche: ich habe wohl auch ein Nachthemd angehabt.«
»Dasselbe Nachthemd?«
»Das könnte ich nicht sagen.«
»Ich nehme an, du trägst deinen Ehering auch in der Nacht.«
»Ja – aber ich weiß auch das nicht, ob ich ihn dort getragen habe.«
»Achte auf solche Dinge.«
»Ich möchte nicht, daß das wiederkommt.«
Ich versuchte, meine Schwester zu beruhigen. Solange es Tag war, war sie nicht ängstlich; sobald es Abend wurde, kam die Angst. Der Schlaf ist unausweichlich. Es half ihr nichts, nicht ins Bett zu gehen.
Eins hätte ihr geholfen, etwas ganz Einfaches, aber das haben wir damals leider noch nicht gewußt. Trotzdem versuchte ich Stephanie zu beruhigen. Gerede wie: vielleicht kommt es doch nicht wieder, Träume sind Schäume, am besten, du lachst darüber, bedeutet natürlich gar nichts. Mir fiel etwas anderes ein. Ich muß dabei einräumen, daß ich schon den Hintergedanken hatte (bald schon mußte ich mich dessen schämen): sie spinnt. Nein: daß sie spinnt, hätte Ferdi gedacht. Ich habe an eine Art subtiler Geisteskrankheit gedacht, Hirngespinste, die durch die uneingestandene Langeweile bei meiner Schwester entstanden sind. Solche Hirngespinste muß man ernst nehmen, hatte ich gehört, oder jedenfalls muß man so tun, als nähme man sie ernst. Vielleicht hilft es, habe ich mir damals gedacht, wenn ich sie förmlich in ihrem Hirngespinst bestärke. Ich legte mir so diese Gedanken zurecht, da sagte Stephanie:
»Du hältst mich auch für verrückt?«
»Nein, nein«, sagte ich schnell. Ich schlug ihr dann vor, die Flucht nach vorn zu ergreifen. Ich sagte: »Ich bilde mir jetzt überhaupt noch keine Meinung. Kann sein, es ist so, kann sein, es ist anders.« Ich versuchte sie zu bereden, alles in dem Zimmer dort genau zu beobachten, genauer auf die Einzelheiten zu achten (Nachthemd, Ehering usw.) und, wenn sie sich irgendwie überwinden könne, aufzustehen und aus dem Fenster zu schauen. Sie versprach mir nichts, ich aber versprach, am nächsten Tag wiederzukommen.
Als ich mich verabschiedete, gab mir Stephanie zwar die Hand, schaute aber nicht von ihrer Handarbeit auf. Den Weg durch das Haus hinaus kannte ich.
Den Gedanken, Ferdi heimlich zu unterrichten, verwarf ich gleich wieder.
III
G-d-a- ist nicht schön, G-d-a- ist auch nicht häßlich. Inzwischen, in den fünfzehn Jahren, die seitdem vergangen sind, haben sie in G-d-a- große neue Siedlungen gebaut, auch Hochhäuser, alles für Leute, die in der Stadt arbeiten. Die S-Bahn fährt hinaus. Wer heute in G-d-a- wohnt, wohnt fast in der Stadt. Als Ferdi damals das Haus in G-d-a- kaufte, war es »weit draußen«, viel zu weit für Leute, die jeden Tag in die Stadt zur Arbeit müssen. G-d-a- liegt dort, wo es noch flach, aber nicht mehr ganz flach ist. Der Wald ist zu sehen. Das Dorf ist keins von den stolzen und schmucken Oberländer Dörfern. Planlos stehen spitzgiebelige Siedlerhäuser herum, mit sogenannten gepflegten Gärten. Häufig kläffen Hunde an den Zäunen aus grünem Maschendraht. In den Gärten blühen Blumen und stehen Wäschespinnen, an denen werktags Unterhosen flattern. Am Sonntag sitzen Frauen in Kittelschürzen und Männer in Trainingsanzügen oder kurzen Hosen (obwohl sie dem Kurzhosenalter längst entwachsen sind, sie haben dicke Schenkel und Glatzköpfe) auf den Terrassen, trinken Kaffee und essen Kuchen. Es sind Häuser, in denen man, wenn man zum ersten Mal hinkommt, sagt: haben Sie es hier aber schön.
Als ich damals am Tag danach, also am Tag, nachdem mir Stephanie zum ersten Mal von ihren merkwürdigen Träumen erzählt hat, zu ihr hinausgefahren bin (ich habe einen Beruf, wo ich mir den Tagesablauf auch an Werktagen mehr oder weniger frei einrichten kann), konnte man noch nicht auf der Terrasse sitzen. Es war Ende März und eher kalt. Es hatte sogar in den Tagen zuvor geschneit, und die Frauen in Kittelschürzen und die Männer, die später im Jahr die kurzen Hosen oder Trainingsanzüge auf den Terrassen tragen würden, hatten in brennender Sorge um ihr Grünzeug Hüllen aus durchlöcherter Plastikfolie um die empfindlicheren Büsche gebunden.
Stephanie trug keine Kittelschürze, nein, das nicht. (Ferdi ja, der lief daheim oft in einem dunkel-weinroten Trainingsanzug herum, der seitlich weiße Streifen hatte, und dessen Hosenboden bis zu den Kniekehlen durchhing.) Ferdi war nicht da. Stephanie war damit beschäftigt, die ohnedies sauberen Fenster zu putzen; sie sah mich deshalb schon von weitem kommen und räumte die Kübel und Putzlumpen weg, noch bevor ich an der Tür war. Sie war aufgeräumt. Nicht, daß ich in der Nacht nicht geschlafen hätte nach ihren Eröffnungen gestern, die durchaus geeignet waren, mich, je länger ich darüber nachdachte, zu erschrecken. Mein Schlaf ist stets stärker als alle meine Sorgen. Aber ich habe fast die ganze Zeit zwischen diesen beiden Besuchen bei meiner Schwester an diese Sache gedacht. Ich hatte vor, sofort, sobald ich das Haus betreten hatte, zu fragen: hast du wieder geträumt? Vorausgesetzt natürlich, Ferdi wäre nicht da.
Jetzt, wie ich Stephanie munter wie immer sah, hatte ich den Wunsch: die ganze Geschichte wäre nicht wahr. Der Wunsch war so stark, daß ich nicht fragen konnte. Ich begann von belanglosen Dingen zu reden, aber Stephanie selber fing davon an. Sie sagte in einem für mein Gefühl merkwürdig lustigen Ton – so als erzählte sie: denk dir, heute habe ich irrtümlich den ersten Band Goethe in der Maschine mitgewaschen – was ihr übrigens tatsächlich einmal passiert ist, weil Ferdi das Buch irgendwie zwischen die schmutzigen Hemden hineingebracht hatte, ein unerhörter Vorgang in so einem ordentlichen Haushalt. Der Tathergang konnte nie mehr ganz genau rekonstruiert werden. Der Goethe war danach in einem bemerkenswerten Zustand: der Einband war deformiert, die Blätter standen nach allen Seiten ab und bildeten eine nahezu geometrisch genaue Kugel. Ich riet, den kugelförmigen Goethe als Rarität aufzubewahren, aber Sephanie warf das Wrack weg. Stephanie sagte: »Ich bin aufgestanden, stell dir vor.« Sie erzählte:
Wie in allen Träumen vorher sei sie in dem großen Bett, in der fein-damastenen Bettwäsche gelegen. Sie habe sofort an meinen Vorschlag gedacht und habe auf ihre Hände geschaut. (Nach rechts zu schauen, habe sie allerdings vermieden.) Sie habe ihren Ehering angehabt, auch den anderen Ring an der linken Hand, den ihr Ferdi zum Hochzeitstag geschenkt habe. Ein Nachthemd habe sie auch angehabt, allerdings nicht das, das sie abends angezogen habe. Es sei sehr kalt gewesen gestern, Ferdi müsse immer bei offenem Fenster schlafen, sonst schnarche er. Sie habe deshalb ein ziemlich dickes Trikotnachthemd angezogen. Als sie aber dort nachgeschaut habe, habe sie ein sehr feines Batistnachthemd angehabt, mit weiten Ärmeln und Spitzen um den Halsausschnitt und an den Ärmeln. Sie habe trotzdem nicht gefroren, obwohl auch dort das Fenster offen war. Sie habe dann tatsächlich das Herz in die Hand genommen und sei aufgestanden. Es sei sehr ruhig gewesen. Der fremde Vogel habe nicht gesungen, der Duft nach Orangen sei aber sehr intensiv vom Fenster her ins Zimmer gedrungen.
Sie habe vorsichtig das leichte Plumeau zurückgeschlagen und sei aufgestanden. Der Boden sei kühl gewesen, ein Steinboden, regelmäßig rot-weiß gemustert. Vor dem Bett aber sei ein Paar gestickter schwarzer Pantoffeln gestanden, fersenfrei mit hohen Absätzen. Es sei ihr recht unangenehm gewesen, in diese Pantoffeln zu schlüpfen, aber – habe sie gedacht – noch unangenehmer wäre es gewesen, barfuß auf dem Steinboden zu gehen, auch wenn es außerhalb des Bettes nicht kalt gewesen sei. Neben dem Bett sei ein schwarzes Kästchen gestanden, auch gedrechselt und geschnitzt, wohl ein Nachtkästchen. Auf dem Nachtkästchen sei ein Buch gelegen: ein dickes Buch, in Pergament gebunden, ohne ein Titelbild oder eine Schrift auf dem Umschlag.
Nein, sagte sie auf meine Frage, das Buch habe sie nicht angerührt.
Neben dem Kästchen sei ein fast mannshoher Leuchter gestanden mit einer dicken, schon weit heruntergebrannten Kerze drauf. Der Leuchter sei vergoldet gewesen wie ein Kirchenleuchter.
Obwohl sie ganz vorsichtig gegangen sei, hätten die Pantoffeln wegen ihrer hohen Absätze auf dem Steinboden geklappert.
»Vergiß nicht«, sagte Stephanie, »trotz aller Neugierde habe ich immer denken müssen: in dem Bett liegt ein Toter.«
Sie habe zuerst zum Fenster gehen wollen, dann aber habe sie sich erinnert, daß ich ihr geraten habe, sich alles einzuprägen. Sie habe deshalb zunächst einmal das Bild mit dem schweren Goldrahmen angeschaut. Es sei ein ziemlich großes Bild gewesen, dunkel und eigentlich nach ihrem Geschmack nicht schön. Es wären verschiedene weibliche Heilige darauf abgebildet gewesen, wohl auch das Jesuskind.
Das, was sie vom Bett aus für ein Fenster gehalten habe, sei eine Tür gewesen, eine Glastür. Die Tür sei halb offengestanden, der schwere Vorhang – nicht schwarz, wie sie zunächst gemeint habe, sondern ganz dunkelgrün – sei zurückgezogen gewesen. Ein Musselinstore sei vom leichten Wind ein wenig in die Türöffnung hineingeweht, hereingebauscht wie ein zierliches Segel.
Sie habe nun auch den Musselinstore zurückgeschlagen und sei einen kleinen Schritt – ohne den Store loszulassen – auf die Terrasse hinausgetreten.
Da habe sie sich eigentlich gar nicht mehr gefürchtet. Ein weiter Blick habe sich geöffnet. Nächst dem Haus – wohl eher Schloß – habe sich ein Garten hingezogen. Der Orangenduft, der auf der Terrasse noch viel intensiver war als im Zimmer, sei aus diesem Garten gekommen. Zypressen hätten zwischen den Orangenbäumen emporgeragt. Seitlich vom Schloß und die Wege entlang hätten unzählige Rosen geblüht in allen erdenklichen Schattierungen von rot, orange und weiß.
Es sei kein italienischer Garten gewesen, schon gar kein französischer. Es war ein wilder Garten, eine gezähmte Wildnis. Es war, als sei die Rosenflut nicht angepflanzt und gehegt, als habe man eher den wilden Wuchs der Rosen beschnitten, mühsam in Bahnen gelenkt, kanalisiert gewissermaßen. Es sei auch kein englischer Park gewesen, kein kühler Park, sondern ein üppiger, glühender Garten. Sie habe schon eine Vermutung, wo das gewesen sei, das sage sie mir später.