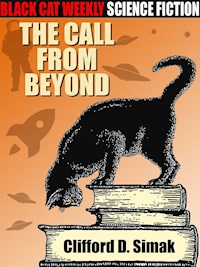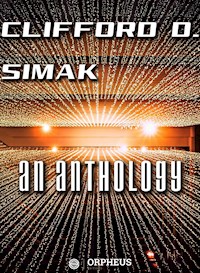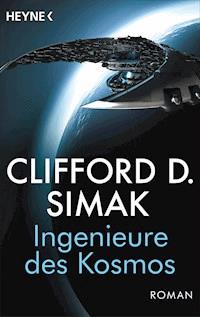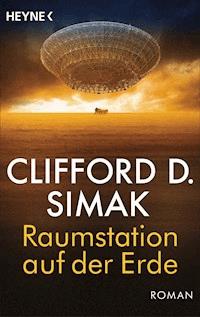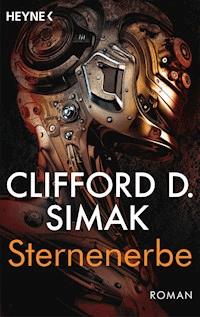
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Reise durch die Zukunft
Tausende Jahre in der Zukunft bedecken die Überreste zerstörter Roboter die Prärien des amerikanischen Kontinents. Sie allein erinnern an das untergegangene Zeitalter technologischer Zivilisation. Da macht sich Thomas Cushing, Waldläufer und Bauer wie seine Zeitgenossen, auf die Wanderung nach Westen, um das Wissen der Vergangenheit aufzuspüren und das verlorene Erbe der Menschheit wiederzugewinnen. Vor allem aber sucht er jenen sagenumwobenen Ort, wo einst Menschen in Raumschiffen die Erde verließen, um die Galaxis zu erforschen. Der liebenswerte Roboter Rollo, die Hexe Meg und Andy, das Wunderpferd begleiten ihn. Auf ihrer Reise begegnen sie intelligenten Steinen und wandernden Bäumen, Zitterschlangen und lebenden Schatten – alles fremdartige Wesen, vor Urzeiten von Raumfahrern aus fremden Welten mitgebracht. Und es geht das Gerücht um, die Hüter des Wissens selbst lebten auf dem Donnerberg …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
CLIFFORD D. SIMAK
EIN ERBE DER STERNE
Roman
Das Buch
Tausende Jahre in der Zukunft bedecken die Überreste zerstörter Roboter die Prärien des amerikanischen Kontinents. Sie allein erinnern an das untergegangene Zeitalter technologischer Zivilisation. Da macht sich Thomas Cushing, Waldläufer und Bauer wie seine Zeitgenossen, auf die Wanderung nach Westen, um das Wissen der Vergangenheit aufzuspüren und das verlorene Erbe der Menschheit wiederzugewinnen. Vor allem aber sucht er jenen sagenumwobenen Ort, wo einst Menschen in Raumschiffen die Erde verließen, um die Galaxis zu erforschen. Der liebenswerte Roboter Rollo, die Hexe Meg und Andy, das Wunderpferd begleiten ihn. Auf ihrer Reise begegnen sie intelligenten Steinen und wandernden Bäumen, Zitterschlangen und lebenden Schatten – alles fremdartige Wesen, vor Urzeiten von Raumfahrern aus fremden Welten mitgebracht. Und es geht das Gerücht um, die Hüter des Wissens selbst lebten auf dem Donnerberg …
Der Autor
Clifford D. Simak, geboren 1904 in Millville, Wisconsin, arbeitete nach dem Studium bis zu seiner Rente 1976 als Zeitungsjournalist. Seit er als Kind die Romane von H. G. Wells gelesen hatte, interessierte Simak sich für die Science-Fiction. Er begann Anfang der Dreißigerjahre, seine ersten Science-Fiction-Kurzgeschichten in den Magazinen von Hugo Gernsback, vor allem in Wonder Stories und später in Astounding
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Titel der Originalausgabe
A HERITAGE TO STARS
Aus dem Amerikanischen von Stephen G. Morse
Überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 1977 by Clifford D. Simak
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Das Illustrat, München
1
Einer der seltsamen Gebräuche, die aus dem Zusammenbruch erwuchsen, war es, die Gehirnkapseln von Robotern in genau derselben Art zu Pyramiden zu türmen, wie gewisse asiatische Barbaren menschliche Köpfe – von denen später nur noch die blanken Schädel übrigblieben – aufhäuften, um einer Schlacht zu gedenken. Zwar wird dieser Brauch nicht überall geübt; die Erzählungen Reisender liefern jedoch genügend Beweise, um aufzuzeigen, dass viele sesshafte Stämme ihn kennen. Nomadische Völker besitzen ebenfalls Sammlungen von Gehirnkapseln, aber diese werden nur zu feierlichen Anlässen aufgeschichtet. Gewöhnlich bewahrt man sie in geweihten Truhen auf, denen eine Ehrenposition gebührt, wenn die Gruppe auf dem Marsch ist, und die auf Kultwagen an der Spitze des Zugs mitgeführt werden.
Es wurde bislang allgemein angenommen, dass der große Reiz, der von den Gehirnschalen der Roboter ausgeht, auf der Erinnerung an den Triumph des Menschen über die Maschinen beruht. Aber es gibt keine unwiderlegbaren Beweise dafür, dass dem so ist. Es ist vielmehr möglich, dass die Symmetrie der Kapseln einen ästhetischen Reiz ausübt, der durchaus unabhängig ist von jeder echten oder eingebildeten tieferen Bedeutung. Vielleicht ist auch ihre Erhaltung eine unbewusste symbolische Reaktion auf den Wunsch nach Dauerhaftigkeit, denn von allen Dingen, die der Mensch des technischen Zeitalters erschaffen hat, sind diese Kapseln die dauerhaftesten, bestehen sie doch aus einem Zaubermetall, das Zeit wie Wetter trotzt.
Aus Wilsons Geschichte vom Ende der Zivilisation
2
Thomas Cushing jätete den ganzen Nachmittag lang Unkraut auf dem Stückchen Kartoffelacker, das terrassenförmig zwischen Fluss und Mauer lag. Das Land stand gut. Wenn es nicht von irgendeiner unvorhergesehenen Krankheit befallen, nicht von einem der Stämme des anderen Ufers in einer dunklen Nacht geplündert, von keinem anderen Übel befallen wurde, könnte es zur Erntezeit einige Zentner Ertrag abwerfen. Er hatte hart gearbeitet, um diese Ernte vorzubereiten. Er war auf allen vieren die Pflanzreihen entlanggekrochen und hatte mit einem Stöckchen Kartoffelkäfer von den Stauden heruntergeklopft und sie in einem Behälter aus Baumrinde aufgefangen, den er in der anderen Hand trug. Hatte sie sorgsam eingesammelt, damit sie nicht von dort, wo sie hingefallen waren, wieder in die Stauden krochen, um sich an den Blättern gütlich zu tun. War auf allen vieren die Reihen auf und ab gekrochen; seine Muskeln hatten unter der Pein aufgeschrien; eine gnadenlose Sonne hoch über ihm, so dass er sich wie in einem giftigen Nebel zu bewegen schien, der aus toter, erhitzter Luft bestand, durchsetzt von dem Staub, den sein Kriechen aufgeworfen hatte. In Abständen, wenn der Behälter mit wimmelnden, hilflosen und hungrigen Käfern fast gefüllt war, hatte er sich zum Ufer hinuntergeschleppt, nicht ohne zuerst die Stelle zu kennzeichnen, an der er aufgehört hatte zu arbeiten, indem er den Stecken in den Boden stieß. Dann hatte er sich hingehockt, den Arm weit vorgestreckt und den Behälter in den Strom entleert, wobei er ihn heftig schüttelte, um auch die letzten Käfer daraus zu entfernen und sie auf eine Reise zu schicken, die nur wenige überleben würden – weit fort von seinem eigenen Kartoffelacker!
Im Geist hatte er manchmal mit den Tieren geredet. Ich wünsche euch nichts Böses, hatte er ihnen gesagt; ich tue dies alles nicht aus Bosheit, sondern um mich und die anderen meiner Gattung zu schützen; ich entferne euch, damit ihr nicht die Nahrung fresst, von der ich und andere abhängen. Er hatte sich bei ihnen entschuldigt, hatte es ihnen erklärt, um ihren Zorn abzuwenden, so wie die vorzeitlichen Jäger sich bei den Bären entschuldigt und erklärt hatten, welche sie für ein Festmahl erlegten.
Im Bett, bevor er einschlief, dachte er wieder über die Käfer nach, sah sie noch einmal vor sich, in einem gestreiften, goldenen Film, der das Wirbeln des Wassers festhielt und von einem Schicksal erzählte, das sie nicht verstehen konnten, da sie nicht verstanden, wie oder warum ihnen solches widerfuhr, die machtlos waren, es abzuwenden, ohne Möglichkeit, ihm zu entgehen. Und nachdem er sie in den Fluss gekippt hatte, ging er wieder daran, zwischen den Reihen entlangzukriechen, um andere Käfer einzusammeln, welche er dann demselben Schicksal überantwortete.
Dann, später im Sommer, wenn die Tage vergingen, ohne dass Regen fiel, wenn die Sonne aus der wolkenlosen blauen Kuppel des Himmels niederbrannte, schleppte er an einem Joch, das er über die Schultern gelegt hatte, Eimer voll Wasser heran, um die durstigen Pflanzen mit jener Feuchtigkeit zu versorgen, die sie entbehrten; Tag für Tag stapfte er den steilen Hang vom Ufer zur Terrasse hinauf und wankte dann zurück, um weitere Eimer des kostbaren Nasses zu holen – eine endlose Tretmühle, damit die Kartoffeln wuchsen und gediehen und für den Winter eingelagert werden konnten. Das Dasein, dachte er, das Überleben, das so schwer und so teuer erkauft werden musste – es war ein andauernder Kampf! Nicht wie in jenen alten Tagen, von denen Wilson vor so langer Zeit geschrieben hatte, als er mit tastender Hand versuchte, die Vergangenheit neu entstehen zu lassen. Jene Zeit, die bereits um Jahrhunderte vorbei war, bevor Wilson die Feder aufs Papier setzte, gezwungen, damit äußerst sparsam umzugehen (er hatte jedes Blatt beidseitig beschrieben, weder links noch rechts einen Rand gelassen, weder am Kopf noch am Schluss einen weißen Rand). Und immer diese kleine, karge, diese schmerzhaft enge Schrift, mit der er all jene Worte aufs Papier zwingen wollte, die in seinem Kopf brodelten. Gequält blieb er stets von der Sorge, die er ein ums anderemal erwähnte – dass die Geschichte, die er schrieb, mehr auf Mythen und Legenden denn auf Tatsachen beruhte; ein unvermeidbarer Zustand, weil so wenig Faktisches übriggeblieben war. Und doch war Wilson davon überzeugt, dass es von größter Wichtigkeit war, die Geschichte niederzulegen, bevor jenes dürftige Tatsachenwissen, das noch da war, vollends verschwand, bevor die Mythen und Legenden noch verzerrter wurden, als sie es ohnehin schon waren. Gepeinigt auch von seiner Einschätzung gerade dieser Mythen und Legenden; im Schweiße seines Angesichts über ihre Wertung grübelnd … Er fragte sich immer wieder: Was soll ich einfügen? Was soll ich auslassen? Denn er nahm nicht alles auf; einiges ließ er weg. Der Mythos, welcher sich um den Abflugplatz der Sternenreisen rankte, blieb unerwähnt.
Aber genug von Wilson, sagte sich Cushing; er würde sich wieder dem Hacken und Jäten zuwenden müssen. Unkraut und Insekten waren Feinde. Regenmangel – ein Feind. Die zu heiße Sonne – ein Feind. Nicht nur er dachte so; es gab viele, die ebenfalls kleine Mais- und Kartoffeläcker bearbeiteten, welche auf anderen Terrassen lagen, seiner eigenen zum Verwechseln ähnlich: überall am Wasser entlang und nahe genug an den Mauern, um geschützt zu sein vor gelegentlichen Überfällen von der anderen Seite des Flusses.
Er hatte den ganzen Nachmittag lang gejätet, und jetzt, nachdem die Sonne schließlich hinter den Klippen im Westen verschwunden war, kauerte er sich neben dem Fluss nieder und starrte über das Wasser hinweg. Stromaufwärts, etwa eine Meile entfernt, standen die steinernen Pfeiler einer Brückenruine, von deren Aufbau noch ein Teil übriggeblieben war, aber nicht genügend, um den Fluss überqueren zu können. Noch weiter stromaufwärts erhoben sich zwei riesige Türme, ehemalige Wohngebäude (in den alten Büchern Wolkenkratzer genannt). Es hatte, so schien es, zweierlei Arten solcher Bauwerke gegeben – gewöhnliche Wolkenkratzer und Wolkenkratzer für die Alten –, und er fragte sich kurz, was eine solche Unterscheidung wohl bedeutet hatte. Heutzutage kannte man so etwas nicht. Es gab keine Trennung zwischen Alt und Jung. Sie lebten zusammen und brauchten einander. Die Jungen stellten Kraft und die Alten Weisheit – und sie arbeiteten zum Wohl aller.
Dies hatte er gesehen, als er erstmals zur Universität gekommen war, und selbst erlebt, als er in die Obhut von Monty und Nancy Montrose genommen worden war, wobei ihre Patenschaft mit der Zeit über jede Förmlichkeit hinausgewachsen war, denn er hatte mit ihnen gelebt und war praktisch ihr Sohn geworden. Die Universität und vor allem Monty und Nancy hatten ihm das Gefühl von Gleichheit und Güte gewährt. Er war in den letzten fünf Jahren zu einem so vollkommenen Teil der Universität geworden, als wäre er hineingeboren worden, und hatte etwas erfahren, das er schließlich als einzigartige Form von Glück erkannte, wie er es in seinen Wanderjahren andernorts nie kennengelernt hatte. Jetzt, da er am Ufer des Flusses kauerte, gestand er sich ein, dass es ein bohrendes, nörgelndes Glück geworden war, ein Glück, das aus Schuldgefühlen erwuchs, angekettet an das Gefühl der Zuneigung und Treue dem alten Paar gegenüber, das ihn aufgenommen und zu einem Teil ihrer selbst gemacht hatte. Er hatte während seiner fünf Jahre hier viel gewonnen: die Fähigkeit des Lesens und Schreibens; eine gewisse Vertrautheit mit Büchern, die Reihe auf Reihe in der Bibliothek gestapelt lagen; ein besseres Verständnis dafür, was es mit der Welt auf sich hatte, was sie einst gewesen und was sie im Augenblick war. Ihm war innerhalb der Sicherheit der Mauern auch Zeit gegeben worden, nachzudenken, herauszubekommen, was er von sich selbst erwartete. Aber obwohl er konzentriert daran gearbeitet hatte, wusste er immer noch nicht ganz genau, was er von oder für sich wollte.
Er erinnerte sich abermals an jenen Tag zu Anfang des Frühlings, als er im Bibliotheksdepot an einem Pult gesessen hatte. Womit er sich gerade beschäftigte, wusste er nicht mehr – vielleicht hatte er einfach nur ein Buch gelesen, um es bald darauf wieder ins Regal zurückzustellen. Aber er erinnerte sich mit verblüffender Klarheit daran, wie er in einem müßigen Augenblick eine Schublade aufgezogen und dort den kleinen Stapel Notizen gefunden hatte, die auf herausgerissene Vorsatzblätter geschrieben waren – in kleiner, verkrampfter Handschrift, die mit jedem Millimeter knauserte. Er wusste noch, wie er vor Überraschung erstarrt war, denn diese gedrängte, platzsparende Schrift war unverwechselbar. Er hatte die Geschichte von Wilson ein ums anderemal gelesen, auf merkwürdige Weise von ihr angezogen und keine Sekunde im Zweifel – nicht im leisesten Zweifel –, dass dies Wilsons Notizen waren, die hier in der Schublade ruhten, um ihrer Entdeckung nach einem Jahrtausend zu harren.
Mit zitternden Händen hatte er sie aus dem Fach genommen und ehrfürchtig aufs Pult gelegt. Langsam hatte er sie im verblassenden Licht des Nachmittags gelesen und vieles wiedererkannt, Material, welches schließlich den Weg in die Bücher gefunden hatte. Aber es gab eine Seite – eigentlich anderthalb –, die nicht veröffentlicht waren, ein Mythos, der so unerhört klang, dass Wilson sich schließlich wohl entschlossen hatte, ihn nicht in sein Werk einzubauen, ein Mythos, von dem Cushing nie gehört hatte und den, wie er auf vorsichtige Erkundigungen hin herausfand, auch sonst niemand kannte.
Die Notizen berichteten von einem Abflugplatz zu den Sternenreisen, der irgendwo im Westen lag, obwohl kein weiterer Hinweis auf seine Lage auftauchte – einfach ›im Westen‹. Es klang alles überaus konfus und wahrhaftig eher nach einer Sage denn einer Tatsache – zu unmöglich, um wahr zu sein. Aber seit jenem regnerischen Nachmittag hatte Cushing gerade das Unglaubliche daran nicht losgelassen und bis heute festgehalten.
Jenseits der breiten Wirbel des Flusses erhob sich das Steilufer jäh über dem Wasser, gekrönt von starkem Baumbewuchs. Der Fluss gab saugende Geräusche von sich, während er weitereilte, eine hastige Flut, die ihrem Ziel entgegenstürmte. Und als Unterton zu diesen Lauten das Grollen einer Macht, die alles hinwegfegte, was ihr im Weg stand. Etwas Mächtiges, dieser Fluss, und irgendwie seiner Macht bewusst und sie eifrig wahrend, der griff und alles nahm, was er erhaschen konnte – ein Stück Treibholz, ein Blatt, einen Klumpen Kartoffelkäfer oder einen Menschen –, wenn er seiner habhaft wurde. Cushing blickte auf ihn nieder und erschauerte vor seiner Drohung, obwohl er selbst nichts zu befürchten brauchte. Er war im oder auf dem Fluss genauso zu Hause wie im Wald. Dieses Gefühl der Bedrohung, so wusste er, wurde nur durch seine gegenwärtige Schwäche hervorgerufen, die aus verschwommener Unentschlossenheit und Ungewissheit entsprang.
Wilson, dachte er – wären nicht jene anderthalb Seiten gewesen, würde er nichts dergleichen empfinden. Oder doch? Waren es nur Wilsons Notizen, oder war es der Drang, diesen Mauern zu entrinnen, zur ungefesselten Freiheit der Wälder zurückzukehren?
Er war, sagte er sich etwas verärgert, von Wilson besessen. Seit jenem Tag, da er die Geschichte erstmals gelesen, hatte dieser Mann von ihm Besitz ergriffen und war allzeit gegenwärtig.
Wie war es denn damals bei Wilson, fragte er sich, an jenem Tag vor fast tausend Jahren, als jener sich hingesetzt hatte, um die Geschichte zu beginnen, verfolgt vom Wissen um seine Unzulänglichkeit? Hatten die Blätter vor dem Fenster im Wind geflüstert? Hatte die Kerze getropft (in seiner Vorstellung war stets bei Kerzenschein geschrieben worden)? Hatte draußen eine Eule im Baum gehockt, die ihre Verachtung hinausschrie über diese verrückte Aufgabe, die der Mann sich gestellt hatte?
Wie war es damals bei Wilson, in jener Nacht in ferner Vergangenheit?
3
Ich muss es deutlich schreiben, sagte sich Hiram Wilson, so dass in den Jahren, die nachkommen, es alle lesen können, die es zu lesen wünschen. Ich muss es sauber gliedern, und ich muss es säuberlich aufzeichnen; vor allem muss ich klein schreiben, denn ich bin knapp mit Papier.
Ich wollte, dachte er, es gäbe mehr, worauf ich aufbauen kann, mehr Tatsachen, einen geringeren Anteil an Sagen; aber ich muss mich mit dem Gedanken trösten, dass Geschichtsschreiber der Vergangenheit sich auch auf Überlieferungen stützten, da sie erkannten, dass Sagen – mögen sie auch verbrämt und beklagenswert arm an Tatsachenmaterial sein – vom Wortsinn her irgendwelche Wurzeln in verlorenem Geschehen haben.
Die Kerzenflamme flackerte bei einem Windstoß, der vom Fenster kam. Draußen schrie sich ein Käuzchen die Seele aus dem Leib.
Wilson tauchte den Federkiel in Tinte und begann knapp am oberen Rand des Blattes, denn er musste ja Papier sparen:
Eine Darlegung der Unruhen, die das Ende der ersten menschlichen Zivilisation herbeiführten (stets in der Hoffnung, es möge eine zweite geben, denn was wir jetzt besitzen, ist keine Zivilisation, sondern Anarchie)
Geschrieben von Hiram Wilson an der Universität von Minnesota nahe den Ufern des Flusses Mississippi, wobei dieser Bericht am ersten Tag des Oktobers 2952 angefangen ward.
Erstellt nach Tatsachen aus noch existierenden Büchern früherer Zeit, vom Hörensagen dessen, was in mündlicher Überlieferung aus den Zeiten der Wirren überkommen ist, und aus alten Mythen und Sagen, die mit Akribie auf jene Körnchen an Wahrheit untersucht wurden, welche sie enthalten mögen.
So, dachte er, das ist wenigstens ehrlich. Es wird den Leser vor Fehlern warnen, aber es gibt ihm die Zusicherung, dass ich mich nach Kräften um die Wahrheit bemühe.
Er ergriff erneut die Feder und schrieb:
Es steht außer Frage, dass früher einmal – vielleicht vor fünfhundert Jahren – die Erde von einer komplizierten und hochstehenden technischen Zivilisation beherrscht wurde. Hiervon ist nichts Funktionsfähiges übriggeblieben. Maschinen und Technologie wurden zerstört, vielleicht innerhalb weniger Monate. Und nicht nur das: Zumindest an dieser Universität – und anderswo vermutlich auch – wurde im Schrifttum jegliche (oder fast jede) Erwähnung von Technik ausgemerzt. Hier sind jedenfalls alle technischen Texte verschwunden, und in vielen Fällen wurden Anspielungen auf Technisches in Büchern nichttechnischer Natur durch Herausreißen der Seiten eliminiert. Was an gedrucktem Wort bezüglich Technik und Wissenschaft übrigblieb, ist nur allgemeiner Natur und bezieht sich möglicherweise auf eine Technik, die zum Zeitpunkt der Zerstörung als so überholt angesehen wurde, dass keine Bedrohung darin zu liegen schien, sie bestehen zu lassen. Aufgrund dieser verbleibenden Hinweise erhalten wir eine Ahnung davon, wie die Lage gewesen sein mag, aber nicht genügend Information, um das ganze Ausmaß der alten Technologie oder ihren Einfluss auf die Kultur erfassen zu können. Alte Karten des Campus zeigen, dass es einst mehrere Gebäude gab, die der Lehre von Technik und Ingenieurswissen dienten. Diese Bauten fehlen jetzt. Es gibt eine Legende, dass die Steine, aus denen sie errichtet waren, dazu verwendet wurden, die Verteidigungsmauer zu errichten, die das Universitätsgelände jetzt umschließt.
Die Vollständigkeit der Zerstörung und die anscheinend methodische Art, in der sie durchgeführt wurde, weisen auf unverständliche Wut und erbarmungslosen Fanatismus hin. Sucht man nach einer Ursache, ist die erste Reaktion, zu schließen, dass alles durch eine Zerstörungswut herbeigeführt wurde, die einem Hass auf die Folgen der Technik entsprang – Erschöpfung nicht erneuerbarer Rohstoffquellen, Vergiftung der Umwelt und Verlust an Arbeitsplätzen, der zu Massenarbeitslosigkeit führte. Aber einmal näher untersucht, erscheint diese Art von Überlegung als zu grob vereinfachend. Bei weiterem Nachdenken kommt man darauf, dass das grundlegende Übel, welches die Zerstörung ausgelöst hat, in den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Systemen gefußt haben muss, deren Nährboden die Technologie war.
Eine technologische Gesellschaft bedarf, um weitestgehend genutzt zu werden, der Größe – Größe in der Gesellschaftsstruktur, in der Verwaltung, im Finanzwesen und im Dienstleistungsbereich. Größe bietet, solange sie beherrschbar bleibt, viele Vorteile, aber an einem bestimmten Punkt ihres Wachstums wird sie unkontrollierbar. Ungefähr zu der Zeit, da diese Größe jenes kritische Ausmaß erreicht, bei dem sie dazu neigt, unkontrollierbar zu werden, entwickelt sie auch die Fähigkeit, kraft ihres Beharrungsvermögens aus eigenem Antrieb zu laufen, und gerät folglich noch weiter außer Kontrolle. Läuft sie aber einmal aus dem Ruder, schleichen sich Pannen und Fehler in ihren Gang, und es gibt zwangsläufig wenig Möglichkeiten zur Korrektur. Unbehoben setzen sich dann die Pannen und Fehler notwendigerweise fort und erzeugen aus sich heraus größere Pannen und noch größere Fehler. Dies geschieht dann nicht nur in den Maschinen selbst, sondern auch in den kopflastigen Verwaltungs- und Finanzstrukturen. Möglicherweise begreifen menschliche Verwalter und Führer, was geschieht, stehen aber der Situation machtlos gegenüber. Und so laufen die Maschinen Amok und ziehen die komplizierten sozialen und wirtschaftlichen Strukturen mit, welche jene nicht nur ermöglicht, sondern erfordert haben. Lange vor dem großen Zusammenbruch, wenn die Systeme versagen, muss es eine aufsteigende Flutwelle von Wut im Lande gegeben haben. Kommt dann schließlich der Zusammenbruch, flammt die Wut zu einer Zerstörungsorgie auf zu einem Gegenschlag, um die Systeme und die Technologie, die versagten, restlos auszulöschen, so dass sie niemals wieder genutzt zu werden vermögen und nie wieder Gelegenheit haben zu versagen. Und so vollbringt die Wut ihr Werk, werden nicht nur die Maschinen vernichtet, sondern die Grundidee der Technik selbst getötet.
Es gibt keine Frage, dass das Zerstörungswerk wohl etwas fehlgeleitet war, aber man muss bedenken, dass die Verheerung von Fanatikern ausgeführt wurde. Ein Merkmal des Fanatikers ist, dass er ein Ziel haben muss, gegen das er seine Wut richten kann. Und die Technik – oder wenigstens deren äußere Erscheinung – war nicht nur zum Greifen nahe, sondern auch wehrlos. Eine Maschine muss notgedrungen stillstehen und alles mit sich geschehen lassen. Sie hat keine Möglichkeit zurückzuschlagen.
Dass alle alten Texte und Aufzeichnungen über Technik zusammen mit den Maschinen zerstört wurden, aber eben nur jene Bücher oder Teile von Büchern, die das Thema Technik anschnitten, lässt folgern, dass die Technik das einzige Ziel war und die Zerstörer nichts gegen Bücher oder Gelehrsamkeit an sich hatten. Es ließe sich sogar anführen, dass sie offenbar großen Respekt vor Büchern hatten, denn selbst in ihrer blinden Wut schonten sie alles, was mit Technik nichts zu tun hatte.
Der Gedanke an den schrecklichen und beharrlichen Zorn, der sich bis zu einem Punkt aufgestaut haben musste, an dem es möglich wurde, all dies herbeizuführen, lässt einen erschauern. Elend und Chaos müssen aus dieser vorsätzlichen Zerstörung einer Lebensweise entstanden sein, welche die Menschheit in jahrhundertelanger Anstrengung so mühsam aufgebaut hatte. Tausende müssen einer Gewalttätigkeit zum Opfer gefallen sein, die das Zerstörungswerk begleitete, und weitere Tausende deren Folgeerscheinungen. Alles, worauf sich die Menschheit verlassen hatte, war vernichtet. Anarchie nahm die Stelle von Gesetz und Ordnung ein. Die Nachrichtenverbindungen wurden so gründlich ausgelöscht, dass eine Stadt kaum mehr wusste, was im benachbarten Ort geschah. Das komplizierte Verteilungssystem kam zum Stillstand, Not und Hunger brachen aus. Die Energiesysteme und Verteilernetze blieben zerstört, und die Welt versank in Dunkelheit. Die medizinische Versorgung war gelähmt. Seuchen überzogen das Land. Das, was geschah, können wir uns nur vorstellen, denn es gibt keine Aufzeichnungen mehr. Zu diesem späten Zeitpunkt reichen unsere finstersten Albträume nicht aus, um die Vollständigkeit des Schreckens zu vergegenwärtigen. Von unserer heutigen Warte aus erscheint das Geschehene eher als Folge von Wahnsinn denn gewachsener Wut, aber dennoch müssen wir begreifen, dass es einen augenscheinlichen Grund für das unvorstellbare Grauen gegeben haben muss.
Wie unser Land aussah, als sich die Lage wieder stabilisiert hatte – sofern es so etwas gab –, darüber können wir nur Vermutungen anstellen. Wir vermögen einige Schlüsse aus den gegenwärtigen Umständen zu ziehen und den großen Umriss zu sehen; das ist aber auch schon alles. In manchen Gegenden bildeten Gruppen von Bauern Gemeinwesen und verteidigten ihre Anbauflächen und ihr Vieh mit Waffengewalt gegen hungrig umherziehende Meuten. Die Städte wurden zu Dschungeln, in denen sich marodierende Haufen um das Vorrecht des Plünderns prügelten. Vielleicht haben damals wie heute örtliche Häuptlinge versucht, Herrscherhäuser zu gründen, sich mit anderen Häuptlingen bekriegt und sind dann einer nach dem anderen – wie heute – untergegangen. In solch einer Welt – und das trifft heute wie damals zu – war es keinem einzelnen und keiner Gruppe möglich, eine Machtgrundlage zu bilden, um darauf eine überregionale Regierung aufzubauen.
Was unseres Wissens in unserer Gegend der Errichtung irgendeiner Art sich fortpflanzender und beständiger sozialer Ordnung am nächsten kommt, ist diese Universität. Wie eine solche Oase relativer Ordnung auf ein paar Hektar genau zustande kam, ist unbekannt. Dass wir überlebt haben, nachdem einmal eine solche Ordnung errichtet war, mag durch die Tatsache erklärt werden, dass wir rein defensiv leben und zu keiner Zeit danach trachteten, unseren Herrschaftsbereich auszudehnen oder unseren Willen irgendjemandem aufzuzwingen, sondern bereit waren, jeden in Frieden zu lassen, wenn uns der gleiche Gefallen erwiesen wurde.
Viele der Menschen, die jenseits unserer Mauern leben, hassen uns, andere verachten uns als Feiglinge, die hinter ihren Wällen zittern. Aber es gibt doch einige – dessen bin ich mir sicher –, denen diese Universität ein Geheimnis geworden ist und ein Hort des Zaubers, denn wir wurden die letzten hundert Jahre oder länger in Ruhe gelassen.
Es hängt von der Wesensart der Gemeinschaften und ihrer geistigen Umgebung ab, wie sie auf eine Lage wie die Zerstörung einer technischen Gesellschaft reagieren. Die meisten würden mit Wut, Verzweiflung und Furcht reagieren und nähmen demnach eine nur kurze Zeit in Betracht ziehende Perspektive ein. Einige – vielleicht sehr wenige – würden dazu neigen, die Angelegenheit aus langer Sicht zu betrachten. Eine Universitätsgemeinschaft wählt sicherlich die Langzeitperspektive mit dem Blick auf die Entwicklungen in zehn oder gar hundert Jahren. Eine solche Lebensform wäre unter Bedingungen, wie sie vor der Katastrophe herrschten, eine locker verknüpfte Gruppe gewesen, wenn auch enger verbunden, als viele ihrer Mitglieder bereit gewesen wären einzugestehen. Alle hätten dazu geneigt, sich als krasse Individualisten zu begreifen. Doch wäre es einmal hart auf hart gekommen, hätten sich die meisten wohl zu der Einsicht bekannt, dass hinter der Gestik ihres betonten Einzelgängertums eine gemeinsame Denkart lag. Anstatt fortzulaufen und sich zu verstecken, wie es bei den Vertretern der Kurzzeitperspektive der Fall gewesen wäre, hätte eine Universitätsgemeinde bald begriffen, dass das beste war, an Ort und Stelle zu verbleiben und zu versuchen, mitten im Chaos eine Gesellschaftsordnung zu bewahren, die soweit wie möglich auf jenen überkommenen Werten aufbaute, welche die Hochschulen über Zeiten hinweg aufrechterhielten. Kleine Gebiete der Sicherheit und des Verstandes – so hätten sie sich ins Gedächtnis gerufen – hatten in der Geschichte schon immer Perioden der Unruhe überlebt. Gedanken an Klöster wären aufgekommen, die wie Inseln der Stille Europas finstere Zeitalter hindurch existierten. Natürlich wären einige dagewesen, die erhaben davon redeten, die Fackel der Gelehrsamkeit hochzuhalten, während sich Nacht über den Rest der Menschheit senkte, und es mag sogar solche gegeben haben, die ernsthaft an das glaubten, was sie sagten. Aber im großen und ganzen wäre die Entscheidung als einfache Existenzfrage erkannt worden – die Wahl eines Verhaltensmusters, das eine reale Überlebenschance bot.
Selbst damals muss es eine Periode der Belastung und Verwirrung gegeben haben, in jenen früheren Jahren, als zerstörerische Kräfte die wissenschaftlichen und technologischen Zentren auf dem Campus dem Erdboden gleichmachten und seitenweise Bücher zerschnitten, um jede nennenswerte Erwähnung von Technik zu beseitigen. Es mag sich wohl ereignet haben, dass in der hitzigen Begeisterung der Zerstörung gewisse Mitglieder des Lehrkörpers, die mit den verhassten Einrichtungen zu tun hatten, zu Tode kamen. Es drängt sich sogar der Gedanke auf, dass manche Hochschulangehörige bei der Zerstörung eine Rolle spielten. So ungern man daran auch denken mag, man muss erkennen, dass zwischen den Vertretern verschiedener Lehrmeinungen leidenschaftliche Kontroversen bis hin zu persönlichen Feindseligkeiten bestanden, die auf widerstreitenden Grundsätzen und Überzeugungen aufbauten und nicht selten durch unverträgliche Persönlichkeiten noch gesteigert wurden.
Nachdem das Zerstörungswerk einmal getan war, muss die Universitätsgemeinschaft – oder was davon übrig war – wieder zusammengerückt sein, begraben haben, was an Eifersüchteleien noch geblieben war, und sich daran gemacht haben, eine Enklave einzurichten, die sich vom Rest der Welt abhob – dazu entworfen, wenigstens einen kleinen Bruchteil menschlicher Vernunft zu bewahren. Die Zeiten müssen viele Jahre lang gefahrvoll gewesen sein, was die Schutzmauer um den kleinen Campus bezeugt. Der Bau der Mauer war sicherlich eine lange und harte Arbeit, aber eine hinreichend wirksame Führung besaß offensichtlich das notwendige Durchhaltevermögen. Die Universität war in jener Zeitspanne wahrscheinlich das Ziel vieler gelegentlicher Raubzüge, obwohl die Stadt jenseits des Flusses und eine weitere im Osten einiges vom Druck auf den Campus abgelenkt haben mögen. Der Inhalt der Lager, der Läden und der Wohnungen innerhalb der Städte hatte wahrscheinlich weit mehr Anziehungskraft als alles, was der Campus zu bieten hatte.
Da es keine Verbindungen zur Welt außerhalb der Mauer gibt und die einzigen Nachrichten, die wir bekommen, die Erzählungen vereinzelter Reisender sind, können wir nicht vorgeben zu wissen, was anderswo geschieht. Vieles mag sich ereignen, von dem wir nichts ahnen. Aber in dem kleinen Gebiet, welches wir kennen oder von dem wir doch bruchstückhaftes Wissen haben, scheint die höchste Stufe sozialer Organisation der Stamm oder die bäuerliche Kommune ähnlich jener zu sein, mit welcher wir in Ansätzen Handelsbeziehungen unterhalten. Direkt im Osten und Westen, an Orten also, wo es einmal riesige und reiche Städte gab, die jetzt großteils nur noch aus Ruinen bestehen, fristen mehrere Stämme eine kärgliche Existenz vom Ertrag des Bodens und befehden sich hin und wieder wegen irgendeines eingebildeten Unrechts oder um begehrtes Gelände zu gewinnen (obwohl nur Gott weiß, weshalb begehrt) oder auch nur um des Anscheins von Ruhm willen, den ein Sieg mit sich bringt. Zum Norden hin liegt eine Landkommune mit vielleicht einem Dutzend Familien, mit denen wir Handelsvereinbarungen getroffen haben, wobei ihre Erzeugnisse dazu dienen, das Gemüse zu ergänzen, das wir in unseren Gärten und auf den Ackern anbauen. Für diese Lebensmittel zahlen wir mit Tand-Perlschnüren, schlecht gemachtem Schmuck, Lederwaren – Dingen, die sie in ihrer Einfalt für wertvoll und begehrenswert halten. So tief sind wir gesunken, dass eine einst stolze Universität Tand herstellt und tauscht, um Lebensmittel zu bekommen!
Einst mögen Sippen sich in Einödhöfen gehalten haben, vor der Welt versteckt. Viele dieser Höfe gibt es nicht mehr; sie wurden entweder vernichtet oder ihre Bewohner gezwungen, sich um des Schutzes willen einem Stamm anzuschließen. Und es gibt die Nomaden – die umherziehenden, weit wandernden Gruppen mit ihren Rindern und Pferden, die von Zeit zu Zeit Kriegertrupps ausschicken, um zu plündern (obwohl es heutzutage wenig genug zu holen gibt). Derart ist der Zustand der Welt, wie sie uns heute vertraut ist; und so leben auch wir. Aber so traurig dieses Dasein ist, in gewisser Weise geht es uns weit besser als vielen anderen auf dieser Welt.
In gewissem kleinen Ausmaß haben wir die Flamme der Gelehrsamkeit am Leben erhalten. Unseren Kindern wird Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht. Wer will, kann zusätzliches Grundwissen erwerben, und es gibt natürlich Bücher zu lesen, Tonnen von Büchern, und aufgrund dieser Lektüre sind viele in der Gemeinde verhältnismäßig gut informiert. Lesen und Schreiben sind Fähigkeiten, die heutzutage nur wenige besitzen, nachdem diese grundlegenden Fähigkeiten aus Mangel an entsprechend ausgebildeten Lehrern abhanden gekommen sind. Gelegentlich gibt es Menschen, die weite und gefährliche Reisen hierher auf sich nehmen, um das wenige an Bildung zu erwerben, das wir ihnen bieten können – aber nicht viele, denn Bildung steht in keinem hohen Ansehen. Einige von denen, die kommen, bleiben ständig bei uns, und so kommt anderes Blut in unser Erbgut, eine Auffrischung, die wir bitter nötig haben. Mag sein, dass einige von denen, die zu uns stoßen und Verlangen nach Bildung vorgeben, eigentlich kommen, um den Schutz unserer Mauern zu suchen oder der harten Gerichtsbarkeit ihrer Stämme zu entfliehen. Dagegen haben wir nichts einzuwenden; wir nehmen sie auf. Solange sie in Frieden kommen und Frieden bewahren, wenn sie einmal da sind, heißen wir sie willkommen.
Jeder, der auch nur ein halbes Auge besitzt, sollte jedoch imstande sein, zu sehen, dass wir viel unserer Wirksamkeit als Bildungseinrichtung verloren haben. Wir können die einfachen Dinge lehren. Aber seit der zweiten Generation, nachdem die Enklave eingerichtet wurde, ist niemand dagewesen, der befähigt wäre, irgendetwas zu lehren, was einer höheren Bildung nahekommt. Wir haben keine Lehrkräfte für Physik oder Chemie, für Philosophie oder Psychologie, für Medizin oder viele andere Wissensgebiete. Und hätten wir welche, so wäre der Bedarf doch gering. Wer braucht in dieser Umwelt Physik oder Chemie? Wo ist der Nutzen der Medizin, wenn Medikamente nicht zu beschaffen sind, wenn es keine chirurgischen Instrumente gibt?
Wir haben uns oft gefragt, ob wohl noch andere Colleges oder Universitäten auf unsere Art existieren. Es wäre eigentlich logisch – aber wir hörten nie etwas davon. Allerdings versuchten wir nicht, es herauszufinden, und halten es nicht für angebracht, unsere Gegenwart über Gebühr bekannt zu machen.
In Büchern, die ich gelesen habe, stehen viele kluge und logische Vorhersagen, dass sich eine derartige Katastrophe wie die geschehene ereignen werde. Aber in allen Fällen wurde Krieg als Ursache vorhergesehen. Mit unvorstellbaren Vernichtungsmaschinen ausgerüstet, besaßen die Großmächte der alten Zeit die Fähigkeit, einander (und im engeren Sinne die Welt) innerhalb weniger Stunden zu vernichten. Es kam jedoch nicht so. Es gibt keine Spuren von Kriegsverwüstungen und auch keine Sagen, die von solch einem Krieg berichten.
4
Dwight Cleveland Montrose war ein gelenkiger, hagerer Mann mit einem Gesicht wie gegerbtes Leder, dessen Bräune gegen das schneeweiße Haar abstach, gegen das borstige Grau seines Schnurrbarts und gegen die schweren Augenbrauen, die gleichsam zwei Ausrufezeichen über den hellen Augen aus verwaschenem Blau bildeten. Er saß aufrecht in seinem Stuhl und schob den Teller von sich, den er abgegessen hatte. Er wischte sich mit einer Serviette den Bart und schob sich vom Tisch ab.
»Wie ging's mit den Kartoffeln heute?«, fragte er.
»Ich bin mit dem Jäten fertig«, sagte Cushing. »Ich glaube, dies war das letzte Mal. Wir können sie jetzt so lassen. Selbst eine Dürreperiode könnte ihnen nicht allzu viel anhaben.«
»Du arbeitest zu hart«, sagte Nancy. »Du arbeitest härter, als du solltest.«
Sie war eine muntere, vogelähnliche kleine Frau, mit den Jahren zusammengeschrumpft, ein Hauch von Frau mit Sanftmut im Gesicht. Sie sah Cushing im flackernden Kerzenlicht liebevoll an.
»Ich arbeite gern«, antwortete er ihr. »Es macht mir Freude. Und stolz bin ich auch darauf. Andere Leute können andere Dinge tun. Ich baue gute Kartoffeln an.«
»Und nun«, brummte Monty barsch und strich sich über den Schnurrbart, »nehme ich an, dass du fortgehen wirst.«
»Fortgehen!«
»Tom«, sagte er, »wie lange bist du jetzt bei uns? Sechs Jahre, stimmt's?«
»Fünf Jahre«, berichtigte Cushing. »Vorigen Monat waren es fünf Jahre.«
»Fünf Jahre«, wiederholte Monty. »Fünf Jahre. Das reicht aus, um dich zu kennen. So nahe, wie wir uns alle gewesen sind, lange genug. Und während der letzten paar Monate bist du so unruhig gewesen, als säßest du auf Ameisen. Ich habe dich nie gefragt, warum. Wir, Nancy und ich, haben dich nie gefragt. Bei gar nichts.«
»Nein, das habt ihr nie getan«, sagte Cushing. »Es muss Zeiten gegeben haben, in denen ich nicht auszustehen war …«
»Nie schwer zu ertragen«, widersprach Monty. »Nein, mein Lieber, das niemals. Wir hatten einen Sohn, weißt du …«
»Er war nur kurze Zeit bei uns«, sagte Nancy. »Sechs Jahre. Wenn er überlebt hätte, wäre er jetzt in deinem Alter.«
»Masern«, sagte Monty. »Masern, in Gottes Namen. Es gab eine Zeit, als die Menschen wussten, wie man mit Masern fertig wird, wie man sie verhütet. Es gab eine Zeit, als Masern fast unbekannt waren.«
»Es gab noch sechzehn andere Kinder«, erinnerte sich Nancy. »Siebzehn, mit John. Alle hatten Masern. Ein schrecklicher Winter. Der schlimmste, den wir je erlebten.«
»Es tut mir leid«, sagte Cushing.
»Der Kummer ist jetzt vorüber«, meinte Monty. »Das heißt, der oberflächliche Kummer. Es gibt einen tieferen Kummer, der uns unser ganzes Leben lang begleiten wird. Wir reden sehr selten darüber, weil wir nicht wollen, dass du glaubst, du stehst an seiner Stelle, du nimmst seinen Platz ein, wir lieben dich seinetwegen.«
»Wir lieben dich«, sagte Nancy sanft, »weil du Thomas Cushing bist. Niemand als du selbst. Wir grämen uns weniger, seit du da bist. Etwas von dem alten Kummer ist mit dir vergangen. Tom, wir schulden dir mehr, als wir zwei dir sagen können.«
»Wir schulden dir genug«, sagte Monty, »um mal offen miteinander zu reden – wirklich, eine längst fällige Unterhaltung. Es wird allmählich unerträglich, weißt du. Du hast geschwiegen, weil du meinst, wir würden es nicht verstehen, falsch verstandene Treue zu uns. Wir merken an den Dingen, die du tust, an der Art, wie du dich benimmst, was dir im Sinn liegt – und fühlten uns bisher verpflichtet, nichts zu sagen, weil wir nicht diejenigen sind, die dich zum Sprechen zwingen. Aber diese Rücksicht wird allmählich töricht, und wir möchten dir sagen, dass wir genug Zuneigung für dich empfinden, um dich gehen zu lassen, wenn es dich hinaustreibt. Wenn du weg willst, sollst du ohne Schuldgefühle scheiden und nicht glauben, du seist uns davongelaufen. Wir haben die letzten paar Monate beobachtet, wie du es uns sagen wolltest, wie du Angst davor hattest! Als säßest du auf Ameisen … Es juckt dich freizukommen.«
»Das ist es nicht«, widersprach Cushing. »Es juckt mich nicht freizukommen.«
»Es ist dieser Abflugort der Sternenreisen«, sagte Monty. »Ich nehme an, das ist es. Wäre ich ein jüngerer Mann, ich käme mit. Obwohl – ich bin mir nicht sicher, dass ich genügend Mut hätte. Ich glaube, dass im Lauf der Jahrhunderte die Menschen in dieser Universität Platzangst bekommen haben. Wir leben hier auf dem Campus alle so dicht zusammengedrängt, dass keiner von uns daran denkt, sich draußen umzusehen.«
»Soll ich das so auffassen«, fragte Cushing, »dass an dieser ganzen Sache, die Wilson in seinen Notizen niedergeschrieben hat, etwas dran sein könnte – dass es diesen Abflugort der Sternenreisen geben könnte?«