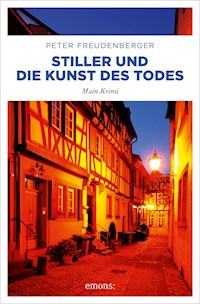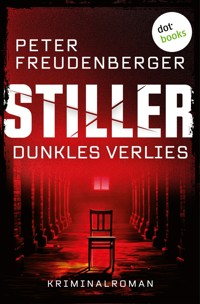Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Main Krimi
- Sprache: Deutsch
Fußball-WM in Brasilien: Am Rande einer nächtlichen Siegesfeier in Aschaffenburg wird eine junge Frau von einem Unbekannten erdrosselt. Als die Polizei ihren Freund festnimmt, setzt eine beispiellose Internethetze ein, die ihn in den Tod treibt. Zwanzig Jahre später greift Journalist Paul Stiller den Fall wieder auf - und wird selbst zum Gejagten der Meute . . . Ein Blick in die Zukunft und ein Fall von überregionaler Brisanz: humorvoll, ungewöhnlich, spannend.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Freudenberger, Jahrgang 1960, ist fest in der Main-Spessart-Region verwurzelt – auch beruflich als Lokalredakteur in seiner Heimatstadt Aschaffenburg. Sein Credo: Ein Journalist darf die Menschen seines Verbreitungsgebietes durchaus etwas lieben. Der humor- und liebevolle Blick auf die Region spiegelt sich (bei aller Spannung) in den Figuren seiner Kriminalromane.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2014 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.com/blindguard Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-589-1 Main Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Prolog
Der Mord ist nicht mehr wichtig. Die Meute benutzt ihn nur noch als Vorwand für ihre Jagd auf den Täter. Wie Bluthunde, die nicht wissen, warum sie die Beute hetzen, sondern nur dem Instinkt und der Fährte folgen. Ihre eigene Mordlust treibt sie an. Sie macht den Täter zur Beute. Zum Opfer.
Die Redaktionskonferenz ist für Paul Stiller der Beleg. Nicht mehr der Mord zählt, sondern die Meute. Stiller sitzt aufrecht in der Runde. Er hat die Ellbogen auf die Tischplatte gestützt, die Hände gefaltet und wie einen Trichter über Nase und Mund gestülpt, das Kinn ruht auf den Daumen. An den Fingern vorbei betrachtet er die Szene und nimmt sich vor, sie nicht zu vergessen.
Eine Szene, die auch seine Niederlage beschreibt. Chefredakteur Rex Bausback hat ihm nach dem ersten Beitrag jede weitere Einmischung in die Berichterstattung über den Mord untersagt. Er habe genug von Stillers Eskapaden bei den früheren Mordrecherchen, so Bausbacks Begründung. Das sei »abmahnungsrelevant«. Stiller hat dem inneren Zwang widerstanden, die Wortschöpfung zu notieren.
Bausback hat Fenia Saalbach auf den Mord angesetzt. Das ist für Stiller nicht das Problem. Fenia hat gerade ihr Volontariat abgeschlossen, und er hat sie im ersten Jahr selbst ausgebildet. Sie weiß, worauf es ankommt. Er ist mit seinen Mitte vierzig gut fünfzehn Jahre älter als sie, aber sie macht mit Fleiß und Ehrgeiz seinen Vorsprung an Erfahrung wett.
Sie sitzt am anderen Ende des Konferenztischs, streicht sich die schwarze Haarsträhne, die ihr vors Auge gefallen ist, hinter das Ohr und schaut zu ihm herüber. Ich hab das nicht gewollt, sagt ihr Blick. Er zwinkert ihr aufmunternd zu. Kein Problem, was den Mord betrifft.
Es ist die Meute, die ihn reizt. Das ist anders, neu. Etwas Bedrohliches, weil die Meute die möglichen Täter zu Opfern und die Beobachter zu möglichen Tätern mutieren lässt. Weil sie etwas Unmenschliches unter der Oberfläche des Menschen durchschimmern lässt, wie in einem Horrorfilm, in dem sich eine schöne Frau in ein echsenartiges Raubtier verwandelt, das von innen aus ihr herausbricht.
Aber auch um die Meute darf er sich nicht kümmern. Stattdessen soll er einen Beitrag über die jüngsten Prognosen der städtischen Demografiewerkstatt liefern. Stiller bläst ärgerlich in die Hände. Er hat das Thema selbst vorgeschlagen, bevor der Mord geschehen und die Meute aufgetaucht ist. Die Demografiewerkstatt hat verschiedene Szenarien für die kommenden zwanzig Jahre in Aschaffenburg entwickelt, gestützt auf wissenschaftliche Studien. Im besten Fall stagniere die Bevölkerungszahl – die Prognose, der die Kommunalpolitik zuneigt. Im Worst-Case-Szenario werde die Stadt in zwei Jahrzehnten ganze Wohnviertel zurückbauen müssen. Eine Entwicklung, die in Halle und anderen Städten der neuen Bundesländer längst Realität ist, von der hier aber niemand hören will – und auch nicht lesen.
Die Themen sind rasch verteilt in dieser Konferenz, die sich erfahrungsgemäß noch eine gute Stunde hinziehen wird. Der Sport hat die WM in Brasilien und als lokales Zubrot die nächtlichen Fußballpartys am City-Kreisel. Die Politik einen neuen Streit der Großen Koalition, der »GroKo«, die seit einem halben Jahr im Amt ist, die Wirtschaft die Dauerkrise der südlichen Euroländer, die Kultur den Kabarettisten Urban Priol im Hofgarten-Kabarett. Und mit der Meute zieht die Online-Redakteurin Kerstin Polke das große Los.
Die Meute hat ein neues Medium gefunden, das Internet. Ein Medium, das zu ihr passt, weil es sie unsichtbar macht, unangreifbar, anonym. Unter falschen Namen hetzt der Mob gegen seine Beute in Blogs und Foren, die er als »soziale Netzwerke« bezeichnet. Hinter den Nicknames versteckt, lässt der Mob die menschliche Maske fallen. Er entlarvt, welcher Abgrund dahintersteckt, aber nicht wer.
Die Wissenschaft zieht Vergleiche zu Stammtischparolen. Doch an den Stammtischen sind Gleichgesinnte unter sich. Im Internet haben sie eine weltweite Öffentlichkeit, entflammen sie Flächenbrände, lösen sie Lawinen aus. Die Sprache hat neue Wörter dafür gefunden: Shitstorm oder Netzhetze.
Die Hetze bleibt aber nicht im virtuellen Raum des Internets. Sie wird real, wie nach diesem Mord. Peter Kleinschnitz ist bereits unterwegs, um die Realität abzulichten, Stiller hat ihm beim Weggehen neidvoll nachgeblickt. Der Fotograf soll Bilder liefern von der aufgewiegelten Menge, die in diesem Augenblick vor der Polizeidienststelle protestiert und die Herausgabe des Verdächtigen fordert. Szenen, wie sie sich in billigen Western vor dem Büro des Sheriffs abspielen. Die Meute fordert ihre Beute, es riecht nach Lynchjustiz.
Bausback blättert in den Ausdrucken, die ihm Kerstin Polke in die Konferenz mitgebracht hat. Hin und wieder zitiert er aus den Einträgen der Meute bei Facebook oder in anderen Foren. Manchmal nur wenige Worte: »Hängt ihn auf«, »Steinigt ihn«, »Erschießen«.
»Hier.« Bausback liest vor: »Sperrt ihn da ein, wo sie solche Schweine als Frischfleisch lieben.« Er schaut in die Runde. »Das ist noch harmlos. Oder da …« Er zieht ein anderes Blatt heraus. »Jemand mit dem Decknamen Riesenmotz schreibt: ›Dieses Monster steckt seinem Opfer auch noch einen Ring an, als wär’s seine Braut. Leider ist unser sogenannter Rechtsstaat viel zu weich gegen solche kaputten Kreaturen.‹ Ein Ring …«, Bausback legt das Blatt zurück, »… vielleicht war es ein Ritualmord?«
Trotz seiner Enttäuschung: Stiller versteht Bausbacks Entschluss, Kerstin Polke für den Bericht über den Shitstorm auszuwählen. Das Internet ist ihr Medium, niemand im Raum kennt es besser als sie, Stiller schon gar nicht. Oft belustigt sich die Online-Redakteurin über ihn, wenn er in Telefonbüchern nach Nummern blättert, mit seinem Uralt-Handy Nokia 6210 hantiert oder sich alles ausdruckt, was er bei Internetrecherchen findet. Wiederholt hat sie ihm geraten, mit der Zeit zu gehen, sich auf moderne Medien einzulassen.
Der Verlauf der Konferenz gibt ihr recht. Stiller hat sich selbst abgehängt, er muss sich ändern. Es hat keinen Sinn mehr, sich gegen den Trend zu stemmen. Mitte vierzig – er hat noch mehr als zwanzig Berufsjahre vor sich, wenn die neue Bundesregierung bei der Rente nicht wieder zurückrudert. Und wer weiß, ob die gedruckte Zeitung nicht schon vorher von mobilen Endgeräten abgelöst wird. Er beschließt, sich so bald wie möglich ein Smartphone zuzulegen. Und er nimmt sich vor, diese Konferenz nicht zu vergessen.
Er muss, er wird sich daran erinnern.
Eines Tages …
1
»Die wollen uns hier raushaben, Paul. Entsiedeln. Du musst das lesen.«
Stiller war in eine Meldung aus dem Sport vertieft: Der frühere Präsident des FC Bayern hatte mal wieder eine Ehrung bekommen. Der Autor erinnerte beiläufig daran, dass der Mann vor zwanzig Jahren wegen Steuerhinterziehung hinter Gitter gewandert war. Stiller schob den Tablet-Computer mit den Morgennachrichten der Redaktion zur Seite und nahm den Briefbogen, den ihm Ruth über den Tisch reichte. Das Papier hatte eine amtliche Aufmachung und wirkte dadurch besonders altertümlich. Das Wort »Entsiedeln« hatte ihm schon genug gesagt. Er ahnte, was in dem Brief stehen würde, er hatte in den letzten Jahren wiederholt darüber geschrieben und sollte gerade einen weiteren Bericht zu diesem Thema abliefern.
Er räusperte sich und suchte nach einer Ausrede, sich ums Lesen zu drücken. »Ich hab’s im Kreuz, ich kann nicht mehr sitzen«, unternahm er einen schwachen Versuch.
»Vergiss das Kreuz. Hauptsache, deine Augen sind in Ordnung. Da.« Ruth hielt ihm die Lesebrille hin.
Stiller setzte sie folgsam auf, strich das Papier glatt und murmelte den Text vor sich hin.
»Herzlichen Glückwunsch, Herr Stiller!
In wenigen Monaten wechseln Sie aus dem aktiven Berufsleben in den wohlverdienten Ruhestand. Sicher haben Sie auch schon über einen Wohnungswechsel nachgedacht, um den letzten Lebensabschnitt gemeinsam mit Ihrer Gattin in einem zentral gelegenen, komfortablen und barrierefreien Ambiente zu verbringen.«
»Gattin«, unterbrach ihn Ruth. »Wer schreibt denn heute noch so etwas in einem Brief?«
Wer schreibt heute überhaupt noch einen Brief?, dachte Stiller. Die Stadt griff anstelle der elektronischen Post nur noch zu solchen Mitteln, wenn es sich um etwas Ernstes handelte. Laut las er:
»Die Demografiewerkstatt im Seniorenreferat Ihres Rathauses wird Sie gern dabei unterstützen.«
Ruth geriet in Rage. »Letzter Lebensabschnitt. Barrierefrei. Seniorenreferat. Die haben sie doch nicht mehr alle!« Sie fuhr sich mit beiden Händen in die Haare und raufte sie. »Da, schau! Alles noch Natur. Kaum graue Strähnchen. Hier …« Sie legte die Zeigefinger an die Augenbrauen und zog sie hoch. »Siehst du irgendwelche nennenswerten Falten? Ich gehe glatt für zehn Jahre jünger durch, oder?«
»Du siehst super aus.« Stiller betrachtete seine Frau. Egal wie alt, er fand sie attraktiv. Er dachte an Morgenröte, wie er sie im kurzen Nachthemd am Frühstückstisch sitzen sah, die Wangen leicht gerötet, darüber der rostrote Schopf. Dagegen hatte er es nach dem Aufstehen vermieden, sein eigenes Gesicht im Badezimmerspiegel zu genau zu erforschen. Die tiefen Krähenfüße in den Augenwinkeln, das fast weiße Haar, das er umso länger trug, je mehr es ihm oben ausging: Diesen Anblick verband er eher mit dem Begriff Morgengrauen. »Und was sagst du zu mir?«, fragte er.
Sie biss sich auf die Unterlippe und schwieg.
»Na?«
»Ein bisschen abnehmen könntest du ja mal. Und vor allem solltest du die Augenbrauen endlich stutzen.«
Stiller seufzte. Ihre Ehrlichkeit war entwaffnend. Er las weiter.
»Entgegen den damaligen Prognosen hat unsere Stadt in den vergangenen zwei Jahrzehnten ungeachtet ihrer Attraktivität einen bedauerlichen Rückgang der Einwohnerzahl erfahren. Es ist nicht gelungen, die Migrantenpotenziale auszuschöpfen – trotz großer Anstrengungen auf diesem Sektor seitens der Verwaltung. Die Eigenentwicklung der Aschaffenburger Bevölkerung hat ebenfalls nicht ausgereicht. Die Fertilitätsrate liegt seit über zwanzig Jahren deutlich unter der Sterbequote.«
»Vielleicht hätten sie sich auf diesem Sektor etwas mehr anstrengen sollen, die Bürohengste.« Ruth griff nach der Kaffeekanne und füllte ihre Tasse. »An unserer Fertilitätsrate lag es jedenfalls nicht. Wir haben drei Kinder.«
»Aber nur zwei Enkel.«
»Na und? Das kann man ja uns nicht vorhalten.«
»Soll ich den Brief jetzt lesen oder nicht?«
Sie nickte. »Lies ihn.«
»Sinkende Belegungsdichte der Haushalte, wachsende Leerstände in den Wohnquartieren und nicht zuletzt die angespannte Lage der Kommunalfinanzen machen es unmöglich, die nötige Infrastruktur zur Erschließung, Versorgung und Entsorgung aller Stadtviertel zu unterhalten. Besonders betroffen sind der Stadtteil Leider und Ihre Siedlung, die Obernauer Kolonie. Neben der Problemlage Infrastruktur droht hier zugleich eine Gettoisierung von Menschen mit Altershintergrund.«
»Jetzt kommen sie zur Sache. Weiter!«
»Als innovative und nachhaltige Stadtverwaltung stellen wir uns diesen Herausforderungen durch konkrete Antworten. Die Demografiewerkstatt hat das Entsiedelungsprogramm aufgelegt, um den Veränderungen flexibel begegnen zu können. Ziel dieses Stadtentwicklungskonzepts ist es, die betroffenen Stadtteile zu entsiedeln und später zu renaturieren. Die dadurch frei werdenden Bevölkerungspotenziale helfen mit, die Belegungsdichte und eine gesunde Generationenstruktur in den anderen, vom Rückgang weniger betroffenen Stadtteilen zu erhalten.«
»So ein Geschwurbel! Warum schreiben die nicht gleich, dass sie uns hier raushaben wollen?« Die Hand mit der Tasse schnellte in Stillers Richtung, der Kaffee schwappte gefährlich am Rand.
»Ruth!«
»’tschuldigung.«
»Die Anpassung des Immobilienmarktes an die allgemeine Entwicklung hat es der Stadtbau GmbH in den zurückliegenden Jahren ermöglicht, preisgünstigen Wohnraum in attraktiven Lagen zu erwerben und bedarfsgerecht zu renovieren. Die Wohneinheiten sind großzügig und barrierefrei gestaltet. Kurze Wege zu den Nahversorgungszentren versprechen gerade älteren Menschen mit eingeschränkter Mobilität ein Höchstmaß an Selbstständigkeit.«
»Die tun ja so, als sitzen wir schon im Rollstuhl. Vorn, in der Helenenstraße, die Engels, die sind schon über achtzig und fahren noch täglich mit dem Auto zum Einkaufen.«
Stiller ignorierte Ruths Zwischenruf.
»Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Schreiben ein für unser aller Zukunft bedeutendes Angebot zu unterbreiten. Mit Beginn des Ruhestands steht es Ihnen frei, Ihr Eigenheim gegen eine städtische Wohneinheit Ihrer Wahl zu tauschen. Da es sich durchweg um hochwertige Immobilien handelt, sollten Wertverluste für Sie ausgeschlossen sein. Andernfalls werden sie finanziell ausgeglichen. Ebenso übernimmt das Seniorenreferat alle Kosten, die Ihnen im Zusammenhang mit Vertragsangelegenheiten, Beurkundung, Ummeldung und Umzug entstehen.«
»Wertverlust!« Ruth lachte laut. »Unser Häuschen ist unbezahlbar. Die reden nur vom Geld. Für mich sind ganz andere Werte entscheidend. Der Erinnerungswert zum Beispiel, wer ersetzt uns den? Wir leben hier seit vierzig Jahren, die Kinder sind hier groß geworden.«
»Das stimmt.« Stiller sprach, ohne den Blick vom Brief zu lösen. »Aber hast du nicht neulich selbst gesagt, das Haus sei viel zu groß für uns beide, seit die Kinder ausgezogen sind?«
»Neulich? Das ist zehn Jahre her. Inzwischen hab ich mich dran gewöhnt. Überhaupt«, sie runzelte die Stirn, »zu wem hältst du eigentlich?«
»Ich halte zu niemandem. Ich lese nur vor.«
»Die bebilderte Auswahl der geeigneten Wohneinheiten ist im Internet unter www.demografiewerkstatt.de aufgelistet. Unter dieser Adresse finden Sie auch alle nötigen Onlineformulare, die Sie bei Interesse bitte ausfüllen. Für persönliche Beratungsgespräche stehen Ihnen unsere Servicemitarbeiter im Seniorenbüro, Pfaffengasse 9, zur Verfügung.«
Diesmal sah Stiller auf. »Ich werde keinen Fuß in einen Laden setzen, über dessen Tür ›Seniorenbüro‹ steht.«
Ruth schnitt ihm eine Grimasse. »Meinst du, ›Menschen mit Altershintergrund‹ macht es besser? Lies fertig, es fehlt nicht mehr viel.«
»Alle Interessenten nehmen an einem einmaligen Wellness-Gewinnspiel teil, gesponsert von der Bundesstiftung gesund-altern-in.de. Wenn Sie sich zur Teilnahme am Entsiedelungsprogramm entschließen, erwartet Sie außerdem ein exklusives Geschenk …«
»Weißt du, was das für ein Geschenk ist?«
Stiller schüttelte den Kopf.
»Ein Rollator.«
»Blödsinn.«
»Doch. Ich weiß das von Frau Fischer gegenüber. Die lässt sich entsiedeln.«
»Du willst mich auf den Arm nehmen.«
»Ich?« Wieder lachte Ruth. »Paul, die wollen dich auf den Arm nehmen. Ein Rollator dafür, dass wir hier wegziehen. Die wollen uns raushaben, das ist alles.«
Stiller sah sie nachdenklich an. »Ist ja schon was Wahres dran. Wenn die Fischer wegzieht, sind wir die Einzigen, die am Legatplatz übrig bleiben. Im Rest der Kolonie sieht es nicht viel besser aus. Und die paar Häuser, in denen noch jemand wohnt? Wir sind hier nur noch zwei von fünf. Im Haus von Engels haben mal elf Leute gewohnt, drei Generationen unter einem Dach. Jetzt sind nur noch die beiden übrig.«
»Mich kriegt hier keiner raus«, beharrte Ruth. »Es sei denn, mit den Füßen zuerst.«
»Die Demografiewerkstatt meint es doch nur gut …«
»Meint es gut?«, unterbrach ihn Ruth. »Was hat die Demografiewerkstatt denn schon groß getan? Von wegen ›entgegen den damaligen Prognosen‹. Die haben das vor zwanzig Jahren genau vorhergesehen – und alles nur schöngeredet. Deine Zeitung übrigens auch.«
»Ruth, das ist zwanzig Jahre her«, wandte Stiller ein.
»Du musst etwas unternehmen. Schreib einen Artikel, mach sie fertig!« Sie schob die Unterlippe vor und blies sich eine Haarsträhne aus der Stirn, wie so oft, wenn sie aufgebracht war. »Die Stadt muss dieses Entsiedelungsprogramm stoppen!«
Stiller biss sich auf die Unterlippe. Der Beitrag, an dem er gerade arbeitete – er sollte genau das Gegenteil bewirken: bei den Betroffenen um Verständnis für das Programm werben. Bausback hatte ihm das aufs Auge gedrückt, nachdem die Demografiewerkstatt bei ihm angerufen hatte. Sie brauche Rückenwind, nach anfänglichen Erfolgen gebe es »unerwartete Widerstände« gegen die Entsiedelung. Ruth war nicht die Einzige, die sich dem Druck nicht beugen wollte.
»Ruth«, setzte er an, doch seine Armbanduhr unterbrach ihn.
»Acht Uhr dreißig, Paul.« Aus dem kleinen Lautsprecher klang die Stimme wie durch Watte. »Du musst los.«
Stiller sah auf seine Smartwatch. »Du hörst es«, sagte er zu Ruth, »ich muss los, sei mir nicht böse. Lass uns heute Abend darüber reden.«
»Ja, drück du dich nur«, brauste Ruth auf. Dann besann sie sich und drückte Stiller zum Abschied.
Stiller zog die Haustür zu und hob das Handgelenk. »Hallo, Schlaumeier«, sagte er zur Smartwatch.
»Hallo, Paul«, kam es zurück.
»Gibt es Regen heute?« Misstrauisch betrachtete er den Himmel, den ein leichter Grauschleier bedeckte. Die letzten Tage waren ungewöhnlich trocken und höllisch heiß gewesen, üblicherweise folgte auf eine solche Periode ein heftiges Gewitter. »Starkregen« war der Standardausdruck dafür geworden.
»Regenwahrscheinlichkeit für Aschaffenburg: null Prozent.«
Also gut, er würde das Fahrrad nehmen. »Danke, Schlaumeier.«
»Du hast ungelesene Nachrichten.«
»Später erinnern!« Stiller tippte auf die Uhr, das Display zeigte wieder die Zeit.
Vor zwanzig Jahren – die Wörter ließen Stiller nicht los, während er durch die Obernauer Kolonie radelte. Ruth hatte recht, die Bevölkerungsentwicklung war vor zwanzig Jahren durchaus erkennbar gewesen. Es hatte jede Menge Experten gegeben, die vor dem demografischen Wandel gewarnt hatten. Aber den Menschen waren damals andere Ereignisse wichtiger.
Er versuchte, sich in diese Zeit zurückzuversetzen. Das lenkte ihn ab. Vielleicht war es auch nur eine Alterserscheinung, in der Vergangenheit zu kramen. Was war los gewesen, vor zwanzig Jahren? Sicher hatte er noch keine Rückenschmerzen, dachte Stiller, dem es auf dem Rad spürbar besser ging. Dass Leute mit ihren Armbanduhren sprachen, ging damals gerade erst los, es war aber schon üblich, das Handy oder iPhone nach dem Wetter zu fragen. Die Eurokrise kam ihm in den Sinn. Griechenland, Spanien und Zypern standen damals am Abgrund, Italien und Portugal dicht hinter ihnen. In Deutschland hatte eine Große Koalition die schwarz-gelbe Regierung abgelöst – die waren in Berlin viel zu sehr mit sich selbst und der Energiewende beschäftigt, um ernsthaft über den demografischen Wandel nachzudenken.
Da war noch was. Es hatte nichts mit der großen Politik zu tun. Er erinnerte sich an die Fußball-WM in Brasilien, aber den Sport hatte es nur am Rande betroffen. Irgendeine Sache hatte vor zwanzig Jahren in Aschaffenburg für Aufsehen gesorgt. Allmählich fiel es ihm wieder ein, schließlich hatte ihm diese Sache damals eine berufliche Niederlage beschert: der Mord im City-Parkhaus.
* * *
Stefan Rohm tritt auf das oberste Parkdeck hinaus. Es hellt schon auf, neben dem Parkhaus schiebt sich der Büroturm der City-Galerie in den blassen Morgenhimmel. Der Turm ist eines der höchsten Gebäude in der Stadt, die Hochhäuser immer vermieden hat. Nichts darf die Basilika überragen, auch nicht das sandsteinverkleidete Rathaus, das nach dem Krieg in ihrem Schatten entstanden ist. Das Stift ist die kirchliche Krone Aschaffenburgs, auf dem höchsten Punkt der Altstadt errichtet. Der Büroturm der City am anderen Ende des Zentrums ist dagegen die Krönung des Kommerzes. Er steht für den Sündenfall, schon als typische Bausünde der frühen siebziger Jahre.
Rohm lässt seinen Blick zum Schloss Johannisburg gleiten, das mit dem Stift und dem City-Turm ein Dreieck bildet. Auch das Schloss ist ein Symbol, es spiegelt den vergangenen Glanz der weltlichen Macht Aschaffenburgs. Über Jahrhunderte war es die Sommerresidenz der Mainzer Erzbischöfe, der mächtigsten Kurfürsten deutscher Nation. Jetzt ist der Glanz verblichen, die nächtliche Beleuchtung längst abgeschaltet. Schattenhaft schwebt die Silhouette der Schlosstürme in der Morgendämmerung über den Dächern der Stadt.
Darüber ringt die Nacht mit der aufgehenden Sonne. Blinzelnd morsen die Sterne letzte Lebenszeichen herab, bevor das Licht sie verschlingt. Rohm liebt die blaue Stunde hier oben unter dem freien Himmel, diese Augenblicke zwischen Dunkelheit und Tag. Es sind unwirkliche Augenblicke, die zwar die Konturen der Gebäude und Bäume aus der Schwärze schälen, nicht aber ihre Farben. Für wenige Minuten verlöschen auch alle Geräusche, schweigt die Stadt, setzt ihr Herzschlag aus, holt sie Luft.
Zum Luftholen ist er hier. Rohm schaut auf die Armbanduhr, es ist vier und dämmert schon. Er überquert das Parkdeck, das um diese Uhrzeit fast leer steht. Er will zur Brüstung an der Goldbacher Straße. Als er sie erreicht, beugt er sich darüber und sieht hinab. Neun Ebenen unter ihm liegt die Straße. Tagsüber ist sie eine Hauptschlagader der Stadt, jetzt ist ihr das nicht anzumerken. Kein Auto ist unterwegs, der Berufsverkehr lässt noch auf sich warten. Himmlische Ruhe herrscht in der Schlucht, in der vor einer Stunde noch die Hölle tobte.
Die Goldbacher Straße ist für Fußballfans die Feiermeile der Stadt und der Kreisverkehr an der City-Galerie die Zentrifuge der Party, das Auge des Zyklons. Alle zwei Jahre, bei den Welt- und Europameisterschaften, schieben sich die Autokorsos durch die Goldbacher, am Kreisel vorbei, lassen die Staus in die Straßen hineinwachsen, die hier münden, bis nichts mehr geht und der Verkehr im gesamten Stadtzentrum zusammenbricht. So ein Halligalli! Hupen hallen, Jugendliche jubeln und schwenken Fahnen aus den Fenstern der Fahrzeuge. Die Menschenmenge drängt sich auf dem Kreisel, kreischt, brennt Knaller ab und trampelt alles nieder, was die Stadt in den zwei Jahren dazwischen verzweifelt hochpäppelt.
Irgendwann hat sich das so eingebürgert. Die meisten, die mitmachen, haben nicht einmal Ahnung von Fußball. Vor zwei Jahren hat Rohm nach einem Spiel eine grölende Gruppe im Parkhaus angesprochen und gefragt, wer denn gewonnen habe, aber niemand konnte es ihm sagen. In Aschaffenburg leben hundertzwanzig Nationen. Irgendeine gewinnt immer und liefert den Grund zum Partymachen.
Dass manche Spiele der deutschen Elf bei der WM in Brasilien hierzulande erst um Mitternacht enden, wie heute, hat nichts geändert. Ab halb eins ging’s da unten rund wie üblich. Rohm hat nicht den blassesten Schimmer, wer der Gegner war. Er hat mit Fußball nichts am Hut und als Mitarbeiter der Parkhaus-Security ohnedies keine Zeit, sich während des Dienstes vor den Fernseher zu setzen. Für ihn ist die aufgeputschte Menge direkt vor dem City-Parkhaus in erster Linie ein Sicherheitsproblem.
Rohm schnauft verächtlich. Das City-Management hat für die Dauer der WM als Verstärkung ein paar schwarze Sheriffs aus dem Ruhestand zurückgeholt. Jetzt schickt es die alten Hasen da unten an die Parkhausfront, während es ihn auf die Oberdecks befördert hat. Dabei hat er mit seinen fünfundzwanzig bestimmt einen besseren Draht zu den Jugendlichen. Zugegeben, es macht ihn neidisch, wenn die Alten in der Umkleide die Storys erzählen von den angetörnten Pärchen, die in den dunklen Ecken knutschen oder fummeln oder mehr, und von den blonden Tussen, die sich in der Hitze der Nacht und der Party fast alles vom Leib reißen. Andererseits hat er auch wenig Lust, sich von Besoffenen anpöbeln zu lassen, wenn er sie daran hindern will, in den Parkhauseingang zu pinkeln oder, noch schlimmer, zu kotzen.
Einen Vorteil hat die WM in Brasilien: Höchstens zwei Stunden dauert es nach dem Spiel, dann ist der Zauber auf der Straße vorbei. Es macht halt weniger Spaß, wenn es keine Passanten gibt, die verzweifelt versuchen, sich durch das Gedränge zu quetschen, und wenn der Verkehr fehlt, den der Korso behindern könnte. Vielleicht liegt es auch daran, wie die Deutschen spielen, dass die Party so schnell aus ist. Aber das glaubt Rohm nicht – die meisten haben doch von Fußball so viel Ahnung wie er.
Mit den Feiernden sind vor einer guten Stunde auch die Aushilfssheriffs abgezogen. Im Augenblick hat er das gesamte Parkhaus für sich allein, ein Kumpel ist im Einkaufszentrum unterwegs. Zwei Stunden noch, dann beginnt die neue Schicht.
Etwas reißt Rohm aus seinen Gedanken. Es hat geblitzt, zwei-, dreimal, irgendwo unter ihm. Er hat das Blitzen selbst nicht sehen können, aber in den Fenstern des Wohnsilos auf der anderen Straßenseite den leichten Lichtreflex wahrgenommen. Er beugt sich noch weiter über die Brüstung, so weit, wie es das Gitter zulässt, das Lebensmüde vom Springen abhalten soll, und schaut an der Fassade des Parkhauses hinab. Er sieht nichts, nichts Auffälliges oder Ungewöhnliches.
Schräg unter ihm liegt der Seitenausgang zur Goldbacher Straße. Da bewegt sich etwas. Eine Gestalt verlässt das Parkhaus, ein Schatten nur, schaut rasch nach beiden Seiten und geht dann Richtung Feierkreisel davon. Rohm sieht die Gestalt nur von oben. Er meint, es ist ein Mann. Er meint, er ist blond. Aber es liegen neun Parkhausebenen zwischen ihnen, und die Gestalt läuft schnell. Auf der Höhe vom früheren »Oscar«, das inzwischen »O-19« heißt, verschwindet sie aus seinem Blickfeld. Rohm weiß nicht, ob sie in die Elisenstraße zum Bahnhof abgebogen oder weiter in die Stadt gelaufen ist. Er kneift die Augen zusammen, um besser sehen zu können, aber die Straße ist wieder leer.
Er schaut noch einmal hinunter zum Seiteneingang. Niemand sonst ist zu sehen. Er überlegt. Wo ist der Mann hergekommen, wenn es einer war? Rohm hat kein Auto durchs Parkhaus fahren hören. Er hört das in den stillen Morgenstunden über drei, vier Ebenen hinweg. Vielleicht hat jemand weiter unten geparkt. Aber es ist auch kein Auto ins Parkhaus hineingefahren, jedenfalls nicht, seit er hier an der Brüstung steht. Wer in das City-Parkhaus will, muss durch die Goldbacher Straße, er hätte das mitbekommen.
Hat sich jemand an den geparkten Autos zu schaffen gemacht? Unwahrscheinlich. Alle Ebenen sind videoüberwacht, die Kameras liefern die Bilder direkt in die Zentrale im Büroturm, die immer besetzt ist. Rohm löst das Funkgerät vom Gürtel. »Zentrale von S 1«, sagt er, »bitte kommen.«
Das Funkgerät knarzt. »Zentrale hier. Kommen.«
»Eben ist wer aus Eingang zwo auf die Goldbacher raus. Einzelne Person, ziemlich eilig. Hast du jemand auf dem Schirm gehabt?«
»Fehlanzeige.«
»Sicher?«
»Glaubst du, ich penne?«
»Natürlich nicht.« Rohm weiß jedoch, wie schwierig es ist, alles im Blick zu behalten. Es gibt elf Monitore, für jedes Deck einen. Aber nachts schaltet die Zentrale mehrere Decks auf einen Monitor, entsprechend klein sind die Bilder. »Ich frag ja nur, weil definitiv jemand raus ist.«
»Und ich habe definitiv niemand gesehen. Mach lieber deinen Rundgang, statt da oben rumzuhängen«, kommt es im Offizierston zurück. »Ich hab schon gedacht, du wolltest springen. Ende.«
»Ende von S 1.« Rohm schiebt das Funkgerät wieder in die Lasche am Gürtel. Er schaut noch einmal zum Seiteneingang hinunter, dann dreht er sich um und lehnt sich gegen die Brüstung. Wenn der Unbekannte wirklich auf keinem Parkdeck war, kann er sich nur im Treppenhaus aufgehalten haben. Die Stiege ist nicht überwacht, weil am Seiteneingang keine Kassenautomaten stehen. Es gibt da unten nur die Knopfkamera der Gegensprechanlage für Notfälle, die schaltet sich aber erst ein, wenn jemand die Ruftaste drückt.
Was will einer im Treppenhaus? Vielleicht knutschen, sagt sich Rohm und spürt ein leichtes Kribbeln. Aber dazu gehören zwei. Also eher pinkeln. War vielleicht auf dem Heimweg von einer WM-Fete, zu viel Bier, hält es nicht mehr aus … Doch die Straße war leer. Da hätte der schmale Pflanzstreifen am Parkhaus auch gereicht für jemand, der sich erleichtern will.
Außerdem war da noch etwas. Das Blitzen! Es hat geblitzt, und das muss etwas mit dem Unbekannten zu tun haben. Rohm geht zum Treppenhaus, das zum Seiteneingang hinunterführt. Er wird nachsehen.
* * *
Stiller war froh, als er das Zentrum hinter sich hatte. Die Stadt hatte das Radwegenetz gehörig ausgebaut, gleich nach der Fertigstellung der Ringstraße, damals ein Jahrhundertereignis, das nun auch schon wieder über zwei Jahrzehnte zurücklag. Dennoch war die Fahrt durch die Innenstadt für ihn als Fahrradfahrer zum Abenteuer geworden. Vielleicht lag es daran, dass er ins Rentenalter kam, ganz sicher aber hatte es damit zu tun, dass er in einer anderen Zeit groß geworden war. Früher hatte ihn das Motorengeräusch gewarnt, wenn sich von hinten oder aus einer Seitenstraße ein Auto näherte. Heute tauchten die E-Mobile völlig unerwartet auf, sausten fast lautlos vorbei und machten es den Radlern unmöglich, die Fehler der Autofahrer rechtzeitig zu bemerken.
In der Straße durch das Industriegebiet an der Aschaff schien noch alles wie einst. Dröhnende Lastzüge drängten sich vor den Speditionen und der Wellpappenfabrik. Ihre Zahl hatte trotz des Einsatzes der Gigaliner kaum abgenommen. Und Brennstoffzellen leisteten sich nur die deutschen Logistikunternehmen. Die osteuropäischen bevorzugten Biodiesel oder synthetischen Sprit. Die grauen Abgaswolken schienen umso stärker zu riechen, je seltener sie im übrigen Verkehr geworden waren. Stiller dachte an Feinstaub und hielt den Atem an, während er sich durch die Kette der Transportriesen schlängelte und schließlich aufs Verlagsgelände abbog.
Der Parkhausmord war Stiller während der Fahrt nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Die Kripo hatte den Fall damals abgeschlossen, doch für ihn war die Sache nie richtig aufgeklärt gewesen, so viel wusste er noch. An die Details erinnerte er sich kaum, wohl auch, weil er nicht darüber hatte berichten dürfen. Bausback hatte das verhindert.
Lag der Mord wirklich genau zwanzig Jahre zurück? Dann wäre das ein schöner Anlass, den Fall aus dem Archiv zu kramen und die Leser daran zu erinnern. Bausback liebte derartige Rückblicke. Sie seien »kompetenzrelevant« für die lokale Presse, wie er es nannte. Kein anderes Medium sei in der Lage, vergangene Ereignisse aus der Region vergleichbar umfassend und fundiert aufzuarbeiten, egal ob auf Papier, in der Online-Ausgabe oder auf den diversen Endgeräten.
Stiller gab ihm recht. Schließlich war das Zeitungsarchiv einmalig – digital oder, ja, das existierte noch, auf Papier. Wenn sich daraus Kapital schlagen ließ durch vermehrte Zugriffe auf die unterschiedlichen Netzprodukte und die gedruckte Ausgabe, die immerhin noch zweimal pro Woche erschien – warum nicht? Dennoch war er skeptisch, ob er Bausbacks Zustimmung bekommen würde, den alten Fall neu aufzurollen. Vielleicht konnte er das Gespräch noch etwas hinauszögern, um sich eine Strategie zu überlegen. Andererseits: Was sprach dagegen? Er hatte nicht vor, sich in irgendwelche Ermittlungen einzumischen, er wollte nur auf einen längst abgeschlossenen Fall zurückblicken.
Der Fahrradparkplatz am Verlagshaus war mit Pedelecs und E-Bikes überfüllt, ein paar von ihnen hingen an der Stromzapfsäule. Stiller schob sein altes Gudereit-Modell dazwischen. Wenn es regnete, sah es hier anders aus. Der junge Juni bescherte der Stadt einen Frühsommer wie aus dem Bilderbuch, seit Jahren hatte es das nicht mehr gegeben. Die Sonne hatte den üblichen Grauschleier vom Himmel gebrannt, der jetzt tiefblau glänzte. Stiller hatte Schweißflecken unter den Achseln. Die anderen Radler sahen bestimmt nicht anders aus, tröstete er sich.
»Sie haben wieder nicht abgeschlossen«, begrüßte ihn der Pförtner vorwurfsvoll. Der Mann war der lebende Beweis, dass sich manche Dinge einfach noch nicht online über Smartphones und Uhren abwickeln ließen.
»Der alte Bock kommt bestimmt nicht weg«, gab Stiller zurück. »Schon gar nicht unter Ihren wachsamen Augen. Ist der Häuptling schon oben?«
»Welcher?« Der Pförtner setzte eine unschuldige Miene auf.
Bausback hatte die zurückliegenden Reformen genutzt, um vor allem eine Abteilung auszubauen: die Chefredaktion. Immerhin hatte er für eine ausreichende Auswahl an Nachfolgern gesorgt, wenn er in drei Jahren ausscheiden würde.
»Der Häuptling«, feixte Stiller.
»Ach der. Nö, heute noch nicht gesehen.«
Stiller verkniff sich ein »Gut«, steuerte aber sichtlich beschwingt den Newsroom an. Wenn Bausback nicht im Haus war, musste er nicht gleich mit der Idee herausrücken, einen Rückblick auf den Parkhausmord zu schreiben. Er würde sich erst einmal in Ruhe die nötigen Infos im Archiv zusammenklauben.
Im Newsroom standen die Fenster auf Durchzug und die meisten Deskplätze leer. Immer mehr Producer arbeiteten von zu Hause aus. Stiller hasste das Homeoffice und die Online-Konferenzen, zumal er zu Hause kein ausreichend schnelles Netz hatte. Die Obernauer Kolonie war für die Telekommunikationsunternehmen ein hoffnungsloser Fall, sie würde nie ein Glasfasernetz bekommen. Wie war das gleich? »Wachsende Leerstände in den Wohnquartieren und die angespannte Lage der Kommunalfinanzen machen es unmöglich, die nötige Infrastruktur zu unterhalten«, zitierte er den Brief der Stadt.
Jemand hinter ihm unterbrach ihn: »Was sagst du? Redest du wieder mit dir selbst?«
»Nein.« Stiller drehte sich verlegen um. Er hatte Kleinschnitz sofort erkannt. »Du hörst Stimmen.«
»Das wäre mir neu. Jedenfalls, wenn es um Stimmen geht, die von Kommunalfinanzen und Infrastruktur faseln.« Kleinschnitz saß lässig auf einer Tischkante und spielte mit einer Kamera herum. Er war älter als Stiller, hatte aber noch ein paar Berufsjährchen drangehängt – für die Bonusrente. Angeblich könne er sich sonst sein Hobby nicht leisten: Er fuhr noch immer seinen Buick, der inzwischen klappriger wirkte als er selbst. Kleinschnitz hatte den Oldtimer zwar für Biosprit umrüsten lassen, doch auch der war sündhaft teuer – wie alles, was einfach nur verbrannt wurde, um Energie zu erzeugen. Auch die Ersatzteile waren kaum noch legal zu bekommen und erst recht nicht zu bezahlen.
Veit, der Blattmacher am Regiodesk, winkte Stiller zu sich. »Hab ich da was von Infrastruktur gehört? Du, also wenn es um deinen Beitrag über den Stand des städtischen Entsiedelungsprogramms geht – den könnte ich echt gut gebrauchen.« Kollegial legte er Stiller die Hand auf die Schulter. »Schreibst du schon mal den Teaser fürs Netz?«
Stiller schluckte. Er hatte die Wahl, es sich mit der Redaktion zu verderben oder mit Ruth. Er entschied sich für die Redaktion, mit der teilte er nachts nicht das Bett. »Ich glaube, ich muss das Thema abgeben«, sagte er. »Ich stecke da plötzlich mit drin. Das kommt nicht gut an.«
Schlagartig sank die Laune des Blattmachers, seine Hand verwandelte sich in eine Klaue, die sich in Stillers Schulter krallte. »Das kommt nicht gut an«, äffte er ihn nach. Stiller kannte ihn, seit er als Volontär zur Zeitung gekommen war. Jetzt hatte er es weit nach oben geschafft und sah auf die älteren Kollegen herab. »Weißt du, was nicht gut ankommt? Wenn jemand seine Themen nicht abliefert, das kommt nicht gut an.«
Am Nachrichtentisch hoben sich ein paar Köpfe und drehten sich in ihre Richtung.
»Ich versteh schon, was du meinst«, sagte Stiller freundlich. Erfolglos versuchte er, mit einem Schulterzucken die Hand des Blattmachers abzuschütteln. »Aber ich muss passen, Veit. Ich schreibe keine Beiträge in eigener Sache.« Er zögerte. »Dafür hab ich vielleicht ein anderes Projekt.«
»Und das wäre?« Veit ließ den Blick über die Häupter der Producer schweifen, die sich rasch wieder ihren Bildschirmen zuwandten.
»Ich muss das zunächst mit Bausback besprechen.« Stiller trat den Rückzug an.
»Der kommt heute erst später.«
Stiller breitete entschuldigend die Arme aus.
»Und wie, bitte, füttern wir hier die Kanäle?« Der Blattmacher lockerte den Klammergriff. »Ich brauche was Spannendes.«
»Du hast doch noch meinen Beitrag über die Kommunalfinanzen. Also ich find den spannend.«
Kleinschnitz brach in heftiges Husten aus.
Veit warf ihm einen angeekelten Blick zu. »Jetzt kommen die schon zum Sterben hierher«, grummelte er. »Und was die Kommunalfinanzen betrifft: Solche Beiträge sind die Sargnägel für unser modernes Medienhaus. Du bist Reporter, schau zu, dass du mit einer ordentlichen Story rüberkommst.« Seine Klaue öffnete sich vollends, wurde wieder zur Hand, die Stiller mit einem gnädigen Winken entließ.
Im Flur beruhigte sich Kleinschnitz wieder. »Kommunalfinanzen, spannend … Und dich hat man früher mal als Themensau bezeichnet. Du hast was anderes vor, stimmt’s? Raus mit der Sprache, was ist das für ein ominöses Projekt?«
Stiller sah ihn von der Seite an. »Erinnerst du dich noch an den Parkhausmord?«
»Parkhausmord?« Kleinschnitz runzelte die Stirn, was ihm, ähnlich wie Stiller, nicht sonderlich schwerfiel. »Da klingelt was. Aber das ist doch ewig her.«
»Zwanzig Jahre. Glaub ich. Wär doch eine gute Gelegenheit für einen Rückblick.«
Kleinschnitz pfiff durch seine großen Zähne. »Verstehe, du willst dich revanchieren. Natürlich erinnere ich mich! Bausback hat dich damals nicht rangelassen an die Story. Hat dir die schöne Fenia vorgezogen. Ach …« Er blieb stehen und hielt Stiller nun auch an der Schulter fest, die noch vom Klammergriff des Blattmachers schmerzte. »… sicher musst du diese gute Gelegenheit nutzen, um dich mal bei ihr zu melden, was?«
»Du klingst wie ein eifersüchtiges Schulmädchen. Ich will mich nicht bei Fenia melden, ich brauche deinen iScreen in eurem verschwiegenen Fotografenbüro.«
Kleinschnitz setzte sich wieder in Bewegung. »Paul, der Fall war damals abgeschlossen. Und er war ziemlich widerlich, soweit ich noch weiß. Lass die Toten ruhen.«
»Meine Güte, ich will mich doch nur mal informieren.«
»Na gut.« Kleinschnitz schob Stiller ins Fotografenbüro. »Ist mir eh lieber, du wühlst in der Vergangenheit herum, statt dich in neue Eskapaden zu stürzen. Hier, du kannst meinen Stuhl haben.«
Stiller ließ sich in den Bürosessel fallen und sah für das Screening den Bildschirm an, als wolle er ihn sprengen.
»Guten Morgen, Paul Stiller«, begrüßte ihn eine warmherzige Männerstimme aus dem Lautsprecher. »Angenehm, Sie hier wieder einmal zu begrüßen.«
»Ich bin auch dabei.« Kleinschnitz stützte die Ellbogen auf die Rückenlehne des Sessels.
»Enchanté, Monsieur Petäär«, kam die Antwort.
Stiller schaute Kleinschnitz fragend an. »Ich brauche eine Weile. Wenn du Termine hast …«
Kleinschnitz zuckte die Schultern. »Du glaubst ja wohl nicht, dass ich euch beide allein lasse.«
Stiller seufzte und drehte sich zum Bildschirm zurück. »Intranet«, sagte er. »Archiv.«
2
Die Tür fällt knallend zu und sperrt die blasse Morgendämmerung aus. Im Treppenhaus brennt das grelle Neonlicht. Unbarmherzig entblößt es die Risse und Macken, die Flecken und Graffitis an den Wänden, wie Wunden, die Zeit und Besucher in den gelblichen Ölputz geschlagen haben. Sie sollten das Licht dimmen, sagt sich Stefan Rohm, während er abwärtssteigt.
Je weiter er nach unten kommt, desto schäbiger wird auch der Plattenbelag der Treppe. Die Putzkolonne rückt erst um sechs an, überall kleben daher noch die Reste der nächtlichen Fußballparty, Kaugummis und verstreute Pommes zwischen Pfützen aus Bier und Kotze. Zerknüllte Hamburgertüten liegen herum, Scherben zerschlagener Flaschen.
Rohm lässt sich Zeit. Er trödelt nicht, er hat es aber auch nicht eilig. Auf jedem Treppenabsatz hält er kurz inne und lauscht. Das Parkhaus ist still, kein Geräusch dringt von den Parkdecks ins Treppenhaus. Als ob ihn etwas zurückhält, den Ausgang ganz unten zu erreichen, öffnet er auf Ebene eins die Stahltür und lässt den Blick über das Deck schweifen. Nichts. Er wartet, bis auch diese Tür wieder zugefallen ist. Im Weitergehen prüft er die Laschen seines Gürtels. Der Gummiknüppel, die Taschenlampe, das Funkgerät – alles sitzt. In der Brusttasche seiner schwarzen Uniformjacke steckt sein Handy, in der Seitentasche – griffbereit – ein Pfefferspray. Das ist nicht erlaubt, aber alle nehmen es mit. In letzter Zeit häufen sich Übergriffe von Randalierern auf die Mitarbeiter der Sicherheits- und Ordnungsdienste, sogar auf Polizeibeamte.
Rohm biegt um die letzte Ecke und sieht die Frau.
Sie sitzt auf den braunen Platten des Fluchttreppenhauses, ihr Rücken lehnt an der Wand neben der Tür. Sie wirkt jung, auch wenn Rohm von oben ihr Gesicht nicht sehen kann, sondern nur auf ihr zerzaustes blondes Haar schaut, weil ihr Kopf nach vorn gesunken ist. Er denkt, vielleicht hat sie sich da hingesetzt, um sich kurz auszuruhen, weil sie müde war oder betrunken. Und dann ist sie eingeschlafen.
Er ruft: »Hallo! Hör’n Sie?« Und lauter: »Aufwachen!«
Aber alles, was er sieht, sagt ihm, dass sie nicht schläft. Sie trägt ein Fußball-T-Shirt, das vom Halsansatz bis zur Taille aufgerissen ist und ihren Busen sehen lässt. Kleine, feste Brüste. Sie sind bleich, bläulich gefärbt, ebenso wie die Arme und die Beine der Frau. Die nackten Beine sind über den Boden ausgestreckt, gespreizt. Der Slip, heruntergezogen, hängt an einem Fußknöchel. Der Minirock ist hochgeschoben. Zwischen den Schenkeln liegt ihre linke Hand, unnatürlich, auffällig, als hätte sie jemand absichtlich da hingelegt. An der Hand blinkt etwas im Neonlicht, Rohm kann es nicht genau erkennen.
»Hallo!« Seine Stimme hallt im Treppenhaus. Die Frau regt sich nicht.
Vorsichtig steigt Rohm die letzten Stufen hinab, passt genau auf, wohin er tritt. Er weiß, dass er keine Spuren zerstören darf, obwohl er in den sechs Jahren bei der Security noch nie eine Leiche hatte. Aber er braucht Gewissheit.
Er beugt sich über die Frau, legt seinen Mittelfinger auf ihre Halsschlagader. Kein Puls. Rohm hat auch keinen erwartet, für ihn ist die Frau tot. Unübersehbar sind aus der Nähe die violetten Striemen oder Würgemale am Hals. Er beugt sich tiefer, schaut in ihr Gesicht. Auch ihr Gesicht wirkt jung, trotz des verzerrten Mundes und der weit aufgerissenen, starren Augen, die die verschmierte Wimperntusche noch größer erscheinen lässt. Der Anblick erschreckt ihn, Rohm fährt jäh zurück.
Ein paarmal atmet er tief ein und aus, die Hände auf die Knie gestützt, bevor er sich aufrichtet und sein Handy aus der Brusttasche zieht. Er wählt den Notruf und verständigt die Polizei. Dann sagt er über Funk in der City-Zentrale Bescheid.
Er steht mitten in dem kleinen Vorraum des Seitenausgangs, genau zwischen der Treppe und der Tür. Er beschließt, hier auf die Polizei zu warten. Hier kann er am wenigsten Schaden anrichten und am besten verhindern, dass jemand Fremdes hereinstolpert. Vor ihm sitzt die tote Frau. Rohm schaut auf ihre Schenkel. Ihn fröstelt.
* * *
Während Stiller mit dem Finger über den Bildschirm wischte und die Texte im digitalen Archiv durchsah, standen ihm die einstigen Zeitungsartikel vor Augen, als hätte er sie erst gestern gelesen. Der erste Beitrag stammte ohnedies zum Teil von ihm selbst, weil Bausback da noch keine Gelegenheit gehabt hatte, ihn von der Berichterstattung abzuziehen.
Die Leiche der jungen Frau war am Morgen gefunden worden, gegen halb fünf. Die Spurensicherung war eingetroffen, als sich das Parkhaus gerade mit den ersten Einpendlern zu füllen begann. Der Auftrieb am Seiteneingang in der Goldbacher Straße war nicht zu übersehen gewesen. Kurz und gut, irgendein treuer Leser hatte sich der Presse besonnen und Stiller aus dem Bett geklingelt. Der hatte beim Losradeln Kleinschnitz verständigt.
Sie waren fast gleichzeitig angekommen. Statt ins Parkhaus zu fahren, hatte Kleinschnitz seinen Buick einfach mit Warnblinkanlage auf dem Mittelstreifen der Goldbacher abgestellt, da war wegen der WM-Partys ohnedies alles niedergetrampelt.
Hauptkommissar Johannes Strobel war mit der Spurensicherung am Fundort der Leiche. Er war wenig erfreut gewesen, die beiden Journalisten zu sehen, die sich wiederholt in Mordermittlungen eingemischt hatten. Uniformierte Beamte hatten bereits eine Absperrung gezogen, Stiller und Kleinschnitz mussten mit den Schaulustigen hinter dem rot-weißen Flatterband bleiben.
Informationen hatte es erwartungsgemäß noch nicht gegeben. Auch Mike Staab, Strobels Mitarbeiter, mit dem sich Stiller bis heute hin und wieder im Schachcafé traf, war damals äußerst zugeknöpft – über das Maß hinaus, das in diesem frühen Stadium einer Ermittlung üblich ist. Er hatte lediglich bestätigt, dass es sich um eine weibliche Leiche und vermutlich um eine Gewalttat handelte. Der Täter sei flüchtig. Kein Wort zum möglichen Alter und zur Identität der Toten, nichts über die näheren Umstände der Gewalttat – erschossen, erschlagen, erdrosselt? –, auch nicht unter dem Vorbehalt der späteren Obduktion. Stiller hatte aus dieser Verschwiegenheit geschlossen, dass ein Sexualdelikt mit im Spiel war.
Die Leiche hatten sie ebenfalls nie zu Gesicht bekommen. Kleinschnitz hatte versucht, über eines der oberen Parkdecks durch das Treppenhaus in den Vorraum zu gelangen, aber die Zugänge waren versperrt und zusätzlich bewacht gewesen. Schließlich hatte er seine Fotos von der Absperrung aus geschossen.
»Zeig mir die Fotos«, sagte Stiller.
»Wie Paul Stiller wünschen«, säuselte es dienstbeflissen aus dem Lautsprecher. Kachelartig erschienen die Bilder auf dem Touchscreen.
Kleinschnitz winkte ab. »Vergiss es.«
»Bilder löschen?«, fragte die Computerstimme nach.
»Nein, lass mal sehen.« Kleinschnitz beugte sich nach vorn. »Was ich gemeint habe: Ruhmesblätter sind das nicht.«
»Vor dem musst du dich nicht entschuldigen.« Stiller deutete auf den Bildschirm. »Der war damals noch nicht geboren.«
»Ich sag’s ja nur, weil ich damals nicht richtig rangekommen bin.«
Das Archiv umfasste nicht nur die veröffentlichten Fotos, sondern alle, die Kleinschnitz eingestellt hatte. Stiller sah sie aufmerksam durch. Nachdem der Leichenwagen vorgefahren war, hatte Kleinschnitz festgehalten, wie die beiden Fahrer, unterstützt von zwei Streifenbeamten, den grauen Metallsarg aus dem Seitenausgang trugen. Der Wagen war so geschickt geparkt, dass selbst der Sarg kaum zu sehen war, bevor er im Heck des Fahrzeugs verschwand. Stiller wusste, wohin die Reise ging: zur Gerichtsmedizin nach Würzburg.
Auf einigen Bildern waren Strobel und Staab zu erkennen. Ein ungleiches Paar, der hünenhafte, durchtrainierte Hauptkommissar und der untersetzte, korpulente Experte für Tatortsicherung.
»Fällt dir eigentlich auf, dass sämtliche Akteure von einst heute noch immer auf der Bühne stehen?«, wandte sich Stiller nachdenklich an Kleinschnitz. »Strobel und Staab, Bausback und Kerstin, du und ich … Nur Fenia macht Erziehungspause.«
»Du hörst dich an, als blätterst du im Familienalbum. Wonach suchst du überhaupt?«
Stiller schwieg und zuckte die Schultern. Er musterte die Schaulustigen, die Kleinschnitz fotografiert hatte, doch nirgends machte es klick. Wie auch? Hatte er erwartet, zwanzig Jahre später plötzlich etwas zu entdecken, was da nicht hingehörte? Den entscheidenden Hinweis, der damals allen entgangen war?
Nein, Strobel hatte gute Arbeit geleistet, seinem Ruf als ehrgeiziger und erfolgreicher Ermittler alle Ehre gemacht. Außerdem war Glück im Spiel: Noch am Fundort der Leiche stand die Identität der Toten fest. Sie hatte eine kleine Umhängetasche bei sich gehabt, in der nichts fehlte, und falls doch, dann jedenfalls nicht ihre Papiere.
Die Tote hieß Lisa Falk. Sie war achtzehn und wohnte in Elsenfeld.
Auch die Frage, wie sie nach Aschaffenburg gekommen war und was sie vermutlich im Parkhaus gesucht hatte, war in kürzester Zeit geklärt: Ein Führerschein und noch jüngere Fahrzeugpapiere wiesen sie als stolze Besitzerin eines Kleinwagens aus. Den neuen Fiat 500, weiß, mit Schiebedach und rotem Polster, hatten ihr, wie sich später konkretisieren sollte, die Eltern zum achtzehnten Geburtstag geschenkt – und im Vorgriff auf das Abitur, das sie am Aschaffenburger Kronberg-Gymnasium ablegen wollte.
Strobels Männer hatten den Fiat auf der zweiten Parkhausebene aufgestöbert und das Deck umgehend absperren lassen. Dort hatten sich aber keine weiteren Spuren gefunden. Der oder die Mörder hatten es weder auf Lisas Tasche abgesehen noch auf ihr Auto.
Es war aber schon nicht mehr Stiller gewesen, der diese Details zusammentrug. Bausback hatte die Berichterstattung inzwischen Fenia Saalbach übertragen.
»Du hast ungelesene Nachrichten«, schnarrte Stillers Armbanduhr.
»Später erinnern!«, gab er barsch zurück.
»Unverständliche Eingabe«, monierte die Stimme aus dem Bildschirmlautsprecher, während die Smartwatch wie beleidigt schwieg. »Bitte Erinnerungsgegenstand präzisieren.«
»Niemand redet mit dir«, fauchte Stiller. Er sah Kleinschnitz verzweifelt an. »Die Dinger machen mich völlig kirre.«
»Du solltest dir die neue Sprachsteuerung der Komm-Union runterladen«, riet Kleinschnitz. »Damit kannst du vier Endgeräte gleichzeitig kontrollieren.«
»Oder die mich.« Stiller wandte sich wieder dem Bildschirm zu. Später erinnern … Irgendwas war damals passiert, woran er sich später erinnern wollte. Er kam nicht mehr darauf, was es war, es lag zu lang zurück. »Zeig mir die Archivtexte«, fauchte er den Bildschirm an.
»Wie Paul Stiller wünschen.« Dem unterwürfigen Ton eines Butlers war keinerlei Verärgerung über Stillers kleinen Ausbruch anzumerken.
»Immer höflich, das ist das einzig Tolle an euch Maschinen«, sagte Stiller und vertiefte sich wieder in die Texte. Fenia Saalbach war für die Berichterstattung keine schlechte Wahl gewesen: Sie verstand es, den Lesern das Gefühl zu geben, dabei zu sein. Die meisten Informationen hatte sie aus einer Pressemitteilung. Kripo und Staatsanwaltschaft hatten sie am Nachmittag des ersten Tages gemeinsam herausgegeben, vermutlich gleich nachdem die ersten Ergebnisse der Gerichtsmedizin Würzburg eingegangen waren.
Demnach war Lisa Falk erdrosselt worden, knappe zwanzig Minuten bevor der Parkhauswächter die Leiche gefunden hatte. Der Mörder hatte sie in auffälliger Weise in einer Ecke des Notausgangs drapiert, näher hatten sich Strobel und der leitende Oberstaatsanwalt Rudolf Possmann auch auf telefonische Nachfragen »der Redaktion«, also Fenias, nicht dazu geäußert. Bei der Tatwaffe hatte die Polizei auf einen »textilen Gegenstand« getippt, möglicherweise einen Fan-Schal oder etwas Ähnliches. Sie war und blieb unauffindbar. Ein Raubmord schied aus, vage war in der Pressemitteilung von einer »sexuell motivierten Tat« zu lesen. Auch dazu war nichts Näheres zu erfahren gewesen, Possmann hatte auf das genaue Ergebnis der Obduktion verwiesen, das noch ausstand.
»Erdrosselt«, sagte Kleinschnitz. »Da hat sie sich doch bestimmt gewehrt. Gab es keine Spuren vom Täter?« Interessiert beugte er sich über Stillers Schulter.
»Irgendwo steht’s.« Stiller spreizte die Finger über dem Bildschirm und vergrößerte den Text. »Er hat sie von hinten angefallen und ist unglaublich brutal vorgegangen. Sie hatte keine Chance.«
»Also keine Hautspuren unter den Fingernägeln oder so etwas?«
Stiller betrachtete ihn von der Seite. »Du schaust dir wohl gerade den Stick mit der Tatortstaffel an, den ich dir geschenkt habe. Nein, keine Hautpartikel. Übrigens solltest du mal wieder zum Friseur.«
»Was?« Kleinschnitz strich sich mit der Hand über den fast kahlen Schädel. »Das sagt der Richtige! Du mit deiner albernen silbernen Mähne. Ich rasier meine Haare jeden dritten Tag.«
»Das meine ich nicht. Ich rede von den Haaren, die dir aus dem Ohr sprießen.« Stiller blickte wieder nach vorn.
»Manche mögen das.«
»Mag sein, aber ich mag die nicht, die das mögen.«
Kleinschnitz zog den Kopf zurück. »Mach voran, wir haben heute noch was zu tun. Ich zumindest.«
Gegen acht Uhr am Morgen des ersten Tages hatte Strobel damals die Soko »Parkhaus« zusammengestellt. Achtzehn Beamte, später war ihre Zahl auf vierzig gestiegen. Über die Tatnacht hatten sie bis zur Pressemitteilung am Nachmittag noch nicht allzu viele Informationen, die Zeit war für umfassende Ermittlungen zu kurz gewesen.
Lisa Falk hatte das Elternhaus in Elsenfeld am Abend ihrer Ermordung gegen zwanzig Uhr verlassen und war mit dem Auto in die Stadt gefahren. Sie wollte sich mit einem Freund treffen, mit ihm beim Public Viewing im Hofgarten-Biergarten das Fußballspiel anschauen und anschließend zur WM-Party am City-Kreisel gehen. Dass der Fiat im City-Parkhaus stand, sprach dafür, dass sie den Plan auch umgesetzt hatte.
Nach der Auswertung der Videoaufzeichnungen im Parkhaus war sie dort um einundzwanzig Uhr achtzehn eingefahren. Da die Fahrzeit von Elsenfeld nach Aschaffenburg kaum eine halbe Stunde beträgt, hätte sie schon gegen zwanzig Uhr dreißig in der Stadt gewesen sein müssen. Die Kripo war davon ausgegangen, dass sie sich in der Zwischenzeit bei ihrem Freund aufgehalten hatte – wenn nicht an irgendeinem anderen Ort.
»Sie waren im Bett«, murmelte Stiller.
»An solche Details erinnerst du dich natürlich.« Kleinschnitz schnippte ihm mit dem Zeigefinger an den Kopf.
»Das ist keine Erinnerung, sondern eine Vermutung«, gab Stiller zurück.
Die Identität des Freundes stand noch nicht fest. Die Kripo hatte ihn als »groß, schlank, blond und dunkel gekleidet« geschildert. Stiller nahm an, dass sich die Soko dabei auf die Videoüberwachung des Parkhauses stützte, er wusste, dass solche Aufnahmen zur damaligen Zeit erst nach einer aufwendigen Nachbearbeitung mehr hergaben. Die Soko hatte noch am Vormittag begonnen, Lisas Mitschüler zu befragen. Niemand hatte ihren Freund gekannt, er war also offensichtlich nicht am Kronberg-Gymnasium. Auch ihr Elsenfelder Freundeskreis brachte keine Anhaltspunkte, aus dem hatte sie sich schon vor Längerem zurückgezogen.
Der Fußweg vom City-Parkhaus durchs Schöntal zum Biergarten dauert zehn Minuten. Wann die beiden dort angekommen waren, hatte die Soko nicht ermitteln können. Die Beamten hatten sich das Personal vorgeknöpft, das allerdings wenig Brauchbares beobachtet hatte. Es waren etwa hundertfünfzig Zuschauer bei diesem Public Viewing gewesen, und für die Dauer des Spiels hatten sie sich selbst die Getränke holen müssen. Lisa war am Ausschank nie aufgetaucht, vermutlich hatte ihr Freund das übernommen.
Aber Lisa war unter den Zuschauern gewesen. Einem Kellnerjungen, der leere Gläser einsammelte, war sie aufgefallen. Das Foto, das die Kripo herumgezeigt und zur Veröffentlichung an die Medien gegeben hatte, ließ den Grund ahnen: Lisa Falk war ausgesprochen hübsch. Sie hatte blondes nackenlanges Haar, ein schmales Gesicht mit hohen Wangenknochen und Grübchen in den Mundwinkeln, wenn sie lächelte. Sie war sportlich und, tja, gut gebaut. In der Nacht ihrer Ermordung trug sie ein knallenges T-Shirt, das den Trikothemden der deutschen Elf nachempfunden war, und einen Minirock. Der Kellner dürfte nicht der Einzige gewesen sein, der ein Auge auf sie geworfen hatte. Ihrem Begleiter dagegen hatte er keine Beachtung geschenkt.
Nach dem Spiel hatte sich ihre Spur verloren. Die Kripo hatte das Foto mit einem eindringlichen Zeugenaufruf verknüpft. Wer hatte Lisa Falk beim Public Viewing oder später bei der WM-Party am City-Kreisel gesehen? Mit wem? Wer konnte Hinweise darauf geben, wo sie sich nach der Feier bis zu ihrer Ermordung aufgehalten hatte?
Dem Freund war ein eigener Aufruf gewidmet: Zum einen an ihn direkt, er sollte sich umgehend an die Kripo wenden. Zum anderen an Personen, die vielleicht wussten, wer er war, oder die ihn gemeinsam mit Lisa Falk gesehen hatten.
Stiller erinnerte sich. Der Freund hatte sich bis zum Abend des ersten Tages noch nicht selbst gemeldet. Das hatte gleich Anlass zu wilden Spekulationen gegeben, in der Öffentlichkeit ebenso wie in der Redaktion. Fenia hatte sich aber gehütet, ihn im Zeitungsbericht als Verdächtigen hinzustellen, zumal auch von der Kripo keine derartigen Signale gekommen waren.
Allerdings war es kaum zu glauben, dass er vom Mord an seiner Freundin nichts mitbekommen hatte. Die Nachricht hatte sich wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreitet. Die Zeitung hatte sie sofort online gestellt und ständig aktualisiert. Fortlaufend berichteten auch Rundfunk und Fernsehen – nicht nur die örtlichen Sender. Schon gegen Mittag waren die ersten überregionalen Medien in Aschaffenburg eingefallen.
Nach dem Unterricht hatten sich Lisas Mitschüler am Fundort der Leiche versammelt, Kerzen und Blumen aufgestellt, sich umarmt und geweint. Alles vor laufenden Kameras. Auch Fenia und Kleinschnitz waren vor Ort gewesen, sie hatte mit einigen der Trauernden gesprochen, er Fotos geschossen.
Stiller tippte auf den Text. »Zeig mir die Bilder«, forderte er die Maschine auf.
Doch er kam nicht mehr dazu, die Fotos zu betrachten. Die Tür zum Büro flog auf. Stiller und Kleinschnitz wandten die Köpfe. Bausback stand hinter ihnen.
»Da stecken Sie also«, schnaubte er und ließ ein scharfes »Herr Stiller!« folgen.
Mit einer Geschwindigkeit, die ihm Stiller gar nicht mehr zugetraut hatte, umrundete Kleinschnitz den Bürostuhl und stellte sich mit dem Rücken vor den Bildschirm.
»Guten Morgen, Herr Bausback«, begrüßte er den Chefredakteur wie ein artiger Schüler seinen Lehrer.
Stiller sah am Lichtspiel hinter Kleinschnitz’ Rücken, dass der Bildschirm schlagartig die Farbe wechselte. Die Begrüßungsfloskel war offensichtlich als Kommando für den Computer bestimmt gewesen.
»Was treiben Sie denn da?« Neugierig reckte Bausback den Kopf und bedeutete Kleinschnitz mit einem Wedeln seiner Hand, zur Seite zu treten.
Kleinschnitz folgte gehorsam. »Wir gehen gerade die heutigen Termine durch.« Er deutete auf den Touchscreen, auf dem der Terminplan stand.
»Die Termine sind jetzt nicht erörterungsrelevant. Sie …«, Bausback zeigte mit dem Kinn auf Stiller, »gucken Sie eigentlich nicht mehr in Ihre Mails? Ich habe Ihnen heute früh vielleicht ein halbes Dutzend Nachrichten geschickt!«
»Oh.« Stiller dachte kurz nach. »Ich hab Probleme mit dem – äh – Akku«, sagte er leise.
»Womit?«
»Akku«, wiederholte Stiller etwas lauter.
»Akkuleistung achtzig Prozent«, antwortete seine Smartwatch. Stiller hätte sie sich am liebsten vom Arm gerissen und an die Wand geschleudert.
Bausbacks Gesicht rötete sich, nur die Nase blieb bleich. »Wollen Sie mich verschaukeln?«
»Hat sich wohl wieder gefangen«, erwiderte Stiller. Wie zur Bestätigung ließ die Uhr ihr »Du hast ungelesene Nachrichten« hören.
Bausback schnaufte. »Wie auch immer. Ich will, dass Sie beide sich unverzüglich auf den Weg machen.«
»Ich …«, setzte Stiller an.
Bausback schnitt ihm das Wort ab. »Sie? Wie ich höre, wollen Sie sich um Ihren Beitrag über die Entsiedelung drücken. Das trifft sich gut, da haben Sie jetzt ja Zeit.«
»Was ist denn los?«, schaltete sich Kleinschnitz ein.
»Endlich eine vernünftige Frage.« Bausback sah ihn wichtig an. »Ein Flashmob.« Er sprach das Wort, seit er es kannte, stets mit andächtig vorgestülpten Lippen aus, als handele es sich um etwas besonders Ernstes. Er hatte Flashmobs auch immer besonders ernst genommen, schon vor Jahrzehnten, als sie aufkamen, obwohl es in ihrer Entstehungszeit oft um Banalitäten gegangen war. Aufrufe im Internet, spontan eine McDonald’s-Filiale zu stürmen oder dergleichen. Meist hatten sich über die sozialen Netzwerke Tausende angesagt, und letztlich kamen nicht einmal hundert.
»Ein Flashmob«, wiederholte Stiller. »Wer, wo und warum?«
»So gefallen Sie mir!« Bausbacks braun gebranntes Gesicht strahlte. »Der Aufruf stammt von einer Gruppe, die sich ›Zweimalvierzig‹ nennt. Kennen Sie die?«
Stiller nickte. Der Name sagte alles. »Eine Seniorendemo«, seufzte er.
Bausback nickte. »In der Sandgasse. Spontane Kundgebung für eine barrierefreie Fußgängerzone.«
»Aber die Fußgängerzone ist doch längst barrierefrei«, warf Kleinschnitz ein. »In der Sandgasse hat die Stadt das Pflaster gegen Platten austauschen lassen. Vor bald zwanzig Jahren schon.«
»Ist denen egal.« Bausback breitete die Arme aus. »Die wollen in der Sandgasse jetzt auch Rollbänder wie in der Herstallstraße.«
»Das ist auch die Haupteinkaufsmeile. Aber wer braucht …«
Wieder schnitt Bausback Stiller das Wort ab. »Diskutieren Sie nicht mit mir, reden Sie mit denen. Fahren Sie hin.«
»Ich hab ’nen Haufen Termine«, probte Kleinschnitz den Rückzug. »Und dann eine Seniorendemo … Die sind immer so aggressiv. Kann da nicht mal jemand Jüngeres an die Front?«
Bausback lehnte erbost ab. »Ich will Sie beide da draußen haben. Sie sind schließlich an dieser Altersgruppe am nächsten dran. Das ist vertrauensrelevant.«
Stiller lachte in sich hinein. Er war keine zwei Jahre älter als Bausback. Aber der hatte noch nie eine Gelegenheit ausgelassen, ihm das aufs Brot zu schmieren. »Okay«, sagte er, angelte seine Umhängetasche unterm Tisch hervor und zwinkerte Kleinschnitz zu. »So kommen wir bei diesem schönen Wetter wenigstens raus.« Die Sandgasse hatte nach wie vor die höchste Dichte an Straßencafés.
Kleinschnitz hatte verstanden. »Dann lass uns keine Zeit verlieren«, sagte er, klopfte seine Taschen ab, um festzustellen, ob er alles Nötige bei sich trug, und zog Stiller zur Tür.
»Moment!«, hielt ihn Bausback auf. »Ihre Kamera.« Er deutete auf das Ungetüm, das Kleinschnitz neben dem Bildschirm abgelegt hatte.
»Ach die«, Kleinschnitz schüttelte den Kopf, »die ist nur Dekoration. Meine Kamera ist hier.« Er tippte an seine Brille. Stiller wusste, Kleinschnitz fotografierte nur noch mit den Cam-Glasses. Er war begeistert von der Technik, zumal sich durch die Kameras in beiden Bügeln dreidimensionale Bilder schießen ließen.
»Verstehe.« Wie zu Beginn des Treffens wedelte Bausback mit der Hand, diesmal, um die beiden zur Tür hinauszuscheuchen.
Wieder folgten sie artig. Sie wussten, warum er noch blieb: Er wollte nachsehen, womit sie sich wirklich beschäftigt hatten, bevor er ins Büro kam. Im Gang blieben sie lauschend hinter der Tür stehen.
»Zeig mir den vorigen Bildschirm!«, hörten sie Bausback drinnen sagen.
»Keine Identifikation möglich«, entschuldigte sich die warmherzige Computerstimme. »Bitte erneute Spracheingabe.«
Kleinschnitz schlug Stiller auf die Schulter. »Das kann jetzt stundenlang so weitergehen. Verschwinden wir lieber.«
Kleinschnitz steuerte den Buick in die Tiefgarage hinter der Sandkirche. Früher hatte er den breiten Schlitten auf den schmalen Stellplätzen da unten kaum unterbringen können. Die Energiewende hatte dieses Problem für ihn gelöst. Die Autos waren immer kleiner, sparsamer und elektrischer geworden. Seit die Brennstoffzelle serienreif war, tauchten zwar wieder große Straßenkreuzer auf. Doch gerade im Stadtverkehr waren fast nur noch Kleinwagen unterwegs, die in den Parkhäusern weniger Platz benötigten. Smarts, Minis, nachgebaute Fünfhunderter, dazu die Palette der ein- und zweisitzigen E-Mobile, zum Teil mit futuristischen Formen und hochklappbaren Türflügeln, zum Teil nostalgisch in der Art von Kabinenrollern. Wie überdimensionale Klunker an einer Kette hingen sie an den Stromzapfsäulen, mit denen die Stadt die obere Garagenebene nachgerüstet hatte, bevor die kabellosen Induktionsladeplätze in Mode kamen. An sonnigen Tagen wie diesem war das Laden kostenlos; die Solaranlagen produzierten Überschussstrom, den die städtische Versorgungsgesellschaft zum Happy-Sun-Hour-Tarif verschenkte.
Der Buick glitt in eine ausreichend weite Lücke im zweiten Untergeschoss. »Wenigstens gibt’s hier jetzt Platz«, sagte Kleinschnitz, als hätte er Stillers Gedanken gelesen, und stellte den blubbernden Motor ab.
Sie warteten nicht auf den Aufzug, sondern stiegen durchs Treppenhaus nach oben. Als sie ins Freie traten, hörten sie schon die Demonstranten. Mit Trillerpfeifen und Presslufthupen machten die Achtziger auf sich aufmerksam. Für Stiller waren die Seniorendemos allmählich Routine, fast täglich gab es eine andere. Die Themen hingen von der Altersgruppe ab.
Die Gruppe ab fünfundsiebzig war besonders breit gefächert. Die Jüngeren bezeichneten sich selbst als »Aera« – abgeklärt, erfahren, reif, a