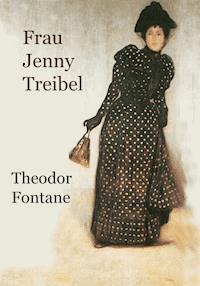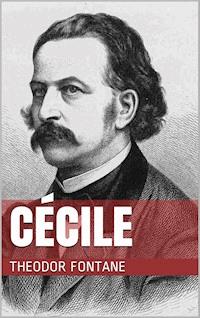3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die aus einfachen kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende Ernestine Rehbein sich in den Grafen Haldern verliebt, kommt es zur Tragödie.
Coverbild: © Westcorner_D / Shutterstock.com
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Stine
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenZum Buch + 1. Kapitel
Zum Buch:
Stine
Theodor Fontane
Coverbild: © Westcorner_D / Shutterstock.com
1. Kapitel
In der Invalidenstraße sah es aus wie gewöhnlich: Die Pferdebahnwagen klingelten und die Maschinenarbeiter gingen zu Mittag, und wer durchaus was Merkwürdiges hätte finden wollen, hätte nichts anderes auskundschaften können, als dass in Nummer 98e die Fenster der ersten Etage – trotzdem nicht Ostern und nicht Pfingsten und nicht einmal Sonnabend war – mit einer Art Bravour geputzt wurden.
Und nicht zu glauben: Diese Merkwürdigkeit ward auch wirklich bemerkt und die schräg gegenüber an der Scharnhorststraßenecke wohnende alte Lierschen brummte vor sich hin:
„Ich weiß nicht, was der Pittelkow’n wieder einfällt. Aber sie kehrt sich an nichts. Und was ihre Schwester ist, die Stine, mit ihrem Stübeken oben bei Polzins un ihren Sep’ratschlüssel, dass keiner was merkt, na, die wird grad ebenso. Schlimm genug. Aber die Pittelkow’n ist schuld dran. Wie sie man bloß wieder dasteht und rackscht und rabatscht! Und wenn es noch Abend wär’! Aber am hellen, lichten Mittag, wo Borsig und Schwarzkoppen seine grade die Straße runterkommen! Is doch wahrhaftig, als ob alles Mannsvolk nach ihr raufgucken soll; ne Sünd’ und ne Schand’.“
So brummelte die Lierschen vor sich hin, und so wenig freundlich ihre Betrachtungen waren, so waren sie doch nicht ganz ohne Grund; denn oben auf dem Fensterbrett und kniehoch aufgeschürzt, stand eine schöne; schwarze Frauensperson mit einem koketten und wohlgepflegten Wellenscheitel und wusch und rieb, einen Lederlappen in der Hand, die Scheiben der einen Fensterseite, während sie den linken Arm, um sich besser zu stützen, über das andere Querholz gelegt hatte. Mitunter gönnte sie sich einen Stillstand in der Arbeit und sah dann auf die Straße hinunter, wo jenseits des Pferdebahngeleises ein dreirädriger, beinahe eleganter Kinderwagen in greller Mittagssonne hielt.
Dem im Wagen sitzenden, allem Anscheine nach überaus ungebärdigen Kinde, das ganz aristokratisch in weiße Spitzen gekleidet war, war ein zehnjähriges Mädchen zur Aufsicht beigegeben, das, als alles Bitten und Zureden nichts helfen wollte, dem Schreihals einen tüchtigen Klaps gab.
Im selben Augenblick schielte aber die Zehnjährige, die diesen Erziehungsakt gewagt hatte, scheu nach dem Fenster hinauf, und richtig, es war alles von drüben her gesehen worden, und die schöne, schwarze Person, die „klapsen und erziehen“ durchaus als ihre Sache betrachtete, drohte sofort mit dem Lederlappen nach der auf ihrem Übergriff Ertappten hinüber. Auch schien ein Zornesausbruch in Worten trotz der weiten Entfernung folgen zu sollen; aber ein befreundeter Briefbote, der gerade die Straße heraufkam, hielt einen Brief in die Höh’, zum Zeichen, dass er ihr etwas bringe.
Sie verstand es auch so, stieg sofort vom Fensterbrett auf einen nebenstehenden Stuhl und verschwand im Hintergrunde des Zimmers, um den Brief draußen auf dem Korridor in Empfang zu nehmen.
Eine Minute später kam sie zurück und setzte sich ins Licht, um bequemer lesen zu können. Aber was sie da las, schien ihr mehr Ärger als Freude zu machen, denn ihre Stirn legte sich sofort in ein paar Verdrießlichkeitsfalten, und den Mund aufwerfend, sagte sie spöttisch:
„Alter Ekel. Immer. verquer.“
Aber sie war keine Person, sich irgendwas auf lange zu Herzen zu nehmen und so lehnte sie sich, den Brief immer noch in der Hand haltend, weit über die Fensterbrüstung hinaus und rief mit jener enrhümierten (d.i. verschnupften) Altstimme, wie sie den unteren Volksklassen unserer Hauptstadt nicht gerade zum Vorteil eigen ist, über die Straße hin:
„Olga!“
„Was denn, Mutter?“
„Was denn, Mutter! Dumme Jöhre! Wenn ich dir rufe, kommste. Verstehste?“
Ein mit einem alten Dampfkessel bepackter Lastwagen, der dröhnend und schütternd gerade des Weges kam, hinderte die unverzügliche Ausführung des Befehls; kaum aber, dass der Rollwagen vorüber war, so nahm Olga den Stoßgriff des Kinderwagens in die Hand und fuhr quer über den Damm hin, auf das Haus zu und mit einem Ruck in den Hausflur hinein. Hier nahm sie das Kind heraus und ging, während sie den Wagen zunächst unten stehen ließ, treppauf in die Wohnung der Mutter.
Diese hatte sich mittlerweile beruhigt, die Stirnfalte war fort, und Olga bei der Hand nehmend, sagte sie mit jenem Übermaß von Vertraulichkeit, das gewöhnliche Leute gerade bei Behandlung intimster Dinge zu zeigen pflegen:
„Olga, der Olle kommt heute wieder. Immer, wenn’s nich passt, is er da. Grad als wollt er mir ein’n Tort antun. Ja, so ist er. Na, es hilft nu nich, und, Gott sei Dank, vor achten kommt er nich. Und nun gehst du zu Wanda und sagst ihr ... Ne, lass man ... Bestellen kannst du’s doch nich, es is zu lang zum Bestellen. Ich werde dir lieber einen Zettel schreiben.“
Und mit diesen Worten trat sie, von der Tür her, wo dies Gespräch stattgefunden, an einen überaus eleganten und um eben deshalb zu Haus und Wohnung wenig passenden Rokokoschreibtisch heran, auf dem eine fast noch mehr überraschende ledergepresste Schreibmappe lag. In dieser Mappe begann jetzt die noch immer hochaufgeschürzte Frau nach einem Stück Briefpapier zu suchen, anfangs ziemlich ruhig, aber als sich, nach dreimaligem Durchblättern der roten Löschpapierbogen immer noch nichts gefunden hatte, brach ihre schlechte Laune wieder los und richtete sich, wie gewöhnlich, gegen Olga:
„Hast es wieder weggenommen und Puppen ausgeschnitten?“
„Nein, Mutter, wahr und wahrhaftig nich; ich kann es dir zuschwören.“
„Ach, geh mir mit dein ewiges Geschwüre. Haste denn gar nichts?“
„Ja, mein Schreibebuch.“
Und Olga lief, so rasch es ging, in das Neben- und Hinterzimmer und kam dann mit einem blauen Schreibeheft zurück. Die Mutter riss ohne Weiteres die letzte Seite heraus, auf deren oberster Zeile lauter ch’s standen, und kritzelte nun mit verhältnismäßiger Schnelligkeit einen Brief fertig, faltete das Blatt zweimal und verklebte die noch offene Stelle mit Briefmarkenstreifen, von denen sie die gummireichsten immer mit dem Bemerken: „Is besser als Englischpflaster“ aufzuheben pflegte.
„So, Olgachen. Nun gehst du zu Wanda un gibst ihr das. Und wenn sie nich da is, gibst du’s an den alten Schlichting. Aber nich an seine Frau un auch nich an die Flora, die guckt immer rein und braucht nicht alles zu wissen. Und wenn du zurückkommst, dann gehste mit zu Bolzanin ran un bestellst ne Torte.“
„Was für eine?“, fragte Olga, deren Gesicht sich plötzlich verklärte.
„Appelsine ... Un bezahlst sie gleich. Un wenn du sie bezahlt hast, sagste, dass er nichts drauflegen soll, auch keine Appelsinenstücke, die doch bloß Pelle un Steine sind ... Und nun geh, Olgachen, un mach flink, und wenn du wieder da bist, kannst du dir drüben bei Marzahn auch für’n Sechser. Gerstenbonbons kaufen.“
2. Kapitel
Olga säumte nicht und ging in die Hinterstube, um hier ihr rot und schwarz kariertes Umschlagetuch zu holen, das, neben einem etwas verschlissenen Schnurenhut, ihr gewöhnliches Straßenkostüm bildete. Witwe Pittelkow in Person aber stieg, nachdem sie das immer noch schreiende Kind in eine ganz vornehm ausgestattete Himmelwiege gelegt und ihm eine Flasche mit Saugpfropfen in den Mund gesteckt hatte, zwei Treppen höher zu Polzins hinauf, wo ihre Schwester Stine Chambre garnie wohnte.
Polzins waren gutsituierte Leute, die das mit dem Chambre garnie gar nicht nötig gehabt hätten, aber trotzdem, aus purem Geiz, alles vermieteten, oder doch so viel, wie irgend möglich, um ihrerseits frei wohnen zu können oder, wie Polzin sich ausdrückte: „Für umsonst einzusitzen.“
Er, Polzin, war seiner eigenen Angabe nach „Teppichfabrikant“ (allerdings niedrigster Observanz) und beschränkte sich darauf, unter geflissentlicher Verachtung aller Komplementärfarbengesetze, schmale, kaum fingerbreite Tuchstreifen wie Stroh oder Binsen nebeneinander zu flechten und dies Geflecht als „Polzinsche Teppiche“ zu verkaufen.
„Sehen Sie“, so schloss jedes seiner Geschäftsgespräche, „solch ,Polzinscher’ (er behandelte sich dabei ganz als historische Person) wird nie alle; wenn eine Stelle weggetreten is oder der Esstisch mit seinem Rollfuß ein Loch gerissen hat, nehm’ ich ein paar alte Streifen raus und setz’ ein paar neue rein, un alles is wieder propper und fix und fertig. Sehen Sie, so sind die Polzinschen. Aber wenn der Smyrnaer ein Loch hat, dann hat er’s, und da hilft kein Gott nich.“
Polzin, wie sich aus diesem Redefluss ergibt, neigte zu philosophischer Betrachtung: ein Zug, der durch das zweite Metier, das er betrieb, noch eine ganz erhebliche Stärkung erfuhr. Während der Abendstunden nämlich war er bei sich bietenden Gelegenheiten auch noch Lohndiener und wegen seiner Vorsicht und Geschicklichkeit beim Präsentieren in dem zwischen Invaliden- und Chausseestraße gelegenen Stadtteil allgemein beliebt, was Frau Polzin in ihren Gesprächen mit der Pittelkow immer wieder betonte:
„Sehn Sie, liebe Pittelkow, mein Mann is ein ordentlicher und manierlicher Mensch, der, weil wir selber ganz klein angefangen haben, am besten weiß, dass es nich jeder zum Wegschmeißen hat. Un sehn Sie, danach präsentiert er auch, und Sausieren, die nich feststehen und immer hin und her rutschen, die nimmt er gar nich. Und wenn Polzin schon eine einzige Plüschtaille verdorben hat, so will ich sterben. Und ebenso galant und manierlich is er auch beis Mitnehmen. Er is mein Mann, aber das Mus ich sagen; er hat was Feines un Bescheidenes un überhaupt so was, was die andern nich haben. Ja, das muss ich ihm lassen. Und da reichen nich hundertmal, dass er mir gesagt hat: ,Emilie, heut hab ich mir mal wieder über meine Kollegen geschämt. Natürlich war es wieder der mit’n Plattfuß aus der Charitestraße. Glaubst du, dass er sich auch bloß geniert und ein ganz klein bisschen für Schein und Anstand gesorgt hätte? I, Gott bewahre. Ganz dreiste weg, als ob er sagen wollte: Ja, meine Herrschaften, da steht der Rotwein, un nu nehm’ ich ihn mit nach Hause.‘“
So waren die Polzins, an deren Flurtür, trotz einer daneben befindlichen Klingel, die Pittelkow jetzt klopfte, zum Zeichen (so hatte man abgemacht), dass es bloß „Freundschaft“ sei, was zu Besuch käme. Und gleich danach erschien denn auch Frau Polzin und öffnete.
Die nur drei Stuben zählende Polzinsche Wohnung erfreute sich des Vorzugs eines Korridors, der aber freilich nicht größer war als ein aufgeklappter Spieltisch und augenscheinlich nur den Zweck hatte, drei auf ihn ausmündende Türen zu zeigen, von denen die links gelegene zu der verwitweten Privatsekretär Kahlbaum, die mittlere zu Polzins selbst, die rechts gelegene zu Stine führte. Diese hatte das beste Zimmer der Wohnung, hell und freundlich, mit dem Blick auf die Straße, während sich die Kahlbaum mit etwas Beleuchtung vom Hof her und die Polzinschen Eheleute mit einem schrägen Dachlicht begnügen mussten, das wie bei fotographischen Ateliers von oben hereinfiel.
„Liebe Polzin“, sagte die Pittelkow, als beide Frauen sich oberflächlich begrüßt hatten, „es riecht wieder so sehr nach Petroleum bei Ihnen. Warum nehmen Sie nich Koks? Sie werden sich mit Ihrem Petroleumkocher noch alle Mieter aus der Wohnung kochen. Und Ihr lieber Mann? Was sagt denn der eigentlich dazu? Der muss doch nachgerade bei Puten und Fasanen eine feine Nase gekriegt haben. Und ich weiß nicht, wenn ich ein herrschaftlicher Lohndiener wäre, so was litt ich nich. In Gesellschaften immer was Delikates, un zu Hause so. Na, meinetwegen. Is denn Stine drin?“
„Ich denke doch, ich habe sie nicht weggehen hören. Und denn wissen Sie ja, liebe Pittelkow, wir sehen nichts un hören nichts.“
„Versteht sich, versteht sich“, lachte die Pittelkow, „sehen nichts un hören nichts. Und das ist auch immer das Beste.“
Sehr wahrscheinlich, dass sich dies Gespräch noch fortgesetzt hätte, wenn, nicht in ebendiesem Augenblick die Tür von rechts her aufgemacht und Stine herausgetreten wäre.
„Jott, Stine“, sagte die Pittelkow mit einem Ausdruck von Freude. „Na, das ist recht, Kind. Ein Glück, dass du da bist. Du musst heute noch runterkommen un helfen.“
Unter diesen Worten waren die Schwestern, während sich Frau Polzin artig, aber insgeheim grollend zurückzog, in Stines Zimmer eingetreten und auf ein paar kleine Stühle zugegangen, die zu beiden Seiten des Fensters auf einem Tritt standen. Draußen am Fenster aber war ein Dreh- und Straßenspiegel angebracht, bei dessen Anbringung der ebenso praktische wie pfiffige Polzin vor Jahr und Tag schon zu seiner Frau gesagt hatte:
„Emilie, solange der da ist, solange vermieten wir.“
Die Pittelkow setzte sich gegenüber dem Drehspiegel, der denn auch heute wieder, wie zur Bestätigung der Worte Polzins, eine Quelle herzlichen Vergnügens für die hübsche Witwe wurde, nicht aus Eitelkeit (denn sie sah sich gar nicht), sondern aus bloßer Neugier und Spielerei.
Stine, die das alles schon kannte, lächelte vor sich hin; auch sie trug einen gewellten Scheitel, aber ihr Haar war flachsgelb, und die Ränder der überaus freundlichen Augen zeigten sich leicht gerötet, was, aller sonst blühenden Erscheinung und einer gewissen Ähnlichkeit mit der Pittelkow unerachtet, doch auf eine zartere Gesundheit hinzudeuten schien.
Und so war es auch. Die brünette Witwe war das Bild einer südlichen Schönheit, während die jüngere Schwester als Typus einer germanischen, wenn auch freilich etwas angekränkelten Blondine gelten konnte.
Stine sah der immer noch mit dem Spiegel beschäftigten Schwester eine Weile zu, dann erhob sie sich, hielt ihr die Hand vor die Augen und sagte:
„Nun hast du aber genug, Pauline. Du musst doch nachgerade wissen, wie die Invalidenstraße aussieht.“
„Hast recht, Kind. Aber so is der Mensch; immer das Dümmste gefällt ihm un beschäftigt ihn, un wenn ich in den Spiegel kucke und all die Menschen und Pferde drin sehe, dann denk ich, es is doch woll anders als so mit bloßen Augen. Un ein bisschen anders is es auch. Ich glaube, der Spiegel verkleinert, un verkleinern is fast ebenso gut wie verhübschen. Aber du brauchst nicht kleiner zu werden, Stine, du kannst so bleiben, wie du bist. Ja, wahrhaftig. Aber, warum ich komme. Jott, man hat doch keine ruhige Stunde.“
„Was is denn?“
„Er kommt heute wieder.”
„Nu, Pauline, das ist doch kein Unglück. Bedenke doch, dass er für alles sorgt. Und so gut wie er ist und gar nich so.“
„Na, ich wollt ihm auch. Und den alten Baron bringt er auch mit und noch einen.“
„Und noch einen! Wen denn?“
„Lies.“
Und sie reichte Stine den eben erhaltenen Brief, und diese las nun mit halblauter Stimme:
„Mein lieber schwarzer Deibel. Ich komme heute, aber nicht allein; Papageno kommt mit und ein Neffe von mir auch; natürlich noch jung und etwas blass. ,Aber bleich und blass, ei, die Weiber lieben das.‘ Sorge nur, dass Wanda kommt und Stine. Wein schick ich und eine Salatschüssel. Aber für alles andre musst Du sorgen. Nichts Apartes, nichts Großes, bloß so wie immer. Dein Sarastro.“
„Wer ist denn der Neffe?“, fragte Stine.
„Weiß ich nich Wer kann alle Neffens kennen? Denkst du, dass ich mich um seinen Stammbaum kümmere? Jott, wie mag es damit aussehen? Na, überhaupt Stammbäume!“
„Lass ihn das nich hören.“
„Oh, der hört noch ganz andres. Oder denkst du, dass ich mir wegen eine Treppe hoch mit Klavier un Diwan un wegen nen Schreibtisch, der immer wackelt, weil er dünne Beine hat, ein Pechpflaster aufkleben soll? Nein, Stinechen, da kennst du deine Schwester schlecht. Oder wegen den blassen Neffen? Ich denk ihn mir so.“ Und dabei zog sie das Gesicht in die Länge und drückte mit Daumen und Zeigefinger die beiden Backen ein.
Stine lachte. „Ja, damit wirst du’s wohl getroffen haben. Und überhaupt, ich find es unpassend und ungebildet, dass er den jungen Menschen mitbringt. Ein Onkel ist doch immer so was wie ne Respektsperson. Für sich mag er ja tun, was er will; aber solchen jungen Menschen ... ich weiß nicht, Pauline. Findst du nich auch?“
„Na, ob ich finde: Natürlich; erst recht. Aber, Kind, wenn wir davon erst reden wollen, denn is kein Ende. Das is nu mal so; sie taugen alle nichts un is auch recht gut so; wenigstens für unsereins (mit dir is es was anders) und für alle, die so tief drin sitzen un nich aus noch ein wissen. Denn wovon soll man denn am Ende leben?“