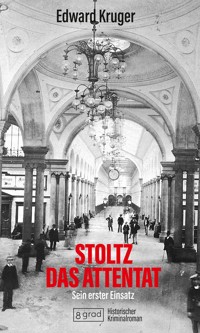
19,99 €
Mehr erfahren.
Württemberg, September 1857. König Wilhelm I. erwartet hohen Besuch: Der französische Kaiser und der russische Zar kommen nach Stuttgart. Zur gleichen Zeit macht Richard Stoltz aus Amerika unfreiwillig Station in der alten Heimat. Er war nach der gescheiterten Revolution von 1848 geflüchtet, hat sich als Detektiv in Pinkertons legendärer Agentur bewährt und befindet sich jetzt auf Europatour. Mit unorthodoxen Mitteln »überzeugt« ihn Polizeipräfekt Wulberer, an seiner Seite ein geplantes Attentat auf die gekrönten Häupter zu vereiteln. Der Einsatz verlangt Stoltz alles ab. Er stößt auf ein Netz von Intrigen, und was er dabei entdeckt, bringt nicht nur ihn selbst in Gefahr, sondern auch die Menschen, die ihm einst lieb und teuer waren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Edward Kruger
StoltzDas Attentat
Edward Kruger
STOLTZ Das Attentat
Sein erster EinsatzHistorischer Kriminalroman
Inhalt
I Montag, 21. September 1857 Vormittag
II Montag, 21. September 1857 Nachmittag
III Montag, 21. September 1857 früher Abend
IV Montag, 21. September 1857 Nacht
V Dienstag, 22. September 1857 Abend
VI Dienstag, 22. September 1857 Abend
VII Dienstag, 22. September 1857 Nacht
VIII Montag, 23. Juli 1849 Morgengrauen
IX Mittwoch, 23. September 1857 Morgen
X Mittwoch, 23. September 1857 Abend
XI Mittwoch, 23. September 1857 Abend
XII Mittwoch, 23. September 1857 Nacht
XIII Mittwoch, 23. September 1857 Nacht
XIV Donnerstag, 24. September Morgen
XV Donnerstag, 24. September 1857 Mittag
XVI Donnerstag, 24. September 1857 Mittag
XVII Donnerstag, 24. September 1857 Nachmittag
XVIII Donnerstag, 24. September 1857 Nachmittag
XIX Donnerstag, 24. September 1857 Abend
XX Freitag, 25. September 1857 Morgen
XXI Freitag, 25. September 1857 Vormittag
XXII Freitag, 25. September 1857 Mittag
XXIII Freitag, 25. September 1857 Mittag
XXIV Freitag, 25. September 1857 Mittag
XXV Freitag, 25. September 1857 Nachmittag
XXVI Freitag, 25. September 1857 später Nachmittag
XXVII Freitag, 25. September 1857 früher Abend
XXVIII Freitag, 25. September 1857 Abend
XXIX Freitag, 25. September 1857 später Abend
XXX Freitag, 25. September 1857 später Abend
XXXI Freitag, 25. September 1857 Nacht
XXXII Samstag, 26. September 1857 Morgen
XXXIII Samstag, 26. September 1857 Vormittag
XXXIV Samstag, 26. September 1857 Vormittag
XXXV Samstag, 26. September 1857 Vormittag
XXXVI Samstag, 26. September 1857 Nachmittag
XXXVII Samstag, 26. September 1857 Nachmittag
XXXVIII Samstag, 26. September 1857 Nachmittag
XXXIX Samstag, 26. September 1857 später Nachmittag
XL Samstag, 26. September 1857 Abend
XLI Samstag, 26. September 1857 Nacht
XLII Sonntag, 27. September 1857 Morgen
XLIII Sonntag, 27. September 1857 Morgen
XLIV Sonntag, 27. September 1857 Vormittag
XLV Sonntag, 27. September 1857 Mittag
XLVI Sonntag, 27. September 1857 Nachmittag
XLVII Sonntag, 27. September 1857 Nachmittag
XLVIII Sonntag, 27. September 1857 Nachmittag
XLIX Sonntag, 27. September 1857 Nachmittag
L Sonntag, 27. September 1857 Nachmittag
LI Sonntag, 27. September 1857 Abend
LII Montag, 28. September 1857 sehr früh
LIII Montag, 28. September 1857 Morgen
LIV Montag, 28. September 1857 Vormittag
LV Montag, 28. September 1857 Vormittag
LVI Montag, 28. September 1857 Nachmittag
LVII Montag, 28. September 1857 Abend
Nachbemerkung
I
Montag, 21. September 1857Vormittag
Auf dem Schreibtisch stand als Zier einer dieser nickenden Vögel, die unbeirrt und im gleichmäßigen Tempo aus einem Napf Wasser zu trinken schienen. Der Vogel war liebevoll gestaltet. Er trug einen schwarzen Miniaturtschako mit einem roten Puschel auf dem Deckel und einer rot-schwarzen Kokarde, ganz so wie die Landjäger des Königlichen Korps von Württemberg.
Der Ziervogel stand auf dem großen – und ansonsten leeren – Schreibtisch des Landjäger-Leutnants Martin Wulberer. Der Leutnant war Anfang vierzig, aber er sah älter aus. Wulberer gehörte zu jenen Männern, die nach einer eher blässlichen Jünglingsphase umgehend in den Habitus eines gesetzten Herrn verfielen, in dem sie dann verblieben, bis sie eines Tages als Greis aufwachten und so ihrem Ende entgegengingen.
Dass es in Wulberers Leben keine Phase gegeben hatte, in der er als kraftstrotzender junger Mann breitbeinig durch die Welt schritt und nach Bäumen suchte, die er ausreißen konnte, wurde von dem Landjäger-Leutnant keineswegs als Mangel empfunden.
Wulberer wusste um seine Farblosigkeit. Er hielt sie für eine Tugend. So war ihm schon vor Jahren bei den Landjägern eine Dienststelle für »besondere Aufgaben« eingerichtet worden. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, zu definieren, worin diese besonderen Aufgaben denn bestehen könnten, und es war keinem aufgefallen, dass Wulberer im Wesentlichen mit Nichtstun beschäftigt war.
Das Korps hatte ihm in der Kaserne an der Marienstraße ein Büro eingerichtet. Dort traf Wulberer jeden Morgen pünktlich um neun Uhr ein. Auf dem Weg zu seinem Büro begrüßte er den Schreiber Schaal und die Sekretärin, Fräulein Holder. Schreiber Schaal war ein hässlicher, hagerer Kerl mit dem länglichen Gesicht eines Schafs, dessen leicht einfältiges Gesicht zu allem Überfluss von einer beeindruckenden Warze verunstaltet wurde.
Schaal war ein Untergebener ganz nach Wulberers Geschmack. Ergoss sich Wulberer in einen seiner gelegentlichen cholerischen Wutanfälle, dann begannen Schaals Lider zu flattern, und er wirkte tatsächlich wie ein verirrtes Schaf in einem Gewitter. Ließ sich Wulberer jedoch zu einem Lob herab – was selten war, aber vorkam –, dann strahlte Schaal dankbar wie ein Kind. Aus Fräulein Holder hingegen war er bis zum heutigen Tage nicht schlau geworden. Sie huschte mit für sie typischer Graumäusigkeit über den Flur, den Blick stets gesenkt. Fräulein Holder redete nur, wenn sie gefragt wurde, und dann so leise, dass Wulberer selten verstand, was sie gesagt hatte. Aber eigentlich interessierte ihn das auch nicht.
Hatte Wulberer seine Untergebenen passiert, betrat er sein Büro und schloss die Tür hinter sich. Während der Ziervogel nickte, studierte Wulberer den Schwäbischen Merkur – und da wiederum mit Hingabe die »Schwäbische Kronik«, denn auch wenn er selbst nicht auffallen wollte, interessierten ihn doch unbändig alle jene, die aus der Menge herausragten.
Gegen Mittag war er für gewöhnlich mit der Zeitungslektüre fertig. Dann verbrachte Wulberer die Zeit bis Dienstschluss mit Sinnieren und Betrachten des nickenden Ziervogels.
Das Spielzeug war ihm vor ein paar Jahren als Weihnachtsgeschenk übereignet worden. Gebaut hatte es wohl ein Student des Polytechnikums. Bei der Geschenkübergabe hatten ihm die Kollegen auch erklärt, wie das scheinbare Perpetuum mobile funktionierte, es hatte wohl irgendwas mit Äthanol im Vogelkörper und Spiritus im Trinknapf zu tun. Wulberer hatte kein Wort verstanden, naturwissenschaftliche Fragen interessierten ihn eher am Rande, aber er mochte den Ziervogel, weil er seine Lebensphilosophie verkörperte: Stetig und unaufgeregt dem Ziel entgegen.
Es klopfte.
»Ja«, sagte Wulberer knapp. Als sich die Tür öffnete, steckte Wulberer den Kopf wieder in die Zeitung. Aus den Augenwinkeln beobachtete er, wie sich Schaal in devoter Haltung näherte. Als der Schreiber den Schreibtisch seines Chefs erreicht hatte, legte er auf diesem ein gefaltetes Schreiben ab. Dann zog er sich im Rückwärtsgang, genauso devot wieselnd wie beim Eintritt, zurück. Als Wulberer unwirsch aufsah, war Schaal schon wieder verschwunden.
»Was zum Teufel …«, knurrte Wulberer.
Dann verstummte er. Das Schreiben trug das geprägte Siegel des Königs. Nun war es an Wulberer, eine devote Haltung einzunehmen. Behutsam, als wäre das Papier auf Schmetterlingsflügeln gedruckt, öffnete er den Brief:
Seine Majestät wünschen die Präsenz des Sekondeleutnants Wulberer in der Residenz am 21. September 1857 A. D. um 12 1/2 Uhr.
Darunter eine unleserliche Unterschrift. Wulberer schloss aus, dass der Landesherr das Schreiben selbst unterzeichnet hatte. Allerdings war er auch bis zum heutigen Tag davon ausgegangen, dass Wilhelm I. nichts von der Existenz eines gewissen Sekondeleutnants wusste.
Wulberer kam hinter dem Schreibtisch hervor und nahm seine Uniformjacke vom Bügel. Er begann, sie sorgfältig zu bürsten. Normalerweise hätte er diese Aufgabe Fräulein Holder überlassen, aber in Anbetracht einer Audienz beim König nahm er die Dinge lieber selbst in die Hand.
Als er säuberlich und geschickt die Jackenbrust bürstete, unterdrückte er einen Seufzer. Wulberer hatte keinen einzigen Orden, mit dem er sich schmücken konnte. Aber vielleicht war das der Grund, weshalb Majestät ihn ins Schloss bestellte!
Am kommenden Sonntag würde der Monarch seinen sechsundsiebzigsten Geburtstag feiern. Aus diesem Anlass würden sich die Landeskinder mit Geschenken für ihren Landesvater nicht lumpen lassen. Aber auch der König gab gern. Warum also sollte Wulberer in diesem Jahr nicht zu den Beschenkten gehören? Möglicherweise hatte ein kluger Geheimrat den König darauf aufmerksam gemacht, dass es gerade die unscheinbaren Arbeiter im Weinberg des Herrn waren, die seinen Laden am Laufen hielten. All die Flamboyanten und Prominenten waren doch schon bedacht worden, nun also war die Reihe an den Stillen und Bescheidenen.
Je länger Wulberer über diese Vermutung nachdachte, desto mehr wurde sie ihm zur Gewissheit. Es war richtig gewesen, dass er sich nie nach vorn gedrängt hatte, getreu dem Motto: Gehe nie zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Er hatte immer geahnt, dass sich seine Demut eines Tages auszahlen werde.
Wulberer zwängte seinen korpulenten Leib in die Uniformjacke. Die Residenz lag weniger als eine halbe württembergische Meile entfernt, das Wetter war schön, bestens geeignet für einen Spaziergang.
Wulberer verließ das Kasernengelände und ging gemächlichen Schrittes die Königstraße entlang. Die Luft war herbstlich angenehm, wenn man nicht gerade – wie Wulberer auf Höhe der Büchsenstraße – einen Jauchewagen passierte.
Stuttgart hatte um die fünfzigtausend Einwohner, war damit also kein Dorf, aber auch keine pulsierende Großstadt, wohl aber eine schmucke Residenzstadt, die mit dem nahe gelegenen Ludwigsburg auch ihr »schwäbisches Potsdam« hatte. Es gab in der Stadt an die vierhundert Kneipen, Wirtshäuser und Kaschemmen, in den gerne gezecht wurde. Derzeit war die Stimmung etwas rauer, was mit der schlechten Wirtschaftslage zusammenhing; im Sommer waren in New York die ersten Bankhäuser bankrott gegangen, und nun zog sich die Krise langsam, aber sicher über den gesamten Globus.
Und so waren auch Heißsporne, die einen über den Durst getrunken hatten, die größte Herausforderung für das Gendarmeriekorps; eine Aufgabe, der es sich jederzeit gewachsen fühlte.
Nachdem Wulberer das Palais des Kronprinzen erreicht hatte, bog er nach rechts auf den Schlossplatz ab und ging direkt auf die Jubiläumssäule zu. Dann näherte er sich mit klopfendem Herzen den schmiedeeisernen Toren der königlichen Residenz.
II
Montag, 21. September 1857Nachmittag
Zwei Stunden später saß Wulberer wieder hinter dem Schreibtisch in seinem Büro an der Marienstraße. Er hatte Kopf und Oberkörper auf die Schreibtischplatte gelegt, die Arme hingen schlaff herab. Der Kopf lag seitlich auf der Platte, aus Wulberers Mundwinkel rann ein dünner Speichelfaden, was Wulberer regungslos zur Kenntnis nahm. Seit mindestens einer halben Stunde hatte sich Wulberer nicht bewegt.
Die Audienz beim König war ein Desaster gewesen. Eigentlich hätte er schon misstrauisch werden müssen, als ihn der Geheimrat Kronwetter direkt am Tor abfing und zum Hintereingang des Schlosses lotste. In seiner Unschuld hatte Wulberer in diesem Moment noch geglaubt, er sei für eine sehr hohe Auszeichnung vorgesehen, weshalb die Vorgespräche unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollten. Dabei hätte ihn Kronwetters maliziöses Grinsen misstrauisch stimmen sollen. Kronwetter konnte Wulberer von Anfang an nicht leiden, dass er sich für Wulberer freute, war also auszuschließen.
Nachdem Wulberer sich dem König in seinem Gemach ähnlich devot genähert hatte wie zuvor Schaal seinem Vorgesetzten, erklärte der »viel geliebte Landesvater«, dass er für den Sekondeleutnant Wulberer eine ganz besondere Aufgabe habe.
Dieser Tage stand das Treffen zwischen den Kaisern von Frankreich und Russland an, und Württemberg hatte die Ehre, Gastgeber des Treffens zu sein. Die Häupter der beiden Weltmächte reisten mit ihrem gesamten Kometenschweif an, darüber hinaus würden im Laufe der Tage noch weitere Majestäten anreisen – so aus Holland und Griechenland.
Da die Herrschaften den Wunsch geäußert hatten, sich während ihres Aufenthalts volksverbunden zu zeigen, war der Besuch für die Polizeikräfte eine anspruchsvolle Aufgabe. Doch Wilhelm I. hatte seinen Gästen im Voraus versichert, dass sie sich frei bewegen könnten und keinerlei Sorgen machen müssten, denn schließlich verfügte Württemberg mit den Königlichen Landjägerkorps nicht nur über eine der besten Polizeiformationen auf dem Kontinent, sondern mit dem Sekondeleutnant Wulberer auch noch über einen Spezialisten, der für Aufgaben wie diese wie geschaffen war.
Wulberer musste Seiner Majestät versichern, dass er für die Zeit des Aufenthalts die Sicherheit aller edlen Häupter garantieren könne.
»Dafür verbürge ich mich«, war Wulberer gezwungen zu sagen. Dabei hatte er das Gefühl, er würde ein Schafott besteigen.
Materiell und qua Befehlsgewalt standen Wulberer alle Ressourcen des Königreichs zur Verfügung, allerdings konnte er weder auf das Landjägerkorps noch auf die Soldaten aus der Infanteriekaserne am Rotebühlplatz zurückgreifen.
»Aber Sie haben ja im Laufe der Zeit eine schlagkräftige Abteilung aufgebaut, stimmt’s?«, fragte Geheimrat Kronwetter im Namen des Königs.
Wulberer dachte an Schaal und Fräulein Holder, wie sie sich über Dokumente beugten und Federkiele über das Papier huschen ließen. Das darf doch nicht wahr sein, dachte er dann. War das eine Intrige? Ein brutaler Scherz? Doch dann fiel ihm siedend heiß ein, was ihm zu dieser Ehre verholfen haben könnte.
Schon vor Jahren war Wulberer zu der Erkenntnis gekommen, dass sein Gehalt für seinen Dienst am Vaterland viel zu mager war. Also begann er, die Planstelle für einen Korporal zu schaffen, der ihm bei alltäglichen Aufgaben zur Hand gehen sollte. Der Korporal existierte nur in Wulberers Fantasie, aber die Soldzahlungen, die Wulberer für seinen treuen Mitarbeiter in Empfang nahm, waren real. Und weil es so gut funktionierte, fügte Wulberer im Laufe der Jahre noch Quartiermeister und ein halbes Dutzend Gemeine hinzu, die ihm alle zuarbeiten sollten. Nie stellte jemand die Notwendigkeit der Mitarbeiter infrage. Und wenn doch mal jemand die Leute sehen wollte, murmelte Wulberer etwas von »klandestinen Aktionen«, was als Erklärung allemal genügte. Zu seiner Verwunderung bemerkte Wulberer, dass man ihn umso ernster nahm, je mehr Leute ihm auf dem Papier unterstanden.
Und es war ja wahr. Mit einem Korporal, einem Quartiermeister und einen halben Dutzend Gendarmen hätte er die Aufgabe vielleicht sogar meistern können. Aber so, mutterseelenallein?
Doch was sollte er tun? Gerade in diesem Moment seinen Betrug gestehen? Unmöglich. Das würde vermutlich übel enden. Wilhelm I. bestimmte über Leben und Tod seiner Landeskinder. Er hatte das Recht, die Todesstrafe zu verhängen, was er auch gar nicht so selten tat. Majestät begnadigte auch gerne.
Aber nicht immer. Um sich wenigstens fürs Erste aus der Affäre zu ziehen, verbeugte sich Wulberer vielfach, murmelte etwas von Ehre und Stolz.
In diesem Moment blickte der König Wulberer zum ersten Mal direkt an. Wulberer schien es, als würden die Augen des Monarchen vor Rührung feucht. Der König erhob sich und sagte: »So kenne ich meine Schwaben. Furchtlos und treu.«
Und damit war Wulberer entlassen. Geheimrat Kronwetter sollte ihn mit allen Details versorgen.
Die Details zum Treffen der beiden Kaiser waren in einem dicken Dossier versammelt. Kern der Papiersammlung war der Zeitplan, in dem die wichtigsten Punkte des Besuchs aufgelistet waren:
Donnerstag, 24. September 1857
Der russische Kaiser Alexander II. trifft am Bahnhof Feuerbach mit seinem Gefolge ein. Majestät Wilhelm I. wird den hohen Gast persönlich begrüßen.
Danach nimmt der Herrscher aller Reußen Quartier in der Villa Berg.
Freitag, 25. September 1857
An diesem Tag wird der französische Kaiser, Napoleon III., mit einem Sonderzug direkt aus Paris erwartet. Auch hier wird Majestät sich persönlich zur Begrüßung an den Bahnhof bemühen. Napoleon III. wird für die Dauer seines Aufenthalts im Südflügel der neuen Residenz Quartier nehmen.
Für den Nachmittag ist eine Festveranstaltung aller Schützengilden geplant, die mit einem Festschießen dem König und seinen Gästen die Ehre erweisen wollen.
Am Abend lädt der König seine Gäste und ihr Gefolge zu einer Venezianischen Nacht in die Villa Berg. Höhepunkt des Abends wird der Maskenball sein.
Samstag, 26. September 1857
Eröffnung der Herbstblumenausstellung. Ob König Wilhelm I. und seine Gäste teilnehmen, ist noch nicht geklärt.
Am Abend lädt Wilhelm I. seine Gäste zu einem Lichterfest in die Wilhelma. Über hunderttausend Lampen werden hier die Nacht zum Tag machen.
Sonntag, 27. September 1857
Der Geburtstag des Königs beginnt mit einem Festessen für verdienstvolle Beamte, wobei aber noch nicht geklärt ist, ob Majestät und/oder Gäste hier einen Auftritt haben.
Am Nachmittag werden die Kaiserin von Russland und die Königin von Griechenland am Bahnhof Feuerbach erwartet. Auch hier wird Majestät sich nicht nehmen lassen, die Gäste unter dem Jubel seiner Landeskinder zu begrüßen.
Am frühen Abend wird es im Residenzschloss ein Abendessen für die gekrönten Häupter geben. Danach begeben sich Wilhelm I. und seine Gäste in das Königliche Hoftheater, wo sie in der königlichen Loge der Premiere der Oper Die Zigeunerin des irischen Komponisten William Balfe erleben werden. Es wird damit gerechnet, dass die gekrönten Gäste mindestens den ersten Akt ansehen werden.
Montag, 28. September 1857
Da der Geburtstag des Königs in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, besaß Majestät die Güte und die Weisheit, den Landeskindern auch den Montag freizugeben. Höhepunkt dieses Tages wird unbestritten der gemeinsame Ausritt von König Wilhelm I. mit den Kaisern von Frankreich und Russland zum Wasen nach Cannstatt sein. Dabei werden Zehntausende erwartet, die dem Landesvater und seinen Gästen huldigen und sie bejubeln wollen. Der junge Graf Ferdinand von Zeppelin hat angekündigt, den Ausritt aus der Luft mit einem Heißluftballon zu begleiten. Er wird versuchen, von der Gondel seines Luftfahrzeugs aus Daguerreotypien anzufertigen, die Bilder werden das historische Ereignis unauslöschlich in das Gedächtnis der Menschheit bannen.
Einzelheiten müssen noch geklärt werden, aber bislang ist geplant, dass der König und der Kaiser von Frankreich am frühen Vormittag am Residenzschloss aufbrechen. Der Kaiser von Russland wird sich den beiden an der Wilhelma anschließen. Von hier an wird der König in der Mitte seiner beiden Gäste reiten. Damit das jubelnde Publikum einen guten Blick auf die Gäste bekommt, werden die drei im Schritt-Tempo reiten. Die anderen Mitglieder der edlen Familien folgen im offenen Wagen.
Nach dem Defilee wird der russische Kaiser am Bahnhof Feuerbach Stuttgart in Richtung Darmstadt verlassen. Auch hier gedenkt der König, seinen Gast persönlich zu verabschieden.
Wulberer stemmte sich von seinem Schreibtisch hoch. Er wusste nicht, wie oft er den Zeitplan des Besuchs gelesen hatte, aber er hasste jeden Buchstaben da drin.
Der Sekondeleutnant hatte bislang noch nicht ernsthaft versucht, sich in das Hirn eines Anarchisten hineinzuversetzen, aber schon nach der ersten Lektüre war er sich sicher: Die Lieblingsfantasie eines Königsmörders sah vermutlich genau so aus wie dieser vermaledeite Ablaufplan.
Jede Menge öffentlicher Auftritte, immer an Orten, wo sich ein Attentäter gut in der Menschenmenge verstecken und – auch nicht unwichtig – schnell flüchten konnte.
Der Gedanke an das Treffen der Schützenvereine, die mit einem Wettschießen (!) dem König zum Geburtstag gratulieren wollten, trieb Wulberer schon jetzt den Angstschweiß auf die Stirn.
Was das Lichterfest in der Wilhelma betraf: Die Monarchen würden sich hier vor erleuchtetem Hintergrund wie beim Scheibenschießen präsentieren. Und schließlich der Ausritt auf dem Wasen. Das war die Gelegenheit für den Attentäter. Sollte er bis dahin keinen Erfolg gehabt haben, auf dem kilometerlangen Defilee sollte es ihm doch gelingen, den einen oder anderen Monarchen – hoch zu Ross, im Schritt-Tempo vorüberziehend – aus dem Sattel ins Jenseits zu befördern. Und als ob das alles nicht genug Gelegenheiten für Anschläge böte: Ging es nicht auch im Freischütz um einen Schuss und eine Wunderkugel?
Wenn der potenzielle Attentäter es klug anstellte, hatte er große Chancen, sein Unternehmen zu einem glücklichen Ende zu führen. Für Wulberer hingegen waren die Chancen groß, dass sich dieses Unternehmen für ihn als Himmelfahrtskommando erwiese.
Wulberer erhob sich ächzend. Er warf einen weiteren verächtlichen Blick auf den Zeitplan, dann noch einen auf den stoisch vor sich hin pickenden Ziervogel. Schließlich griff er nach dem Vogel und schleuderte ihn an die Wand, wo er in tausend Splitter zerbrach. Äthanol und Spiritus traten aus. Der Geruch von Alkohol durchzog den Raum.
III
Montag, 21. September 1857früher Abend
Nach dem Wutausbruch kam der Katzenjammer. Nun saß Wulberer nicht mehr hinter dem Schreibtisch. Stattdessen lief er ruhelos in seinem Büro auf und ab. Es ist alles deine Schuld, ermahnte er sich, alles deine eigene Schuld. Wärst du nicht so gierig gewesen und hättest keine kleine Schattenarmee aus lauter non-existenten Gendarmen aufgebaut, nie wäre Kronwetter – und erst recht nicht der König – auf die Idee gekommen, dich mit dieser heiklen Mission zu betrauen. Also, Wulberer, ermahnte er sich, tu Buße und trag dein Kreuz mit Würde.
Allerdings hatte Wulberer es noch nie lange im Zerknirscht-Modus ausgehalten. Wie nicht wenige Beamte war er der festen Überzeugung, dass er für seinen Dienst am Vaterland nicht genügend entlohnt und sein Engagement nie genügend gewürdigt worden war.
Und überhaupt: Schließlich hatte sich nicht Wulberer diesen dämlichen Staatsbesuch ausgedacht. Das war doch ganz allein – Wulberer stockte der Atem bei diesem Gedanken – der König gewesen. Das klang jetzt fast nach Majestätsbeleidigung, war dennoch eine unbestreitbare Tatsache.
Im Grund seines Wesens interessierte sich Wulberer nicht dafür, was in den Köpfen der Großen und Mächtigen vorging. Er verfolgte nur sporadisch die Querelen innerhalb des Deutschen Bundes, wo mal die eine und dann wieder die andere Fraktion die Oberhand gewann, es aber nie zu einer stabilen Lösung kam.
Aber dass der Kaiser von Frankreich und der von Russland Weltpolitik machten, das war auch Wulberer klar. Vermutlich hatten sie wie alle Großen immer irgendeinen Zwist.
Genauso deutlich war, dass König Wilhelm I. nicht mit ihnen auf einer Stufe stand. Und das war dann auch Wulberers Erklärung für das Ereignis. Wie ein Schulbub auf dem Schulhof, der sich Respekt heischend zwischen zwei Grobiane warf, um ihren Streit zu »schlichten« und so allerorten Ruhm zu ernten, wollte wohl der König mit dem Treffen in der Welt Eindruck schinden. Was für ein kindisches Vorhaben, dachte Wulberer flüchtig. Dann verbot er sich jegliche – wenn auch nur mentale – Majestätsbeleidigung. Er hatte einen Entschluss gefasst. Wenn er schon musste, wollte er mit wehenden Fahnen untergehen. Selbst wenn ein Attentäter das Treffen für seine Zwecke nutzen sollte, Wulberer wollte sich nicht vorwerfen lassen, er habe nicht alles versucht, um den Anschlag zu verhindern.
Wulberer öffnete die Tür seines Büros und rief auf den Gang: »Schaal!«
Der Kopf des Schreibers erschien in der Tür seines Verschlags. Schaal blickte fragend.
»Zu mir.«
Nachdem Schaal die Tür des Büros von innen geschlossen hatte, zog er kaum merklich die Nase kraus. Wulberer ahnte, welcher Gedanke Schaal durch den Kopf ging: Hatte Wulberer getrunken? Doch Wulberer war nicht gewillt, die unausgesprochene Frage auch nur ansatzweise zu beantworten. Stattdessen sagte er: »Ich möchte, dass Sie mir zwei Dossiers zusammenstellen. Einmal zum Kaiser der Franzosen und dann eines über den Herrscher aller Reußen.«
»Sehr wohl, Herr Leutnant.« Schaal überlegte. »Bis wann?«, fragte er.
»Umgehend.«
Schaals Blick wanderte zur Wanduhr. Diesmal beantwortete Wulberer die unausgesprochene Frage.
»Tut mir leid, Schaal. Aber heute ist erst Feierabend, wenn die Dossiers zusammengestellt sind. Nehmen Sie sich die Holder, und tragen Sie zusammen, was Sie finden können.«
Schaal nickte wenig begeistert und begab sich wieder zur Tür. Als der Schreiber die Klinke herunterdrückte, fiel Wulberer noch etwas ein.
»Wenn Sie schon mal dabei sind, Schaal, gucken Sie mal, was Sie über die Leute haben, die nach dem Umsturzversuch vor zehn Jahren das Land verlassen haben. Ebenso auch über diejenigen, die im Gefängnis saßen oder noch sitzen.«
Schaal nickte und schloss die Tür von außen.
Es dauerte geraume Zeit, bis Schaal mit zwei großen Textmappen in der Tür stand, hinter ihm folgte Fräulein Holden mit einem weiteren großen Stapel Papiere. Die beiden platzierten die Unterlagen auf Wulberers Schreibtisch.
Der honorierte den Auftritt mit einem Kopfnicken und sagte dann: »Das wäre alles für heute, vielen Dank.«
IV
Montag, 21. September 1857Nacht
Seine Untergebenen hatten Wulberers Büro verlassen, bevor er wieder hinter dem Schreibtisch saß. Das erste Dossier widmete sich dem russischen Kaiser Alexander II.
Wulberer erfuhr während seines Aktenstudiums, dass die Russen ihren Kaiser »Zar« nannten, ein Wort, das ebenso wie das deutsche »Kaiser« vom lateinischen »Caesar« abgeleitet worden war. Die Erbfolge Alexanders schien einwandfrei, was am Petersburger Hof beileibe nicht selbstverständlich war, wie Wulberer bei dieser Gelegenheit lernte. Er hielt das für eine gute Nachricht, denn dadurch fielen von Thronprätendenten gedungene Meuchelmörder aus.
Alexander saß seit zwei Jahren auf dem Thron. Die feierliche Krönung hatte aber erst im letzten Jahr stattgefunden. Er war gleich zu Beginn der Amtszeit ins tiefe Wasser geworfen worden. Zwei Jahre vor seiner Thronbesteigung hatte der Krimkrieg begonnen, der auch noch tobte, als Alexander das Zepter übernahm.
Wulberer erinnerte sich dunkel. Als der Krieg am Schwarzen Meer ausbrach, hatte jeder erwartet, die Russen würden – als die militärische Supermacht, die Napoleon bis nach Paris zurückgeworfen hatte – mühelos Filetstücke aus dem schwächelnden Osmanischen Reich herausschneiden. Doch es kam anders. Ein von England und Frankreich unterstütztes dürftig ausgestattetes Expeditionskorps wies die Russen in die Schranken.
Alexander kam nach Besichtigung der Front zu dem Schluss, dass der Krieg sinnlos sei, und beendete ihn. Doch am Ende standen die Russen als Paria mit heruntergelassenen Hosen vor der Welt da. Nicht auszuschließen, dass es unter der russischen Elite den einen oder anderen gab, der Alexander für den Gesichtsverlust büßen lassen wollte. Außerdem musste man immer damit rechnen, dass bei den Russen irgendjemand – Kosak, Bauernführer, Kadett – putschen würde.
Ungeachtet der Niederlage im Krimkrieg hatte der Zar sich eine Schwäche für militärische Paraden und Prozessionen bewahrt. Er war mit einer Hessin verheiratet, die als Zarin auf den Namen Marija hörte. Offenbar war die Zarin seine Jugendliebe, Alexander hatte sie kennengelernt, als sie noch keine fünfzehn war.
Die kaiserliche Schwester, Olga, war Wulberer mehr als vertraut. Diese Prinzessin war mit Karl, dem Sohn von König Wilhelm, verheiratet. Es gab in Stuttgart zwei offene Geheimnisse. Zum einen wusste so gut wie jeder, dass sich Prinz Karl kaum für Olga und ihre Kugeln – erst recht nicht für andere Frauen – interessierte. Zum anderen, dass Wilhelm I. seinen Sohn aus tiefstem Herzen verabscheute und ihm die Thronfolge kaum gönnte. Was Karl verständlicherweise betrübte.
Wulberer nahm sich einen Bogen Papier und zeichnete eine Tabelle. Sie bestand aus drei Spalten. In den Kopf schrieb er die Namen der drei Landesväter: Wilhelm I. (Württemberg), Alexander II. (Russland), Napoleon III. (Frankreich). Darunter notierte er die Namen von Leuten, aus deren Umfeld sich potenzielle Attentäter rekrutieren könnten. Bei Wilhelm I. fiel ihm vorerst nur Prinz Karl ein. Sollte der auf seinen Vater so wütend sein, dass er danach trachtete, ihn vom Thron zu fegen und seinen Platz einzunehmen? Das klang für Wulberer ziemlich abwegig, aber die Verbindung nach Russland machte den Prinzen interessant. Olga hatte bestimmt noch gute Verbindungen in ihre Heimat. Wulberer beschloss, auf jeden Fall die Entourage von Alexander genauer unter die Lupe zu nehmen.
Dann schnürte Wulberer das Dossier des Franzosenkaisers auf. Hier erkannte er schnell, dass eine Spalte in seiner Tabelle kaum ausreichen würde. Napoleon mochte über viele Talente verfügen, aber geradezu unübertroffen war er, wenn es darum ging, sich Feinde zu machen.
Dass für Napoleon Numero drei der große Napoleon sowohl Onkel als auch Großvater war, überraschte Wulberer nicht. Das entsprach der Liederlichkeit, die Wulberer Franzosen in Familiendingen sowieso unterstellte. So wie Wulberer die Unterlagen verstand, war Napoleon III. wohl von Kindesbeinen an dazu erzogen worden, eines Tages in die Fußstapfen des großen Onkels/Opas zu treten; als Junge sollte er mit seinem Erzieher durch Italien gereist sein und die Orte besichtigt haben, an denen Napoleon und Cäsar ihre großen Schlachten geschlagen hatten.
Nach der Julirevolution von 1830 – haben Franzosen eigentlich auch andere Hobbys als Revolutionen?, fragte sich Wulberer an dieser Stelle – ging Napoleon Nummer drei nach Italien, wo er sich den Carbonari anschloss. Über diesen Verein fand Wulberer nicht viel in seinen Unterlagen. Offenbar handelte es sich um eine terroristische Organisation, die für die Einheit Italiens stritt, aber auch einfach gern Leute umbrachte. Wulberer machte eine Notiz, unbedingt mehr über diese Carbonari in Erfahrung zu bringen.
Nach der Revolution von 1848 – schon wieder, Frankreich, dachte Wulberer, wirklich: schon wieder? – wurde Napoleon III. Präsident, bis er sich vor ein paar Jahren zum Kaiser krönen ließ. Das lag anscheinend in der Familie. Auf jeden Fall hatte das französische Parlament unter dem Kaiser nicht viel zu lachen.
Bei den Einträgen in Wulberers Tabelle fanden sich zu Napoleon unter anderem:
– Carbonari
– Italiener, die Carbonari hassten
– französische Parlamentarier, die mitreden wollten
– Anti-Bonapartisten, die mit seinem Großvater/Onkel noch eine Rechnung offen hatten
– Bonapartisten, die meinten, dass der Enkel nie die Schuhe des Großvaters würde ausfüllen können
Da Frankreich und Italien entschieden näher lagen als Russland, nahm Wulberer an, dass von dort die größere Bedrohung ausging. Nicht aus den Augen lassen durfte man auch das Pressekorps. Anlässlich des Kaisertreffens hatten sich Journalisten aus aller Welt angesagt, nicht nur aus Frankreich – Le Figaro et al. –, sondern auch Blätter aus London, unter ihnen die ruhmreiche und altehrwürdige Times. Was den württembergischen Monarchen mit Freude erfüllte. Bis das Witzblatt Punch vor zwei Tagen in Vorschau auf das Treffen eine Karikatur zeigte, die Kaiser und Zar porträtierte, jedoch den württembergischen König mit keiner Silbe erwähnte. Aber dafür war Stuttgart schauerlich falsch geschrieben.
Wulberer machte sich eine weitere Notiz. Kronwetter musste ihm unbedingt eine Liste der akkreditierten Journalisten erstellen.
Es dauerte noch Stunden, dann hatte sich Wulberer auch durch die letzten Miszellen gearbeitet. Um Mitternacht war er schließlich so weit, dass er sich durch die Dossiers der gescheiterten Revolutionäre von 1848/49 arbeiten konnte. Hier hatte er kaum Anhaltspunkte, eigentlich nicht viel mehr als eine Ahnung. Wilhelm I. war zwar der einzige deutsche König, der im Revolutionsjahr die Verfassung anerkannt hatte, allerdings war ihm das – in diesem Punkt Napoleon III. nicht unähnlich – in den folgenden Jahren herzlich egal gewesen. Wulberer wollte nicht ausschließen, dass es unter den Rebellen noch genügend gäbe, die mit Wilhelm I. ein Hühnchen zu rupfen hatten. Und die würden sich die Gelegenheit kaum entgehen lassen, ihm seinen internationalen Auftritt, der ihn auf die Weltbühne katapultieren sollte, gründlich zu verderben.
Doch selbst wenn er hier nicht fündig werden sollte: Es gab immer noch jede Menge Amtshilfeersuchen aus den Nachbarstaaten, die zumindest Namen und – so nannte man in Wulberers Kreisen eine Personenbeschreibung – Signalement enthielten.
Lange Zeit schien es, als wollte der Aktenstapel gar nicht kleiner werden. Aber das störte Wulberer nicht. Aktenstudium gehörte zu den Dingen, die er beherrschte wie kaum jemand. Der Leutnant studierte einen Schriftsatz nach dem anderen, nie in Tempo oder Konzentration nachlassend; in dieser Beziehung dem von ihm vor einigen Stunden entsorgten Ziervogel nicht unähnlich. Und als der Morgen graute, hatte er tatsächlich eine Erfolg versprechende Information gefunden.
V
Dienstag, 22. September 1857Abend
»Ehrlich gesagt, Sie sehen gar nicht aus wie ein Mann Gottes.« Kaum hatte Walburga diesen Satz ausgesprochen, hielt sie erschrocken die Hand vor den Mund und errötete leicht. Sie warf einen Hilfe suchenden Blick auf ihren Mann Matthäus, dann musterte sie Richard Stoltz, der ihr im Abteil des Abendzugs nach Bietigheim gegenübersaß.
Richard Stoltz trug Kragen und Beffchen eines anglikanischen Vikars, und als solcher hatte er sich auch vorgestellt, als die beiden in Bretten in sein Abteil kamen. Vikar Richard Stoltz, Amerikaner mit deutschen Wurzeln, auf Grand Tour durch Europa, das Land der Vorväter mit der Seele suchend.
Doch die kirchlichen Insignien konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass Stoltz eigentlich ein eher gotteslästerliches Leben führte. Sein muskulöser Körper wirkte in seiner Kleidung wie gefangen, die sonnengebräunte Haut und der wache Blick aus graublauen Augen ließen eher auf ein Leben unter freiem Himmel schließen als auf einen Alltag in Kirchengemäuern.
Stoltz wollte erst so tun, als habe er die Bemerkung von Bäuerin Walburga gar nicht gehört. Dann sagte er: »Sie dürfen nicht vergessen, dass ich sehr viel mit Missionsarbeit in den Prärien des Westens beschäftigt bin. Das erfordert nicht nur einen starken Geist, sondern auch einen starken Körper.«
Das Pärchen wechselte einen Blick, als wollte es sagen: Ja, dann ist ja alles klar. Walburga überlegte, ob sie noch eine weitere Frage nachschieben sollte, aber dann entschied sie sich dafür zu schweigen.
Stoltz war das recht.
Auf dem kleinen Tisch unter dem Fenster lagen zwei Büchlein. Ein Baedeker-Reiseführer für Italien und eine Sammlung von Goethe’schen Gedichten. Stoltz griff nach dem Lyrikband und schlug die Seite auf, die durch ein Lesebändchen markiert war.
Amerika, du hast es besser
Als unser Kontinent, das alte,
Hast keine verfallenen Schlösser
Und keine Basalte
Dich stört nicht im Innern
Zu lebendiger Zeit
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit.
Als er vor knapp zehn Jahren den Sprung von der Alten in die Neue Welt wagte, hatte Stoltz nicht viel mehr als dieses Gedicht im Gepäck gehabt. Er konnte sich nicht mehr erinnern, wie oft er die Verse gelesen, ja nicht nur gelesen, manches Mal auch deklamiert hatte. Am Anfang waren sie ihm ein Mantra gewesen, Glücksverheißung, vielleicht sogar eine Art Zauberformel, eine seelische Balancierstange für seinen ganz persönlichen »pursuit of happiness«.
Doch als er nun als naturalisierter Amerikaner zurückkehrte, merkte er zu seiner Verblüffung, dass sich sein Blick auf Europa geändert hatte. Er hatte damit gerechnet, dass gerade in Deutschland ihm alles eng und wuselig erscheinen werde. Zwar hatte es schon Eisenbahnen gegeben, als er Süddeutschland verließ, doch die ersten Waggons waren damals nicht viel mehr als aneinandergeschraubte Kutschen gewesen. Man saß in einem Abteil und wenn die anderen Fahrgäste unangenehm, langweilig oder beides waren, gab es keine Möglichkeit, mit einer höflich dahergesagten Floskel den Sitzplatz zu wechseln. In Amerika hingegen waren die Waggons geradezu riesig; sie waren lang, und im Mittelgang kam man sich vor wie in einer Kirche auf dem Weg zum Altar.
Doch zu Stoltz’ Überraschung hatte dieser Trend mittlerweile auch in Europa Einzug gehalten. Die Eisenbahn in Württemberg benutzte Waggons ähnlicher Konstruktion, es gab einen Gang an der Seite, und so war es möglich, den Sitzplatz zu wechseln, wenn die Nachbarschaft nicht behagte.
Stoltz hatte nichts gegen das Bauernpaar, das offenbar auf Schmuggelfahrt war. Mann wie Frau waren eher schlank, doch sie trugen vermutlich mindestens ein halbes Dutzend Lagen Unterwäsche und Hemden mit Rüschen und Verzierungen an den Ärmeln, weshalb sie in ihrer Wulstigkeit ein wenig an menschliche Knallbonbons erinnerten. Vermutlich schwitzten sie tief drinnen beträchtlich. Stoltz hoffte, dass sich die Mühe der beiden lohnen werde.
Je näher der Zug der Grenze zu Württemberg kam, desto mehr entspannte sich Stoltz. Zwar hatte er auch in Baden eigentlich nichts zu befürchten. Eigentlich … Sein Pass war korrekt und gültig, im Falle eines Falles würde ihm eine Armada von Konsuln beistehen, aber dennoch hatte Stoltz ein mulmiges Gefühl, als ihn in Karlsruhe zwei Gendarmen länger als nötig musterten. Da er nicht wusste, wie viele Bekannte aus alten Zeiten noch unterwegs waren – und wer da vielleicht noch eine Rechnung mit ihm offen hatte –, entschied er sich für eine Verkleidung. Die Tracht, die er jetzt trug, hatten einem Geistlichen gehört, der in Baden-Baden all sein Geld verspielt hatte. Am Ende entschied der Mann sich, Kragen und Binde zu verhökern und alles auf Schwarz zu setzen. Stoltz hoffte, dass das Kalkül des Geistlichen aufgegangen war. Schließlich sollte die Kleidung auch ihm Glück bringen.
Ursprünglich wollte Stoltz das Großherzogtum Baden an einem Tag durchfahren, aber dann wurde Aristide von heftigen Zahnschmerzen buchstäblich niedergestreckt. Aristide war für Stoltz eine Mischung aus Vertrautem und Assistenten, in letzter Zeit ertappten sich die beiden immer öfter bei dem Gedanken, dass sie im Laufe der Jahre fast so etwas wie Freunde geworden waren.
Da Aristide wusste, dass Stoltz sich im Großherzogtum nicht gerade wohlfühlte, hatte er vorgeschlagen, Stoltz solle vorausfahren und in Stuttgart Quartier nehmen. Stoltz war einverstanden gewesen.
Stoltz sah auf seine Uhr. In einer knappen Stunde würden sie in Stuttgart sein. Er legte das Buch auf das Tischchen und entspannte sich weiter.
Walburga war wieder im Gesprächsmodus. Allerdings hatte sie diesmal keine Fragen, sondern verspürte den Drang, aus ihrem bewegten Leben zu erzählen.
»Wir hätten den Zug in Bruchsal fast verpasst«, erklärte sie.
Denn Walburga und Matthäus waren zuerst zum Badischen Bahnhof gelaufen, aber da fuhren nur Züge nach Baden.
»Die haben eine andere …«
Walburga stieß Matthäus an. »Wie heißt das?«
»Spurweite«, gab Matthäus an.
»Genau«, sagte Walburga.
Wie sie im Folgenden erklärte, fuhren die Züge in Baden auf breiteren Gleisen – »noch breiter als in Russland«, sagte Matthäus –, während in Württemberg die Eisenbahn auf der Normalspur verkehrte. Deshalb mussten die beiden zum Württemberger Bahnhof hetzten.
»Denn der badische Zug hätte uns ja niemals nach Württemberg fahren können.«
»Wegen der unterschiedlichen Spurweiten«, erinnerte Matthäus.
»Aber wir haben es doch noch gerade so geschafft«, verkündete Walburga freudestrahlend.
»Das freut mich«, bemerkte Aushilfsvikar Stoltz. Er überlegte, ob er noch ein »Auch die Schienenwege des Herrn sind unergründlich« nachlegen sollte, aber dann entschied er sich dagegen. Egal, wie gut eine Maskerade ist, man kann es immer auch übertreiben.
In Mühlacker machte der Zug mit quietschenden Bremsen halt. Wer von den Passagieren das Bedürfnis verspürte, konnte den Abort des Gasthofs im Bahnhofsgebäude nutzen. Wer das nicht wollte, konnte sich einfach nur auf dem Bahnsteig die Beine vertreten.
Stoltz war mittlerweile die Ruhe selbst. Doch er bemerkte, dass Walburga und Matthäus unruhig wurden. Stoltz warf einen Blick aus dem Abteilfenster und verstand, warum.
Auf dem Bahnsteig waren wie aus dem Nichts sechs Landjäger erschienen. Sie arbeiteten in Paaren. Eines kontrollierte den Zug von der Lokomotive her, ein weiteres am Ende und das dritte begann aufs Geratewohl in der Mitte.
Walburga und Matthäus sahen sich erschrocken an. Sie hatten – wie übrigens auch Stoltz – mit Kontrollen gerechnet. Schließlich wurde in Zeiten der Wirtschaftskrise vermehrt geschmuggelt, und an den Grenzen sollte die Ausfuhr von Gold möglichst unterbunden werden. Jedoch nur mit Stichproben. Dass die Landjäger jeden Passagier kontrollieren würden, das war eher ungewöhnlich.
Stoltz überlegte. Er trug Gold bei sich. Ein prall gefülltes Säckchen voller Zwanzig-Dollar-Gold-Eagles, geprägt aus frisch geschürftem kalifornischem Edelmetall, aber da machte er sich die wenigsten Sorgen. Als Amerikaner wurde von ihm erwartet, dass er als Gast seine Existenz bestreiten konnte, maximal würden bei Ein- und Ausreise seine Barbestände kontrolliert werden. Damit konnte er leben. Doch er trug andere Konterbande bei sich. Und die sollte den Landjägern unter keinen Umständen in die Hände fallen.
Stoltz überlegte. Er musste zuerst Zeit gewinnen. Dass er im Bahnhof seine Notdurft verrichten wollte, konnte ihm niemand verübeln.
Walburga und Matthäus waren mittlerweile nur noch ein Häufchen Elend. Stoltz hatte eine ziemlich klare Vorstellung von dem, was in ihren Köpfen vor sich ging. Sie konnten unmöglich viel Schmuggelware an ihren Körpern mit sich herumtragen, aber die Schande, erwischt und vor den Nachbarn bloßgestellt zu werden, drohte zusätzlich zu der zu erwartenden Strafe.
Stoltz sah noch einmal aus dem Fenster. Die Gendarmenpärchen hatten offenbar ihre Claims abgesteckt. Jedes Paar war für drei Waggons zuständig und sicher nicht gewillt, auch nur einen Zoll mehr zu kontrollieren als nötig. Denn warum sollten sie die Arbeit der Kollegen machen? Die wurden ja genauso mager entlohnt. Das hieße auch, dass sich außer dem designierten Gendarmenpaar niemand um Stoltz kümmern würde.
Das war gut.
VI
Dienstag, 22. September 1857Abend
Stoltz bedachte Walburga und Matthäus mit einem Blick, den er für väterlich streng hielt. Dann räusperte er sich.
»Machen Sie jetzt bloß nichts Unüberlegtes«, sagte er.
Walburga sah ihn verständnislos an.
»Was meinen Sie?«, fragte sie fast tonlos.
Matthäus kannte sich nicht nur in Spurweiten aus.
»Ich glaube, der Pfarrer glaubt, wir denken an türmen.«
Der Gedanke gefiel Walburga. »Gute Idee.«
Sie sprang auf. Stoltz drückte sie wieder auf ihren Platz.
»Ganz im Gegenteil. Schlechte Idee. Wenn Sie wegrennen, machen Sie alles nur noch schlimmer.«
Und im Geiste fügte Stoltz hinzu: Sagt ein Kerl, der wie ein Hase nach Amerika abgehauen ist.
»Aber was sollen wir denn machen?«, fragte Walburga.
Darauf wusste Matthäus auch keine Antwort.
»Setzen Sie ein Zeichen tätiger Reue«, schlug Stoltz vor. »Warten Sie nicht, bis die Landjäger bei unserem Abteil sind. Gehen Sie zu ihnen. Präsentieren Sie Ihre Ware und sagen Sie ihnen, wie leid Ihnen alles tut. Erzählen sie von Not, von hungernden, weinenden Kindern.«
Nun räusperte sich Matthäus. »Entschuldigen Sie, Hochwürden …« Stoltz unterbrach ihn. »Bei uns Anglikanern heißt es Most Reverend.«
Matthäus setzte noch mal an. »Meinetwegen, Most …«
Stoltz unterbrach wieder. »Gilt auch nur erst ab Bischof.«
Matthäus wurde ungeduldig. »Wie auch immer. Ich finde einfach, Ihre Idee taugt nichts. Die Landjäger werden lachen, uns unseren Krempel abnehmen, und wir stehen nur doof da.«
Dem konnte Stoltz nicht wirklich widersprechen. Er dachte nach.
»Können Sie lesen?«
Beide nickten fast gleichzeitig. »Ein bisschen. Und eigentlich nur Großbuchstaben. Aber es geht schon.«
»Sehr schön. Aber davon müssen die Landjäger ja nichts wissen.«
Es dauerte ein bisschen, bis der Kreuzer fiel. Aber er fiel.
»Sie meinen, wir sollen sagen, wir sind in den falschen Zug eingestiegen, weil wir das Schild am Bahnhof nicht lesen konnten?«, fragte Walburga langsam.
»Genau. Vorher müssen Sie natürlich Ihre Ware in ein paar Bündel schnüren. Die tragen Sie ganz offen. Dann gehen Sie zu den Landjägern und fragen naiv: Seit wann hält denn der Zug nach Durlach auf freier Strecke?«
Matthäus überlegte. »Das könnte klappen«, sagte er zögernd. »Aber die Schwaben halten uns doch sowieso schon für Trottel. Sollen wir ihnen jetzt auch noch freiwillig Material liefern?«
»Willst du lieber, dass nächste Woche jeder im Dorf weiß, dass wir beim Schmuggeln erwischt wurden?«, fragte Walburga.
Matthäus überlegte lange. Man konnte förmlich spüren, wie die Zahnräder im Gehirnkasten hinter seiner Stirn ratterten.
»Von mir aus«, sagte er schließlich. »Was schert mich, was in der Zeitung steht? Ich kann doch sowieso nicht lesen.«
Walburga lachte erleichtert. Stoltz verließ das Abteil, die beiden zogen die Vorhänge zu und entledigten sich ihrer Schmuggelware. Als sie, beide mit zwei großen Kleiderbündeln bewaffnet, wieder auf den Gang traten, wirkten sie erheblich schlanker.
»Viel Glück«, rief ihnen Stoltz hinterher.
Als er zu seiner Zufriedenheit beobachtete, dass Walburga und Matthäus die beiden Landjäger wort- und gestenreich über ihre Lese-Rechtschreib-Schwäche informierten, sprang Stoltz aus dem Zug auf den Bahnsteig. Die beiden anderen Gendarmenpärchen beachteten ihn nicht. Stoltz lief den Zug entlang, in Richtung der immer noch fauchenden und schmauchenden Lokomotive.
Stoltz brauchte ein Versteck. Am besten zwei Verstecke. Er zog das Bahnhofsgebäude in Erwägung, verwarf es dann aber wieder. Er hatte keine Ahnung, wie es im Innern des Gebäudes aussah, außerdem: Wann sollte er hier wieder auftauchen?
Direkt hinter der Lokomotive führte der Zug einen Gepäckwagen. Eher einem Impuls als einem Gedanken folgend, rüttelte Stoltz an der Schiebetür. Sie war nicht verschlossen. Stoltz schlüpfte in den Gepäckwagen. Nachdem sich seine Augen an das Halbdunkel gewöhnt hatten, erkannte er zwei Dinge: Die Wände des Wagens waren – warum auch immer – doppelt isoliert, und an der Decke gab es eine Verkleidung.
Mit seinem Taschenmesser drückte Stoltz geschickt ein Paneel aus der Holzverkleidung. Dann versteckte er dahinter einen Umschlag aus stabilem braunem Packpapier, der mehrfach versiegelt war.
Stoltz arbeitete ruhig und konzentriert. Er setzte das Paneel sauber wieder ein, ohne dass auch nur ein Span vom Holz absplitterte. Dann stieg er auf zwei Postsäcke und machte sich an der Deckenverkleidung zu schaffen. Das war komplexer, aber Stoltz fand auch hier schnell einen Hohlraum, der groß genug für seine Zwecke war. Stoltz entnahm seinem Priesterrock eine kleine Segeltuchtasche, in die er eine grob gestrickte Socke steckte, die einen Siebenundfünfziger Colt-Revolver enthielt. Stoltz verstaute die Handfeuerwaffe in der Decke so geschickt wie den Umschlag in der Wand. Der ganze Vorgang hatte nur ein paar Minuten gedauert.





























