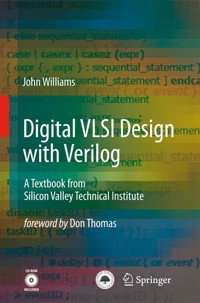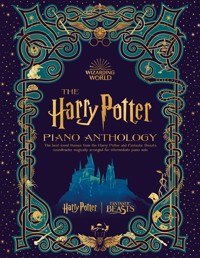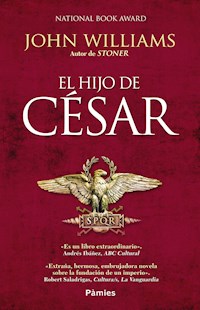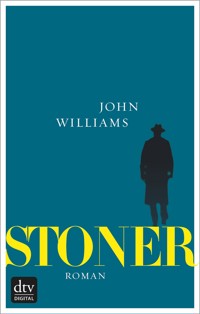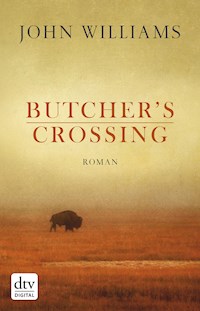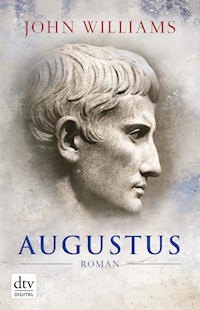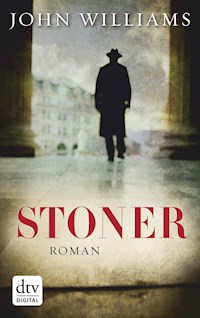
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich habe mich in ihn verliebt.« Anna Gavalda ›Stoner‹ ist einer der großen vergessenen Romane der amerikanischen Literatur. John Williams erzählt das Leben eines Mannes, der, als Sohn armer Farmer geboren, schließlich seine Leidenschaft für Literatur entdeckt und Professor wird – es ist die Geschichte eines genügsamen Lebens, das wenig Spuren hinterließ. Ein Roman über die Freundschaft, die Ehe, ein Campus-Roman, ein Gesellschaftsroman, schließlich ein Roman über die Arbeit. Über die harte, erbarmungslose Arbeit auf den Farmen; über die Arbeit, die einem eine zerstörerische Ehe aufbürdet, über die Mühe, in einem vergifteten Haushalt mit geduldiger Einfühlung eine Tochter großzuziehen und an der Universität oft teilnahmslosen Studenten die Literatur nahebringen zu wollen. ›Stoner‹ ist kein Liebesroman, aber doch und vor allem ein Roman über die Liebe: über die Liebe zur Poesie, zur Literatur, und auch über die romantische Liebe. Es ist ein Roman darüber, was es heißt, ein Mensch zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Über das Buch
›Stoner‹ war einer der großen vergessenen Romane der amerikanischen Literatur. John Williams erzählt das Leben eines Mannes, der, als Sohn armer Farmer geboren, schließlich seine Leidenschaft für Literatur entdeckt und Professor wird – es ist die Geschichte eines genügsamen Lebens, das wenig Spuren hinterließ, aber auch die Geschichte eines wahrhaftigen Lebens. Ein Roman über die Freundschaft, die Ehe, ein Campus-Roman, ein Gesellschaftsroman, schließlich ein Roman über die Arbeit. Über die harte, erbarmungslose Arbeit auf den Farmen; über die Arbeit, die einem eine zerstörerische Ehe aufbürdet, über die Mühe, in einem vergifteten Haushalt mit geduldiger Einfühlung eine Tochter großzuziehen und an der Universität oft teilnahmslosen Studenten die Literatur nahebringen zu wollen. Vor allem aber ist ›Stoner‹ ein Roman über die Liebe: die Liebe zur Poesie, zur Literatur, und auch über die Liebe zwischen Mann und Frau.
Es ist ein Roman darüber, was es heißt, ein Mensch zu sein.
Von John Williams sind bei dtv außerdem lieferbar:
Butcher's Crossing
Augustus
Nichts als die Nacht
John Williams
Stoner
Roman
Aus dem Amerikanischen von Bernhard Robben
Dieses Buch ist meinen Freunden und früheren Kollegen am Fachbereich Englisch der Universität Missouri gewidmet. Sie werden ohne Weiteres erkennen, dass es sich hierbei um ein Werk der Fiktion handelt, dass keine der darin vorkommenden Personen noch lebende oder bereits gestorbene Vorbilder haben und dass kein Ereignis seinen Widerpart in jener Wirklichkeit findet, wie wir sie an der Universität Missouri kannten. Sie werden ebenfalls bemerken, dass ich mir mit der Universität Missouri gewisse Freiheiten sowohl in räumlicher wie in historischer Hinsicht erlaubt habe, weshalb auch sie letztlich ein fiktiver Ort ist.
I
William Stoner begann 1910, im Alter von neunzehn Jahren, an der Universität von Missouri zu studieren. Acht Jahre später, gegen Ende des Ersten Weltkriegs, machte er seinen Doktor der Philosophie und übernahm einen Lehrauftrag an jenem Institut, an dem er bis zu seinem Tode im Jahre 1956 unterrichten sollte. Er brachte es nicht weiter als bis zum Assistenzprofessor, und nur wenige Studenten, die an seinen Kursen teilnahmen, erinnern sich überhaupt mit einiger Deutlichkeit an ihn. Als er starb, spendeten seine Kollegen der Universitätsbibliothek ihm zu Ehren ein mittelalterliches Manuskript, das man dort vermutlich noch heute in der Abteilung für seltene Bücher findet. Es enthält die Widmung: ›Der Bibliothek der Universität Missouri überreicht zur Erinnerung an William Stoner, Fachbereich Englisch. Von seinen Kollegen.‹
Der ein oder andere Student, der den Namen William Stoner liest, mag sich fragen, wer er war, doch geht die Neugier selten über müßige Spekulationen hinaus. Stoners Kollegen, die ihn zu seinen Lebzeiten nicht besonders schätzten, erwähnen ihn heutzutage nur noch selten: Den Älteren bedeutet sein Name eine Erinnerung an das Ende, das sie alle erwartet, für die Jüngeren ist er bloß ein Klang, der ihnen weder die Vergangenheit näherbringt noch eine Person, die sich mit ihnen oder ihrer Karriere verbinden ließe.
Er wurde 1891 auf einer kleinen Farm im tiefsten Missouri unweit des Dorfes Booneville geboren, etwa sechzig Kilometer außerhalb der Universitätsstadt Columbia. Obwohl die Eltern bei seiner Geburt noch jung waren – der Vater fünfundzwanzig, die Mutter kaum zwanzig –, fand Stoner sie auch als kleiner Junge schon alt. Mit dreißig wirkte sein Vater wie fünfzig und blickte, von der Arbeit gebeugt, ohne Hoffnung über den kargen Flecken Land, der seine Familie von einem aufs andere Jahr ernährte. Die Mutter nahm ihr Leben so geduldig hin, als währte es nur eine kurze Spanne, die sie durchzustehen hatte. Ihre Augen waren blass und trüb, und die winzigen Falten ringsherum wurden vom dünnen, ergrauenden Haar noch betont, das straff am Schädel anlag und im Nacken zu einem Knoten zusammengefasst war.
Solange William Stoner sich erinnern konnte, hatte er Pflichten zu erledigen. Mit sechs Jahren melkte er die mageren Kühe, fütterte die Schweine im wenige Meter vom Haus entfernten Stall und sammelte die kleinen Eier einer Schar dürrer Hühner ein. Auch als er anfing, in die zwölf Kilometer entfernte Landschule zu gehen, bestimmten seinen Tag die unterschiedlichsten Tätigkeiten, vom Morgengrauen bis nach Sonnenuntergang. Und bereits mit siebzehn begannen seine Schultern, sich unter der Last dieser Mühen zu beugen.
Es war ein einsamer Hof, auf dem er das einzige Kind blieb, doch die Not der täglichen Plackerei hielt den Haushalt zusammen. Abends saßen die drei beim Licht der Petroleumlampe und starrten in die gelbe Flamme; der einzige Laut, den man in der knappen Stunde zwischen Abendbrot und Bett hören konnte, war meist nur das Räkeln eines müden Körpers auf einem harten Stuhl oder das leise Knarren eines Pfostens, der sacht unter dem Alter des Mauerwerks nachgab.
Das Haus war etwa im Quadrat gebaut, und das rohe Gebälk, das auf der Veranda und an den Türen schon ein wenig durchhing, hatte mit den Jahren die Farben der ausgelaugten Felder angenommen – grau und braun mit weißlichen Streifen. Auf der einen Seite war das langgezogene Wohnzimmer, spärlich möbliert mit geradlehnigen Stühlen und einigen grob behauenen Tischen, außerdem die Küche, in der die Familie gewöhnlich ihre wenige gemeinsame Zeit verbrachte. Auf der anderen Seite lagen zwei Schlafzimmer, in denen jeweils ein eisernes, weiß emailliertes Bettgestell, ein einzelner Stuhl und ein Tisch mit Lampe und Waschschüssel standen. Der Boden war aus blanken, ungleich verlegten, altersrissigen Dielen, durch die ständig Staub drang, der von Stoners Mutter Tag für Tag wieder nach draußen gefegt wurde.
In der Schule erledigte William Stoner seine Aufgaben, als zählten sie zu seinen täglichen Pflichten, auch wenn sie nicht ganz so anstrengend waren wie die auf der Farm. Im Frühjahr 1910 schloss er die Highschool ab und nahm an, auf der Farm nun weitere Arbeiten übernehmen zu müssen; es schien ihm, als sei der Vater in letzter Zeit immer schwerfälliger und müder geworden.
Eines Abends im späten Frühling aber, nachdem die beiden Männer den ganzen Tag lang Mais gehackt hatten, richtete sein Vater, sobald das Abendbrot abgeräumt worden war, in der Küche das Wort an ihn.
»Der Viehhändler kam letzte Woche.«
William blickte von dem ordentlich mit einem rot-weiß karierten Wachstuch bedeckten runden Küchentisch auf, sagte aber nichts.
»Angeblich gibt’s ein neues Institut an der Universität in Columbia. Heißt Landwirtschaftscollege. Meinte, du solltest hin. Dauert vier Jahre.«
»Vier Jahre«, sagte William. »Kostet das was?«
»Für Kost und Logis kannst du arbeiten«, erwiderte sein Vater. »Deine Ma hat einen Vetter, dem gehört bei Columbia ein Hof. Und dann wären da noch Bücher und so Sachen, aber ich würde dir jeden Monat zwei, drei Dollar schicken.«
William spreizte die Hände auf dem im Licht der Lampe matt schimmernden Tischtuch. Er war nie weiter fort als im fünfzehn Meilen entfernten Booneville gewesen und musste schlucken, ehe er mit ruhiger Stimme fragen konnte:
»Glaubst du denn, du kommst hier allein zurecht?«
»Deine Ma und ich, wir schaffen das schon. Ich könnte auf den oberen zwanzig Morgen Weizen anpflanzen, macht weniger Arbeit.«
William sah zu seiner Mutter hinüber. »Ma?«, fragte er.
Mit tonloser Stimme antwortete sie: »Du tust, was dein Pa dir sagt.«
»Ihr wollt das wirklich?«, fragte er, als rechne er halb damit, dass sie es sich anders überlegten. »Ihr wollt wirklich, dass ich das mache?«
Sein Vater verlagerte sein Gewicht auf dem Stuhl und betrachtete die dicken, schwieligen Finger, in deren Risse die Erde so tief eingedrungen war, dass sie sich nicht mehr herauswaschen ließ. Dann verschränkte er die Hände und hielt sie über dem Tisch, als wollte er beten.
»War nicht viel, was ich an Schule hatte«, sagte er, den Blick noch auf die Hände gerichtet. »Hab auf dem Hof angefangen, sobald ich mit der sechsten Klasse fertig war. Hielt auch nicht viel von der Schule, als ich noch jung war, aber heute? Ich weiß nicht. Kommt mir vor, als würde das Land von Jahr zu Jahr trockener und der Boden schwerer zu bearbeiten, dabei war es schon kein guter Boden, als ich noch klein war. Der Viehhändler sagt, es gibt neue Ideen, neue Methoden, die sie einem an der Universität beibringen. Vielleicht hat er recht. Manchmal, auf dem Acker, da mache ich mir so meine Gedanken.« Er schwieg. Die Finger pressten sich fester aneinander, die verschlungenen Hände sanken auf den Tisch. »… so meine Gedanken.« Stirnrunzelnd betrachtete er seine Hände und schüttelte den Kopf. »Kommenden Herbst gehst du zur Universität. Und deine Ma und ich, wir schaffen das schon.«
Es war die längste Rede, die ihm sein Vater je gehalten hatte. Also fuhr er im Herbst nach Columbia und schrieb sich am Kolleg für Agrarwirtschaft ein.
Mit einem neuen Anzug aus feinem schwarzen Tuch, bestellt aus dem Katalog von Sears & Roebuck und bezahlt mit Mutters Eiergeld, sowie einem gebrauchten Mantel vom Vater, einer Hose aus blauer Serge, die er bislang nur einmal im Monat zum Besuch der Methodistenkirche in Booneville getragen hatte, sowie mit zwei weißen Hemden, Arbeitssachen zum Wechseln und fünfundzwanzig Dollar in bar, die sich sein Vater vom Nachbarn auf den Herbstweizen geliehen hatte, machte er sich auf den Weg nach Columbia. Von Booneville aus, wohin ihn Vater und Mutter am frühen Morgen mit dem von ihrem Esel gezogenen, flachen Hofkarren gebracht hatten, ging er zu Fuß.
Es war ein warmer Herbsttag, der Weg von Booneville nach Columbia staubig und Stoner schon gut eine Stunde unterwegs, als neben ihm ein Lieferwagen hielt. Der Fahrer fragte, ob er aufsteigen wolle, woraufhin Stoner nickte und sich auf den Kutschbock setzte. Bis hinauf zu den Knien war die Sergehose rot vom Staub, das von Sonne und Wind gegerbte Gesicht sandverkrustet, wo sich Straßenstaub und Schweiß vermischt hatten. Während der langen Fahrt klopfte er immer wieder mit verlegener Geste die Hosenbeine ab und fuhr sich mit den Fingern durchs glatte hellbraune Haar, das einfach nicht flach anliegen wollte.
Sie erreichten Columbia am späten Nachmittag. Der Fahrer ließ Stoner am Stadtrand absteigen und zeigte auf eine Gruppe von hohen Ulmen überschatteter Bauten. »Das ist die Universität«, sagte er. »Da werden Sie studieren.«
Noch mehrere Minuten, nachdem der Mann weitergefahren war, stand Stoner reglos da und starrte zu dem Gebäudekomplex hinüber. Nie zuvor hatte er etwas so Imposantes gesehen. Die roten Ziegelsteinbauten ragten aus einer weiten, allein von Steinmauern und kleinen Gärten unterbrochenen Grünanlage auf. In der Ehrfurcht, die er empfand, schwang ein überraschendes Gefühl der Sicherheit und Gelassenheit mit, wie er es nie zuvor empfunden hatte. Und obwohl es schon spät war, wanderte er viele Minuten lang am Rand des Universitätsgeländes auf und ab und schaute, als wäre ihm das Betreten nicht gestattet.
Es war schon fast dunkel, als er einen Passanten nach Ashland Gravel fragte, jener Straße, die zur Farm von Jim Foote führte, dem Vetter seiner Mutter, für den er arbeiten sollte; und es war längst dunkel, als er zu dem weißen zweistöckigen Holzhaus kam, in dem er von nun an wohnen würde. Er kannte die Footes noch nicht, und es kam ihm seltsam vor, sie so spät abends aufzusuchen.
Sie begrüßten ihn mit einem Kopfnicken, um ihn dann aufmerksam zu begutachten. Nach einer Weile, in der Stoner verlegen in der Tür stehen blieb, bedeutete ihm Jim Foote, in ein kleines, düsteres, mit Möbeln und Nippes auf matt glänzenden Tischen vollgestelltes Wohnzimmer zu treten. Er setzte sich nicht.
»Zu Abend gegessen?«, fragte Foote.
»Nein, Sir«, antwortete Stoner.
Mrs Foote lockte ihn mit gekrümmtem Zeigefinger und tappte davon. Stoner folgte ihr durch mehrere Zimmer in eine Küche, wo sie ihn anwies, sich an den Tisch zu setzen, um dann einen Krug Milch und mehrere Kanten kaltes Maisbrot vor ihn hinzustellen. Er nippte an der Milch, bekam aber mit seinem vor Aufregung trockenen Mund keinen Bissen hinunter.
Foote kam herein und stellte sich neben seine Frau. Er war ein kleiner Mann, kaum eins sechzig groß, mit hagerem Gesicht und kantiger Nase. Seine Frau war zehn Zentimeter größer; eine dicke, randlose Brille verdeckte ihre Augen, und die dünnen Lippen hielt sie zusammengepresst. Beide Eheleute sahen gierig zu, wie er an seiner Milch nippte.
»Morgens Vieh füttern und tränken, Schweinetröge auffüllen«, brach es aus Foote heraus.
Stoner blickte ihn verständnislos an. »Was?«
»Das machst du morgens«, sagte Foote, »vor der Universität. Abends fütterst du wieder das Vieh, füllst noch einmal die Tröge auf, sammelst Eier ein und melkst die Kühe. Falls du dann noch Zeit hast, kümmerst du dich ums Feuerholz. Und an Wochenenden hilfst du mir bei meiner Arbeit.«
»Ja, Sir«, antwortete Stoner.
Foote musterte ihn einen Moment lang. »College«, sagte er dann und schüttelte den Kopf.
Um sich neun Monate im Jahr Kost und Logis zu verdienen, fütterte und tränkte er also das Vieh, füllte die Schweinetröge, sammelte Eier, melkte Kühe und hackte Holz. Außerdem pflügte und eggte er die Felder, grub Baumstümpfe aus (wobei er sich im Winter durch zehn Zentimeter gefrorenen Boden arbeiten musste) und schlug Butter für Mrs Foote, die mit im Takt nickendem Kopf und grimmiger Zustimmung dabei zusah, wie der Holzstampfer durch den Rahm platschte.
Stoner wurde im oberen Stock untergebracht, in einem ehemaligen Vorratsraum, dessen Mobiliar allein aus einem eisernen schwarzen Bettgestell mit durchhängendem Rost bestand, auf dem eine dünne Federmatratze lag, sowie einem wackligen Tisch mit Petroleumlampe, einem harten Stuhl auf unebenem Boden und einer großen Kiste, auf der er schrieb. Im Winter wärmte ihn nur die aufgeheizte Luft, die von den unteren Räumen durch den Boden aufstieg; er wickelte sich in zerlumpte Flickendecken, dazu in die ihm zugeteilten Wolldecken und blies sich in die Hände, damit er die Seiten der Bücher umblättern konnte, ohne sie zu zerreißen.
Seine Arbeit für die Universität erledigte er wie die Arbeit auf der Farm – gründlich, gewissenhaft, weder gern noch widerwillig. Am Ende des ersten Jahres lag sein Notenschnitt bei Zwei minus, und es freute ihn, dass er nicht schlechter abgeschnitten hatte; dass er nicht besser war, kümmerte ihn kaum. Er wusste, dass er Sachen lernte, von denen er zuvor nichts geahnt hatte, doch war für ihn nur wichtig, dass er sich im zweiten Jahr hoffentlich ebenso gut halten würde wie im ersten.
Im Sommer nach dem ersten Studienjahr kehrte er nach Hause zurück und half bei der Ernte. Einmal fragte ihn der Vater, wie es ihm an der Universität gefalle, und er antwortete, es gefalle ihm gut. Sein Vater nickte und kam mit keinem Wort mehr darauf zurück.
Erst in seinem zweiten Jahr sollte William Stoner erfahren, warum er ans College gekommen war.
Im zweiten Jahr war er auf dem Campus eine vertraute Gestalt. Bei jedem Wetter trug er denselben Anzug aus schwarzem Tuch, dazu ein weißes Hemd mit schmaler Krawatte, die Handgelenke ragten aus den Jackenärmeln hervor, und die Hose schlotterte ihm um die Beine, als gehörte sie zu einer Uniform, die zuvor von jemand anderem getragen worden war.
Mit der zunehmenden Gleichgültigkeit seiner Verwandten wuchs die Zahl seiner Tätigkeiten auf der Farm; außerdem verbrachte er lange Abende auf dem Zimmer damit, seine Universitätsaufgaben methodisch abzuarbeiten. Er hatte den Studiengang begonnen, der mit einem Bakkalaureat in Naturwissenschaften abgeschlossen wurde, und musste während des ersten Semesters seines zweiten Studienjahres zwei Grundkurse in Naturwissenschaft belegen, einen Kurs in landwirtschaftlicher Bodenanalyse sowie einen Kurs, der für alle Studenten vorgeschrieben war, obwohl ihm keine besondere Bedeutung beigemessen wurde – eine Einführung in die englische Literatur.
Schon nach wenigen Wochen hatte er mit den Kursen in Naturwissenschaft kaum noch Probleme, obwohl es so viel zu tun gab, so vieles, was er sich merken musste. Der Kurs in landwirtschaftlicher Bodenanalyse weckte auf eine eher allgemeine Weise sein Interesse, da ihm noch nie der Gedanke gekommen war, dass jene bräunlichen Klumpen, die er nahezu sein Leben lang bearbeitet hatte, etwas anderes als das sein könnten, was sie allem Anschein nach waren, und er begann zu ahnen, wie seine wachsende Kenntnis von Nutzen sein würde, wenn er denn erst einmal zur Farm des Vaters zurückgekehrt war. Nur der vorgeschriebene Einführungskurs in die englische Literatur verstörte und beunruhigte ihn auf eine Weise wie nichts zuvor.
Der Dozent, ein Mann gesetzteren Alters, Anfang fünfzig, Archer Sloane mit Namen, ging seinem Lehrauftrag offenbar nur widerwillig und mit scheinbarer Geringschätzung nach, so als registriere er zwischen seinem Wissen und dem, was er vermitteln konnte, eine derart profunde Kluft, dass sich keinerlei Mühe lohnte, sie schließen zu wollen. Bei den meisten seiner Studenten war er gleichermaßen gefürchtet und unbeliebt, worauf er amüsiert und mit ironischer Distanz reagierte. Archer Sloane war ein Mann mittlerer Größe mit langem, zerfurchtem, glatt rasiertem Gesicht, der die Angewohnheit besaß, sich mit den Fingern ungeduldig durch die graue, lockige Haarmähne zu fahren. Seine Stimme klang flach und trocken, drang über sich kaum bewegende Lippen, die ihr weder Gefühl noch Betonung verliehen, doch die langen, schlanken Finger bewegten sich mit einer Anmut und Überzeugung, als wollten sie den Worten zu einer Ausdruckskraft verhelfen, die seine Stimme ihnen nicht geben konnte.
Wenn Stoner seinen Pflichten auf der Farm nachging oder in der fensterlosen Dachkammer im Dämmerlicht der Lampe blinzelnd seine Bücher studierte, gewahrte er oft, wie das Bild dieses Mannes vor seinem inneren Auge auftauchte. Obwohl es ihm keineswegs leichtfiel, das Gesicht eines anderen Dozenten aufzurufen oder sich an etwas Besonderes aus einem der übrigen Seminare zu erinnern, wartete an der Schwelle seiner Wahrnehmung stets die Gestalt von Archer Sloane auf ihn, seine trockene Stimme und seine so verächtlich wie beiläufig vorgebrachten Worte über irgendeinen Passus in Beowulf oder über einige Verse von Chaucer.
Er spürte, dass er mit dem Einführungskurs nicht wie mit den anderen Kursen zurechtkam. Obwohl er sich an die Autoren und ihre Werke erinnerte, an Daten und Einflüsse, hätte er den ersten Test fast verpatzt, auch mit dem zweiten erging es ihm nicht viel besser. Er las die Bücher, die auf der Leseliste standen, und las sie so oft wieder, dass die Arbeit für die übrigen Kurse darunter zu leiden begann, dennoch blieben, was er las, nur Worte auf dem Papier, und er begriff nicht, welchen Sinn sein Tun hatte.
Also grübelte er über das, was Archer Sloane im Unterricht sagte, als könnte er hinter den im flachen, trockenen Ton vorgebrachten Worten einen Hinweis entdecken, der ihn dorthin führte, wohin er zu gehen hatte. Stoner beugte sich über das Pult seines Schreibstuhls, der zu klein für ihn war, um bequem darauf sitzen zu können, und umklammerte die Tischkanten mit so kräftigem Griff, dass die Knöchel weiß unter der braunen, ledrigen Haut hervortraten; dabei runzelte er konzentriert die Stirn und biss sich auf die Unterlippe. Doch je verzweifelter Stoner und dessen Mitstudenten sich anstrengten, desto erbarmungsloser wurde Archer Sloanes Verachtung. Einmal aber steigerte sich diese Verachtung zu heller Wut und richtete sich allein gegen William Stoner.
Im Seminar hatten sie zwei Stücke von Shakespeare gelesen, und die Woche endete mit dem Studium seiner Sonette. Die Studenten waren gereizt und verwirrt, fast verängstigt von der wachsenden Spannung zwischen ihnen und jener gebeugten Gestalt, die sie hinter dem Rednerpult hervor ansah. Sloane hatte ihnen das dreiundsiebzigste Sonett laut vorgelesen; und nun schweifte sein Blick durch den Raum, die Lippen zu humorlosem Lächeln zusammengepresst.
»Was bedeutet dieses Sonett?«, fragte er abrupt, schwieg wieder und suchte den Raum mit einer grimmigen, beinahe freudigen Hoffnungslosigkeit ab. »Mr Wilbur?« Keine Antwort. »Mr Schmidt?« Jemand hustete. Sloane drehte sich mit dunkel blitzenden Augen zu Stoner um. »Mr Stoner, was bedeutet das Sonett?«
Stoner schluckte und versuchte, den Mund zu öffnen.
»Es ist ein Sonett, Mr Stoner«, erklärte Sloane trocken, »eine lyrische Komposition aus vierzehn Zeilen in einer bestimmten Anordnung, die Sie fraglos auswendig gelernt haben. Es wurde in der englischen Sprache geschrieben, die Sie, wenn ich nicht irre, bereits seit einigen Jahren beherrschen. Der Verfasser heißt William Shakespeare, ein Dichter, der zwar schon tot ist, aber in den Köpfen nicht weniger Menschen dennoch einen Platz von einiger Bedeutung einnimmt.« Er blickte Stoner noch einen Moment an, dann wurde der Blick ausdruckslos, während die Augen einen unsichtbaren Punkt außerhalb des Seminars fixierten. Ohne ins Buch zu schauen, trug er das Gedicht erneut vor, wobei seine Stimme tiefer und weicher klang, so als wären Wort, Ton und Rhythmus einen Moment lang er selbst geworden:
Den späten Herbst kannst Du in mir besehen:
Die letzten gelben Blätter eingegangen
An Zweigen, die dem Frost kaum widerstehen,
Und Chorruinen, wo einst Vögel sangen.
In mir siehst Du den späten Tag sich neigen,
Das Dunkel in die graue Dämmrung dringen,
Die Nacht mit ihrer Schwärze langsam steigen
Und Todes Bruder, Schlaf, die Welt umschlingen.
In mir siehst Du die Glut von alten Bränden,
Gebettet auf die Asche bessrer Zeiten –
Ein Sterbelager, wo sie muss verenden,
Verzehrt vom Brennstoff eigner Lustbarkeiten.
Siehst Du all dies, wird’s Deine Liebe steigern:
Denn was Du liebst, wird Tod Dir bald verweigern.
In einem Augenblick der Stille räusperte sich jemand. Sloane wiederholte die letzten Zeilen, und seine Stimme wurde flach, er wieder er selbst.
Siehst Du all dies, wird’s Deine Liebe steigern:
Denn was Du liebst, wird Tod Dir bald verweigern.
Sloanes Augen richteten sich wieder auf William Stoner, und er meinte trocken: »Über drei Jahrhunderte hinweg redet Mr Shakespeare mit Ihnen, Mr Stoner. Können Sie ihn hören?«
William Stoner fiel auf, dass er mehrere Sekunden lang die Luft angehalten hatte. Behutsam atmete er nun weiter und war sich bis ins Detail bewusst, wie die Kleidung über seinen Leib glitt, als ihm der Atem aus den Lungen fuhr. Er wandte den Blick von Sloane ab und ließ ihn durch den Raum wandern. Licht fiel schräg durch die Fenster auf die Gesichter seiner Mitstudenten, doch so, als leuchtete die Helligkeit aus ihnen heraus in die frühe Dämmerung; ein Student blinzelte, und ein dünner Schatten fiel auf eine Wange, in deren Härchen sich Sonnenschein verfing. Stoner spürte, wie sich der feste Griff lockerte, mit dem seine Finger das Schreibpult umklammerten. Er drehte die Hände vor den Augen und staunte, wie braun sie waren, wie passend die Nägel in stumpfen Fingerkuppen ausliefen, und meinte, das unsichtbare Blut durch die winzigen Adern und Arterien strömen, es zart und schutzlos von den Fingerspitzen durch den Körper pochen zu spüren.
Sloane redete wieder. »Was sagt er Ihnen, Mr Stoner? Was bedeutet das Sonett?«
Stoner hob langsam und zögerlich den Blick. »Es bedeutet«, sagte er und streckte mit vager Bewegung die Hände in die Höhe, wobei er spürte, wie sein Blick die Gestalt von Archer Sloane suchte und zugleich glasig wurde. »Es bedeutet«, sagte er noch einmal, konnte aber nicht beenden, was er zu sagen begonnen hatte.
Sloane sah ihn neugierig an. Dann nickte er abrupt, sagte: »Der Unterricht ist beendet« und verließ, ohne jemanden anzusehen, den Raum.
William Stoner war sich der Studenten kaum bewusst, die um ihn herum murmelnd und murrend von den Plätzen aufstanden und nach draußen drängten. Noch mehrere Minuten, nachdem sie gegangen waren, saß er da, ohne sich zu rühren, und starrte vor sich auf die schmalen Bodendielen, deren Lack von den ruhelosen Füßen so vieler Studenten abgetragen worden war, von Menschen, die er nie sehen oder kennenlernen würde. Er ließ die eigenen Füße über den Boden gleiten, hörte das trockene Scharren der Schuhsohlen und konnte das raue Holz durch das Leder spüren. Dann stand er auf und ging langsam nach draußen.
Die leichte Kühle des späten Herbsttages drang durch seine Kleider. Er schaute sich um und sah die kahlen, knorrigen Äste der Bäume, wie sie sich in den fahlen Himmel rankten und wanden. Über den Campus zu ihren Seminaren hastende Studenten rempelten ihn an; und er hörte das Gemurmel ihrer Stimmen, das Klappern der Schuhe auf den Wegen, sah die vor Kälte geröteten Gesichter, die gegen den aufkommenden Wind gesenkten Köpfe. Er musterte sie so neugierig, als hätte er sie nie zuvor gesehen, und fühlte sich ihnen zugleich fern und nah. Er behielt dieses Gefühl, als er zur nächsten Unterrichtsstunde eilte, behielt es auch während der Vorlesung seines Professors für Bodenanalyse, behielt es trotz der monotonen Stimme, die vortrug, was in Notizbücher niedergeschrieben und gelernt werden sollte, eine mühselige Plackerei, die ihm jetzt schon fremd zu werden begann.
Im zweiten Semester dieses Studienjahres meldete sich William Stoner aus beiden Grundkursen Naturwissenschaft ab und schied auch aus dem Studiengang Agrarwirtschaft aus, stattdessen belegte er Einführungskurse in Philosophie und Frühgeschichte sowie zwei Kurse in englischer Literatur. Im Sommer kehrte er wieder auf die Farm seiner Eltern zurück und half dem Vater bei der Ernte; sein Studium an der Universität erwähnte er mit keinem Wort.
Wenn er, bereits viel älter, auf diese letzten beiden Studienjahre zurückblickte, kamen sie ihm vor wie eine unwirkliche Zeit, die zu jemand anderem zu gehören schien, eine Zeit, die nicht im gewohnten steten Fluss vergangen war, sondern in Brüchen und Sprüngen. Ein Augenblick folgte dem nächsten und war doch von ihm getrennt, wodurch Stoner meinte, der Zeit enthoben zu sein, ihr dabei zusehen zu können, wie sie vor ihm gleich einem großen, sich unstet drehenden Diorama ablief.
Er wurde sich in einem zuvor ungekannten Maße seiner selbst bewusst. Manchmal betrachtete er sich im Spiegel, das lange Gesicht mit dem Schopf brauner, spröder Haare, berührte die ausgeprägten Wangenknochen, sah die dürren Handgelenke zentimeterweit aus den Mantelärmeln lugen und fragte sich, ob ihn die anderen ebenso lächerlich fanden, wie er es in seinen Augen war.
Er hatte keine Pläne für die Zukunft, redete aber mit niemandem über diese Ungewissheit und verdiente sich weiterhin bei den Footes Kost und Logis, wenn er auch nicht mehr so lange arbeitete wie noch in den ersten beiden Studienjahren. Drei Stunden am Nachmittag und einen halben Tag am Wochenende ließ er sich von Jim und Serena Foote nach deren Gutdünken ausnutzen; die übrige Zeit beanspruchte er für sich.
Einen Teil davon verbrachte er in seiner kleinen Dachkammer im Haus der Footes, doch sooft er konnte, kehrte er nach Erledigung der Hausaufgaben und der Farmarbeit zur Universität zurück. Abends spazierte er dann gern über den langgezogenen offenen Vorplatz unter den dort schlendernden, leise miteinander murmelnden Paaren und fühlte sich ihnen verbunden, obwohl er keinen Menschen kannte und mit niemandem redete. Manchmal blieb er in der Mitte des Platzes stehen und schaute auf die fünf riesigen, aus kühlem Gras in die Nacht aufragenden Säulen vor Jesse Hall, die, wie er wusste, Überreste des ursprünglichen, vor vielen Jahren durch einen Brand zerstörten Universitätsgebäudes waren. Grausilbern im Mondlicht, klar und rein, schienen sie ihm ein Sinnbild des Lebensweges zu sein, für den er sich entschieden hatte, so wie ein Tempel Sinnbild des in ihm verehrten Gottes war.
In der Universitätsbibliothek wanderte er zwischen den Regalen umher, unter abertausend Büchern, und atmete den modrigen Geruch von Leder, Leinen und trockenem Papier ein, als wäre es ein exotisches Parfüm. Manchmal blieb er stehen, zog einen Band aus dem Regal und hielt ihn einen Augenblick in den großen Händen, die noch immer kribbelten beim unvertrauten Gefühl von Buchrücken, Buchdeckel und nachgiebigem Papier. Dann blätterte er ein wenig, las hier und da einen Abschnitt und schlug die Seiten mit steifen Fingern so behutsam um, als könnte er sie in seinem Ungeschick zerreißen und damit vernichten, was sie so beharrlich zu offenbaren trachteten.
Er hatte keine Freunde, und zum ersten Mal in seinem Leben wurde er sich seiner Einsamkeit bewusst. Manchmal sah er abends in seiner Dachkammer von dem Buch auf, in dem er las, und blickte in die dunklen Winkel des Zimmers, dorthin, wo Lampenlicht mit Schatten spielte. Starrte er nur lange und intensiv genug, verdichtete sich das Dunkel zu einem Licht, das die flüchtigen Konturen dessen annahm, was er gerade gelesen hatte. Er konnte spüren, dass er außerhalb der Zeit existierte, und fühlte sich wie an jenem Tag im Seminar, an dem Archer Sloane mit ihm gesprochen hatte. Die Vergangenheit schälte sich aus dem Dunkel, in dem sie blieb, und die Toten erhoben sich, um vor ihm zum Leben zu erwachen; beide, die Vergangenheit und die Toten, mischten sich in die Gegenwart und unter die Lebenden, wodurch Stoner einen intensiven Moment lang eine Vision von Dichtigkeit überkam, in die er fest eingefügt war und der er nicht entkommen konnte, der er auch gar nicht entkommen wollte. Vor ihm gingen Tristan und Isolde die schoene Minne; Paolo und Francesca wirbelten durch die glühende Dämmerung; Helena und der strahlende Paris traten aus dem Zwielicht, die Mienen bitter angesichts der Folgen ihres Tuns. Und er war auf eine Weise bei ihnen, wie er nie bei seinen Mitmenschen sein konnte, die von Seminar zu Seminar eilten, ihre Heimstatt in einer großen Universität Columbias fanden und unbekümmert im tiefsten Missouri lebten.
Im ersten Jahr lernte er Griechisch und Latein gut genug, um einfache Texte lesen zu können; seine Augen waren oft rot und brannten vor Überanstrengung und Schlafmangel. Manchmal dachte er daran, wie er noch vor wenigen Jahren gewesen war, und ihn erstaunte die Erinnerung an diese seltsame Gestalt, braun und teilnahmslos wie die Erde, der sie entsprungen war. Dachte er an seine Eltern, schienen sie ihm beinahe ebenso seltsam wie das Kind, das sie geboren hatten, doch empfand er für sie eine Mischung aus Mitleid und verhaltener Liebe.
Etwa gegen Mitte seines vierten Jahres an der Universität sprach ihn eines Tages nach dem Unterricht Archer Sloane an und bat ihn, zu einer Unterredung in sein Büro zu kommen.
Es war Winter, und ein klammer Nebel hing tief über dem Campus. Noch am späten Vormittag glitzerte Raureif an den dürren Zweigen der Hartriegelbüsche; funkelnde Kristalle überzogen den die großen Säulen vor Jesse Hall hinaufrankenden schwarzen Wein und glitzerten in all dem Grau. Sein Mantel war so schäbig und verschlissen, dass Stoner beschlossen hatte, ihn trotz der Kälte nicht für den Termin bei Sloane anzuziehen. Bibbernd eilte er über den Weg und die breiten Steinstufen hinauf, die zur Jesse Hall führten.
Nach der Kälte draußen war es drinnen richtig heiß. Das Grau von draußen sickerte durch Fenster und Glastüren auf beiden Seiten des Flurs, sodass die gelben Fliesen heller schimmerten als das Licht, das auf sie fiel; dunkel glimmten die großen Eichenpfeiler und Wischwände. Schuhe scharrten über den Boden, das Stimmengemurmel wurde von den enormen Weiten der Flure gedämpft; undeutliche Gestalten trieben langsam dahin, begegneten und trennten sich, und die betäubende Luft verströmte den Geruch geölter Wände und feuchter Wollsachen. Stoner ging die Treppe aus glattem Marmor hinauf zu Archer Sloanes Büro im ersten Stock. Er klopfte an die verschlossene Tür, hörte eine Stimme antworten und trat ein.
Das schmale, langgezogene Zimmer wurde von einem einzigen Fenster am hinteren Ende erhellt. Mit Büchern überladene Regale reichten bis an die Decke, und neben dem Fenster stand ein zwischen die Regale gedrängter Tisch, an dem Archer Sloane saß, halb zu ihm umgedreht, eine dunkle Silhouette vor dem Licht.
»Mr Stoner«, begrüßte ihn Sloane trocken, erhob sich halb und wies auf einen ihm gegenüberstehenden, lederbezogenen Sessel. Stoner setzte sich.
»Ich habe mir Ihre Arbeiten angesehen.« Sloane verstummte, nahm einen Ordner vom Tisch und musterte ihn mit ironischer Reserviertheit. »Ich hoffe, meine Neugier ist Ihnen nicht unangenehm.«
Stoner feuchtete die Lippen an, verlagerte sein Gewicht und versuchte, die großen Hände so zu falten, dass sie unsichtbar wurden. »Nein, Sir, ist sie nicht«, antwortete er mit heiserer Stimme.
Sloane nickte. »Gut. Mir ist aufgefallen, dass Sie Ihr Studium als Student der Agrarwirtschaft begonnen haben, im zweiten Jahr aber zur Literaturwissenschaft wechselten. Ist das korrekt?«
»Ja, Sir«, sagte Stoner.
Sloane lehnte sich in seinem Sessel zurück und schaute zu dem Lichtviereck auf, das durch das kleine, hohe Fenster fiel. Er tippte die Fingerspitzen aneinander und wandte sich dann wieder dem jungen Mann zu, der steif vor ihm hockte.
»Der offizielle Zweck dieses Gesprächs ist es, Ihnen mitzuteilen, dass Sie die Änderung Ihrer Studienfächer beantragen müssen und Ihre Absicht, das anfängliche Studienprogramm aufgeben und sich endgültig für ein neues Studienziel entscheiden zu wollen, förmlich kundzutun haben. Eine Angelegenheit von fünf Minuten im Büro des Sekretariats. Sie kümmern sich darum, nicht wahr?«
»Ja, Sir«, erwiderte Stoner.
»Doch wie Sie bereits erraten haben dürften, ist dies nicht der eigentliche Grund, weshalb ich Sie bat, bei mir vorbeizuschauen. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich Sie ein wenig nach Ihren Zukunftsplänen befrage?«
»Nein, Sir«, antwortete Stoner und blickte auf seine eng ineinander verflochtenen Hände.
Sloane strich über den Aktenordner, den er auf seinen Schreibtisch gelegt hatte. »Wenn ich mich nicht irre, waren Sie bereits ein wenig älter, als Sie an die Universität kamen. Fast zwanzig, glaube ich?«
»Ja, Sir.«
»Und damals hatten Sie vor, den Studiengang Agrarwirtschaft zu absolvieren?«
»Ja, Sir.«
Sloane lehnte sich wieder in seinem Sessel zurück und sah zu der im Zwielicht verschwindenden hohen Decke hinauf. Dann fragte er abrupt: »Und wie sehen jetzt Ihre Pläne aus?«
Stoner blieb stumm. Das war etwas, woran er nicht gedacht hatte, woran er nicht denken wollte. Schließlich antwortete er leicht verstimmt: »Ich weiß nicht. Ich habe mir darüber bislang kaum Gedanken gemacht.«
»Freuen Sie sich auf den Tag, an dem Sie diese klösterlichen Mauern verlassen und in das hinaustreten können, was manch einer die Welt nennt?«
Stoner grinste durch seine Verlegenheit hindurch. »Nein, Sir.«
Sloane tippte auf den Papierstapel auf seinem Tisch. »Diese Unterlagen haben mir verraten, dass Sie aus einer ländlichen Gegend stammen. Ich nehme also an, dass Ihre Eltern Farmer sind?«
Stoner nickte.
»Und wollen Sie auf diese Farm zurückkehren, sobald Sie hier Ihren Abschluss gemacht haben?«
»Nein, Sir«, erwiderte Stoner, und die Bestimmtheit seines Tons überraschte ihn. Mit einigem Erstaunen registrierte er die Entscheidung, die er gerade getroffen hatte.
Sloane nickte. »Es würde mich nicht sonderlich überraschen, wenn ein ernsthafter Student der Literaturwissenschaften feststellen sollte, dass seine Fähigkeiten den Anforderungen des Ackerbodens nicht recht genügen.«
»Ich gehe nicht zurück«, fuhr Stoner fort, als hätte Sloane nichts gesagt. »Auch wenn ich nicht genau weiß, was ich tun soll.« Er schaute wieder auf seine Hände und sagte, als spräche er zu ihnen: »Ich kann gar nicht glauben, dass ich schon so bald fertig bin und Ende des Jahres die Universität verlassen muss.«
Wie beiläufig sagte Sloane: »Natürlich besteht keine unbedingte Notwendigkeit, dass Sie von der Universität abgehen. Irre ich mich, wenn ich annehme, dass Sie über kein eigenes Einkommen verfügen?«
Stoner schüttelte den Kopf.
»Ihre Studienergebnisse sind ausgezeichnet. Bis auf …«, er zog die Augenbrauen in die Höhe und lächelte, »… bis auf Ihre Zensur für den Einführungskurs in die englische Literatur haben Sie lauter Einsen in sämtlichen Literaturseminaren vorzuweisen, und auch in keinem anderen Fach stehen Sie schlechter als zwei. Wenn Sie also den Unterhalt für ein weiteres Jahr aufzubringen vermöchten, könnten Sie, da bin ich mir sicher, erfolgreich Ihren Magister ablegen, wonach sich für die Dauer der Arbeit an Ihrer Promotion gewiss die Möglichkeit zum Unterrichten ergäbe, falls Sie denn an dergleichen überhaupt interessiert sind.«
Stoner fuhr zurück. »Was wollen Sie damit sagen?«, fragte er und hörte Furcht in seiner Stimme mitschwingen.
Sloane beugte sich vor, bis sein Gesicht nur noch eine Handbreit von ihm entfernt war, sodass Stoner sah, wie sich die Furchen in dem schmalen, langen Gesicht glätteten, und er hörte, wie die trockene, spöttische Stimme plötzlich sanft und ungeschützt klang.
»Wissen Sie es denn nicht, Mr Stoner?«, fragte Sloane. »Kennen Sie sich selbst noch so wenig? Sie sind ein Lehrer.«
Die Wände des Büros wichen zurück, und Sloane schien mit einem Mal sehr fern zu sein. Stoner fühlte sich, als schwebte er im weiten Äther, und er hörte seine Stimme fragen: »Sicher?«
»Ich bin mir sicher«, antwortete Sloane leise.
»Aber wie können Sie das sagen? Woher wollen Sie das wissen?«
»Es ist Liebe, Mr Stoner«, erwiderte Sloane fröhlich. »Sie sind verliebt. So einfach ist das.«
Und so einfach war es. Stoner merkte, wie er Sloane zunickte, irgendwas Belangloses sagte und dann das Büro verließ. Seine Lippen kribbelten, die Fingerspitzen waren taub; er ging wie ein Schlafwandler und war sich doch sehr genau seiner Umgebung bewusst, strich über die polierten holzvertäfelten Flurwände und meinte, Wärme und Alter des Holzes spüren zu können. Langsam folgte er der Treppe und staunte über den kalten, vielädrigen Marmor, der sich unter seinen Füßen ein wenig rutschig anfühlte. Die einzelnen Stimmen der Studenten in den Korridoren hoben sich jetzt deutlich vom gedämpften Murmeln ab, und die Gesichter waren nah und so fremd wie vertraut. Er trat aus der Jesse Hall auf den Campus, und das morgendliche Grau wirkte nicht länger bedrückend; es zog den Blick ins Weite und hinauf in den Himmel, sodass Stoner meinte, einer Möglichkeit entgegenzusehen, für die er keinen Namen hatte.
In der ersten Juniwoche des Jahres 1914 erhielt William Stoner zusammen mit sechzig anderen jungen Männern und einigen wenigen Damen zum Abschluss seines Studiums an der Universität Missouri den Titel eines Bachelors.
Um bei der Feier dabei sein zu können, waren seine Eltern tags zuvor in einem geliehenen, von ihrer alten, falben Stute gezogenen Einspänner aufgebrochen, um nachts die knapp sechzig Kilometer zu den Footes zurückzulegen, wo sie steif von schlafloser Fahrt kurz nach Anbruch der Morgendämmerung eintrafen. Stoner ging hinunter in den Hof, um seine Eltern zu begrüßen. Sie standen Seite an Seite im ersten Morgenlicht und erwarteten ihn.
Ohne sich anzusehen, gaben Vater und Sohn einander die Hand, eine einmalige, rasche Pumpbewegung.
»Wie geht’s?«, fragte sein Vater.
Die Mutter nickte. »Dein Pa und ich sind hergefahren, um bei deiner Abschlussfeier dabei zu sein.«
Einen Moment lang schwieg Stoner, dann sagte er schließlich: »Kommt rein und lasst uns frühstücken.«
Sie saßen allein in der Küche, denn seit Stoner auf dem Hof war, hatten es sich die Footes angewöhnt, lang zu schlafen. Doch weder in diesem Augenblick noch später, als seine Eltern mit dem Frühstück fertig waren, brachte er es über sich, ihnen von seinen geänderten Plänen zu erzählen und von dem Entschluss, nicht auf die Farm zurückzukehren. Ein- oder zweimal setzte er an, sah dann aber die sonnenverbrannten Gesichter, die rosig und nackt aus den neuen Kleidern ragten, und dachte an die lange Fahrt, die seine Eltern zurückgelegt, an die Jahre, in denen sie auf seine Rückkehr gewartet hatten. Steif saß er da, bis sie den Kaffee ausgetrunken hatten und die Footes aufgestanden und in die Küche gekommen waren. Dann sagte er, er müsse früh zur Universität; er sehe sie ja später bei der Feier.
Er wanderte über den Campus mit Barett und geliehenem schwarzem Talar, der schwer und hinderlich war, doch wusste er nicht, wo er ihn lassen sollte. Er dachte daran, was er seinen Eltern sagen musste, und begriff zum ersten Mal, wie endgültig seine Entscheidung war, woraufhin er sich fast wünschte, er könnte sie rückgängig machen. Angesichts des Ziels, das er sich so leichtsinnig gesetzt hatte, fand er sich mit einem Mal schrecklich unzureichend und spürte eine Sehnsucht nach jener Welt, die von ihm aufgegeben worden war. Er trauerte um den eigenen Verlust und um den seiner Eltern, aber noch in seiner Trauer spürte er, wie es ihn fortzog.
Dieses Gefühl von Trauer legte sich während der ganzen Abschlussfeier nicht, und als sein Name fiel und er zum Podium ging, um von einem Mann, dessen Gesicht hinter einem weichen grauen Bart verschwand, seine Urkunde entgegenzunehmen, konnte er die eigene Anwesenheit kaum fassen; die Pergamentrolle in der Hand besaß für ihn keinerlei Bedeutung. Er musste nur immerzu daran denken, dass seine Eltern irgendwo in der Menge saßen, steif und unbehaglich.
Nach der Feier fuhr er mit ihnen zu den Footes zurück, wo sie über Nacht bleiben und bei Tagesanbruch die Rückreise antreten wollten.
Sie saßen im Wohnzimmer. Jim und Serena Foote blieben noch eine Weile mit ihnen auf. Dann und wann nannte Jim oder Stoners Mutter den Namen eines Verwandten, doch versanken sie gleich darauf wieder in Schweigen. Sein Vater saß auf einem der geradlehnigen Stühle, die Füße gespreizt, ein wenig vorgebeugt, die Hände umfassten die Knie. Irgendwann sahen die Footes sich an, gähnten und verkündeten, es sei schon spät. Sie gingen in ihr Schlafzimmer, und die drei blieben allein zurück.
Wieder herrschte Schweigen. Seine Eltern, die vor sich in die von den eigenen Leibern geworfenen Schatten starrten, warfen gelegentlich einen Seitenblick auf ihren Sohn, so als wagten sie es angesichts seines neu erworbenen Bildungsstandes nicht, ihn zu stören.
Nach mehreren Minuten beugte sich William Stoner schließlich vor und sagte nachdrücklich und lauter als eigentlich beabsichtigt: »Ich hätte es euch früher sagen sollen. Letzten Sommer oder heute Morgen.«
Im Licht der Lampe wirkten die Mienen seiner Eltern dumpf und ausdruckslos.
»Was ich sagen will: Ich komme nicht mit euch zurück auf die Farm.«
Niemand regte sich. Sein Vater sagte: »Wenn du hier noch ein paar Dinge zu erledigen hast, können wir morgen vorfahren und du kommst in ein paar Tagen nach.«
Stoner rieb sich das Gesicht mit offener Hand. »So … habe ich das nicht gemeint. Ich versuche euch zu sagen, dass ich überhaupt nicht auf die Farm zurückkomme.«
Sein Vater umfasste seine Knie etwas fester und richtete sich auf. »Steckst du in Schwierigkeiten?«
Stoner lächelte. »Nein, nichts dergleichen. Ich werde noch ein weiteres Jahr zur Universität gehen, vielleicht auch noch zwei, drei Jahre.«
Der Vater schüttelte den Kopf. »Ich habe doch heute Abend gesehen, wie du fertig geworden bist. Und der Viehhändler hat gesagt, die Landwirtschaftsschule dauert vier Jahre.«
Stoner versuchte, dem Vater seine Absichten zu erklären, versuchte, in ihm jenes Gefühl für Sinn und Bedeutsamkeit zu wecken, das er selbst empfand, doch hörte er seine Worte wie aus dem Mund eines Fremden dringen und sah dabei das Gesicht seines Vaters, auf das diese Worte einhieben wie der wiederholte Schlag einer Faust auf einen Stein. Als er verstummte, saß der Vater da, die Hände zwischen die Knie geklemmt, den Kopf gesenkt. Er lauschte der Stille im Zimmer.
Endlich regte er sich, und Stoner blickte auf, blickte in die Gesichter seiner Eltern und hätte sie am liebsten laut angefleht.
»Ich weiß nicht«, sagte sein Vater mit rauer, müder Stimme. »So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, dich hierherzuschicken sei das Beste, was ich für dich tun kann. Deine Ma und ich, wir wollten nämlich immer nur das Beste für dich.«
»Ich weiß«, sagte Stoner und konnte sie nicht länger anschauen. »Kommt ihr denn zurecht? Ich könnte im Sommer eine Weile aushelfen. Ich könnte …«
»Wenn du meinst, dass du hierbleiben und deine Bücher studieren musst, dann musst du das wohl. Deine Ma und ich, wir schaffen das schon.«
Seine Mutter hielt ihm das Gesicht zugewandt, sah ihn aber nicht an. Sie kniff die Augen zusammen, presste die geballten Fäuste an die Wangen, atmete schwer, und ihre Miene war wie vor Schmerz verzerrt. Erstaunt begriff Stoner, dass sie weinte, stumm und aus tiefstem Innern, mit all der Scham und Verlegenheit eines Menschen, der selten weint. Er betrachtete sie einen Augenblick, dann erhob er sich schwerfällig, ging aus dem Wohnzimmer und erklomm die schmale Stiege, die in seine Dachkammer führte; er lag noch lange auf dem Bett und starrte mit offenen Augen in die Dunkelheit.
II
Zwei Wochen, nachdem Stoner das Studium abgeschlossen hatte, wurde in Sarajewo Erzherzog Franz Ferdinand von einem serbischen Nationalisten erschossen, und noch vor dem Herbst herrschte überall in Europa Krieg. Für die älteren Studenten war dies ein Thema von drängendem Interesse, da sie sich fragten, welche Rolle Amerika in diesem Krieg zufalle, sodass sie der eigenen Zukunft mit wohliger Verunsicherung entgegensahen.
Vor William Stoner aber lag die Zukunft klar, solide und unwandelbar. Für ihn war sie keine Abfolge von Ereignissen, Veränderungen und Möglichkeiten, sondern ein Territorium, das nur darauf wartete, erkundet zu werden. Sie war wie die große Universitätsbibliothek, der neue Flügel angebaut, neue Bücher einverleibt, die, auch wenn alte Werke entliehen werden mochten, im Kern doch unverändert blieb. Er sah seine Zukunft in dieser Institution, der er sich verschrieben hatte und die er nur so unvollkommen verstand, sah sich als jemanden, der sich in dieser Zukunft veränderte, nur war ihm die Zukunft selbst Instrument dieser Veränderung, nicht ihr Objekt.
Gegen Ende jenes Sommers, kurz vor Beginn des Herbstsemesters, besuchte er seine Eltern. Eigentlich wollte er bei der Sommerernte helfen, erfuhr dann aber, dass sein Vater einen schwarzen Landarbeiter eingestellt hatte, der mit stillem, entschlossenem Eifer zupackte und an einem Tag fast so viel schaffte wie William und sein Vater früher gemeinsam. Seine Eltern freuten sich, ihn zu sehen, und schienen ihm seine Entscheidung nicht übelzunehmen. Allerdings merkte er bald, dass er ihnen nichts zu sagen hatte und dass sie einander bereits fremd wurden, ein Verlust, der seine Liebe zu ihnen noch vermehrte. Eine Woche früher als geplant kehrte er nach Columbia zurück.
Er begann aufzubegehren gegen die Zeit, die er für die Farmarbeit bei den Footes benötigte. Da er so spät mit dem Studium angefangen hatte, spürte er nun umso deutlicher dessen Dringlichkeit. Manchmal, wenn er in die Bücher vertieft war, überkam ihn eine Ahnung dessen, was er alles nicht wusste, was er noch nicht gelesen hatte, und die Ruhe, auf die er hinarbeitete, wurde von der Erkenntnis erschüttert, wie wenig Zeit ihm doch im Leben blieb, um so viel lesen, um all das lernen zu können, was er wissen musste.
Im Frühjahr 1915 beendete er den Magisterstudiengang und verbrachte den Sommer damit, seine Abschlussarbeit zu schreiben, eine Sprachstudie über eine der Erzählungen in den Canterbury Tales von Geoffrey Chaucer. Noch vor dem Ende des Sommers sagten ihm die Footes, dass sie ihn auf ihrer Farm nicht länger brauchen konnten.
Damit hatte er gerechnet, und in gewisser Weise begrüßte er seine Entlassung, dennoch überkam ihn einen Moment lang ein Anflug von Panik. Ihm war, als würde die letzte Verbindung zu seinem alten Leben gekappt. Die verbleibenden Wochen dieses Sommers verbrachte er auf der Farm seines Vaters, um letzte Korrekturen an seiner Arbeit vorzunehmen. Archer Sloane hatte inzwischen dafür gesorgt, dass er zwei Einführungskurse Englisch für Erstsemester geben konnte, während er selbst damit begann, auf den Doktor hinzuarbeiten. Fürs Unterrichten erhielt er vierhundert Dollar im Jahr. Also räumte Stoner seine Habseligkeiten aus Footes’ winziger Dachkammer, in der er fünf Jahre lang gehaust hatte, um ein noch kleineres Zimmer in der Nähe der Universität zu beziehen.
Obwohl er einer bunt gemischten Gruppe von Erstsemestern nur Grundkenntnisse in Grammatik und Komposition beibringen sollte, sah er seiner Aufgabe voller Begeisterung und in der festen Überzeugung entgegen, etwas Wichtiges zu leisten. Er begann mit den Kursvorbereitungen in der letzten Woche vor dem Herbstsemester und entdeckte Möglichkeiten, wie man sie wahrnimmt, wenn man sich ernsthaft mit den Inhalten und Zielen eines Unterfangens beschäftigt; er besaß ein Gefühl für die Logik der Grammatik und meinte sehen zu können, wie sie alles durchdrang, die Sprache prägte, die Gedanken strukturierte. In den simplen kompositorischen Übungen, die er sich für die Studenten ausdachte, sah er die Möglichkeiten der Prosa und ihre Schönheiten aufleuchten, und er freute sich darauf, die Studenten mit einem Gefühl für das, was er selbst wahrnahm, begeistern zu können.
Doch als er sich nach anfänglichen Routineaufgaben wie dem Erstellen von Anwesenheitslisten und Studienplänen den eigentlichen Themen und seinen Studenten zuwandte, fühlte er in den ersten Sitzungen, dass jenes Staunen in ihm verborgen blieb. Wenn er zu den Studenten sprach, war ihm manchmal, als stünde er neben sich und sähe einen Fremden zu einer widerwillig versammelten Schar reden; er hörte die eigene Stimme den vorbereiteten Stoff tonlos wiedergeben, und seinem Vortrag war nichts von der eigenen Begeisterung anzumerken.
Erleichterung und Erfüllung aber fand er in den Seminaren, in denen er selbst Student war. Sie weckten in ihm jenes Entdeckergefühl aufs Neue, das er zum ersten Mal gespürt hatte, als Archer Sloane sich im Unterricht an ihn gewandt hatte und er in einem einzigen Augenblick zu einem anderen Menschen geworden war. Während sein Verstand sich mit dem Thema befasste und die Macht der von ihm studierten Literatur zu begreifen, ihr Wesen zu verstehen suchte, war er sich der konstanten Veränderung seiner selbst bewusst. In diesem Wissen bewegte er sich aus sich hinaus in die Welt, der er angehörte, weshalb er verstand, dass das von ihm gelesene Gedicht von Milton, der Essay von Bacon, das Theaterstück von Ben Jonson jene Welt veränderten, die zugleich ihr Thema war, und sie nur deshalb verändern konnten, weil sie darin fußten. Im Seminar meldete er sich selten zu Wort, und seine schriftlichen Arbeiten stellten ihn fast nie zufrieden. Wie seine Vorträge vor den jungen Studenten verrieten sie nichts von dem, wovon er zutiefst überzeugt war.
Er lernte einige Mitstudenten näher kennen, die am selben Fachbereich unterrichteten. Mit zweien freundete er sich besonders an, mit David Masters und Gordon Finch.
Masters war ein schlanker, dunkelhaariger junger Mann mit scharfer Zunge und sanften Augen. Wie Stoner hatte er gerade mit der Promotion begonnen, war allerdings ein gutes Jahr jünger. Am Fachbereich und bei den Studenten besaß er den Ruf, arrogant und impertinent zu sein, weshalb man allgemein annahm, dass es ihm letztlich sicher nicht leichtfallen würde, den Doktortitel zu erringen. Stoner hielt ihn für einen brillanten Kopf und ordnete sich ihm neidlos und ohne jeden Widerwillen unter.
Gordon Finch war groß und blond und begann bereits im Alter von dreiundzwanzig Jahren dick zu werden. Er hatte seinen Abschluss an einer Handelsschule in St. Louis gemacht und es an der Universität mit mehreren weiterführenden Studiengängen versucht, so in Wirtschaftswissenschaften, Geschichte und Maschinenbau. Auf eine Promotion am Fachbereich Literatur hatte er sich wohl nur deshalb eingelassen, weil es ihm in letzter Sekunde gelungen war, eine bescheidene Unterrichtsstelle zu ergattern. Rasch erwies er sich als der Student am Fachbereich, der wohl das geringste Interesse für sein Studiengebiet aufbrachte, doch war er bei den Erstsemestern beliebt; außerdem verstand er sich gut mit den älteren Fakultätsmitgliedern und den Verwaltungsangestellten.
Diese drei – Stoner, Masters und Finch – machten es sich zur Gewohnheit, freitagnachmittags in einer kleinen Bar in der Stadt ein paar große Gläser Bier zu trinken und bis zu später Stunde miteinander zu reden. Obwohl Stoner kein anderes gesellschaftliches Vergnügen als diese Abende kannte, fragte er sich oft verwundert, was sie eigentlich verband. Sie kamen zwar gut miteinander aus, waren aber beileibe keine engen Freunde, zogen einander nur selten ins Vertrauen und sahen sich kaum außerhalb ihrer wöchentlichen Treffen.
Keiner von ihnen stellte ihre Beziehung je in Frage. Stoner wusste, Gordon Finch wäre derlei nie in den Sinn gekommen, doch nahm er an, dass dies nicht für David Masters galt. Einmal saßen sie spätabends an einem der hinteren Tische der schummrigen Bar, und Stoner und Masters redeten über ihre Seminare und ihr Studium im verlegen scherzhaften Ton der ganz Ernsthaften. Wie eine Kristallkugel hielt Masters ein hartgekochtes Ei vom kostenlosen Mittagessen in die Höhe und fragte: »Habt ihr, Gentlemen, je über die wahre Natur der Universität nachgedacht? Mr Stoner? Mr Finch?«
Lächelnd schüttelten sie die Köpfe.
»Natürlich habt ihr das nicht. Ich stelle mir vor, dass sie für Stoner einem großen Vorratsraum gleicht, einer Bibliothek vielleicht oder einem Bordell, etwas, wohin Männer aus freien Stücken gehen, um zu suchen, was sie vervollständigt, ein Ort, an dem alle wie kleine Bienen in einem Bienenkorb zusammenarbeiten. Die Ehrlichen, die Guten, die Schönen. Sie warten gleich um die Ecke oder im nächsten Flur, sind im nächsten Folianten, in dem, den du noch nicht gelesen hast, auf jeden Fall aber im nächsten Bücherstapel, mit dem du noch nicht angefangen hast, doch eines Tages anfangen wirst. Und wenn es dann so weit ist – wenn es dann so weit ist …« Noch einmal blickte er auf das Ei, biss ein großes Stück davon ab und wandte sich mit kauenden Kiefern und funkelnden dunklen Augen zu Stoner um.
Stoner lächelte unbehaglich, und Finch lachte laut und schlug auf den Tisch. »Er hat dich durchschaut, Bill. Er hat dich wirklich durchschaut.«
Masters kaute noch einen Moment, schluckte und richtete den Blick dann auf Finch. »Und du, Finch. Wie sieht deine Vorstellung aus?« Er hob die Hand. »Du protestierst und sagst, du hättest noch nie drüber nachgedacht. Aber das hast du. Hinter dem herzlichen, gutmütigen Äußeren arbeitet ein schlichter Verstand. Für dich ist diese Institution ein Werkzeug des Guten – gut für die Welt im Ganzen, natürlich, und zufälligerweise auch gut für dich. Du siehst darin eine Art geistiges Tonikum, das du jeden Herbst verabreichst, um die kleinen Racker über einen weiteren Winter zu bringen, wobei du der freundliche alte Doktor bist, der gütig ihre Köpfe tätschelt und ihre Gebühren einsackt.«