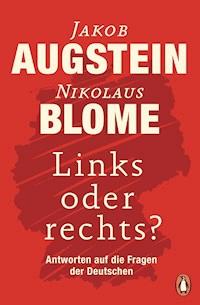16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dass alte Gewissheiten schwinden, dass die Welt sich schneller ändert, als er es für möglich gehalten hätte, wird Misslinger ausgerechnet in den USA klar, dem Ort, der für ihn immer noch für Freiheit und eine bessere Zukunft steht. Hier verschwimmen die Grenzen von Traum und Wirklichkeit, und Misslinger realisiert, dass ihm sein Leben längst entglitten ist.
In seinem grandiosen literarischen Debüt erzählt Jakob Augstein eindringlich von einem Mann unserer Zeit, deren Konturen zwischen politischen Umbrüchen, neuen Ideen und alten Bedrohungen immer schwerer auszumachen sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Herbst 2016: Franz Xaver Misslinger war einmal der Shootingstar der deutschen Politik. Jetzt ist seine Ehe mit Selma in der Krise, seine Tochter entgleitet ihm und seine Position in der Partei wankt.
Kurz vor dem alles entscheidenden Parteitag reist Misslinger mit seiner Tochter in die USA. Das Amerika, das Misslinger vorfindet, steckt selber in der Krise und taugt nicht als Quelle neuer Kraft. Die Welt wandelt sich: New York lässt Luise seltsam kalt, sie versteht unter Freiheit etwas anders als ihr Vater, und aus Deutschland kommen immer beunruhigendere Nachrichten von Misslingers Parteifreund und Förderer.
Als Vater und Tochter nach Long Island aufbrechen, um Misslingers Jugendfreund zu besuchen, gerät seine Welt aus den Fugen. In den buntgefärbten Wälder des Indian Summer geschehen merkwürdige Dinge, auf einer Insel, die es nicht gibt, macht Misslinger eine rätselhafte Begegnung und schließlich verschwimmen an der äußersten Spitze von Montauk nicht nur die Grenzen zwischen Wasser, Land und Himmel sondern auch die zwischen Traum und Wirklichkeit.
Über Jakob Augstein
Jakob Augstein, geboren 1967, ist Verleger und Publizist. »Strömung« ist sein erster Roman.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Jakob Augstein
Strömung
Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Prolog
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Teil II
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
I was home.
What happened?
What the hell happened?
Steve McQueen als Jake Holman in The Sand Pebbles, 1966
Prolog
Im Jahr 2016 kam der Frühling nur langsam über das südliche Jütland und weckte die Halbinsel Angeln ohne Hast aus ihrem Winterschlaf. Bis in den April hinein blieben Schlehen und Herlitze ohne Blüten, und die Hecken standen kahl in der Landschaft und boten dem Wind keinen Widerstand. Die Felder lagen noch lange in der Nässe des Winters, und man konnte sich denken, dass der Raps erst im Mai blühen würde und der Weißdorn nicht vor dem frühen Sommer. So kühl war es.
In anderen Jahren war Franz Xaver Misslinger der Entwicklung der Natur mit einiger Aufmerksamkeit gefolgt. Aber in den ersten Monaten des Jahres 2016 verbrachte er nur wenig Zeit daheim im alten Dreiseithof in der kleinen, zehn Kilometer südlich von Flensburg gelegenen Ortschaft Freienwill. Und auch wenn einmal an einem Wochenende seine Anwesenheit in der Berliner Parteizentrale nicht erforderlich war und auch sonst ihn nichts daran hinderte, nach Hause zu kommen: der Besuch eines Landesverbandes im Westen, ein Abendessen mit Vertretern des Mittelstandes im Festsaal des gründlich renovierten Rathauses einer mittleren Stadt in Schwaben, eine Premiere an der Münchner Oper – seine Verpflichtungen waren ja vielfältig –, dann hatte er dennoch keine Augen dafür, ob draußen noch der Winter herrschte oder schon der Frühling anbrach, weil er mit Wichtigerem beschäftigt war. Mit seiner Zukunft. Um Ostern herum, sagte er zu Selma, er sei früher bekanntlich der Shootingstar der deutschen Politik gewesen – das sagte Misslinger tatsächlich so zu seiner Frau: »Ich war mal der Shootingstar der deutschen Politik!« – aber seitdem sei viel Zeit vergangen, und wenn in diesem Herbst der Vorstand seiner Partei neu gewählt werde, dann solle sich zeigen, was aus ihm noch werden könne: Parteivorsitzender, Außenminister, Vizekanzler. Jetzt erst einmal der Parteivorsitz, das sei fällig, drunter mache er es nicht mehr, sagte Misslinger. Leute wie er würden in Spitzenpositionen heute dringender gebraucht denn je.
Im April wollte Selma wissen, warum er zum zweiten Mal den Termin für die Paartherapie, die ihr, wie sie sagte, sehr wichtig sei, versäumt hatte. Da bat er sie um Entschuldigung.
Im Juni, als der Weißdorn endlich doch zu blühen begann, fuhr Misslinger zu einer Parteiveranstaltung nach Köln, von der er sich Rückendeckung für seine Pläne versprach, und erklärte Selma, dass Nordrhein-Westfalen ja den wichtigsten Landesverband stelle, er sich hier mithin wirklich ins Zeug legen müsse. Im gleichen Monat enttäuschte er einen weiteren Versuch seiner Frau, ihre Ehe zu retten. Mitten in der Flensburger Altstadt wartete Selma an einem hellen Frühsommertag in der Nähe der Praxis des Therapeuten an jenem sechseckigen Brunnen, an dem sie sich früher oft getroffen hatten. Das war ihre Idee. Sie lief viele Mal um den Brunnen herum, aber Misslinger kam nicht. Sie setzte sich auf die Stufen des Brunnens, aber er war auf seinem Telefon nicht zu erreichen. Sie fuhr nach Hause und fand ihn in seinem Arbeitszimmer, in dem sein Vater, der Zahnarzt gewesen war, früher die Patienten behandelt hatte. Er nannte das Zimmer darum den »Schmerzensraum«.
Sie öffnete die Tür, traurig und ohne anzuklopfen. Misslinger schreckte von seinen Unterlagen auf und sah seine Frau überrascht an, weil er die Verabredung vergessen hatte. Er begann gleich zu reden, ja, es tue ihm leid, aber er habe ihr, wie sie sich gewiss erinnere, schon zu Ostern gesagt, dieses werde das Jahr der Entscheidung, und zwar nicht nur für ihn, sondern überhaupt, und darum könne er sich – das sagte er mit einem gewissen Vorwurf in der Stimme – keine Ablenkung erlauben. Er sei an einem entscheidenden Punkt seiner Karriere angekommen, ebenso wie der gesamte Westen, für den zu sprechen er sich durchaus berufen fühle, an einem entscheidenden Punkt, nur damit das klar sei: Er spreche von der gesamten westlichen Wertegemeinschaft, von der NATO, von der Europäischen Union. Ob sie ihm eigentlich zuhöre, wollte er noch wissen. Krisen seien jedoch, das habe er immer gesagt und das gelte auch jetzt, dornige Chancen, und er für seinen Teil sei bereit, diese dornige Chance zu ergreifen, auch wenn das bedeutete, dass er am Ende mit Blut an den Händen dastünde. Als sie ihn entgeistert ansah, fügte er hinzu, das meine er natürlich nicht so, wie es jetzt geklungen habe.
»Wir waren mal ein Team, Misslinger. Aber das hat dir nichts bedeutet. Jetzt bist Du ein Junkie und man wird Dich zu gar nichts mehr wählen«, sagte Selma, drehte sich um und trat durch die Küchentür in den Hof. Die Linde trug das erste zarte Grün. Das Dach des Haupthauses war seit dem vergangenen Jahr wieder mit Reet gedeckt, wie es sich in dieser Gegend gehörte, die Nebengebäude hatte schon Misslingers Vater ausbauen lassen. Selma ging nach hinten in den Garten. Die Esche auf der Wiese war noch schwarz und kahl. Aber die Weißdornhecke blühte wie ein großer Brautstrauß, als wollte sich das grüne Land mit dem blauen Himmel vermählen.
Sie wusste, dass Misslinger früher beinahe sehnsüchtig auf die Blüten des Weißdorns gewartet hatte. Um den Himmelsteich herum waren die Sträucher zu einer dichten Hecke zusammengewachsen, und er hatte ihr erzählt, wie er im Sommer als Kind oft im Netz des Sonnenlichts gesessen hatte, das sich über die Wiese breitete, eingehüllt in den Dunst der dornigen Äste, die in einem wilden Tanz in den Himmel fuhren.
Da setze sich Selma in den summenden Duft und weinte.
Im September wob der späte Sommer goldenes Licht wie feine Fäden von Honig in die Bäume, aber da sprachen Misslinger und Selma kaum noch miteinander. Und als er an den Rhein reiste, weil dort immer noch das geheime Zentrum der Macht lag, warnte sie ihn nicht mehr, wie sie es früher getan hatte, denn sie sah ihn jetzt schon mit anderen Augen.
Im Oktober verkündete Misslinger überraschend, eine Reise nach New York anzutreten, und fragte seine Tochter Luise, ob sie Lust habe, ihn zu begleiten. Er wolle, erklärte er Mutter und Tochter, kurz vor einem für ihn – und den freien Westen – entscheidenden Moment, zu den Quellen seines Glaubens zurückkehren, um Kraft zu schöpfen, ja, es handele sich eigentlich um eine Pilgerreise und Luise sei herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.
Als die Bäume beinahe wieder kahl und die Felder schon leer waren, beschloss Selma, den alten Dreiseithof in Freienwill zu verlassen. Sie mietete im Obergeschoss eines roten Backsteinbaus in Glücksburg eine Wohnung mit Blick auf das Wasser und nahm sich vor, den Namen ihres neuen Wohnortes zum Programm ihrer zweiten Lebenshälfte zu machen. Er hat mich nicht mehr gebraucht, dachte Selma: Ich will aber gebraucht werden. Und sie schloss die Tür auf ruhige Art und Weise hinter sich.
Es war zu dieser Zeit, dass sich auf der Welt ein neues Phänomen ausbreitete: Horrorclowns. In der Stadt Green Bay im Bundesstaat Wisconsin fing es an. Ein Mann, der einen langen Kittel trug und wie ein Clown geschminkt war, lief mit vier schwarzen Luftballons in der Hand durch die Straßen. Sonst tat er nichts. Aber er machte den Menschen Angst. Die sozialen Netzwerke verbreiteten die Nachricht, und eine Unruhe bemächtigte sich der Öffentlichkeit.
In den folgenden Monaten wurden weitere Vorfälle gemeldet. Von Amerika breitete sich das Phänomen über die ganze Welt aus. Schwere und Umfang der Zwischenfälle nahmen zu. Zunächst standen die Clowns nur an Straßenkreuzungen und hoben die Hände. Dann sprangen sie nachts hinter Hausecken hervor oder tauchten unvermittelt aus einem Gebüsch auf. Mehrere Zeugen berichteten von einem »bösen Lachen«, das sie gehört hatten. Plötzlich tauchten mit Baseballschlägern und Messern bewaffnete Clowns auf.
Es kam zu Massenaufläufen und zu Todesfällen. An einem Tag im Herbst versammelten sich Hunderte Studenten der überaus angesehenen und auf eine lange Geschichte zurückblickenden Pennsylvania State University zur »Clownsjagd«, die jedoch ohne Ergebnis verlief. Um Halloween herum erreichte die Zahl der Sichtungen ihren Höhepunkt. Aber Mitte November war der Spuk vorüber.
Es war kalt geworden. Der Winter kam.
Teil I
Kapitel 1
»Lieber Walter, meine Damen und Herren, ich bin Franz Xaver Misslinger, und ich sage immer, bei mir hört das Scheitern mit dem Namen auf. Aber Sie kennen mich. Wir haben viel hinter uns gebracht, um heute hier zu stehen. Wer hätte gedacht, dass wir es so weit bringen? Ich sage es Ihnen: Ich habe es gedacht. Ich habe an Sie geglaubt und an mich selbst. Und woher habe ich diese Sicherheit? Hier sitzt der Mann, der die Antwort ist: Walter! Ich verdanke Dir mehr, als ich sagen kann. Ich verbeuge mich vor Dir. Stellt euch das vor, liebe Freunde: Was einer kann! Was alles möglich ist!«
Misslinger spürt die Begeisterung des Saals schon jetzt, Wochen im Voraus. Er sieht die helle, weite Halle des alten Postbahnhofs vor sich. Die wogenden Köpfe, die fliegenden Hände, das große Tier, das ihm seine Wärme schenkt. Von einem guten Redner sagt man: Der Saal gehört ihm. In Misslingers Fall ist es buchstäblich wahr. Wenn er in Form ist, dann kann er mit den Menschen machen, was er will: Er scherzt, sie lachen, er beschwört, sie sind gebannt, er wirft einen Köder aus, sie greifen gierig danach. Misslinger macht aus einer Rede ein Ritual, einen großen Akt der Vereinigung. Und auf dem Parteitag im November wird er eine große Rede halten. Über die Freiheit. Er wird ein Evangelium des Liberalismus verkünden, eine frohe Botschaft der Leistungsbereitschaft und des Fortschritts. Man wird ihm zujubeln als einem Messias der Eigenverantwortung. Den Text schreibt er jetzt auf, nachher wird er ihn nicht brauchen. Er kann zwei, drei Stunden frei sprechen, klar, verständlich, mitreißend. Das ist sein Talent, und er hat es gut trainiert, so viele Reden hat er gehalten, auf Marktplätzen und in umgebauten Scheunen, die jetzt als Nebenzimmer von Gaststätten dienen, im Landtag und auf den Parteitagen. Die erste Lektion hat er von Walter gelernt: »Das Wichtigste beim Reden sind die Pausen«, hat Walter gesagt, als sie sich kennengelernt haben.
Es ist Montagvormittag, 10. Oktober, der Wagen fährt am Weinbergpark vorbei. Misslinger lehnt den Kopf an die kalte Scheibe. Diese Partei wird sich ihm unterwerfen, sie wird sich ihm hingeben, in der Backsteinindustriearchitektur des alten Postbahnhofs in Berlin. Und Walter wird da sein, auf dem Platz des Ehrenvorsitzenden wie immer, und der Alte wird dem Jüngeren seinen Respekt zollen. Walters Zeit ist abgelaufen, denkt Misslinger.
Er schließt den Rechner, den er gerade erst geöffnet hat, und verstaut ihn in der feinen schwarzen Tasche, die Selma ihm geschenkt hat. Er kann sich gerade nicht gut konzentrieren. Vor einer halben Stunde hat er die Tablette genommen und wartet darauf, dass sie wirkt. Der Wagen hatte ihn um halb zwölf in seiner Wohnung in der Choriner Straße abgeholt. Das Büro hatte ihm einen Fahrer geschickt, den er noch nicht kannte. Während der Fahrt, die wegen erhöhten Verkehrsaufkommens und einer Sperre deutlich länger als die eingeplanten zwölf Minuten dauerte, erfuhr Misslinger den Namen des Mannes, Schwaiger mit »ai«, wie gleich betont wurde, worauf sich eine kurze Unterhaltung über den Ursprung dieses Namens anschloss, die zu der Erkenntnis führte, dass die Familien beider Männer wenigstens väterlicherseits aus dem Süden stammten, Misslingers aus Südtirol, Schwaigers aus Bayern, das Schicksal sie aber beide nach Norden verschlagen hatte, woraus man jetzt eben das Beste machen müsse. Diese Gemeinsamkeit erfüllte das Fahrzeuginnere mit einer heiteren Stimmung, aufseiten des Fahrers, weil er sich etwas davon versprach, dass sein neuer Chef offenbar ein zugänglicher Mann war, aufseiten Misslingers, weil er darauf achtete, im Umgang mit den sogenannten einfachen Leuten einen freundlichen, nie aber einen herablassenden Ton anzuschlagen und sich jedes Mal freute, wenn ihm das gelungen war.
Der Fahrer setzt ihn am nördlichen Eingang des Bahnhofs ab, fährt ein Stück vor und wartet. Die beiden Männer einigen sich noch schnell darauf, wie unsinnig es sei, einen neuen Bahnhof so zu bauen, dass man beinahe gar nicht mit dem Auto heranfahren kann: »Typisch Berlin«, sagt der Fahrer. »Wählen Sie uns«, sagt Misslinger, »freie Fahrt für freie Bürger!« Er hängt sich die schwarze Tasche um, die er nie zurücklässt, und geht ein paar Schritte auf die großen Drehtüren zu, macht kehrt, läuft hin und her. Es wäre jetzt an der Zeit, denkt er, dass die Tablette wirkt. Vor ihm taucht eine junge Frau mit flachsblondem Haar auf. Noch bevor er ihr Gesicht sieht, bemerkt er die schlanke Figur, den engen braunen Rollkragenpullover, den langen, hellen Mantel. Mit der dunklen, mit großen Blumen übersäten Schlaghose und dem braunen Lederbeutel, der ihr über der Schulter hängt, sieht sie aus wie eine Hippie-Studentin, findet Misslinger und erkennt dann seine Tochter.
Luise hatte schon eine Viertelstunde gewartet, allerdings auf der anderen, dem Kanzleramt zugewandten Seite des Hauptbahnhofes, bis sie ihren Irrtum bemerkte. Sie war am frühen Morgen in ihrem im idyllischen Ostholstein gelegenen Internat aufgebrochen, um mit ihrem Vater über Zürich nach New York zu reisen, wo sie um kurz nach acht Uhr abends Ortszeit landen würden.
»Hey, Misslinger!«, ruft sie. Er nimmt sie in den Arm und hält sie fest, dann drückt er sie von sich weg, lässt die Hände noch auf ihren Schultern und blickt direkt in ihre klugen, fröhlichen, grauen Augen. Das Kluge kommt von Selma, das Fröhliche von mir, denkt Misslinger. Alle nennen ihn so. »Sie können gerne Papa zu mir sagen«, sagt er zu seiner Tochter. Luise antwortet: »Und Sie können gerne Du zu mir sagen, Papa!« Er nimmt ihren Koffer in die linke Hand, legt den rechten Arm um ihre Schulter und geht mit ihr zum Wagen.
Luise ist erst 16, aber sie ist schon größer als er, erst recht mit ihren hohen Stiefeln. Sein Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Tochter, alle sind größer als er. Dabei ist er gar nicht klein, die anderen sind nur so groß. Sie ist beinahe erwachsen, denkt Misslinger. Und dass nichts Ängstliches mehr an ihr ist. Ihr Haar, wenn sie es offen trägt, reicht bis zu den Hüften; jetzt hat sie es hochgeknotet, ein blonder Rossschwanz, der beim Gehen pendelt. Die Haare seiner Tochter kommen Misslinger im Licht der Herbstsonne jetzt honigfarben vor.
Er erinnert sich an seine Tochter als ein ängstliches Kind. Damals war er seit ein, zwei Jahren im Bundestag und selten zu Hause. Dann wurde Selma krank. Sie begann zu bluten und wusste nicht, warum. Die Ärzte in der Kieler Klinik entfernten den Krebs zusammen mit der Gebärmutter. In dieser Zeit konnte sich Selma nicht um Luise kümmern. Also verbrachte Misslinger mehr Zeit zu Hause. Er wechselte seiner Tochter die Windeln. Er brachte sie in den Kindergarten, und wenn sie ihn nicht gehen lassen wollte und sich an sein Bein klammerte, dann blieb er im Vorraum sitzen und wartete, bis sie ihn im Spiel vergessen hatte. In diesen Monaten kannte Luise nur die Zärtlichkeit ihres Vaters, seine Stimme, seine Liebe, und beinahe wäre zwischen Vater und Tochter eine Verbindung entstanden, die nichts auf der Welt mehr hätte lösen können. Aber Selma wurde wieder gesund und Misslinger wurde finanzpolitischer Sprecher seiner Fraktion und verbrachte mehr Zeit in Berlin als zu Hause.
Während sie zu dem großen schwarzen Wagen gehen, spürt er die Wirkung der Tablette. Der Koffer in seiner Hand hat gar kein Gewicht mehr. Er ist jetzt sehr glücklich, dass er Luise gefragt hat, ob sie mit ihm diese Reise machen will. Er ist sehr glücklich, dass sie zugesagt hat. Dieses Mal soll sie noch sein Kind sein. Und Selma soll sehen, dass er sich interessiert. Er kann es gar nicht erwarten, dass sie endlich wegkommen. Und er ist Luise dankbar, dass sie ihn nicht allein gelassen hat.
»Bist Du glücklich, Papa?«, fragt Luise, als sie nebeneinander im Fond des Wagens sitzen, der sie zum Flughafen bringt. Die Frage verwirrt Misslinger: »Es gibt verschiedene Arten von Glück und verschiedene Momente dafür, oder?«, sagt er. Luise reagiert nicht. Also redet er weiter: »Ich freue mich auf unsere Reise.« Sie antwortet immer noch nicht. »Glück als Lebensgefühl oder Glück in einem Moment? Immer noch die falsche Antwort? Wenn ich wüsste, worauf die Frage zielt, wüsste ich besser, was ich sagen soll.«
»Ein Schulprojekt«, sagt Luise, »es geht einfach darum, Leuten diese Frage zu stellen und zu sehen, was sie darauf unmittelbar antworten. Ich freue mich auch.«
Es war ein Test, denkt Misslinger. Warum war ich nicht schlagfertiger? »Und? Was sagen die Leute so?« Misslinger sitzt auf der rechten Seite, er drückt sich weit in die Ecke der ledernen Polster, um Platz zwischen sich und seiner Tochter zu schaffen und sich ihr zuwenden zu können.
Luise hat ihre Hände zwischen die Beine gelegt und guckt nach vorne. Immerhin hat sie ihr Telefon noch nicht herausgeholt.
»Sie antworten so wie Du: sie weichen aus«, sagt sie und zuckt mit den Schultern: »Warum eigentlich? Traut sich denn keiner, einfach zu sagen, was er fühlt?«
»Okay, frag mich noch mal.«
Sie lächelt. Und mit unschuldiger Stimme fragt sie:
»Bist Du glücklich, Papa?«
»Ja.«
»Heyyyyyy!«, ruft Luise.
Misslinger setzt sich aufrecht hin: »Siehst Du. Geht doch.«
»Ich find das nicht so doof«, sagt Luise: »Wir haben am Ende festgestellt, dass Glück vor allem etwas mit Erwartungen zu tun hat.«
»Absolut! Erwartungsmanagement ist superwichtig!«, sagt Misslinger: »Was erwartest Du zum Beispiel von unserem kleinen Trip in die erstaunlichste Stadt des Universums?«
Luise lacht. »Ist das so?«
Misslinger sieht sie überrascht an.
»New York ist wie Mekka«, sagt er, »wie das himmlische Jerusalem, der Nabel der Welt, die Quelle der Erneuerung – natürlich ist das so.«
»Schon gut«, sagt seine Tochter: »Ich hab mir eine Liste gemacht. Wir essen bei Katz und bei Barney Greengrass, wir fahren auf jeden Fall nach Brooklyn, und wir gehen auf den Chelsea Flea Market. Und was willst Du?«
»Ich glaube, ich mache alles, was Du willst«, sagt Misslinger.
Er holt seinen Rechner hervor und schreibt:
»Warum sind wir hier? Weil wir zu den Quellen der eigenen Grundüberzeugung zurückgefunden haben.« Grundüberzeugung ist nicht gut. »Weil wir zu den Quellen unseres Glaubens zurückgefunden haben.« Er notiert sich ein paar Stichworte. »Lebensgefühl«, »Wunsch nach Selbstbestimmung«, »Schaffenskraft«, »Lust am persönlichen Fortschritt«. Und in einer Rede über die Freiheit sollte auch das Wort »Freiheit« mal vorkommen. »Ich sage: Quellen unseres Glaubens und unserer Grundüberzeugung. Ich war an den Quellen, liebe Freunde. Ich komme gerade aus den Vereinigten Staaten zurück, Amerika, Heimat der Freiheit.«
Mein Predigtton, denkt Misslinger. »Du hättest Pfarrer werden können«, hat sein Vater gesagt, und das war durchaus als Kompliment gemeint. Die Ideen, die seinen Sohn umtrieben, waren ihm fremd. Aber die Inbrunst, mit der er sie vortrug, die schätzte er. Jetzt hole ich meine Pilgerfahrt nach, ins gelobte Land, denkt Misslinger und schließt halb die Augen.
»Wir haben gesündigt und sind unrein geworden
und sind gefallen wie ein Blatt,
und unsere Missetaten haben uns wie der Wind fortgetragen.«
Er nimmt sein Telefon. Zwei neue Nachrichten. Selma schreibt: »Ich wünsche euch beiden viel Spaß. Denk daran, dass Luise 16 ist. Mein Misslinger, das bist Du ja noch, oder?« Misslinger überlegt, was das bedeuten soll, und dann fragt er sich, ob Selma ihm fehlen wird.
Den Absender der anderen Nachricht kennt er nicht. »Werter Herr, ich teile oft Ihre Meinung. Aber jetzt höre ich, dass Sie gegen die Anschnallpflicht sind. Das geht doch nicht. Ich stelle mir Folgendes vor. Unsere Wege kreuzen sich auf einer Autobahn. Ich – ich wiederhole, ich – verursache einen Unfall. Sie verunglücken tödlich. Den Rest meines Lebens säße ich vor lauter Schuldgefühlen in der Psychiatrie. Sie hätten aber überlebt, wenn Sie angeschnallt gewesen wären. Dann könnten Sie weiter Ihre Familie ernähren und ich bräuchte keinen Psychiater. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Weil Sie clever sind. Sie Arsch.«
Misslinger macht ein überraschtes Geräusch. Die Beschimpfung am Ende, damit hat er nicht gerechnet. »Was ist denn?«, fragt seine Tochter. »Nichts«, sagt er. »Jemand schreibt, ich sei gegen die Anschnallpflicht.«
»Bist Du?«
»Nein.«
»Na dann.«
»Das Internet ist ein eigenartiger Ort. Ich bekomme dauernd so schräge Nachrichten.«
»Warum Du?«
»Keine Ahnung. Wenn einer was auf dem Herzen hat, sucht er sich im Netz jemanden, den er für bekannt hält, und schreibt sich alles von der Seele. Ganz schön wirres Zeug dabei.«
»Eklige Sachen?«
»Eher schräg als eklig!«
»Weil Du ein Mann bist. Frauen bekommen eklige Sachen.«
»Ja, das kann sein.«
Misslinger bemerkt, dass der Fahrer weite Umwege fährt, überall sind die Straßen gesperrt, plötzlich tauchen rechts und links Polizisten auf Motorrädern auf. Das ist meine Eskorte, denkt Misslinger, er stellt sich vor, wie sie ihm den Kopf zuneigen und eine Hand salutierend an das Visier ihres weißen Helmes heben. Aber sie brausen einfach vorbei.
»Was glaubst Du, warum die Leute das machen?«, fragt Luise.
»Was, das Eklige?«
»Nein, das Von-der-Seele-Schreiben.«
»Tja, ich weiß nicht. Manchmal denke ich, sie wollen die Verantwortung an jemanden abgeben. Für ihr Leben, ihre Ängste, ihre Wut. Viele Leute wollen, dass jemand anders für sie entscheidet. Wie ein Vater. Sie wollen nicht erwachsen werden.«
»Ich will erwachsen werden«, sagt Luise.
»Ich weiß«, sagt Misslinger.
Plötzlich stoppt der Wagen unerwartet heftig an einer Kreuzung. Der Fahrer pfeift durch die Zähne und lacht auf: »Jetza!« Misslinger begreift nicht gleich. Ein Mann steht vor ihnen, mitten auf der Kreuzung, die Arme weit geöffnet. Warum steht da dieser Mann? Er trägt einen dunklen Bart, Misslinger denkt sofort an ein Attentat. Aber er fühlt sich gar nicht bedroht. »Jetza!«, sagt der Fahrer noch mal. Misslinger missfällt dieser Ton.
Der Mann auf der Kreuzung wendet sich zur Seite, rechts steht ein anderer Mann, etwas kleiner, schmaler.
Wenn man Misslinger nachher gefragt hätte: »Wie sah er aus?«, hätte er nicht gewusst, was er sagen soll. Da stand etwas Großes, Dunkles, Breites, hätte er gesagt, mit weit aufgerissenen Augen und weit ausgebreiteten Armen, eine furchtbare Kreuzesfigur, mitten auf der Straße. Es ist eine ganz normale Kreuzung, umstanden von Häusern, die alle dieselbe Höhe haben und dieselbe Farbe, unter einem gleichgültigen Himmel. Nur die Bäume, die fallen Misslinger auf, es sind Platanen. In Angeln wachsen keine Platanen, obwohl es im Winter weniger Frost gibt als in Berlin. Aber der Wind macht ihnen da zu schaffen. An dieser Kreuzung stehen also vier Bäume, einer an jeder Seite. Über ihnen kreisen Möwen, und Misslinger denkt, was machen nur diese Möwen hier, mitten in der Stadt?
Misslinger sieht, wie die beiden Männer aufeinander zulaufen und mit aller Macht zusammenprallen. Der kleinere Mann müsste eigentlich davonfliegen, denkt Misslinger, so groß ist die Wucht. Aber aus irgendeinem Grund bleibt er stehen, als habe er die gewaltige Kraft dieses Stoßes einfach in sich aufgenommen.
Misslinger setzt sich auf, jeder Muskel in seinem Körper ist gespannt. Einen solchen Kampf hat er noch nie gesehen. Mit Bewunderung bemerkt er die langen Arme des großen Mannes, die in weiten Schwüngen ausholen, wie die Flügel der schlanken Windmühlen, die in Angeln durch den Horizont ziehen, die Bewegung ruhig aus der Schulter geführt, deren Muskulatur sich unter dem Hemd deutlich abzeichnet. Die Schläge gehen jetzt schon mit großer Regelmäßigkeit auf den kleineren Mann nieder. Er hebt schützend die Hände vor sein Gesicht, dreht sich, fängt einen Hieb nach dem anderen ein, weicht aus, aber er läuft nicht davon. Es ist ein ungleicher Kampf, das sieht man gleich, aber Misslinger wünscht dem Großen den Sieg. Er weiß nicht, warum. Er will, dass der Große den Kleinen niederwirft und ihm den Rest gibt. Er stellt sich vor, dass die Gewalt für diese Männer etwas Natürliches ist, wie Essen und Trinken. Und er beneidet sie darum. Nichts ist ehrlicher als die Gewalt, denkt Misslinger. Keine Lügen, keine Kompromisse, keine Rücksicht. Körper, die aufeinanderprallen, sich abstoßen und anziehen. Nur die Gewalt ist ehrlich und die Liebe. Aber die Liebe ist auch voller Lügen. Es bleibt die Gewalt.
Der Asphalt ist nass. Der Kleine rutscht aus, und noch während er fällt, treten beide aufeinander ein, und anstatt seinen eigenen Sturz zu bremsen, zerrt er mit aller Kraft an seinem Gegner. Misslinger sieht das Opfer fallen und auf dem Boden aufschlagen. Es ist schlimm, wenn ein Mensch fällt. Er hat die Nadl fallen sehen, da war sie schon ganz alt und leicht und wie durchsichtig, und es hätte ihn nicht gewundert, wenn ein Windstoß sie einfach mitgenommen hätte, weil eine Feder und ein Blatt, die man fallen lässt, ja auch nicht direkt den Boden erreichen. Aber die Nadl war gefallen und auf dem Boden aufgeschlagen und hat sich was gebrochen und ein paar Monate später war sie tot. Man macht sich das nicht klar, denkt Misslinger, wie hart ein Körper auf den Boden aufschlägt.
Misslinger weiß noch, dass er damals gar kein Mitleid mit der Nadl hatte. Es war nicht so, dass ihm ihr Schicksal gleichgültig gewesen wäre. Ganz und gar nicht. Er konnte nur kein Mitleid empfinden, als er sie da liegen sah, wie das Bein seltsam verrenkt unter ihr hervorragte, den grauen Mantel mit dem Fellkragen, der ihm sonst bei jeder Umarmung in der Nase kitzelte, im Dreck des abschüssigen Feldweges. Er hatte nur auf sie heruntergeblickt und die kleinen Eiskristalle beobachtet, die in immer größerer Zahl in der rauen Wolle des Mantels hängen blieben. Sie rief etwas, das er nicht verstand. Ihr Dialekt, wenn sie sich keine Mühe gab. Sie musste doch wissen, dass er sie nicht verstehen konnte, hatte er damals gedacht und sich über die am Boden liegende Großmutter geärgert. »Warum hilfst Du mir nicht«, hatte sie dann gerufen, »steh nicht da, hol Hilfe.« Da war ein Vorwurf in ihrer Stimme, den er nicht verstand. Er war für ihren Sturz nicht verantwortlich. Sie waren gemeinsam den Feldweg hinaufgegangen, links der Wald, rechts begann schon die Weide, als sie stolperte und fiel, kerzengerade, von oben nach unten, als wäre sie vorher von Schnüren gehalten worden, die jemand durchgeschnitten hatte. Dieser Sturz ohne Grund machte ihn zornig. Das hätte nicht passieren sollen. Warum sollte er jetzt besondere Gefühle entwickeln? Sie hatte ihn zurück zum Hof geschickt, er war gegangen, aber nicht besonders schnell. Sie hatte ihm noch etwas hinterhergerufen. Aber er hatte es nicht verstanden.
Für einen kurzen Moment sieht Misslinger durch das Wagenfenster aus der Ecke seines Sitzes das Gesicht des am Boden liegenden Mannes, der sich unter den Tritten und Schlägen des Großen im Dreck der Straße krümmt. Es ist nur ein Moment. Aber einen solchen Ausdruck hat Misslinger noch nicht gesehen, nackt, die Augen eines erledigten Tieres. Geduldig empfängt das Opfer Hieb um Hieb, wie man etwas Notwendiges empfängt.
Misslinger empfindet kein Mitleid. Warum auch? Es gibt keine unschuldigen Opfer, denkt er. Wer mitspielt, muss sein Risiko kennen. Jeder spielt seine Rolle. Heute du, morgen ich. »Gefährdungshaftung« nennt man das, denkt Misslinger und lächelt dabei. Das ganze Leben ist ein Kampf, denkt er. Erst recht in der Politik. Vielleicht vermehrt sich die Liebe, wenn man sie teilt, denkt er, aber die Macht nicht. Die Bäume, die in den Himmel wachsen, teilen sich das Licht nicht, sie kämpfen darum. Walter hat gesagt: »Je mehr der Baum in die Höhe will, desto weiter reichen seine Wurzeln in die Tiefe, in die Dunkelheit.« Und plötzlich denkt Misslinger daran, auszusteigen.
Er hört, wie Luise ruft: »Was machst Du? Bleib hier!«
Kapitel 2
Es war ein heller Septembertag. Misslinger war zu früh nach Irlich gekommen. Er ließ das Taxi ein gutes Stück vor Walters Haus halten und stieg aus. Den Strauß, den er am Bahnhof gekauft hatte, warf er weg. Drei Ranunkeln waren in die Wagentür geraten und abgeknickt. Unter dem Arm hatte er noch die Flasche Riesling. Misslinger ging durch die stillen Straßen, die er von seinen früheren Besuchen kannte, hinunter zum Fluss.
Irlich lag direkt am Rhein, eine halbe Stunde von Bonn entfernt. Der Ort war berühmt. Ein Sanatorium der alten Republik. In jedem Haus ein eigener Bierkeller. Und in jedem saß ein früherer Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen, ein ehemaliger Staatssekretär im Bundesministerium für Inneres, eine ehemalige Bildungsministerin aus Rheinland-Pfalz oder ein pensionierter Regierungsrat aus dem Hochsauerlandkreis und träumte von früher.
Misslingers Weg führte an niedrigen Buchenhecken und Kirschlorbeeren vorbei. Hinter schlichten Zäunen standen schmucklose Häuser, hohe Bäume nahmen ihnen das Licht. Bäume, Häuser, Hecken, alles wuchs aus dunkler Zufriedenheit empor. Alles war gepflegt, aber ohne viel Aufwand, ordentlich und lieblos. Genau, wie es sein sollte.
Unter einem hellen Himmel stieg er gut gelaunt die Stufen zu den Uferwiesen hinab. Er freute sich über die Kraft seiner Beine, die jeden Schritt mühelos abfingen, und er freute sich darüber, dass er hier nur zu Besuch war. Das Licht war wie Honig, der späte Sommer hatte die Luft weich gemacht, die Erde an seinen Schuhen störte ihn nicht. Er fühlte sich jung und hielt die Menschen, die hier lebten, für alt. Er würde wieder gehen. Sie würden hier sterben.
»Das passiert mir nicht, das passiert mir nicht, das passiert mir nicht«, summte Misslinger und machte sich in Gedanken eine Liste der Dinge, die er vermeiden würde, die den Menschen, die hier lebten, schon widerfahren waren. Ganz oben stand natürlich die Fettleibigkeit, die immer seine größte Sorge war, gefolgt von Alkoholismus und anderen Abhängigkeiten. Scheidung und Einsamkeit rangierten etwa auf gleicher Höhe, Senilität kam vor, spielte aber keine große Rolle, und dann gab es noch etwas, das ihm nicht passieren würde: »Ichwer-de-sicht-barblei-ben«, sang er im Stillen vor sich hin, immer wieder: »Ichwer-de-sicht-barblei-ben«, in einem bestimmten Rhythmus, zu dem er den lehmigen Uferweg entlangtänzelte. Da war niemand, dem er sonderbar hätte vorkommen können.
Es war ihm überhaupt seit seiner Ankunft bisher niemand begegnet. Keine Menschen in den Straßen, niemand auf den Bänken, nicht mal eine Hand am Vorhang, eine Silhouette im Fenster. Die Bewohner von Irlich waren nicht nur alt, sie waren unsichtbar. Und vor allem das würde Misslinger nicht passieren: Unsichtbarkeit. »Sie sind einer, der gesehen werden will. Das erkenne ich gleich«, hatte Walter gesagt, als er vor 23 Jahren auf Misslinger zugekommen war, nach der ersten Rede, die der auf einem Parteitag gehalten hatte. Und dann das Versprechen: »Machen Sie sich keine Sorgen: Sie werden gesehen werden!«
Der Fluss strömte mit erstaunlicher Geschwindigkeit nach Norden. Auf der anderen Seite lagen freundliche Hügel. Misslinger setzte sich auf eine Bank und wartete. Er sah die dichten bewaldeten Hänge, er sah das Binnenschiff, das stromaufwärts fuhr, und er sah den abgerissenen Ast, der sich in den Büschen am Ufer verfangen hatte. Da waren noch frische Blätter, die aus dem Wasser ragten und im Wind zitterten, aber das ganze Laub, das die Wellen freilegten und wieder versinken ließen, war schon schwarz verfärbt und tot. Der Strom erzeugte am nackten Stamm einen kleinen Strudel, in dem ein Birkenblatt kreiste, immer im Kreis, und nicht mehr entkam.
Walter wohnte mit seiner zweiten Frau Traudl, die einmal seine Sekretärin gewesen war, in einem zweistöckigen Haus von blasser Farbe, das auf einem Stück Rasen stand, der so grün und gerade war, als wäre er aus Asphalt gegossen. Am Rand der kurzen Auffahrt stand ein kahler Fahnenmast, eine kniehohe Hecke aus roten Berberitzen begrenzte das Grundstück zur Straße wie eine niedrige Mauer aus Backsteinen. Eine kleine Garage mit einem großen Tor aus altem, braunem Holz war dem Wohngebäude vorgelagert wie die Wache vor einer Kaserne. Man fühlte sich nicht willkommen.
Misslinger stand pünktlich vor der Tür. Da er Walter kannte, war er auf Überraschungen gefasst. Traudl öffnete ihm. Sie umarmte Misslinger herzlich, das tat sie ja immer. Er kam ihrem Hals näher, als ihm lieb war. Er fasste sie an den Schultern wie eine gute Freundin und drückte sich von ihr weg.
»Ich komme nicht ungelegen?«, fragte Misslinger. »Lieber Franz«, rief Traudl, »mein lieber Franz, Sie kommen nie ungelegen. Ganz und gar nicht.« Sie lächelte ihn dabei mit einer traurigen Gleichgültigkeit an, die ebenso gut ihm wie ihr selbst gelten konnte. Traudl gehörte zu jenen Frauen, die nie schön gewesen waren, aber immer zur Verfügung gestanden hatten. Misslinger wusste, dass Selma nie so aussehen würde, aber einige der Frauen, mit denen er sie betrog.
Sie zog ihn ins Haus, während sie auf ihn einredete: »Komm schon in die Diele« sagte sie tatsächlich, unerwartet ins Du wechselnd. Misslinger dachte an Selma. Sie hatte ihn korrigiert, als er einmal vom »Eingangsbereich« gesprochen hatte. »Entree, Misslinger, bei uns das Entree!«, hatte sie gesagt, und er hatte ihre Pedanterie mit Spott quittiert und mit Bewunderung. Aber dieses Ensemble aus dunklem Holz und Messing hier in Irlich am Rhein, das war tatsächlich eine Diele. Allerdings überraschte ihn der Anblick einer weiß glänzenden Wand aus Sichtmauerwerk, die ihm bei seinen früheren Besuchen nicht aufgefallen war. So eine hatten sie daheim in Freienwill auch. Selma hatte damals darauf bestanden und ihm erklärt, es handele sich um ein »retro-modernes Element«, das sie sich unbedingt erlauben könnten, weil bei ihnen niemand auf die Idee kommen werde, ein solches Sichtmauerwerk im Entree als unironisches Element eines altmodischen Geschmacks zu verstehen: »Misslinger, mit Design ist es wie mit allen Dingen im Leben: Wenn es geht, geht es, und wenn nicht, dann nicht.« Es konnte an Selmas Überlegenheit auch in dieser Frage keinen Zweifel geben.
Traudl hieß ihn mit einer Geste ins Wohnzimmer zu gehen, sie komme gleich nach: »Sie kennen sich ja aus, lieber Franz.« Misslinger betrat den dunklen, von Musik erfüllten Raum. Im Dämmerlicht sah er Walter von hinten, der in einem niedrigen Ledersessel saß und einen dunklen Morgenmantel trug. Misslinger blieb stehen. Seine Anwesenheit blieb unbemerkt. Auf dem Schreibtisch, der Kommode, dem Kaminsims, dem Fensterbrett, sogar auf einem Hocker neben dem Sessel standen Bilder: Walter Schergen, der frühere Wirtschaftsminister und Vizekanzler, der langjährige Parteivorsitzende, immer noch die sogenannte »graue Eminenz« seiner Partei und Misslingers Mentor von Anfang an, in jedem Alter, mit Staatschefs, Präsidenten und Premierministern, mit dem Papst, mit mindestens drei deutschen Bundeskanzlern und zahllosen Außenministern und Leuten, die man Würdenträger nennen muss, er selbst in ortsüblicher Tracht, im dunklen Anzug, im feierlichen Frack, im reisetauglichen Khaki, je nach Anlass und Außentemperatur.
»Hier ist es ja unerträglich dunkel«, sagte Misslinger ein bisschen lauter als notwendig. Aber Walter hörte ihn nicht. »Und das Fenster ist geschlossen. Es ist ganz warm draußen.« Walter wandte halb den Kopf. Misslinger sah das immer noch scharfe Profil, die Nase, die im Alter nur größer geworden war, aber die Augen waren müde. Wie alt er geworden ist, dachte Misslinger. »Ah, Franz«, sagte Walter und ließ den Kopf mit dem struppigen weißen Haar wieder auf die Brust sinken, »setz Dich neben mich, Franz, und höre …«, dabei streckte er Misslinger seine Hand entgegen, die dieser ergriff, und Walter zog ihn auf den Sessel neben sich, wie man ein Kind zu sich herabzieht.
»Du erlebst mich gerade in meinem Fischer-Dieskau-Moment«, sagte Walter leise. »Magst Du Fischer-Dieskau, Franz? Man hat ihm ja vorgeworfen, dass er sich in den späteren Jahren aufs Deklamieren verlegt habe, dem Manierismus verfallen sei, nicht wahr, das Oberlehrerhafte hat man ihm vorgeworfen, Franz, was meinst Du? Ich kann das alles nicht finden. Im Angesicht dieser Stimme – aber das kann man ja gar nicht sagen: im Angesicht einer Stimme – also sage ich: in der Gegenwart dieser Stimme, da verstummt jede kleinliche Kritik, Fischer-Dieskau entwaffnet mich, ich bewundere ihn rückhaltlos, Franz, Du kennst mich ein bisschen, Du weißt um meine schwach ausgeprägte Bewunderungsfähigkeit.«
Misslinger schwieg und legte als Antwort die Flasche, die er unter dem Arm hatte, in Walters Hand. Walter nahm sie wortlos entgegen und hielt sie seitlich vor die Augen, wodurch er irgendeine Augenschwäche auszugleichen suchte. »Robert Weil, Kiedricher Turmberg Riesling, Erste Lage, trocken, 2013« las er langsam vor. »Ich sehe, Dein Geschmack entwickelt sich.« Misslinger freute sich über das Lob. Aber er wusste auch, dass er gleich dafür würde bezahlen müssen. Walter lehnte sich in seinen Fauteuil zurück und schlug dabei die Beine so übereinander, dass sich die Enden seines Schlafrocks öffneten. Misslinger stellte fest, dass Walter zwei verschiedene Socken trug. Er hielt die auf seiner Brust abgestellte Flasche mit beiden Händen dicht vor seine Augen und sprach so leise, als redete er mit ihr: »Wir haben hier einen der mineralischsten und zugleich kühlsten und elegantesten der Weine bei Weil. Vielleicht einen der mineralischsten und elegantesten Weine des Rheingaus überhaupt. Franz, das ist ein richtiger Gletscherwein, weißt Du, ein glasklarer Wein. Du und ich, wir öffnen diese Flasche! Jetzt gleich!«
Misslinger versuchte zu protestieren. Aber Walter hatte schon einen Flaschenöffner zur Hand und wies Misslinger mit einer Bewegung des Armes an, zwei Gläser aus der Vitrine zu holen.
Der Weißwein schillerte gelb in Misslingers Glas, und es gelang ihm nur mit großer Überwindung, dass er einen kleinen Schluck davon trank. Walter richtete sich auf. »Ah, da haben wir die reife, apfelige Traubigkeit«, redete Walter jetzt leichter dahin, »eine wunderbare Reife, aber ohne fett zu sein, elegant und fein und trotzdem hocharomatisch.« Er hob die Stimme und deklamierte beinahe: »Hier ist die Schiefrigkeit des Rheingaus und da das ganze Spannungsfeld der Mosel. Lieber Franz, kauf Dir auch ein paar Flaschen davon und lege ihn Dir in den Keller. Der kann noch einige Jahre vertragen. Du hast doch einen Weinkeller, Franz?«
Misslinger hatte alles schweigend über sich ergehen lassen und nur gedacht, dass Walter ein Komödiant war, immer noch ein Komödiant. Er antwortete: »Einen Keller haben wir nicht. Aber natürlich trinken Selma und ich gerne hin und wieder ein gutes Glas Wein.« Das bereute er gleich. Denn Walter reagierte nicht. Eine Weile war es ganz still im Raum.
Misslinger fand, er dürfe nun beginnen, und sagte: »Walter, im nächsten Jahr findet die Bundestagswahl statt. Ich bin im Bundestag. Ich war Landesvorsitzender. Ich bin Mitglied im Bundesvorstand. Ich bin Generalsekretär. Wir stehen jetzt so gut da wie seit fünf Jahren nicht. Das ist vor allem mein Werk. Ich will den Vorsitz. Ich will die Spitzenkandidatur. Ich bin dran und Du weißt es. An mir kommt jetzt keiner vorbei.«
»Nein, an Dir kommt keiner vorbei«, sagte Walter leise. »Das weiß ich doch, Franz. Jeder weiß das. Aber was kann ich da noch tun, Franz? In der Partei entgeht mir jetzt ja manches. Es wird vielleicht nicht vor mir verborgen, davon will ich gar nicht ausgehen, ich bin einfach nicht mehr kräftig genug, nicht wahr, ich habe nicht mehr den Blick für all die vielen Sachen.«
Misslinger war von Walters Antwort weder überrascht noch beunruhigt. Er machte ihm Komplimente und versicherte ihm, wie unersetzbar er nach wie vor sei. Daran habe sich nicht das Geringste geändert, ja, im Gegenteil, in den vergangenen Jahren habe das Gewicht seiner Worte eher noch zugenommen. Im Angesicht einer allgemeinen Verunsicherung, einer weltweiten krisenhaften Zuspitzung der Verhältnisse, sei der Wert langjähriger politischer Erfahrung selbst dem ehrgeizigsten Heißsporn klar geworden. Alle wüssten, dass die Partei vor jeder Richtungsentscheidung ratsuchend nach Irlich am Rhein blicke. Und eine solche Richtungsentscheidung stehe nun wieder an und er, Walter, wisse, dass er sich immer auf ihn, Misslinger, habe verlassen können, auch in den Zeiten, die nun glücklicherweise schon lange zurücklägen, als es in Partei und Öffentlichkeit Unruhe wegen dieser Spendengeschichte gegeben habe. So wisse nun auch er, Misslinger, dass er sich ganz auf ihn, Walter, verlassen könne, der ihn ja beinahe seine gesamte politische Laufbahn hindurch begleitet und gefördert habe, und da spreche man immerhin von 24 Jahren, also eigentlich ein Vierteljahrhundert, ja, gefördert ohne Wenn und Aber, denn ohne Walter wäre Misslinger nicht da, wo er heute sei.
»Ja«, sagte Walter, »das ist richtig, Franz. In dieser dummen Geschichte damals konnte ich mich auf Dich verlassen. Das habe ich nicht vergessen und ich sehe, Du hast es auch nicht vergessen. Es gilt aber auch: Ohne mich wärest Du nicht da, wo Du heute bist. Franz, mein letztes Hemd hat keine Taschen. Ich kann nichts mitnehmen. Politischer Einfluss lässt sich nicht vererben, aber wenn, dann wärst Du mein Erbe.« Sie schwiegen.
Traudl brachte auf einem Tablett Tee und Kuchen von der Art, wie man ihn vor allem am Stadtrand findet, schwer und süß, und für Misslinger kaum genießbar. Aber das Service fiel ihm auf, feines weißes Porzellan mit rosafarbenen Blumen von beinahe mädchenhafter Heiterkeit.
Als Traudl gegangen war, sagte Walter plötzlich: »Ich bin alt. Aber Du bist nicht mehr jung.«
»Ich bin 42. Das ist jung.«
»Nicht so jung, wie Du mal warst, Franz. Du warst der Shootingstar der deutschen Politik, oder? Aber jetzt bist Du erwachsen. Ich bin um so vieles älter, ich darf das sagen, oder Franz? Ich darf so mit Dir reden.«
Misslinger stand ohne Antwort auf. Er ging zum Fenster und öffnete den Vorhang, nicht ganz, das wäre zu weit gegangen, aber doch so, dass der Raum, der bisher im Halbdunkel gelegen hatte, plötzlich von der Herbstsonne erfasst wurde. Misslinger drehte sich um und sah befriedigt, wie das Licht alles in einen anderen Zustand überführte. Walter zog sich kaum merklich zusammen wie ein überraschtes Tier.
»Ich bin Generalsekretär unserer Partei«, sagte Misslinger. Er stand vor Walters Sessel und sah auf den alten Mann hinunter. »Du weißt, in welchem Zustand ich sie übernommen habe. Du weißt, wo wir damals standen. Niemand wollte etwas von uns wissen. Man hat uns für überflüssig erklärt. Irrelevant. Du erinnerst Dich an das Dreikönigstreffen in Bayreuth? Meinst Du, ich habe vergessen, wie ich da stand und gewartet habe? Dreikönigstreffen ohne die Drei Könige! Kein Caspar, kein Melchior, kein Balthasar, nirgends!« Er hob die Hände und blickte sich in Walters Wohnzimmer um, auf der Suche nach den Heiligen Drei Königen: »Und um mich herum die Presse, die Meute, die Journalisten, wie sie feixen, wie sie gaffen, wie sie spotten. Jetzt seid ihr nicht nur von allen guten Geistern verlassen – sondern auch noch vom Heiligen Geist, haben sie gesagt. Die Heiligen Drei Könige haben ihre Geschenke wohl schon bei den Grünen abgegeben, haben sie gesagt. Aber ich habe das durchgestanden. Ich habe gekämpft, Walter. Für unsere Partei. Und jetzt schau, wo wir in den Umfragen stehen. Das ist meine Leistung«, sagte Misslinger und setzte sich und fügte hinzu: »Und Leistung muss belohnt werden.«