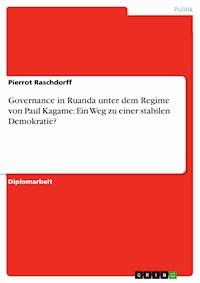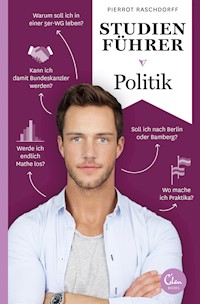
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eden Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Studienführer
- Sprache: Deutsch
Die Pflichtlektüre für angehende Politik-Studenten! Dieser praktische Ratgeber liefert Antworten auf die entscheidenden Fragen: Welche Inhalte erwarten mich? Wie finanziere ich mein Studium? Wie strukturiere ich die Semester sinnvoll? Was gilt es bei Auslandssemestern zu beachten? Und wollen Politikstudenten wirklich alle Bundeskanzler werden? Zahlreiche Anekdoten geben einen breiten und unterhaltsamen Einblick in den Studienalltag. Pierrot Raschdorff räumt hier mit gängigen Klischees auf und hilft bei der Vorbereitung auf den erfolgreichen Abschluss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pierrot Raschdorff
STUDIENFÜHRER
Politik
INHALT
Kapitel 1 EINLEITUNG
Kapitel 2 DAS FACH POLITIKWISSENSCHAFT
2.1 WARUM ICH POLITIKWISSENSCHAFT STUDIERTE – EINE ART PLÄDOYER
2.2 POLITIK UND POLITIKWISSENSCHAFT
2.3 STUDIENINHALTE
2.4 ANFORDERUNGEN AN STUDENTEN DER POLITIKWISSENSCHAFT
Kapitel 3 DIE WAHL DER RICHTIGEN HOCHSCHULE
3.1 KOPF ODER HERZ – UNI ODER STADT?
3.2 ZULASSUNGSBEDINGUNGEN UND BEWERBUNGSVERFAHREN
Kapitel 4 DIE FINANZIERUNG DES STUDIUMS
4.1 WAS KOSTET EIN STUDIUM?
4.2 FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN
Kapitel 5 DEIN NEUES REICH: WOHNHEIM, WG, WOHNUNG
5.1 DAS STUDENTENWOHNHEIM
5.2 DIE WG
5.3 DIE EIGENE WOHNUNG
Kapitel 6 DIE KOMMILITONEN
6.1 FINDE DEINEN TYP
6.2 GEHT DEMONSTRIEREN ÜBER STUDIEREN?
6.3 WIE POLITIKWISSENSCHAFTLER FEIERN
Kapitel 7 DAS STUDIUM
7.1 DAS KLEINE UNIWÖRTERBUCH
7.2 DIE ORIENTIERUNGSWOCHE
7.3 LEHRVERANSTALTUNGEN
7.4 DAS BACHELORSTUDIUM
7.5 DAS MASTERSTUDIUM
7.6 ARBEITSMETHODEN FÜR POLITIKWISSENSCHAFTLER
7.7 REFERATE UND HAUSARBEITEN
7.8 DIE ABSCHLUSSARBEIT
Kapitel 8 AUSLANDSAUFENTHALTE
8.1 DIE FINANZIERUNG
8.2 ERASMUS UND WAS MUTTI NICHT WISSEN SOLLTE
Kapitel 9 DAS PRAKTIKUM
9.1 ANLAUFSTELLEN UND DIE FRAGE NACH DER »RICHTIGEN« STELLE
9.2 WAS DU ALS PRAKTIKANT WISSEN SOLLTEST
Kapitel 10 UND AUS DIR IST DOCH WAS GEWORDEN: HALLO ZUKUNFT
10.1 DER DOKTORAND
10.2 NGOS, AUSWÄRTIGES AMT UND ENTWICKLUNGSORGANISATIONEN ALS ARBEITGEBER
10.3 DIE POLITISCHE STIFTUNG ALS ARBEITGEBER
10.4 DIE ZEITUNG ALS ARBEITGEBER
10.5 DER VERLAG ALS ARBEITGEBER
10.6 DIE AGENTUR ALS ARBEITGEBER
10.7 POLITIKWISSENSCHAFTLER ALS POLITIKER
10.8 ALS POLITIKWISSENSCHAFTLER IN EINEM BUNDESMINISTERIUM
Kapitel 11 FAZIT
Kapitel 12 WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
Kapitel 13 QUELLENVERZEICHNIS
DIE NEUENSTUDIENFÜHRER
KAPITEL 1
EINLEITUNG
Wenn Du dieses Buch in die Hand genommen hast, steht Dein Abitur vermutlich kurz bevor. Vielleicht hast Du es auch schon erfolgreich abgeschlossen oder noch ganz etwas anderes gemacht? In jedem Fall überlegst Du, was Du als Nächstes machen könntest und wohin Dich dieser Schritt womöglich führt, falls Deine Wahl auf ein Studium der Politikwissenschaft fällt. Denn wo Lehramt-, Medizin-, Jura- oder Physikstudenten von Anfang an zumindest eine ungefähre Vorstellung von ihren Zukunftsoptionen haben, herrscht bei geisteswissenschaftlich interessierten Studenten1 und ihren Familien oft eine Stimmung zwischen Ratlosigkeit und Panik: Wird ein Politikwissenschaftler tatsächlich ein Politiker?
Um Dir bei der Entscheidung für oder gegen das Studienfach Politikwissenschaft eine Hilfestellung an die Hand zu geben, gibt es diesen Studienratgeber. Extra und offiziell angefertigt für politisch interessierte Menschen, die de facto noch keinen blassen Schimmer haben, was genau in diesem Studium auf sie zukommt: Blüht Dir tatsächlich, wie es die Nachbarn Deiner Tante prophezeien, das gleiche Schicksal wie Ex-Philosophie-, -Soziologie- und -Geschichtsstudenten in ewiger Langzeitarbeitslosigkeit? Muss man lokalpolitisch aktiv sein und dafür auch im Winter Sandalen tragen? In welcher Stadt könntest Du studieren und was muss bei der Wahl der Universität beachtet werden? Wie kann man das Studium finanzieren und trotzdem Zeit zum Lernen haben? Wie stellt man sich bei einem Praktikum am besten an? Wer geht erfolgreich aus einem WG-Casting? Dieser Ratgeber versucht, durch die am eigenen Leibe gemachte Erfahrung eines politikwissenschaftlichen Studiums erworbene Weisheiten gebündelt weiterzugeben und dabei nichts auszulassen. Neben praktischen Lifehacks für Politikwissenschaftsstudenten wird insbesondere der Versuch unternommen, die Kernfrage aller Studenten sozial- und geisteswissenschaftlicher Disziplinen zu beantworten: »Was zum Teufel kann aus Dir später bloß mal werden?«
Sobald Du eine ungefähre Antwortidee zu dieser Frage hast, kannst Du bereits in frühen Semestern Deines Studiums mit der Ebnung Deines beruflichen Weges beginnen. Der Ratgeber zeigt Dir auch hierfür einige Beispiele und stellt verschiedene Karrierewege vor.
Das Buch mag deshalb auch für diejenigen einen Mehrwert haben, die Politikwissenschaft schon ein wenig länger studieren und sich so langsam doch einmal fragen, wie das Berufsleben als Politikwissenschaftler wirklich aussehen könnte.
Mit der im Rahmen der Bologna-Reform erfolgten Umstellung auf Bachelor- und Masterabschlüsse wurden inzwischen zahlreiche politikwissenschaftliche Studiengänge geschaffen, die inhaltlich sehr spezifische Schwerpunkte haben (zum Beispiel Regionalstudien Afrika und Asien, Internationale Wirtschaft und Entwicklung, Politikmanagement) oder einen möglichen Berufszweig mit aufgreifen (Politik- und Verwaltungswissenschaft). Oft sind dabei disziplinübergreifende Inhalte entstanden, welche gegebenenfalls trotz ihrer politikwissenschaftlichen Dimension in unterschiedlichen Bereichen der Universität angesiedelt sein können. Es lohnt sich also, sich die zahlreichen Studienangebote der unterschiedlichen Universitäten sehr genau anzuschauen und bei der Auswahl des Studienortes nicht vorschnell die Lieblingsstadt aufgrund anderer Verlockungen auszuwählen.
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die zusätzliche Nennung der weiblichen Form verzichtet. Es sind aber stets beide Geschlechter gemeint.
KAPITEL 2
DAS FACH POLITIKWISSENSCHAFT
2.1WARUM ICH POLITIKWISSENSCHAFT STUDIERTE – EINE ART PLÄDOYER
Es gibt viele gute und ein paar weniger gute Gründe, sich für ein Studium der Politikwissenschaft zu entscheiden. Ob Du lediglich besser über Politik Bescheid wissen willst als Dein Vater, in jeder Diskussion mit Freunden die stichfestesten Argumente hervorholen möchtest oder einfach nur verstehen willst, warum sich Völker immer noch bekriegen, kann Dich zu unterschiedlichen Schwerpunkten in Deinem Studium leiten. Das grundsätzliche Interesse ist demnach vielleicht vorhanden, aber beim Gedanken an die Berufsaussichten kommt bei Dir Unsicherheit auf. Du fragst Dich, ob und mit welchem Ziel Du dieses für den Arbeitsmarkt vermeintlich irrelevante Fach überhaupt studieren solltest. Diesen Unschlüssigen kann vielleicht mein persönliches Plädoyer für Politikwissenschaft eine Inspiration sein. Politisches Interesse ist Grundvoraussetzung, politische Ambitionen nicht unbedingt. Solltest Du eine Karriere in der Politik anstreben, ist vielleicht ein Jurastudium und der leidenschaftliche Einsatz für die Partei Deines Vertrauens der zielführendere Weg.
Trotz einiger Vorurteile und der verbreiteten Meinung, dass man als Politikwissenschaftler nichts Handfestes studiert oder die Chancen auf dem Arbeitsmarkt eher schlecht sind, kann ich aus voller Überzeugung schreiben, dass ich das Fach immer wieder studieren würde.
Viele Studenten – und dazu zählte ich auch – machen sich während des Studiums einfach noch sehr wenig Gedanken darüber, in welche berufliche Richtung sie nach dem Abschluss tatsächlich einmal gehen möchten. Und ja, es stimmt: Es gibt viele Absolventen, die das Studium mit dem diffusen Gefühl, »alles und irgendwie nichts zu können«, beenden. Ebenfalls richtig ist, dass viele Absolventen sich durch eine jahrelange Durststrecke von zahlreichen Praktika und Traineeprogrammen kämpfen, bevor sich ein bestimmter Job deutlich herauskristallisiert, der nicht nur gefällt, sondern sogar ein wenig Geld zum Leben abwirft.
Deshalb ist es hilfreich zu wissen, dass die Analyse und die Erforschung von Politik in der Politikwissenschaft stets im Vordergrund stehen. Mittels wissenschaftlicher Methoden werden politische Phänomene von allen Seiten und unter jedem erdenklichen Gesichtspunkt untersucht. Dadurch wird der Politikwissenschaftler mit vielseitigen Fähigkeiten für mehrere Branchen interessant. Für einen Personalmanager ist es bereits eine wichtige Information, dass ein erfolgreicher Absolvent vor ihm sitzt, der es gelernt hat, sich über längere Zeiträume auf komplexe Fragestellungen einzulassen und imstande ist, selbstständig Lösungswege für diese zu erarbeiten. Das Studium gibt erhebliche analytische Fähigkeiten mit, die später in verschiedenen Disziplinen hilfreich sein können und es Dir ermöglichen, eigenverantwortlich Problemstellungen zu lösen und Herausforderungen zu bewältigen. Dieses Basis-Set an Skills ist bereits ein elementarer Wert für den späteren Werdegang im Berufsleben.
Auch wenn Dir während des Studiums vielleicht niemals der Gedanke kommt, dass Du eines Tages eventuell als PR-Manager, Unternehmensberater, empirischer Sozialforscher oder Journalist tätig sein wirst, ist es mit den Fähigkeiten eines Politikwissenschaftlers durchaus möglich, in genau solchen Berufen irgendwann arbeiten zu können. Für andere Richtungen, beispielsweise das Lehramt als Politiklehrer, ist es ratsam, möglichst früh die entsprechende Entscheidung zu treffen, um alle notwendigen Kurse und Fächer absolviert zu haben.
Zudem gibt es viele Berufe, von denen Du eventuell bis dato noch nicht weißt, dass sie existieren. Viele spannende Tätigkeiten stehen Dir nach Abschluss Deines Politikstudiums offen, beispielsweise für Parteien, Stiftungen, Institutionen, Dach- oder Lobbyingverbände.
Damit wird auch schon deutlich, dass es weniger dem Studienfach geschuldet ist, wenn nach dem Studium womöglich eine längere Phase von Praktika und Traineeprogrammen beginnt. Sie mag der Grund sein, warum Sozialwissenschaftlern das Image von Langzeitstudenten mit realitätsfernen oder esoterischen Fähigkeiten aufgedrückt wird, die Wahrheit ist aber wesentlich weniger düster. Politikwissenschaftler kämpfen nach dem Abschluss vielmehr mit der Qual der Wahl als mit orientierungslosem Hippiedasein. Eine erschlagende Vielfalt an Berufsmöglichkeiten und denkbaren Lebenswegen eröffnet unbekannte Welten und ungeahnte Perspektiven, von denen viele erst einmal ausprobiert werden wollen. Während Mediziner oder Lehrkräfte ihr Studium auf die bereits getroffene Berufswahl ausrichten, gehen Politikwissenschaftler von ihrem Grundinteresse aus und lassen sich auf einen Findungsprozess während des Studiums ein. Entsprechend ist dieser Ratgeber aufgebaut.
Falls Du es eilig hast, kommt es also nicht ausschließlich auf die Studienfachwahl an, sondern darauf, ob Du Dich vor und während des Studiums bereits mit Deiner Zukunft auseinandergesetzt hast. Ein Politikwissenschaftler hat nach dem Studium viele Fähigkeiten und hat als Akademiker genügend Chancen, in verschiedensten Bereichen erfolgreich einen Einstieg zu finden. Je früher Du für Dich interessante, unterschiedliche berufliche Richtungen testest und gegebenenfalls Schwerpunkte in Deinem Studium setzt, umso einfacher ist letztendlich auch der Start ins Berufsleben nach dem Studium – Du musst einfach wissen, was Du willst.
Um an dieser Stelle aber den Druck direkt etwas zu mindern, kann ich ergänzend sagen, dass ich im Laufe des Studiums überhaupt noch keine Idee hatte, welchen Beruf ich danach ausüben werde. Den meisten Kommilitonen ging es da ähnlich, die verbreitete Meinung war quasi aus der Schulzeitlogik mitgenommen und übertragen worden: Je besser ich studiere, desto einfacher wird sicherlich auch die abschließende Suche nach einem passenden Job. Wichtig war für mich seinerzeit also nicht die Zeit nach dem Studium, sondern das Studium und seine Inhalte als solche. Wer die berüchtigte und – zu Unrecht – viel verspottete Orientierungsphase nach dem Studium vermeiden möchte, kann während der Semesterferien Praktika in politischen Einrichtungen absolvieren, als freier Mitarbeiter in einer Redaktion arbeiten, in seiner Freizeit bloggen, als studentische Aushilfskraft in Gremien, Verbänden oder Stiftungen ein paar Brötchen dazuverdienen oder bei einer PR-Agentur die Nase hineinhalten. Dies sind wohlgemerkt nur einige Beispiele Deiner Möglichkeiten. Letztendlich musst Du herausfinden, welcher Beruf aus der Fülle der Möglichkeiten nach dem Studium zu Dir passt – und im Gegensatz zum Arzt kannst Du ihn, wenn er Dir nicht mehr gefällt, notfalls immer wieder ändern. Dennoch gilt, Politikwissenschaftler werden zwar als Generalisten nach wie vor beruflich geschätzt, die tatsächlichen Jobangebote verlangen aber immer weniger nach Universalgenies. Eine Spezialisierung auf bestimmte Themen- und Fachgebiete ist zunehmend von Vorteil, dies gilt für fast alle Branchen, in denen Politikwissenschaftler aktiv sind. Damit ist eine Orientierung Deines Studiums im Sinne Deiner persönlichen Interessen nicht nur eine Möglichkeit, Deinen individuellen Präferenzen gerecht zu werden und Dein Studium für Dich interessanter zu gestalten, sondern auf dem Arbeitsmarkt ausdrücklich gewünscht.
2.2POLITIK UND POLITIKWISSENSCHAFT
Wahrscheinlich ist es Dir aufgefallen: In den genannten Beispielen für berufliche Perspektiven war bisher von Politik noch keine Rede. Um zu verstehen, wieso das so ist, was Politikwissenschaft eigentlich ist und was sie mit der bekannten Politik beziehungsweise dem, was aus den Medien bekannt ist, zu tun hat, muss zunächst einmal geklärt werden, inwiefern sich Politikwissenschaft von anderen Fächern unterscheidet.
Es wird in der Wissenschaft zwischen Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften unterschieden. Wahrscheinlich ist Dir beispielsweise die Soziologie bereits ein Begriff, ähnlich wie die Politikwissenschaft untersucht sie das soziale Verhalten von Menschen. Wir halten fest, es gibt unterschiedliche Fächer, die ein ähnliches Themenfeld als Untersuchungsgegenstand haben. Wir bewegen uns also in der Kategorie der Sozialwissenschaften.
Die verschiedenen Sozialwissenschaften analysieren das menschliche Handeln und Miteinander, daher werden sie häufig auch Gesellschaftswissenschaften genannt. Unter diesem Dach werden unterschiedlichste Fächer gruppiert, darunter Pädagogik, Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Soziologie oder Verwaltungswissenschaften. Politikwissenschaft und Soziologie werden als Kernfächer der Sozialwissenschaften angesehen. Einige Disziplinen befinden sich an Schnittstellen der verschiedenen Wissenschaften. Letztendlich geht es aber um Interaktionen, Organisationen und Systeme zwischen Menschen oder Menschengruppen – vieles ist relativ, wenig ist absolut. Dies schließt aber nicht aus, dass auch in diesen Bereichen immer wieder auf Methoden anderer Wissenschaften zurückgegriffen wird: Du als angehender Politikwissenschaftler wirst Dich beispielsweise mit Statistik, ihrer Erhebung, Auswertung und Analyse – zum Beispiel im Umgang mit Umfragen – auskennen müssen. Ein Minimum Mathematik bleibt also auch im Studium niemandem erspart.
2.2.1 Politik
Der Begriff »Politik« umfasst ein ganzes Konzept. Dabei spielen eine Menge Informationen, die Geschichte und der Kontext wichtige Rollen, daher lässt sich Politik nicht mit wenigen Worten definieren. Schaut man sich allerdings das altgriechische Ursprungswort »polis« (Stadt, Burg, Gemeinde) an, kann sich dem heutigen Verständnis von Politik in seinem Grundprinzip bereits angenähert werden: Es geht hauptsächlich also irgendwie um die inneren Zustände oder Geschehnisse in einer Einheit von Menschen, die zusammenleben.
Gemäß einer Lehrbuchdefinition ist Politik »[s]oziales Handeln, das auf Entscheidungen und Steuerungsmechanismen ausgerichtet ist, die allgemein verbindlich sind und das Zusammenleben von Menschen regeln.«2 Außerhalb der kleinen altgriechischen Stadt tobt also das Große und Ganze. Es geht um menschliches Handeln, sowohl in der Gemeinde, im Staat als auch in der Weltpolitik, und darum, dass es auf jeder Ebene einen von uns geschaffenen Rahmen gibt, der unser Handeln mitbestimmt.
2.2.2 Politikwissenschaften
In der Politikwissenschaft werden die genannten Geflechte und Zusammenhänge tiefergehend untersucht. Vor dem Hintergrund der eben aufgezählten Ebenen wird versucht, das soziale Handeln zu erforschen. Verhalten von Menschen oder Gruppen von Menschen ist immer einerseits geprägt von den persönlichen Merkmalen jedes Einzelnen, andererseits aber durch das gesellschaftliche Umfeld: Familie, staatliche Gesetze, kultureller Rahmen oder Werteorientierungen. Das bedeutet, dass unser Handeln immer im Zusammenhang mit den Handlungen anderer Menschen und unserer Position in der Gesellschaft zu sehen ist.
Als Politikwissenschaftler wird von Dir langfristig erwartet, dass Du analytisch dazu in der Lage bist, sozusagen einen Schritt aus dem Gewusel herauszutreten und die Mechanismen, das Regelwerk und Umfeld möglichst sachlich zu betrachten. Du bist zwar Teil des Ganzen, versuchst Dich aber immer wieder an dem neutralen Blick von außen, als würdest Du einen Ameisenhaufen beobachten.
Politikwissenschaft hat eine soziologische Dimension, weil sie zum Beispiel untersucht, wie sich soziales Handeln verändert und wodurch es beeinflusst oder gelenkt wird. Dies gilt beispielsweise im Bezug auf Verhaltensweisen, Entscheidungsprozesse, Ereignisse und mögliche Reaktionen auf diese, Entwicklungen, Strukturen und Organisationen. Politikwissenschaft ist die intensive Auseinandersetzung mit den »Gerüsten« der Gesellschaft, mit ihren Strukturmerkmalen sowie ihren sichtbaren und unsichtbaren Regeln und Normen des politischen Systems.
Die Politikwissenschaft erforscht die unterschiedlichsten politischen Phänomene. Was also einen Politikwissenschaftler von einem Nicht-Politikwissenschaftler unterscheidet, ist der Ansatz, mit dem er politische Ereignisse erläutert. Wissenschaft – dies ist ganz allgemein und für alle Fächer gleich gültig – gibt Methoden vor, wie Wissen erarbeitet wird. Sie stellt einen Baukasten zur Verfügung, mithilfe dessen komplexe Sachfragen beantwortet werden und die Variablen definiert werden können, welche die Situationen beeinflussen.
2.2.3 Policy, Politics, Polity
Die Fragen, mit denen sich Politikwissenschaftler beschäftigen können, sind grundsätzlich sehr weitläufig in ihrer Thematik, Art und der Ebene, auf welcher sie stattfinden. Etwas konkreter wird es schon, wenn man fachüblich beginnt, zwischen den drei Dimensionen der Politik zu unterscheiden, nämlich: politische Inhalte (Policy), politische Prozesse (Politics) und politische Strukturen (Polity). Diese englischen Begriffe werden Dich während des gesamten Studiums begleiten. Sie zu verinnerlichen und ihre Unterschiede klar zu begreifen, ist eine Grundvoraussetzung für Dein späteres wissenschaftliches Arbeiten.
Policy
Wenn Politik unter die Lupe genommen wird, müssen Inhalte sehr genau betrachtet werden. Dies kann etwa das Politikprogramm einer Partei sein, das zum Beispiel die Haltung einer Partei zur Steuerpolitik eines Landes aufzeigt. Bei der Untersuchung von politischen Inhalten soll es aber nicht nur um das einzelne Programm gehen, sondern auch um die Einstellung, also um die Motivationsquelle, die Ideale, die Werte und die Normen jener Personen, die ihr Programm durchsetzen wollen, und welche Kompromisse vielleicht auf dem Weg zu ihrer Einigung auf diese Formulierung geschlossen wurden. Policy bezeichnet also die Aufschlüsselung der inhaltlichen Aspekte von Politik.
Politics
Im politischen Prozess werden die oben genannten Inhalte erstritten. Welche Motive und Interessen werden verfolgt, wie kommen gewisse Inhalte zustande und wie können sie in der Praxis realisiert werden? Solche Fragen zu analysieren und zu beantworten, ist eine wichtige und spannende Aufgabe der Politikwissenschaftler. Die Kernprozesse der Politik, in denen aus Inhalten konkrete Handlungen entstehen, werden hier sichtbar gemacht. Darunter fallen beispielsweise Willensbildungsprozesse wie Koalitionsverhandlungen, bei denen Regeln zur politischen Zusammenarbeit erstellt und manifestiert werden, oder Implementierungsprozesse, die sich mit der Umsetzung und Verankerung von politischen Ideen und Beschlüssen in der Gesellschaft befassen. Politics umfasst die Gesamtheit solcher politischen Prozesse.
Polity
Parteien, Verbände, Institutionen, Parlamente und Regierungssysteme bilden die Struktur eines politischen Systems. Auf welchem Wege ist gerade diese Struktur entstanden, nach welchem Leitbild funktioniert sie, welche historischen Gegebenheiten liegen ihr zugrunde und welche Akteure spielen in ihr die tragenden Rollen? In diesen Bereich fällt zum Beispiel auch die Analyse von zwischenstaatlichen Organisationen wie der Europäischen Union oder den Vereinten Nationen. Als Bühne der politischen Akteure hat die Polity einen maßgeblichen Einfluss auf die Inhalte (Policy) und Prozesse (Politics) der Politik, die sich auf ihr abspielen.
Umgekehrt gilt dies natürlich ebenso: Die Entstehung und Reformen politischer Ordnungen (zum Beispiel des deutschen Föderalismus oder der Europäischen Union) werden von den politischen Programmen (Policy) beeinflusst, durch welche sie im Rahmen bestimmter Prozeduren (Politics) umgesetzt werden. Und schließlich hängt natürlich auch die Form der politischen Auseinandersetzung (Politics) davon ab, wie die Polity beschaffen ist und worum es dabei inhaltlich geht (Policy).
Deshalb untersuchen Politikwissenschaftler zumeist nicht nur einen Bereich. Bei der Auseinandersetzung mit den meisten politischen Phänomenen sind durch ihre wechselseitige Abhängigkeit alle drei Bereiche Polity, Politics und Policy relevant und müssen als verschiedene Dimensionen eines Untersuchungsgegenstandes berücksichtigt werden.
2.3STUDIENINHALTE
Nach erfolgreicher Klärung der drei Grundbereiche Politics, Policy und Polity können die einzelnen Disziplinen und Forschungsgegenstände der allgemeinen Politikwissenschaft klarer verstanden werden. Bei der Auswahl Deines Studiengangs wirst Du Dich damit auseinandersetzen, da diese Bereiche in unterschiedlicher Bezeichnung als Studieninhalte in Deinem Studienplan auftauchen:
2.3.1 Politische Theorie
In dieser Disziplin zeigen sich in den Seminaren sehr schnell offensichtliche Parallelen zu den Geisteswissenschaften. Denn um den Ursprüngen von Politikwissenschaft auf die Spur zu kommen, werden anfangs erst einmal verschiedene Denker und ihre Theorien vorgestellt, die Du vielleicht eher als Philosophen abgestempelt hättest. Angefangen bei Aristoteles über Thomas Hobbes bis zu Jürgen Habermas wird Dir wahrscheinlich zunächst einmal eine Fülle an Texten und Namen um die Ohren gehauen, mit denen Du die Geschichte und Entwicklung der politischen Theorie von der Antike bis zur Gegenwart bereist. Es klingt vielleicht nach abschreckend viel Arbeit oder Auswendiglernen, doch im Unterschied zur Geschichtsklausur in der Schulzeit sollst Du hier in die Denkstrukturen und die Sichtweisen auf die Welt der Autoren eintauchen. Viele der vorgegebenen Lektüren sind in der Tat spannend und ihre Herangehensweisen werden Dir helfen, das vorhin beschriebene Handeln und Miteinander der Menschen, den Kern der Sozialwissenschaft, anders wahrzunehmen. Umfangreiche Klassiker von Karl Marx, Friedrich Engels oder Max Weber sind kein Grund, in eine Angststarre zu verfallen oder voller Zweifel an die eigenen Fähigkeiten nach Audiozusammenfassungen für Laien zu googlen, um der Schmach zu entgehen, sich klein zu fühlen. Sicher soll es Studenten gegeben haben, die sich erfolgreich vor diesen Theorien drücken konnten. Einen Gefallen tut man sich damit jedoch nicht unbedingt, denn es geht bei diesen Aufgaben nicht nur darum, einen Test zu bestehen oder jedes dicke Buch bis ins letzte Detail zitieren zu können (auch wenn das zugegebenermaßen ganz schön Eindruck schinden könnte). Jedoch wirst Du bei der mutigen Lektüre dieser Werke feststellen, dass die fallenden Groschen des Verständnisses Dich mit jedem Klingeln etwas mehr in die politikwissenschaftliche Perspektive beziehungsweise in die Basis der ihr zugrunde liegenden Denkstrukturen mitnehmen. Und genau deshalb wirst Du sie lesen.
Wie positiv das Erlebnis dieser Einführungen für Dich sein wird, solltest Du vor allem von Dir selbst abhängig machen. Denn, machen wir uns nichts vor, ein solches Fach kann bei einem einschläfernden und unmotivierten Professor auch sehr langweilig werden. In einem solchen Fall halte Dich einfach an die vorgegebene Lektüre. Mit dem Vertrauen, dass die großen Denker nicht ganz ohne Grund so einflussreich wurden und Dir sicherlich gute Lehrer sein werden, und einem bisschen Motivation im Rucksack kannst Du auch mit einer Schlaftablette als Dozenten viel aus diesem Studienbereich gewinnen.
Ein guter Prof hingegen kann hier ein Hauptgewinn sein. Richtig spannend wird es erst recht, wenn in den Seminaren der Politischen Theorie neben der Historie auch immer wieder ein Bogen zu aktuellen Fragestellungen und gegenwärtigen politischen Phänomenen geschlagen wird, um diese unter einem theoretischen Gesichtspunkt zu betrachten. Das Wissen aus Theorie und Ideengeschichte, welches Du Dir in diesen Kursen aneignest, gibt Dir ein Reflexionsgerüst, auf dem Deine Ideen, Argumente und schließlich wissenschaftlichen Erkenntnisse zu historischen und aktuellen Geschehnissen aufbauen und Form finden können.
In Studienfächern wie Politische Theorie gibt es zumeist sowohl Vorlesungen als auch Seminare. In Letzteren wirst Du als Prüfungsleistung Referate und Hausarbeiten, also wissenschaftliche Essays, Stellungnahmen und Analysen, verfassen müssen.
2.3.2 Vergleichende Politikwissenschaft
In erster Linie geht es bei der Vergleichenden Politikwissenschaft um die Gegenüberstellung politischer Systeme. Dafür wirst Du Dich zu Beginn – egal an welcher Universität Du studierst – zunächst einmal intensiv mit dem politischen System der Bundesrepublik Deutschland auseinandersetzen. Aufbau und Strukturen eines politischen Systems sind etwas trocken, aber die Basis, um es mit anderen Systemen vergleichen und ihre Unterschiede und spezifischen Funktionsweisen erkennen und aufzeigen zu können. Einmal verinnerlicht, können sie ähnlich wie die Grundsatzparameter Deines Lieblingssports für Dich offensichtliche Elemente werden, von denen aus Strategien, Rollen, Taktiken und Spieler vergleichend diskutiert werden können. Die Aufgaben und politischen Institutionen eines Landes zu verstehen, sich damit auseinanderzusetzen, welche Auswirkungen Parteien und ihre politischen Ausrichtungen auf die Staatstätigkeiten haben, oder wie die Macht von Verfassungsgerichten im internationalen Vergleich einzuschätzen ist, können beispielhaft als Thematiken der Vergleichenden Politikwissenschaft angeführt werden. Oder auch die Frage, inwiefern der Bundesrat oder die zweite Kammer ein Blockadeinstrument für die Regierungsopposition darstellen kann. Fragestellungen im Themenbereich der Vergleichenden Politikwissenschaft sind meist recht praxisnah. Du wirst Dich nach und nach in die Lage versetzen, politische Strukturen (Polity), Prozesse (Politics) und Inhalte (Policy) innerhalb und außerhalb eines Staates miteinander vergleichen und analysieren zu können. Außerdem kannst Du durch den Besuch dieser Vorlesungen und Seminare lernen, Entscheidungsprozesse sowie Funktionslogiken politischer Institutionen besser einzuordnen und zu beurteilen.
2.3.3 Das politische System der Bundesrepublik Deutschland
Die möglichst genaue Kenntnis des deutschen Staatsapparats, seiner Regierung, seiner Institutionen, des Parlaments und der unterschiedlichen (größeren) Parteien sowie alles andere, was dort noch irgendwie mit hineingehört, ist für Studenten der Politikwissenschaft Pflicht. Wie hängt alles wo und warum miteinander zusammen und wer hat letztendlich in welcher Situation das Sagen zu was?
Auch die Analyse der Verwaltung des Staates fällt in diesen Fachbereich. Letztendlich ist es nicht nur wichtig zu wissen, welche Personen diese oder jene Entscheidung treffen, sondern auch das Verständnis dafür, wie und wann Gesetze in die Praxis umgesetzt werden können. Um solche Prozesse nachzuvollziehen, helfen die Kenntnisse staatlicher Verwaltungsstrukturen natürlich. Sich diese einzuprägen, ist nicht immer schön, es führt aber kein Weg dran vorbei – als Politikwissenschaftler würdest Du Unsicherheiten in diesen Bereichen als peinlich empfinden und sowieso nicht lange vertuschen können.
Etwas mehr Leben kommt in die Materie, wenn Du Dir vor Augen führst, dass die staatlichen Organe, Prozesse, Regeln und sogar die Wähler in der Praxis jedoch nur ein Teil des politischen Systems sind. Erst, wenn Du das theoretische Organigramm des politischen Systems kennst, kannst Du das Gedrängel und Gewusel um die Einflussnahme richtig erkennen. Für ein realistisches Bild der politischen Bühne werden in diesem Themenbereich also auch andere, beweglichere Einflussgrößen der Politik genauer unter die Lupe genommen. Als bekannte Beispiele wären Wirtschaftsakteure wie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände oder zivilgesellschaftliche Bewegungen und Organisationen zu nennen. Ihnen können in der Praxis wichtige Rollen des politischen Geschehens zukommen. Im Interesse ihrer Mitglieder, Klienten, Anliegen oder im Sinne der breiten Öffentlichkeit beeinflussen sie – oder versuchen dies zumindest – politische Diskurse auf allen verschiedenen Ebenen von Bund bis Kommune: Mit Informationen und Fachkenntnissen, durch öffentliche Kritik an Gesetzesvorhaben, Feedback zu politischen Entscheidungen und Diskussionsmaterial ihrer Fachgebiete sind die Akteure jenseits des Staatsapparats nahezu omnipräsent im nationalen politischen Geschehen.
Auf all diesen Ebenen, in allen Themen sowie in der medialen Berichterstattung, welche diesen Geschehnissen folgt, kannst Du potenzielle zukünftige Arbeitgeber für Dich ausmachen. Beim Erlernen der Strukturen kannst Du bereits viel über Deine eigenen Jobpräferenzen lernen, indem Du Dein Interesse, Deine Sympathien und Antipathien für bestimmte Bereiche des Systems genau im Auge behältst. Betrachte diesen Bereich an Tagen, an denen der Lernstoff zu trocken ist, demnach als persönliche Berufsorientierung (es hilft ebenfalls, zu wissen, für welche Stellen man gerade nicht arbeiten möchte und warum).
2.3.4 Internationale Politik/Internationale Beziehungen
Schnell wirst Du merken, dass dieser Themenbereich bei Studenten besonders beliebt ist. Über die internen Sorgen Deutschlands hinaus bestechen die Fächer dieses Bereichs mit Praxisnähe, Aktualität und Komplexität einer globalisierten Welt. Entsprechend gut besucht sind die Veranstaltungen, die an den meisten Universitäten aber hauptsächlich für höhere Semester ausgerichtet sind. Wer hier einen Sitzplatz ergattert, wird an die großen Themen und Streitfragen der Weltpolitik herangeführt, jedoch auch hier wieder einmal nicht, ohne zunächst einen intensiven Theorieteil hinter sich zu bringen.