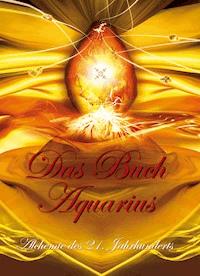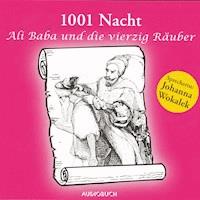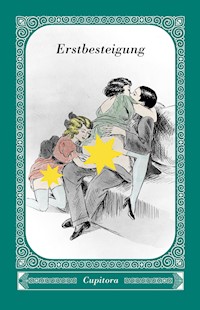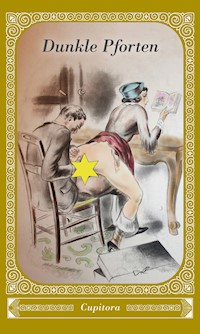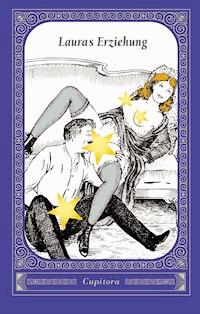Ein offenherziger Roman in zwei Teilen nach einem unveröffentlichten Privat manuskript aus den Goldenen Zwanzigern, versehen mit 13 appetitlichen Abbildungen unzweideutiger Art.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sturm und Drang
Venus in Indien Teil 2
Ein offenherziger Roman in zwei Teilen nach einem unveröffentlichten Privatmanuskript aus den Goldenen Zwanzigern, versehen mit 13 appetitlichen Abbildungen unzweideutiger Art.
eISBN 978-3-95841-776-2
© by Cupitora in der BEBUG mbH, Berlin
Mein Leben lang war ich in noch keinem so unbequemen Gefährt gereist wie einer Ekkha, und ich hoffe nur, dass keine meiner Leserinnen jemals solchen Strapazen und Qualen ausgesetzt sein möge, wie ich sie erdulden musste. Und den tapferen, männlichen Lesern meiner Memoiren wünsche ich, so ihnen ein ungnädiges Schicksal diesen Verdruss beschert, Trost an der Einsicht, dass in der Welt sowohl Blumen wie auch Disteln wachsen und ihr Weg nicht immer nur durch Dornenbüsche führen wird, ja, dass beide vielleicht in viel zu schneller Folge einander ablösen, um das Leben gleich bleibend satt-behaglich werden zu lassen, was ja langweilig wäre. Denn wann hätte das Nachlassen einer Qual oder eines Schmerzes nicht schon Nächte der Freude beschert? Bei mir allerdings war die Reihenfolge jetzt umgekehrt: Qualen folgten auf höchste Wonne – ach, wie anders war mein Sitz in der scheußlichen Ekkha im Vergleich zu meinem weichen Ruhelager auf dem schönen Bauch meiner holden Lizzie Wilson und dem sanften Kissen zwischen ihren schwellenden Elfenbeinschenkeln! Wahrlich, ich war auf einem Blumenfelde gewandelt und hatte jetzt die Dornenwüste erreicht.
Eine Ekkha, mögen meine geneigten Leser fragen, was ist das überhaupt? Nun, eine Ekkha ist ein zweirädriges Fuhrwerk, das in Nordindien viel benutzt wird. Sie hat keine Federn und eine nur etwa drei Quadratfuß große Plattform, auf der man sitzt, so gut man eben kann. Gezogen wird sie von einem kleinen Pferd. Die Wagengabel neigt sich meist vorn hoch, sodass sich die Plattform, auf der man sitzt, stark nach hinten schrägt. Der Kutscher hat seinen Platz auf der Gabel, und wenn er, was vorkommen soll, nicht besonders gut riecht, kriegt man all seinen Duft ins Gesicht geweht. Aber die Ekkha hat auch ihre guten Seiten. Sie kann nahezu überall hin; sie ist leicht und trotzdem robust. Wie oft habe ich gesehen, dass eine einzige ein halbes Dutzend Inder trug, die sich ja mit Leichtigkeit dort hinhocken können, wo auch nur ein Europäer kaum genug Platz findet. Sie hat den Vorteil, ein billiges, zugleich aber meist höchst pompöses Beförderungsmittel zu sein, denn an ihren vier Ecken erheben sich weiße, kunstvoll geschnitzte Pfeiler, die in der Regel einen von einem Messingornament gekrönten Baldachin tragen; dazu ist die ganze Ekkha leuchtend bunt bemalt, mit phantastischen Arabesken in Messing verziert und mit Glöckchen behängt. Des letzteren Umstandes wegen heißt sie bei den englischen Soldaten und ihren Frauen auch »Klingelkutsche«, denn beim Fahren bimmelt und rasselt sie in einem fort und ist somit für die Ohren genauso eine Strapaze wie für die Sitzfläche.
Zu diesen Unbequemlichkeiten meiner Reise kamen noch diverse andere. Zuerst einmal befand sich die Straße in mehr als argem Zustand – während der letzten zwei, drei Jahre waren ja nach Afghanistan hinein und von dort zurück Tausende von Soldaten und Fahrzeugen aller Art, darunter auch leichte und sogar schwere Artillerie, in unaufhörlichem Strom über sie dahingezogen. Folglich war sie zollhoch mit mehlfeinem Sandstaub bedeckt, der während des Tages hochwirbelte, sich stundenlang nicht wieder setzte und einen regelrechten Nebel bildete. Er nahm dem Kutscher den Atem, dörrte ihm die Kehle aus und flog ihm in die Augen und Ohren, ganz davon abgesehen, dass er mich von Kopf bis Fuß bedeckte. Und wie viele Pferde auf dieser Straße schon verendet waren! Ich schätze ihre Zahl auf zehn- oder gar zwanzigtausend. Dem Gestank nach zu urteilen, der vom Ortsrand Nowsheras bis zu dem Publis nahezu ohne Unterbrechung die Luft erfüllte, musste ein großer Teil dieser toten Tiere noch längs der Straße liegen. Die Kadaver wurden zwar so schnell wie möglich vergraben oder verbrannt, aber es waren noch genug oberhalb der Erde übrig, dass selbst dem stärksten Magen übel werden konnte. Ach, Lizzie, Lizzie, wenn ich dagegen an das liebliche Parfüm denke, das immer von dir ausströmte, wenn du mich in lustvoller Leidenschaft und höchster Ekstase umklammertest und mir Stoß auf Stoß zurückgabst, dort auf jenem unvergesslichen Wonnepfühl, wo ich dich so oft und oft gebürstet habe, in dem Freudenbungalow, den ich jetzt immer schneller hinter mir zurücklasse! O ja, das hier waren nun die Dornen, die mich stachen, nachdem ich den köstlichen Duft der Rose genossen hatte!
Schon bald nach Antritt dieser unbequemen und strapaziösen Fahrt wurde es dunkel. Ab und zu kam ein indischer Ulan vorbeigeritten, und beim schwachen Schein unserer Kerzenlaterne konnte ich seine Lanze, seinen Säbel und die verzierten Beschläge auf dem Geschirr seines Gaules glänzen sehen. Die Straße zwischen Attock am Indus und Peshawar ist niemals völlig sicher und wird beziehungsweise wurde seinerzeit stark patrouilliert. Mehr als einmal war selbst Nowshera überfallen und geplündert worden, sogar in Jahren, als in Afghanistan Frieden herrschte – wie viel unsicherer musste der Weg also jetzt sein, so unmittelbar nach Beendigung des Krieges!
Wäre die Ekkha weniger unbequem gewesen, hätte ich die Stunden, die sie mich bis Publi trug, ganz sicher verträumt, indem ich die gänzlich unerwarteten und herrlich wollüstigen Freuden, die meinen Aufenthalt in Nowshera so wahrhaft genüsslich gemacht hatten, noch einmal hätte Revue passieren lassen, doch ich muss gestehen, dass ich meine Sterne, statt sie zu loben, ganz schön verfluchte, denn von der angestrengten Haltung, die ich einzunehmen gezwungen war, schmerzte mein Kreuz immer mehr, und ich sehnte die Zeit herbei, da ich das elende Vehikel verlassen konnte, in dem zu reisen mich das Schicksal verdammt hatte.
Endlich erreichte ich Publi, ein kleines Dorf an der Abzweigung der Straße nach Cherat, in dem trotz der späten Stunde noch reges Leben und Treiben herrschte. Die einheimischen Läden mit ihren zum Verkauf ausgestelltem Frischfleisch und sonstigen Lebensmitteln hatten noch geöffnet und waren durch Öllampen, die aus einem Tonschälchen und einem in Öl getauchten Draht bestanden, mehr oder weniger hell erleuchtet. Männer, Frauen und Kinder strömten umher, als käme ihnen niemals der Gedanke, schlafen zu gehen und in unregelmäßigen Abständen erhoben sich die für unsere europäischen Ohren nicht immer melodischen Klänge indischen Gesanges in die Luft, begleitet vom monotonen Schlagen der beliebten Hindutrommeln. Ochsen, Elefanten, Kamele, Pferde und Hunde säumten beide Seiten der Straße und vermehrten die allgemeine Ansammlung noch um ihre diversen Stimmen und Gerüche.
Wir machten gerade so lange Pause, dass unsere Kutscher sich einen Vorrat an Röstkorn besorgen sowie ihre Wasserflaschen auffüllen und wir unsere verkrampften Beine mal wieder richtig ausstrecken konnten. Dann stiegen Soubratie und ich abermals auf unsere Ekkhas und wir starteten in gutem Trab die Kacha-Straße hinauf in Richtung der Berge, die jetzt infolge der tiefen Dunkelheit unseren Blicken verborgen waren. Doch hoch über uns funkelte der ganze Himmel vor Sternen, und obgleich die Straße hier noch unebener und holpriger war, ließen wir jedenfalls den Staub und Gestank der Hauptstrecke hinter uns. Die Nachtluft, die über die offene Ebene heranwehte, war rein und erfrischend, und ich fühlte mich jetzt wieder einigermaßen wohl, abgesehen natürlich von meiner unglücklichen Sitzposition, die mich leider daran hinderte, mich vergnüglichen Gedanken hinzugeben, denn wenn ich zufällig doch an Lizzie dachte, dann nicht etwa weil ich mir ihren so herrlichen, schönen und aufreizenden Schoß herbeiwünschte, sondern weil ich sie um die Bequemlichkeit ihres Dak-Gharrys beneidete, in dem sie jetzt schnell nach Muttra rollte.
Trotz der freundlichen Warnung, die mir mein trefflicher Freund Major Stone gegeben hatte, zwischen Publi und Shakkote nicht nur unbedingt wach zu bleiben, sondern sogar den Degen gezückt zu halten, um jederzeit verteidigungsbereit zu sein, falls uns Räuber überfielen und trotz meiner verkrampften Haltung kam der Schlaf schließlich mit seiner gütigen Hand und überwältigte mich. Ich hatte bis dahin Stones Rat tatsächlich befolgt und mit blankem Degen im Schoß dagesessen, konnte nun aber einfach nicht mehr die Augen aufhalten. Ich fiel in tiefen Schlaf und wachte erst wieder auf, als die Ekkha anhielt und ich sah, dass wir in einem kleinen Hain waren, an dessen Rande sich die letzte indische Herberge sowie eine mit einheimischer Infanterie besetzte Wachstation befanden. Man sagte mir, ich solle aussteigen, denn wir seien in Shakkote.
Hoch über mir und unbesteigbar aussehend, türmte sich die hohe Bergkette auf, deren zerfurchte Wände von der Gewalt zeugten, mit welcher sich die Regenbäche hier zu Tale stürzten. Cherat lag, wie ich erfuhr, direkt dort oben – rund viertausendfünfhundert Fuß höher, als ich mich jetzt befand, das heißt höher als der Snowdon, die höchste Erhebung, die ich bisher erklommen hatte, und diese Berge hier schienen doppelt so steil zu sein. Am Eingang der Herberge standen zwei Pferde, das eine gesattelt, das andere nicht. Ich fragte, wem die Gäule gehören und als man mir antwortete, sie seien heruntergeschickt worden für einen Offizier, der mit seinem Gepäck erwartet werde, stellte ich keine weiteren Fragen mehr, sondern machte sofort mein Recht auf sie geltend, das zum Glück auch nicht angezweifelt wurde. Ich saß auf, wies Soubratie an, schnell meinen Mantelsack, so gut es gehe, auf dem anderen Tier festzuschnallen und sagte dem Sayce oder Stallburschen, der mein Pferd hielt, es gehe los und er solle mir den Weg zeigen, was er dann auch tat.
Die Landschaft, durch die ich kam, war ungemein wild und schroff. Wir ritten schier senkrecht anmutende Felswände hinauf, die mein kräftiges und gescheites Pferd mit katzenartiger Gewandtheit erklomm, oder stiegen in tiefe, sandige Schluchten hinab, in denen mitunter reißende Wildwasser tosten, nicht selten führte der Pfad, gefährlich schmal und uneben, zuweilen sogar gänzlich unterbrochen, dicht an steil abfallenden Abhängen entlang. Endlich kamen wir am Fuße des Zentralmassivs an, das wir noch hinauf mussten. Ich überließ es meinem braven Gaul, sich selber seinen Weg zu suchen und passte nur auf, dass ich nicht über seine Kruppe nach hinten abrutschte, denn wenn mir das passiert wäre, würde ich dies jetzt wahrscheinlich nicht schreiben und wären die Zugänge zum süßen Allerheiligsten von Fanny und Amy Selwyn vielleicht noch immer unbetreten und durch einen Schleier verhängt und versperrt. Die beiden holden Mädchen, jetzt noch etliche tausend Fuß über mir, und ich, keuchend vor Anstrengung und verbrannt von den sengenden Strahlen der in meinem Rücken aufgehenden Sonne – alle drei ahnten wir wenig, dass der anstrengende Ritt des Mannes hier den zerklüfteten Berg hinauf etwas mit jenem geheimnisvollen Naturgesetz zu tun hatte, welches das, was sich anzieht, auch zusammenbringt, und dass sein wackeres Schwert Tausende von Meilen weit übers Meer hergebracht worden war, um in ihre goldigen, kleinen Scheiden gesteckt zu werden und die niedlichen Schutzhäute davor ein für alle Mal zu durchstoßen, auf dass also die dem Manne mitgegebene Waffe das Werk des Schöpfers vollende und diese hübschen Jungfrauen erst zu richtigen Frauen mache!
Endlich, nach zwei Stunden währendem Aufstieg, schwankte mein stark erschöpftes Pferd auf den Gipfel des Vorsprungs hinaus, der aus dem Hauptmassiv herausragte und den wir seit nunmehr zwei Stunden erklommen. Oh, die herrlich kühle, fast schon kalte und erfrischende Luft, richtige Bergluft, die über mein Gesicht strich und meine Lungen mit ihrer belebenden Kraft füllte! Der Gaul schien sie nicht minder zu genießen als ich. Fast eine ganze Minute lang blieb er stehen und sog den köstlichen Odem der Natur ein. Und dann versuchte er tatsächlich zu traben, als wüsste er, dass es nicht mehr weit bis nach Hause war und dass er, je schneller er das letzte Stück bewältigte, um so eher den Trank bekam, den er sich so verdient hatte und die Morgenration Futter, die das arme Tier bitter nötig zu haben schien. Aber der Trab erstarb bald wieder zu einem ruhigen Schritt, und wir ritten einen gutangelegten, etwa fünf bis sechs Fuß breiten Weg am Rande des Tales entlang, auf dessen anderer Seite ich jetzt, mir direkt gegenüber, einen hübschen Bungalow erblickte und außerdem – ich traute meinen Augen nicht! – ein ganz reizend aussehendes, junges, englisches Mädchen, das dort mit einem kleinen Kinde an der Hand anscheinend einen frühen Morgenspaziergang machte, um dann zu einem guten und herzhaften Frühstück hineinzugehen. Ich konnte zwar noch nicht ausmachen, ob mich mein Pfad, wenn ich ihm getreulich weiter folgte, dorthinführen würde, aber dieses anmutige Bild des Friedens und Unschuld ließ mich den Entschluss fassen, wenn ich jemanden nach dem Weg fragen müsse, dann nur dieses traut aussehende Mädchen dort jenseits des Tales. Die holde Kleine war noch zu weit ab, als dass ich ihr Gesicht hätte erkennen können, aber ihre allgemeine Erscheinung und die graziöse Art, wie sie sich bewegte, verliehen mir die Überzeugung, dass ein Blick von nahem den ersten Eindruck, den sie auf mich machte, nicht zerstören würde. Meine Unbekannte schien jetzt auch mich gesehen zu haben, denn sie blieb stehen und schaute zu mir herüber. Ich trieb also mein Pferd an, wieder etwas Trab vorzulegen, und bald war ich auf dreißig oder zwanzig Schritte an sie heran, denn der Weg führte tatsächlich um das Ende des Tales herum und hin zu dem Bungalow, von dem ich schon sprach. Ich saß ab und führte mein Pferd dorthin, wo die junge Dame stand. Sie hatte einen Tropenhelm auf, und unter dessen Rand sah ich zwei hübsche, dunkelviolette Augen, die mich zwar neugierig und unbefangen, aber keineswegs unmanierlich anschauten.
Der erste Blick von nahem zeigte mir, dass sie in der Tat ein reizvolles Geschöpf war – nicht eigentlich schön in dem Sinne wie Lizzie Wilson, sondern mehr wie meine geliebte Louie: in jeder Beziehung weiblich, hübsch und süß.
Ihre Wangen, rund vor Gesundheit, hatten die Farbe der Rose und verrieten, dass ihr das Klima von Cherat sehr gut bekam. Ihr Teint war weiß und rein und ihre Lippen, diese lieben Lippen, die sich in kommenden Tagen so oft und so brennend heiß mit den meinen vereinen sollten, waren von jenem leuchtendem Rot, das nur denen von blutjungen Mädchen eigen ist und das nach meiner Erfahrung stets von einer zärtlichen, leidenschaftlichen und sinnlichen Natur zeugt. Ihr Hals war edel geformt, glatt und rund, und ihre Figur war die eines Mädchens, das gerade zur Frau wird. Ihren Busen, obwohl noch nicht voll entwickelt, zierten bereits zwei bezaubernde, kleine Halbkugeln, denn man sah deutlich, dass es nicht bloß das Korsett war, was diese beiden sanften Hügel bildete, sondern gutes, festes Fleisch. Ihre Taille, wenn auch nicht so gertenschlank wie die von Lizzie, war wunderbar schmal und, ihre Hüften hatten jenen ausladenden Schwung, der einen schönen, daunenweichen Bauch ankündigt, so prächtig geeignet für einen Mann, darauf zu ruhen! Ruhen? Kann man von einem Manne denn sagen, er ruhe, wenn er zwischen den Schenkeln seiner Liebsten liegt und ihr fleißig und unermüdlich Wonnestöße versetzt? Ich hoffe doch, nein! Aber wie dem auch sein mag, unter dem Rocksaum meiner Maid, wie sie dort stand und auf mein Herankommen wartete, lugten zwei zierliche Füße samt nicht minder zierlichen Fesseln hervor, und ihre Augen schienen in freundlichem Willkomm aufzuleuchten. Zugleich bildeten sich auf den Wangen zwei bezaubernde Grübchen und verliehen ihrem Gesicht etwas so hinreißend Süßes, dass ein Mann sehr wohl gleich auf den ersten Blick schwach werden konnte.
Ich zückte den Hut, machte eine Verbeugung und fragte dieses reizende Geschöpf: »Verzeihung, mein holdes Fräulein, aber können Sie mir liebenswürdigerweise sagen, wie ich zu Colonel Selwyn finde?«
»Papa ist in seinem Büro, wird aber bald heimkommen. Das hier ist unser Haus. Ich nehme an, Sie sind Captain Devereaux?«
»Ja, der bin ich. Soeben erst gekommen. Ich war die ganze Nacht unterwegs und bin, fürchte ich, mehr als schmutzig, weshalb Sie es bitte entschuldigen wollen, dass ich es wage, mich Ihnen in einem solchen Aufzug zu nähern. Ich kannte den Weg nämlich nicht, sondern habe ihn meinem wackeren Pferde überlassen, und das hat mich hierher zu Ihnen geführt.«
»Wollen Sie es nicht dem Sayce übergeben und eintreten um meine Mutter zu begrüßen? Kommen Sie und trinken Sie eine Tasse Tee! Papa wird sicher bald hier sein.«
»Es ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich fühle mich wirklich zu staubig und schmutzig, um mich Mrs. Selwyn vorstellen zu können. Ich bin überzeugt, es würde einen schlechten Eindruck machen und das täte mir leid, denn es könnte vielleicht dazu führen, dass sie den Mann unsympathisch findet, der, seit er Miss Selwyn gesehen hat, zu ihrem Herrn Vater und ihrer Frau Mutter ein gutes Verhältnis haben möchte.«
»Ach, was reden Sie denn für einen Unsinn?«, sagte dieses offenherzige Mädchen, wobei es rot wurde und ganz schelmisch vergnügt dreinschaute. »Meine Mutter hat sicher vollstes Verständnis und Sie müssen doch schon verschmachten nach einer Tasse Tee oder lieber vielleicht noch nach einem Brandy mit Soda. Nun kommen Sie schon!«
In diesem Augenblick erschien, wahrscheinlich durch die gehörten Stimmen angelockt, eine Dame in der Haustür. Sie überragte Miss Selwyn um fast einen Kopf und war begleitet von einem weiteren Mädchen, das etwa die gleiche Größe hatte wie die Kleine vor mir und offensichtlich deren Schwester war.
»Mama«, rief meine freundliche Maid, »hier ist Captain Devereaux, soeben angelangt. Ich habe ihn gebeten, doch reinzukommen, um dir guten Tag zu sagen, und ’ne Tasse Tee oder ’nen Schnaps zu trinken, aber er sagt, er wolle erst zu Papa und sei viel zu dreckig … äh … zu schmutzig. Bitte du ihn doch, dass er reinkommt!«
»Aber Fanny! Du lässt wieder mal deine Zunge mit dir durchgehen! Sehr erfreut, Sie zu sehen, Captain Devereaux. Sie haben sicher eine nicht sehr angenehme Woche in Nowshera hinter sich. Wie wir hörten, haben Sie dort festgesessen, weil die von der Front zurückkehrenden Truppen alle Ekkhas und Wagen benötigten.«
Hm – wenn sie gehört hatte, dass ich in Nowshera war, mochte sie ebenso gut auch von Lizzie Wilson gehört haben! Aber obwohl mir das alles rasch durch den Kopf ging, antwortete ich: »Fürwahr, Madam! Weder mit guten Worten noch mit Geld ließ sich für mich irgendein Fahrzeug auftreiben, und sehr gegen meinen Willen musste ich dort bleiben, bis der Brigadeoffizier schließlich zwei Ekkhas für mich auftrieb. Ich bin soeben erst angekommen.«
»Und warum in aller Welt treten Sie nicht endlich ein?«, fuhr die ungeduldige Fanny fort, die entschlossen schien, mich unbedingt ins Haus zu bekommen – ein Vorläufer jenes Verlangens, das sie später so leidenschaftlich drängte, mich auch in ihr eigenes geheimstes und lauschigstes Plätzchen zu bekommen. »Mama, ich bin überzeugt, dieser arme Mann muss vor Durst sterben! Bitte ihn doch herein und lass uns ihm was zu trinken geben!«
Mrs. Selwyn kam dem Wunsche ihrer hübschen Tochter insoweit nach, als sie mich zwar bat einzutreten, doch tat sie es nicht mit jener uneingeschränkten Freundlichkeit, dass ich hätte annehmen können, es sei ihr genauso ein Herzenswunsch wie ihrer gastfreien Tochter. Der Grund dafür war, wie ich später von ihr selber hörte, dass sie es nicht schicklich fand, wie sich die gute Fanny mir sozusagen gleich an den Hals warf; sie hätte gern gesehen, dass Fanny ein bisschen weniger ungeniert und impulsiv wäre. Mir wurde das sofort klar und obwohl ich wirklich schier verdurstete und liebend gern die Einladung angenommen hätte, nicht zuletzt um mir auch die zweite Tochter anzuschauen, die auf den ersten Blick noch hübscher zu sein schien als ihre Schwester, lehnte ich dankend und mit den Worten ab, ich sehe es als meine dringlichste Pflicht an, mich beim Colonel zu melden; danach und sobald ich Toilette gemacht habe, wolle ich mir die Ehre erlauben, Ihnen meine Aufwartung zu machen.
Fannys Miene war ein stummer Vorwurf abzulesen: »Sie hätten ruhig tun können, was ich wollte!« Das andere Mädchen sah mich aus seinen großen, strahlenden Augen an, den Mund leicht offen und Mrs. Selwyn erklärte mir, wie ich zum Regimentsstab kam, nämlich den Weg wieder ein Stück zurück bis zu einer Straße, diese entlang, und dann würde ich bereits die Militärbaracken sehen; es sei nur ungefähr eine Meile von hier. Ich machte meine Verbeugung, dankte Mrs. Selwyn, warf der jetzt schmollenden Fanny einen so dankbaren und strahlenden Blick zu, wie es mir meine staubverkrusteten Augen gestatteten, bedachte die andere Tochter, deren Namen ich noch nicht erfahren hatte, ebenfalls mit einem langen Blick, übergab mein Pferd dem Sayce und schlug den Weg in die angegebene Richtung ein.
Bevor ich um die Ecke verschwand, drehte ich mich noch einmal um. Fanny war allein; sie stand vor dem Haus und schaute mir nach, offensichtlich in Gedanken verloren. Irgendwie machte sie den Eindruck, ausgescholten worden zu sein und sie tat mir leid, zugleich aber freute ich mich, dass mich das Schicksal allem Anschein nach unter Leute verschlug, die so damenhaft und nett waren, wie es Mrs. Selwyn und ihre Töchter zu sein schienen. Ich hatte mich in Fanny zwar noch nicht verliebt, doch gefiel sie mir bereits sehr. Ein hübsches Mädchen, natürlich und ohne Arroganz, kann wohl kaum verfehlen, einen günstigen Eindruck auf einen Mann zu machen. Doch wenn ich die körperlichen Reize, die ich hatte wahrnehmen können, auch ausführlich beschrieben habe, muss ich meine lieben Leserinnen bitten, nicht etwa zu glauben, dass mir jetzt nur die Spur eines Verlangens nach der hübschen Fannys Gunst gekommen wäre. Ich kann nicht anders, wenn ich eine Schönheit sehe, muss ich sie bewundern – jedoch nicht so, dass ich jede Zuckerpuppe, auf die mein Auge fällt, auch unbedingt vernaschen möchte. Und was Fanny betrifft, so bewunderte ich sie zwar von Anfang an, doch es dauerte noch einige Zeit, bis sie meinen Johnny strammstehen und meine Leisten vor Geilheit schmerzen ließ, und obwohl mir bald klar war, dass sie ein ganz süßes Döschen haben musste, verlangte es mich nicht gleich danach, es öffnen zu wollen. Dieser Wunsch – samt seiner Erfüllung – sollte erst später kommen; jetzt war noch gar kein Gedanke daran. Und so ging ich den zauberhaften und bequemen Weg am Berghang weiter entlang und ergötzte mich an dem gewaltigen Panorama, das sich von hier oben bot. Unter mir lagen die schroffen, zerklüfteten Berglehnen, durchbrochen von tiefen Schluchten und weit hinausragenden Vorsprüngen, alle trugen unverkennbare Zeichen der Gewalt, mit welcher der Regen ihre felsdurchsetzten Flanken ausgewaschen hatte. Über all diese Abhänge hin wuchsen unzählige Zwergbäume und Sträucher mannigfaltigster Art, worunter die wilde Olive jedoch vorherrschte. Weit hinten in der Ferne und sich bald verlierend in dem starken, staubigen Dunst, der sich der über Ebene und Tal brütenden Hitze zugesellte, sah ich zwei Flüsse, wovon der eine der Indus sein musste, den ich bei Attock überquert hatte, denn ich konnte seinen Lauf bis dorthin verfolgen, wo er aus weit entfernten Bergen heraustrat und der andere der Kabul, der in Nowshera nur ein paar hundert Schritte hinter jenem Bungalow vorbeigeflossen war, in welchem ich eine in jeder Beziehung so heiße und außerdem so wonnige Woche verbracht hatte – dank der wunderbar sinnlichen Veranlagung der unübertrefflichen Lizzie Wilson und meiner eigenen unerschöpflichen Jugendkraft und Lust am Bürsten.
Von der großen Höhe, in der ich mich befand, sahen diese beiden Ströme wie dünne Silberfäden aus, die sich in Windungen durch die braune Ebene zogen und in nahezu rechtem Winkel aufeinanderstießen. Eine Gruppe weißer Gebäude, nahezu mikroskopisch klein wirkend, verriet, wo Nowshera lag, und als ich in zärtlicher Erinnerung an die vergangene Woche dorthinschaute, sah ich plötzlich inmitten des Dunstes etwas grell aufblitzen, in unregelmäßigen Abständen und leuchtend hell wie die Sonne. Ich erriet sofort, dass dies ein Heliograph oder Spiegeltelegraph sein musste, jenes sinnreich erdachte und nützliche Instrument, das mittels reflektierten Sonnenlichtes Nachrichten weiterleitet und das für ein Land wie Indien so besonders geeignet ist. Vielleicht verdankte ich meine zwei Pferde heute früh meinem guten Jack Stone, indem er hatte signalisieren lassen, dass ich endlich zum letzten Stück meiner Reise aufgebrochen sei. Womöglich war auch die traurige Geschichte von des unseligen Searles’ Unfall samt der Ursache dazu genauso unbarmherzig durch die vielen Meilen Luft geblitzt und von meinen Offizierskameraden gelesen worden! Wusste Mrs. Selwyn etwa doch von Lizzie Wilson? Wenn ja, war es kein Wunder, dass sie es nicht sonderlich eilig gehabt hatte, mich in ein Haus voller Jungfrauen zu bitten. Und das mochte auch erklären, warum sie mich dann nicht zur Annahme ihrer endlich ausgesprochenen Einladung zum Verschnaufen und zu einer Tasse Tee gedrängt hatte, einer Einladung, die ich, wie ich fand, unter solchen Umständen fast schon hätte verlangen können.
Dieser Gedanke beunruhigte mich etwas, weniger in dem Sinne, dass es mir nicht gleichgültig gewesen wäre, was wildfremde Privatpersonen von meiner Moral halten mochten, denn dazu kannte ich die Welt zu gut, aber in den Augen meiner militärischen Vorgesetzten, vor allem meines Kommandeurs, würde es gewisslich keinen allzu feinen Eindruck machen, dass ich meine Zeit in Nowshera in den Armen einer Hure (für die er die arme Lizzie doch höchst ungerechterweise halten würde) vertan hatte, anstatt mein Äußerstes zu unternehmen, um so schnell wie möglich zu meinem Regiment zu gelangen. Und ich hatte mich ja tatsächlich kein bisschen bemüht. Ich war viel zu froh gewesen, diese vorzügliche Ausrede für mein Bleiben in Nowshera zu haben, und Lizzies liebliche Grotte hätte mich sogar jetzt noch dort festgehalten, wäre sie nicht von ihr nach Muttra entführt worden. Es ist wahrlich kurios zu beobachten, wie das Gewissen uns alle zu Feiglingen und Heuchlern werden lässt. Denn kein Mensch von Verstand wird behaupten wollen, dass uns so etwas wie Reue überhaupt jemals überkäme, wenn nicht aus Angst vor eventuellen Folgen. Das Mädchen, dessen Leib anschwillt, nachdem es den schönen Jüngling zu heftig geliebt hat, bereut seine Sünde bitterlich, weil diese die schlimmste Folge der wilden Wonnenacht gezeitigt hat, die für dieses Mädchen eintreten konnte, wohingegen jedes andere, das von seinem Liebhaber mit zärtlicher Umsicht vor solchem Unglück bewahrt worden ist, das Zusammensein mit ihm fröhlich weiter genießt. Reue ist letzten Endes nur Schall und Rauch, und sie käme sicher niemals auf, würde nicht eine realistische Einbildungskraft Bilder nahenden Leides und Elendes auftun. Darum, meine lieben, jungen Leserinnen, haltet euch immer an das Gebot »du sollst dich nicht erwischen lassen!« und denkt nicht an Reue oder Selbstvorwürfe.
Diese Gedanken mischten sich leider in meine Bewunderung der wildromantischen Schönheit der Landschaft, durch die ich kam, bis ich um einen Vorsprung der Steilwand herum war und ein kleines Stück oberhalb der Straße eine tanggestreckte, niedrige, aber enorm große Holzbaracke mit rotem Ziegeldach erblickte. Da ich vor ihrer Tür eine Gruppe von Soldaten in Khaki sah, schätzte ich, dass ich hier richtig war, um zum Regimentsstab zu gelangen. Ich ging durch die Gruppe hindurch, trat ein und entdeckte, dass das Ganze eine einzige, riesige Halle war, ohne Zwischenwände und mit Holzpfeilern als Dachstützen. Der Erste, den ich anredete, stellte sich als der Zahlmeister heraus. Als er meinen Namen hörte, hieß er mich sogleich herzlich willkommen und zeigte mir, wo ich Colonel Selwyn finden konnte, dessen Büro oder vielmehr Schreibtisch sich am äußersten Ende des Gebäudes befand. Dort begab ich mich hin. Der Colonel saß an seinem Tisch und sprach Recht. Rings um ihn standen etliche Offiziere in den verschiedensten Uniformen, rot, khaki und blau, die Straffälle von Mannschaften vorbringen mussten. Ich kannte keinen der Offiziere, und da ich selber in Zivil und zudem staub- und schmutzbedeckt war, bot ich gewisslich keinen sehr günstigen Eindruck. Ich wartete, bis der letzte, unglückliche »Tommy« seinen Arrest aufgebrummt bekommen hatte, trat dann an den Tisch heran und stellte mich vor als Captain Devereaux, soeben eingetroffen, um sich beim Regiment zu melden. Colonel Selwyn sah mich einen Augenblick musternd an, während sich die bisher ernst und mürrisch dreinschauenden Gesichter der ihn umgebenden Offiziere zu begrüßendem Lächeln aufheiterten.
»Oh, guten Tag!«, sagte der Colonel und stand auf. »Sehr erfreut, Sie zu sehen, Devereaux! Wie ich hörte, saßen Sie in Nowshera fest. Sie sind zu einer ungünstigen Zeit gekommen, jedenfalls in Bezug auf Transportmöglichkeiten. Ich fürchte, es war Ihnen dort unten elend langweilig«.
Er schüttelte mir herzlich die Hand und stellte mich mehreren Offizieren vor, die mich ebenfalls mit Handschlag begrüßten und dann vorschlugen, ich solle zuallererst einmal einen Drink nehmen. Der Colonel bat die anderen, mir den Weg zur Messe zu zeigen; er selber, sagte er, müsse schnell nach Hause.
Nun, meine »Reue«, schien also, jedenfalls bis jetzt, gar nicht nötig, und ziemlich erleichterten Herzens begleitete ich meine neuen Waffenbrüder, die mich plaudernd, lachend und unter vielen Fragen zu dem elenden Schuppen führten, der den Höflichkeitsnamen »Messe« trug.
Ich will hier keine Beschreibung von jedem einzelnen dieser Offiziere geben. Es möge genügen, wenn ich sage, sie waren mehr oder weniger typisch für den größten Teil der Offiziere in jedem x-beliebigen Regiment in Ihrer Majestät Diensten: die höheren Chargen meist nur auf den eigenen Vorteil bedacht und geizig, die mittleren sich diesem Zustande schon nähernd und die unteren flott, leichtlebig, großzügig und stets bereit, ihr bisschen mit einem Bruder in der Not zu teilen.
Als Erstes erfuhr ich, da Wasser sehr knapp war, sei es fraglich, ob ich heute noch eine Möglichkeit finden würde, mich zu waschen, denn jeder erhalte nur seine tägliche Ration zugeteilt und mein Kommen sei nicht eingeplant. Als nächstes, dass ich, falls ich mein Zelt nicht mitgebracht habe, wohl im Freien schlafen müsse. Außerdem: Ehe es mir nicht gelinge, einen Chokeydar, einen indischen Wächter, zu bekommen, würden weder mein Eigentum noch meine Kehle sicher sein, da es unmöglich sei, bei Nacht Räuber aus dem Lager fern zu halten.
Das war in der Tat ein starker und nicht eben angenehmer Gegensatz zu dem Leben, das ich noch vor so kurzem in Nowshera geführt hatte, wo die heißen Winde und die Sandflöhe alles gewesen waren, worüber ich mich beklagen konnte, und wo ich die wonnige Liebesgrotte einer wahrhaftigen Venus zur Verfügung gehabt hatte, um mich darin nach Herzenslust zu tummeln. Doch wie es bei mir fast immer der Fall ist, wurde dann alles doch nicht gar so schlimm, wie es anfangs aussah.
Schon nach ein paar Tagen fand ich als Unterkunft für mich einen hübschen Lehmbungalow. Gewiss, es wimmelte darin von schrecklich aussehenden und auch gefährlichen Tausendfüßlern, aber ich wurde zum Glück nie von ihnen gebissen, sodass sie lediglich dazu beitrugen, mich in ständiger, angenehmer Aufregung zu halten und ich tötete viele von ihnen. Was jedoch einen großen Teil der Unbequemlichkeiten in Cherat wieder wettmachte, das war die wunderbar kühle und erfrischende Luft dort. Ich fühlte mich durch sie richtig belebt und gestärkt. Sie ganz tief einzuatmen war mir ein herrlicher Genuss, der durch den steten Anblick der zauberhaft wilden Landschaft ringsum noch verstärkt wurde.
Soubratie war nach Nowshera zurückgekehrt, um seine Frau und mein Gepäck zu holen und es dauerte fast vierzehn Tage, ehe er wieder eintraf. Es sei so schwierig gewesen, sagte er, einen Karren aufzutreiben, dass er bleiben musste, bis Major Stone ihm einen besorgen konnte, aber ich glaube, ja ich bin überzeugt, an dieser besonders langen Verzögerung war nicht zuletzt der Profit schuld, der sich bei den Offizieren aus Mrs. Soubraties gefälligen Reizen herausschlagen ließ. Ich hatte noch niemandem etwas von Mrs. Soubratie gesagt, ja kaum an sie gedacht, doch musste ich mich am Abend nach ihrer Ankunft ihretwegen ganz schön hochnehmen lassen. Ein verheirateter Mann! Gerade erst aus den Armen seines treuen Weibes gekommen! Und nimmt eine Frau in Dienst! Meine Bemühungen, mich zu verteidigen, blieben so lange vergebens, bis ich sagte, was mich betreffe, so könne jeder sie haben, denn sie sei sicher nicht spröde! Zuerst wollten mir meine Kameraden nicht glauben, doch als sie merkten, dass dies tatsächlich so war, kannte ihre Freude keine Grenzen. Wie überall waren auch hier sämtliche Huren des Regimentes desertiert, als nach der Rückkehr der Truppen aus Afghanistan der Ruf »Mädchen! Mehr Mädchen!« von Peshawar übers Land gehallt war, und schon seit Monaten hatten in Cherat weder Offiziere noch Mannschaften die süße Erquickung einer guten, geilen Nummer genossen, sofern sie nicht, was aber nur bei wenigen zutraf, verheiratet waren und ihre Frauen bei sich hatten.
Mrs. Soubratie wurde keine Ruhe gewährt. Noch in jener ersten Nacht musste sie von Zelt zu Zelt, von Hütte zu Hütte, und bis zum Morgen hatte ein Dutzend Offiziere endlich wieder einmal von jenem Fleisch gekostet, von dem ein Mann so lange nicht genug bekommt, bis die erschöpfte Natur nicht mehr kann.
In Cherat waren seinerzeit mehrere Offiziere von anderen Korps oder Regimentern, die Detachements befehligten, welche man von Peshawar hier heraufgeschickt hatte, dass sie sich in der kühlen und heilkräftigen Luft erholten. Mit diesen Offizieren hat meine Geschichte nichts zu tun, außer dass ich vielleicht Mrs. Soubratie Gerechtigkeit widerfahren und meinen geneigten Lesern berichten sollte, dass sie auch bei diesen Herren sehr fleißig war und sich viele, viele »Scheidemünzen« verdiente. Zwei Offiziere des Sanitätsdetachements muss ich jedoch näher erwähnen, weil das Betragen des einen mich unbewusst auf den Weg trieb, ja fast zwang, der in der süßen, kleinen Grotte der hübschen Fanny endete, von wo aus dann ein Seitengang zu der nicht minder süßen Klamm zwischen den drallen weißen Schenkeln ihrer Schwester Amy führte. Doch bevor ich das alles erzähle, möchte ich, dass meine Leser mir vertrauen, besonders die Mädchen unter ihnen, die hübschen, holden Geschöpfe, die ich liebend gern alle kennenlernen würde, so persönlich wie möglich! Ich möchte euch allen nämlich sagen, ich bin zwar immer ein eifriger Schürzenjäger gewesen – seit meinem ereignisreichen, sechzehnten Geburtstag, an welchem glücklichen Tage mich unser hübsches Dienstmädchen Margaret in die Mysterien der Liebe einführte und mich bürsten lehrte, aber so, dass man im selben Maße Wonne bereitet, wie man Wonne empfängt – doch habe ich niemals die Absicht oder den Wunsch gehabt, ein weibliches Wesen, ob Mädchen oder Frau, Jungfer oder Matrone, regelrecht zu verführen. Ich habe stets nur solche Gelegenheiten gesucht und wahrgenommen, wo ich das erwünschte Gegeninteresse feststellte. Wenn ich sah (und welch alltäglicher Anblick ist das!) dass ein Mädchen, das noch keinen Mann kannte, diese ergötzliche Kenntnis gern erwerben wollte, tat ich eben alles, was ich konnte, ihr bei der Aneignung jenes Wissens zu helfen. War sie noch Jungfrau, musste der Unterricht notwendigerweise ausführlicher sein, als wenn sie bereits praktische Studien am Manne getrieben hatte und natürlich bin ich stolz auf die wirklich stattliche Strecke von Jungfernhäutchen, die mit dem Speer meiner Männlichkeit zu durchbohren mir vergönnt gewesen ist. Aber niemals habe ich, und ich werde es auch nie tun, dem Herzen eines unberührten Mädchens Begierden oder Gedanken eingeflößt, die es nicht schon selber gehegt hatte. Mit anderen Worten: Wenn ich eine Schöne »verführte«, geschah es genauso zu ihrem eigenen Vergnügen wie zu dem meinen und war es stets meine Sorge, dass ihr daraus, dass sie mir die Schenkel öffnete, kein Leid und Unglück erwuchs. Ich wahrte immer die größte Sorgfalt, um weder ihrem Körper noch ihrem Ruf Schaden nehmen zu lassen, und ich bin Venus aus tiefstem Herzen dankbar dafür, dass sie mich in diesen so äußerst wichtigen Dingen nie hat unachtsam sein lassen und mich deshalb auch nie strafen musste. Ein Mädchen unter irgendwelchen falschen Vorspiegelungen zu verführen, das sehe ich als in höchstem Maße feige Tat an, wohingegen ihm dabei zu helfen, die natürlichen Begierden seiner Weiblichkeit zu befriedigen, mir stets als ein Akt wahrer Gefälligkeit erscheint. In Cherat fand ich zwei entzückende Mädchen, fast noch Kinder, und für mehr hielt ich sie wirklich nicht, so reif ihre knospenden Formen und Reize auch sein mochten. Ich war, wie man noch sehen wird, in der günstigsten Lage, die ein Mann nur haben kann, sie beide vorsätzlich zu verführen und zu entjungfern. Ich sage nicht, die Versuchung wäre nicht stark genug gewesen, aber wenn man sie stillschweigend übergeht beziehungsweise ihr kein Entgegenkommen gewahrt, ist jeder Versuchung leicht Herr zu werden, und ich bemühte mich weder durch Taten noch durch Worte, diese reizenden Geschöpfe vom Pfade der Tugend herunterzulocken. Später, als mich die Ereignisse in ein schon einigermaßen zärtliches Verhältnis zu Fanny gebracht hatten, als ich entdeckte, dass ich in ihrem Herzen der Mann alter Männer war, den sie anbetete und mit unsäglicher Leidenschaft begehrte. Als ich merkte, dass eine anfangs nur platonische Zuneigung in lodernde und alles verzehrende, sinnliche Liebe umgeschlagen war, tat ich der süßen Verführerin ihren Willen und sparte keine Mühe, sie dorthinzubringen, wo sie, wie ich wusste, einzig und allein Erfüllung finden konnte. Ich nahm ihr die Jungfernschaft, und weder sie noch ich haben das je bereut und werden es auch nie bereuen.
Die zwei Sanitätsoffiziere hießen Stabsarzt Jardine und Assistenzarzt Lavie. Der erste war ein riesiger, ungeschlachter Schotte von nicht übermäßig großem Geist. So ungeschliffen wie seine Erscheinung waren auch seine Manieren und sein Innenleben und ich staunte nicht schlecht, als ich nach etlichen Monaten erfuhr, dass er nicht nur glaubte, Fanny sei die richtige Frau für ihn, sondern ihr sogar einen Heiratsantrag gemacht hatte. Dass ein Mann, so plump er auch sein mochte, Fannys jugendfrische Schönheit begehrenswert fand und dachte, sie im Bett zu haben müsse himmlisch sein, konnte ich durchaus verstehen, aber Jardine war von jener Sorte, die sich mit den gewöhnlichsten Huren abgibt. Eine seiner Lieblingswendungen lautete, das einzig Gute an einer Frau sei ihr Unterleib. Man möchte meinen, einen Mann mit solcher Einstellung würde es niemals danach verlangen, sich mit einer Ehefrau zu belasten. Bei all seiner poltrigen Klotzigkeit blieb Jardine jedoch immer friedlich, aber das ist auch so ziemlich alles, was ich Gutes über ihn sagen kann. Er war wirklich kein Adonis, allerdings riesig groß und in den Augen mancher Frauen zählen bloße Größe und herkulische Körpermaße ja mehr als Schönheit des Gesichts und Eleganz der Figur. Solche Frauen sollten lieber Kühe sein und sich Bullen nehmen.
Lavie war ganz anders. Von Herkunft und Erziehung ein Gentleman, von so geschliffenem Geist, wie der von Jardine ungeschliffen war, von betonter Zurückhaltung und ohne jede Arroganz, war er stets ein guter Zuhörer, der nur dann selber etwas sagte, wenn es auch Hand und Fuß hatte. Ich pflegte mit ihm sehr angenehme und anregende Spaziergänge zu machen und bald wurden er und ich gut Freund miteinander. Er erzählte mir Gedanken, die er sich gescheut hätte, vor anderen zu äußern, und öffnete mir sein Herz in jeder Beziehung mit Ausnahme einer einzigen. Wie fast alle Männer bürstete er gern, und niemand war erfreuter als er, als er vernahm, dass ich bereit sei, mein vermeintliches Embargo aufzuheben und Mrs. Soubraties saftigen und regen Schoß der Allgemeinheit zugänglich zu machen.
Lavies großer Ehrgeiz war, wie er mir erzählte, in die Heimat zu kommen und sich im Zivilleben als Arzt niederzulassen. Er beklagte sich bitter, dass im schablonisierten Betrieb des Militärs wenig oder gar kein Platz für Privatinitiative sei, und da meine eigenen Gedanken zu diesem Thema mit den seinen übereinstimmten und wir überhaupt in vielem die gleichen Ansichten hatten, sah er mich wohl als seinen vertrauenswürdigen Freund an, vor dem er keine Geheimnisse zu haben brauchte. Scheinbar vertraute er mir auch alles an, was ihn bewegte, doch wie meine lieben und, wie ich annehme, interessierten Leser noch sehen werden, hielt er das wichtigste Geheimnis zurück. Hätte er es mir damals mitgeteilt, hätte ich jetzt höchstwahrscheinlich keinerlei Anlass, diesen Teil meiner Memoiren zu schreiben, denn dann wäre alles ganz anders gekommen. So aber legte, ebnete und glättete mir Lavie, allerdings gänzlich unbewusst, sogar den Weg zu den lieblichen Reizhügeln und -tälern von Fanny und Amy Selwyn, auf dem ich dahinschritt und eigentlich erst kurz vor seinem Ende merkte, wohin er mich führte.
Von meinen anderen Offizierskameraden brauche ich nicht ausführlich zu erzählen. Ich kam gut mit ihnen aus, hatte aber keine engen Freunde unter ihnen. Sie waren nicht unbedingt das, was ich meinen Schlag nennen würde. Zwar hätte ich Anlass, einen oder zwei näher zu erwähnen, aber ich möchte das wegen des eventuellen Einflusses auf meine Karriere lieber sein lassen.
Doch revenons a nos moutons! Man nehme nicht etwa an, dass ich meinen Antrittsbesuch bei Mrs. Selwyn und ihren holden Töchtern auf die lange Bank schob. Ich ging sogar schon an meinem zweiten Nachmittag in Cherat hin, nachdem es mir endlich gelungen war, eine Gelegenheit zum Baden und Rasieren zu bekommen, was mir beides am Tage meiner Ankunft nicht mehr glückte.