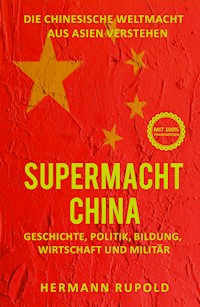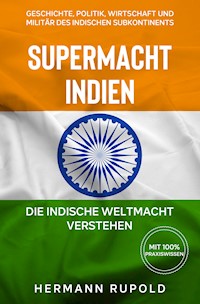
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GbR Corinna Krupp und Martin Seidel
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Supermächte
- Sprache: Deutsch
Supermacht Indien – Die indische Weltmacht verstehen Geschichte, Politik, Wirtschaft und Militär des indischen Subkontinents Die Entwicklungen auf dem indischen Subkontinent sind in den letzten Jahren zum allgegenwärtigen Thema in Medien und Gesellschaft geworden. Doch was ist dran an den vielen Berichten über die größte Demokratie der Welt, die auf dem Weg ist, nach China zur zweiten Asiatischen Supermacht aufzusteigen? Wie tickt das zweitbevölkerungsreichste Land der Erde? Was sind seine Ziele und wie denkt die einheimische Bevölkerung? Was macht die historische Entwicklung des Landes aus und wo liegen die Stärken und Schwächen? Machen Sie sich Ihr eigenes Bild dieser aufstrebenden Weltmacht, indem Sie die Zahlen und Fakten hinter dem siebtgrößten Staat der Erde verstehen. Um sich ein umfassendes Bild über dieses vielfältige Land machen zu können, ist eine tiefere Betrachtung der Geschichte, der Politik, des Bildungssystems, der Wirtschaft und des Militärs nötig. In diesem Buch erhalten Sie einen Überblick über all diese Aspekte, die das moderne Indien ausmachen. Nur durch eine Gesamtbetrachtung all dieser Teilbereiche ist es möglich, das Land Indien und seine Ziele zu verstehen. Über den Autor des Buches, Hermann Rupold: Schon seit dem Studium der Politikwissenschaften vor über 25 Jahren beschäftigt er sich mit politischen, gesellschaftlichen und geschichtlichen Randthemen. Als Lehrkraft gibt er dieses Wissen nicht nur seinen Schülern und Studierenden weiter, sondern spricht im Rahmen verschiedener Publikationen auch die breite Masse der Menschen in Deutschland an. Bei seinen Büchern liegen ihm solche Themen besonders am Herzen, deren Auswirkungen in vielen Bereichen der Gesellschaft zu spüren sind, die aber trotzdem weitgehend unbekannt sind. Zudem konzentriert er sich auf Themen, bei denen neben allgemeinen wissenschaftlichen Recherchen auch eigene Erfahrungen mit eingebracht werden können. Seien Sie gespannt auf viele Hintergründe und Erkenntnisse, die sich rund um den indischen Subkontinent drehen und Ihnen eine neue Sicht auf die aufstrebende Supermacht in Asien ermöglichen. Sichern Sie sich noch heute dieses Buch und erfahren Sie... » ... wie sich das Land im Laufe der Zeit zur überregionalen Macht entwickelt hat, » ... wie dieses riesige Reich aufgebaut ist und funktioniert, » ... was wir in den nächsten Jahren von Indien erwarten können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Supermacht Indien – Die indische Weltmacht verstehen
Geschichte, Politik, Wirtschaft und Militär des indischen Subkontinents
©2021, Hermann Rupold
Expertengruppe Verlag
Die Inhalte dieses Buches wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Der Inhalt des Buches repräsentiert die persönliche Erfahrung und Meinung des Autors.
Sämtliche hier dargestellten Inhalte dienen somit ausschließlich der neutralen Information. Sie stellen keinerlei Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten Methoden dar. Dieses Buch erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann die Aktualität und Richtigkeit der hier dargebotenen Informationen garantiert werden. Der Autor und die Herausgeber übernehmen keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Information ergeben.
Supermacht Indien – Die indische Weltmacht verstehen
Geschichte, Politik, Wirtschaft und Militär des indischen Subkontinents
Expertengruppe Verlag
Inhaltsverzeichnis
Über den Autor
Vorwort
Die Geschichte Indiens
Frühe Geschichte
Die Indus-Zivilisation
Die vedische Zeit
Exkurs: Die Arier
Das klassische Zeitalter Indiens
Exkurs: Der Maharaja
Das Indien des Mittelalters
Die Islamischen Reiche in Indien
Exkurs: Die Bauten des Firuz Shah
Das Mogulreich
Exkurs: Der mutige Akbar
Exkurs: Frühe Handelsposten europäischer Staaten außer Großbritannien in Indien
Exkurs: Die Britische Ostindien-Kompanie
Exkurs: Die Patronen des Enfield-Gewehrs
Die Kolonie Britisch-Indien
Exkurs: Das Leben des Mahatma Gandhi
Exkurs: Die Legion Freies Indien
Die Unabhängigkeit Indiens
Exkurs: Die Grenzlinien des Cyril John Radcliffe
Die Republik Indien
Exkurs: Operation Smiling Buddha
Exkurs: Die Cricket-Diplomatie
Die Republik Indien im Überblick
Das politische System Indiens
Exkurs: Der Anschlag von 2001
Administrative Gliederung
Exkurs: Jedes Dorf verwaltet sich selbst
Politische Parteien in Indien
Die Bevölkerung Indiens
Exkurs: Massiver Überschuss an Männern
Das indische Kastensystem
Exkurs: Priester am Herd
Religion in Indien
Indiens Außenpolitik
Die indische Wirtschaft
Die indische Rupie
Indiens Landwirtschaft
Exkurs: Die Bedeutung der Kuh in Indien
Indiens Außenhandel
Exkurs: Die Apotheke der Welt
Dienstleistungsland Indien
Exkurs: Die Volkszählung des Jahres 2010
Die Energiewirtschaft Indiens
Gold, Erze, Metalle und mehr
Indiens Banken und Börsen
Indien und der Klimawandel
Exkurs: Der heilige Fluss
Tourismus in Indien
Telekommunikation und Internet
Indiens Militär
Das Heer Indiens
Exkurs: Frauen in der indischen Armee
Indiens Marine
Die indische Luftwaffe
Die Atomstreitkräfte
Nachwort
Hat Ihnen mein Buch gefallen?
Buchempfehlung für Sie
Quellenangaben
Impressum
Über den Autor
Hermann Rupold lebt seit 4 Jahren zusammen mit seiner Frau Charlotte in Hamburg. Nach zahlreichen Auslandsstationen hauptsächlich in Afrika, Asien und Südamerika ist er an der Elbe zur Ruhe gekommen.
Schon seit dem Studium der Politikwissenschaften vor über 25 Jahren beschäftigt er sich mit politischen, gesellschaftlichen und geschichtlichen Randthemen, die vor der breiten Masse oft verborgen sind, aber wissenschaftlich breit akzeptiert sind. Als Lehrkraft gibt er dieses Wissen nicht nur seinen Schülern und Studierenden weiter, sondern spricht im Rahmen verschiedener Publikationen auch die breite Masse der Menschen in Deutschland an.
Bei seinen Büchern liegen ihm solche Themen besonders am Herzen, deren Auswirkungen in vielen Bereichen der Gesellschaft zu spüren sind, die aber trotzdem weitgehend unbekannt sind. Zudem konzentriert er sich auf Themen, bei denen neben allgemeinen wissenschaftlichen Recherchen auch eigene Erfahrungen mit eingebracht werden können. Jede seiner Veröffentlichungen basiert daher neben den unverzichtbaren wissenschaftlichen Grundlagen auch auf ganz persönlichen Erfahrungen und Erkenntnissen. So entstehen nicht nur rein sachliche Abhandlungen, sondern praktische Werke mit breitem Wissen und nützlichen Hinweisen, die leicht verstanden und nachvollzogen werden können.
Hermann Rupold erschafft so leicht zu lesende Bücher, die dem Leser in entspannter und angenehmer Atmosphäre einen Einblick in Themenfelder geben, von denen die meisten wenig wissen, aber von denen jeder einzelne sehr profitieren kann.
So möchte er vor allem Neugierde für fremde Kulturen wecken, Vorurteile abbauen und den Leser motivieren, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.
Vorwort
Indien – was ist das eigentlich? Ein sagenhafter Subkontinent mit reichhaltiger Kultur? Das neue globale Silicon Valley? Ein Schwellenland mit Atomwaffen, im ständigen Konflikt mit dem Erzfeind Pakistan? Oder ein neues China, das durch einfache Produktionswege den etablierten Industrienationen immer eine Nasenlänge voraus ist? Fakt ist: In Indien bewegt sich etwas, und zwar gewaltig. Mit dem beginnenden 21. Jahrhundert hat das Land die Fesseln der ehemaligen Kolonialherrschaft endgültig abgeschüttelt und geht nun seinen eigenen Weg. Immer auf der Suche nach den Nischen auf dem Weltmarkt, die es zu besetzen gilt. Und das funktioniert: Seien es Mikrochips oder Medikamente – in manchen Branchen konnten sich indische Unternehmen einen Namen machen. Indische Konzerne boomen an der Börse, geben Millionen Menschen Arbeit und geregelte Einkommen. Der Wohlstand ist spürbar, sichtbar und greifbar. Mumbai und Neu-Delhi sind Wirtschaftsmetropolen und beeindrucken mit ihrem sichtbaren Aufschwung. Schon längst wird Indien als vielversprechender Juniorpartner auf dem internationalen Wirtschafts- und Politikparkett gehandelt. Andere Nationen schauen mit Skepsis auf den Aufschwung auf dem Subkontinent. Die „Supermacht Indien“ ist für die Supermacht China eine unbequeme Vorstellung. Spannungspotential ist also garantiert. Und die anderen Nachbarn des südasiatischen Megastaates? Die sind längst funktionierende Bestandteile der indischen Interessensphäre. Wäre da nicht Pakistan, der Erbfeind, der sich irgendwann aus der ursprünglich gemeinsamen Geschichte abspaltete. Statistisch betrachtet ist das Land in vielerlei Hinsicht ganz oben angekommen. Denn in Indien gibt es von allem viel. Viele Menschen, viele Glaubensrichtungen, viel Licht und Schatten, super reich trifft auf super arm. Luxuriöser Medizintourismus trifft auf Unterversorgung von Einheimischen. Friedensbewegungen münden in blutige Aufstände. Und immer ist der Krieg ein ständiger Begleiter der Bevölkerung des noch jungen Landes. Indien ist die größte Demokratie der Erde. Doch wie demokratisch lebt man dort? Sind die Zwänge des berühmt-berüchtigten Kastensystems wirklich abgeschüttelt? Sicher ist, dass Indien bald das bevölkerungsreichste Land der Welt sein wird und China auf dieser Spitzenposition hinter sich lassen wird. Ist das ein gutes Zeichen in einer Welt voller neuer Herausforderungen wie dem Klimawandel? Wir werden es herausfinden. Dazu müssen wir Indien verstehen. Und dazu ist ein Blick in die wechselhafte, aber gleichzeitig faszinierende Geschichte des fernen Landes nötig, um die Frage zu beantworten: Was ist die Supermacht Indien?
- Kapitel 1 -
Die Geschichte Indiens
Frühe Geschichte
Schon seit der Altsteinzeit war der indische Subkontinent besiedelt. Dies ist durch eine Vielzahl archäologischer Funde wie steinerne Faustkeile und Schabwerkzeuge belegt. Im Jahre 1982 entdeckte der indische Geologe Arun Sonakia den „Namada-Mann“ beziehungsweise dessen versteinerte Schädeldecke. Benannt wurde der Mensch, der vor mindestens 235.000 Jahren lebte, nach dem gleichnamigen Fluss. Dabei handelte es sich um eine Sensation: Zum ersten Mal wurde das Fossil eines Frühmenschen auf dem Subkontinent gefunden. Untersuchungen ergaben, dass es sich nicht um einen Mann handelte – dies war nur die erste Vermutung Sonakias. Vielmehr gehörte die Schädeldecke einer Frau im Alter von etwa 30 Jahren. Sie gehörte zur Art Homo Erectus, ein Vorfahre des modernen Menschen, dem Homo Sapiens. Die ersten dieser modernen Menschen sind etwa zwischen 73.000 und 55.000 Jahren v. Chr. im heutigen Indien eingetroffen. Grundsätzlich gilt der afrikanische Kontinent als Wiege der Menschheit. Im zuvor genannten Zeitraum trennten sich einzelne Gruppen, gingen auf Wanderschaft und erreichten dem Küstenverlauf folgend Indien. Im Tal des Indus begannen die Menschen nach und nach die nomadische Lebensweise als Jäger und Sammler aufzugeben und sich niederzulassen. Um 5.000 v. Chr. intensivierten sich Landwirtschaft und Viehzucht. Verschiedene Getreidesorten wurden angebaut und einige Tierarten wie Schweine, Ziegen und Ochsen domestiziert. Diese Entwicklung setzte sich fort und führte schließlich zur Indus-Zivilisation, einer frühen, aber bedeutenden Hochkultur.
Die Indus-Zivilisation
Ihren Namen verdankt die Indus-Zivilisation dem gleichnamigen Fluss, der in Tibet entspringt und nach 3.180 Kilometern ins arabische Meer mündet. Der Indus und sein weitverzweigtes Flusssystem mit temporär überschwemmten Ebenen bot einen idealen Boden für Landwirtschaft. Die Indus-Zivilisation war jedoch nicht auf die Ufergebiete des Flusses begrenzt. Das Besiedlungsgebiet dieser frühen Hochkultur erstreckte sich bis in den Nahen Osten, über Teile des heutigen Pakistans, bis in den nordöstlichen Teil Afghanistans und deckt Gebiete des heute nordwestlichen Teils von Indien ab. Gemeinsam mit den Ägyptern und Mesopotamiern gilt die Induskultur als eine der ersten bedeutenden Zivilisationen in der Bronzezeit. Ihre Blütezeit erlebte die Zivilisation von 2600 bis 1900 v. Chr.. Mit den großen Städten Mohenjo-Daro in der heutigen Provinz Sindh in Pakistan und Harappa bei Punjab, ebenfalls Pakistan, entstanden zwei imposante Ballungsräume. Archäologen vermuten, dass diese Metropolen bis zu 60.000 Einwohner beherbergt haben könnten. Gerade Harappa ist für Archäologen wichtig. Die Grundmauern der Stadt sind gut erhalten und lassen Rückschlüsse auf die Lebensweise der Bewohner zu. Für die damaligen technischen Möglichkeiten waren die Städte auf einem herausragenden städtebaulichen Niveau. So gab es bereits eine Wasserversorgung. Auch der Aufbau der Häuser und deren Umfeld war mit ihren charakteristischen Innenhöfen und Brunnenanlagen ein Glanzstück der Handwerkskunst. Auch heute finden sich in pakistanischen und indischen Dörfern entsprechende Wohnanlagen, die der damaligen Bauweise frappierend ähneln. Bezüglich der Bauweise unterscheiden sich die Städte der Indus-Zivilisation von denen in anderen Hochkulturen. Während die Ägypter zu monumentalen Bauten neigten, sind in den Überresten der Indus-Städte Großgebäude eher selten zu finden. Bauten von dem Format der ägyptischen Pyramiden fehlen gänzlich. Die größten Gebäude waren vermutlich Getreidespeicher.
Es gilt als gesichert, dass die Bewohner des Indusufer Händler und Handwerker waren. Die Bewohner Harappas brannten Ziegel und Keramik und stellten Halsketten, Figuren und Spielzeuge her. Auch in der Metallurgie waren die Bewohner Harappas kundig: Zinn, Bronze, Blei und Kupfer waren bekannte Metalle. Auch Terrakottafiguren, die mit Gold verziert sind, wurden gefunden. Sogar die Mathematik war kein unbekanntes Feld. Geometrische Formen wie Würfel waren durchaus bekannt. Auf Schalen und Töpfen wurde außerdem eine Vielzahl von Schriftzeichen gefunden, die auf eine Schriftsprache deuten. Letztendlich ist die Frage nach der Sprache des Volkes am Indus bisher nicht hinreichend beantwortet. Ein schlüssiges Sprachsystem konnte nicht identifiziert werden. Bei den 600 entdeckten Schriftzeichen könnte es sich um eine Kunstsprache handeln.
Die Indus-Zivilisation war keine friedliche Gemeinschaft. Kriegerische Auseinandersetzungen fanden häufig statt. Diesen Rückschluss lassen Skelettfunde aus Harappa zu. An jedem sechsten Skelett fanden sich deutliche Spuren von Verletzungen. Auch die Existenz von Krankheiten wie Lepra konnte so belegt werden.
Wie erwähnt, war der Handel wichtig. So wichtig, dass es als gar nicht so unwahrscheinlich gilt, dass das Rad tatsächlich im Wirkungskreis der Indus-Zivilisation erfunden wurde. Archäologische Funde weisen darauf hin, dass im frühen Indien Ochsenkarren im Einsatz waren, die auch heute noch in weiten Teilen im Süden und Osten Asiens in Gebrauch sind. Der Überlandhandel profitierte von dieser Entwicklung. Auch der Handel zur See florierte. Dass das Indusvolk mit den Mesopotamiern Handel getrieben hat, gilt als gesichert. Es wird vermutet, dass es sogar Handelsbeziehungen bis nach Ägypten oder Kreta gegeben haben könnte. Doch auf eine bedeutende Frage konnte die Archäologie bisher keine echte Antwort liefern: Wer hatte eigentlich das Sagen im Land am Indus? Dass es einen Herrscher im Sinne eines „Königs“ gegeben habe, ist vermutlich auszuschließen. Denn im Normalfall, zumindest dann, wenn andere Hochkulturen als Maßstab herangezogen werden, wäre der Regent auf Abbildungen dargestellt. Entsprechende Hinweise konnten bisher nicht gefunden werden. Die Forschung ist sich jedoch sicher, dass es irgendeine Form von „übergeordneter Behörde“ gegeben haben muss. Darauf lässt die ausgeklügelte Städteplanung schließen. Es besteht die Annahme, dass die Städte von einzelnen Personen geleitet wurden oder vom Volk selbst. Zumindest scheint es so, als wäre ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheit innerhalb der einzelnen Siedlungen gegeben gewesen.
Wie jede Hochkultur hatte auch die Zeit der Indus-Zivilisation ein Ende. Um 1900 v. Chr. zeigten sich erste Zerfallserscheinungen. Offenkundig verließen die Menschen die Städte. Zunehmende Ausbrüche von Gewalt und die Verbreitung von schweren Krankheiten wie Lepra oder Tuberkulose konnten möglicherweise zu dieser Entwicklung führen. Das Resultat war eine Aufgabe der urbanen Standorte und eine Umorientierung zu einer ländlich und nomadisch geprägten Lebensweise. Ein Beispiel dieses Rückschrittes zeigt sich am Handwerk. Töpferwaren aus dieser Zeit weisen nicht mehr die einst hochwertige Machart auf, die noch in der Blütezeit der Indus-Zivilisation deutlich sichtbar war. Der Fernhandel wurde aufgegeben und die Städte verfielen. Neu errichtete Häuser wurden eher „zusammengeworfen“ statt fachmännisch errichtet. Archäologen fanden aus dieser Zeit Überbleibsel, die auf unruhige Zeiten hinweisen. Wertsachen wurden in „Horten“ gefunden, also versteckt. Dies deutet darauf hin, dass sich die Menschen dieser Zeit vor Plünderungen fürchteten. Außerdem wurden Leichen gefunden, die unbeerdigt in Gebäuden lagen. Entweder war für eine Beerdigung keine Zeit oder die Bewohner sahen dafür keine Notwendigkeit.
Die vedische Zeit
Der Zeitraum zwischen 1900 bis 200 v. Chr. wird als die vedische Zeit bezeichnet. Namensgeber sind die sogenannten Veden oder auch Veda genannt, liturgische Texte, die uns einen Einblick in das religiöse Verständnis und die Lebenskultur geben. Nach dem Zerfall der Indus-Zivilisation beschreibt die Veden-Zeit eine Rückbesinnung zur Kultur. Das alte Indien befand sich wieder im Aufschwung. Die Veden sind in einer indo-arischen Sprache abgefasst und die Vorläufer der Sprache, die wir heute als Sanskrit kennen. Bekannt sind vier Veden, das Rigveda, das Yajurveda, das Samaveda und das Atharvaveda, die wiederum in eine Vielzahl von Untergruppen unterteilt sind. Eine davon sind die Mantren, die auch heute im westlichen Kulturkreis bekannt sind. Ein Mantra ist eine Aneinanderreihung von Worten, denen besondere Kräfte nachgesagt werden. Die Veden gelten im hinduistischen Glauben auch in der Gegenwart als heilig. Eine Besonderheit stellt die Überlieferung der Veden dar. Sie wurden zunächst nicht schriftlich fixiert, sondern wurden mündlich übertragen, genauer gesagt in Liedern. Der Gesang dieser Veden wurde 2003 in die UNESCO-Liste der Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit aufgenommen. Im Laufe der Jahrhunderte entstanden jedoch zahlreiche Abschriften. Dank dieser komplizierten Technik sind uns heute zahlreiche Einblicke in die Lebensweise der indo-arischen Völker überliefert, die sich im Norden und Nordwesten Indiens ansiedelten. Die Veden beschrieben nicht nur religiöse Themen, sondern auch weltliche Aspekte. Die Rigveda gilt als der älteste Text und beschreibt das Zusammenleben der Indo-Arier als Hirten- und Stammeskultur. Von den früheren Errungenschaften der Indus-Zivilisation mit ihren großen und modernen Städten ist in diesen Schilderungen kaum etwas spürbar. Das Leben damals war einfach und archaisch. In dieser, auch Rigveda-Zeit genannten Epoche, begannen die Indo-Arier, sich in den westlichen Teil der Ganges-Ebene auszubreiten, die sich im nördlichen Teil des indischen Subkontinentes befindet. Des Weiteren erfolgte die Besiedlung im Punjab. Einblicke in die weitere Entwicklung bietet die Atharvaveda. Dort wird ein „schwarzes Metall“ erwähnt. Die Wissenschaft ist sich einig, dass es sich hierbei nur um Eisen handeln konnte. Somit war die Eisenzeit in Indien angebrochen. Auch im Zusammenleben der Menschen tat sich etwas. Einzelne Stämme bildeten zunächst Zusammenschlüsse, also in etwa Stammesunionen, die in Königreiche oder Republiken aufgingen und Janapadas genannt wurden. Mit Kuru, Kosala, Panchala und Videha sind vier solcher Staatsgebilde bekannt. Gerade letzteres, Videha, galt als Hochstätte von Kultur und Religion.
Exkurs: Die Arier
Als Arier bezeichnen sich diejenigen Menschen, die eine indo-arische Sprache sprechen. Letzterer Begriff wird in neueren Zeiten auch als indoiranisch bezeichnet, eine Sprache, die in der Bronze- und Kupferzeit weit verbreitet war. Die Heimat der Arier war Ariana; so wurde zumindest der Landstrich von den Römern und Griechen bezeichnet, der heute größtenteils das Staatsgebiet Afghanistans darstellt.
Diese indo-arische Sprache ist – einfach formuliert – verwandt mit dem Germanischen. Im Europa des 19. Jahrhunderts führte dies zu einer Stilisierung der Arier als „Urvolk“, verbunden mit der Vorstellung, zur gleichen Ethnie zu gehören. Unter den Gelehrten der damaligen Zeit wuchs die Idee, dass die arische Rasse den anderen überlegen sei. Ein Gedanke, den später die Nationalsozialisten in Deutschland aufnahmen und weiter radikalisierten. In seinem Buch „Mein Kampf“ formte Adolf Hitler die Vorstellung weiter, dass die Deutschen als Nachfahren der Arier nicht nur überlegen, sondern auch durch die sogenannte „Rassendurchmischung“ in ihrem Fortbestehen gefährdet seien. Dieser Glaube legte den Grundstein für die grauenhaften Verbrechen der Nazis. Im Kontext der altindischen Geschichte wird der Begriff eher selten verwendet. Stattdessen wird die Bezeichnung Indo-Arier gebraucht.
Im Grunde ging die Besiedlung des nördlichen Indiens durch die Indo-Arier, die ihre ursprüngliche Heimat in den nordwestlich gelegenen Grassteppen hatten, langsam voran. In der spätvedischen Zeit bildete sich ein Kastensystem heraus, das im heutigen Indien und dem hinduistischen Glaubenssystem nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. Die Kasten wurden unterteilt in Brahmanen (Priester), Kshatriyas (Krieger), Vaishyas (Bauern), Shudras (Unterworfene) und Parias (Kastenlose). In der gleichen Epoche wandelte sich die Gesellschaft. Es wurden Städte gegründet und die Menschen gaben ihre nomadische Lebensweise auf. Es wurde verstärkt Ackerbau betrieben. In großem Maßstab wurde Reis kultiviert. Die zuvor genannten Stammesunionen, Republiken und Königreiche blühten auf, es kamen Neue dazu, andere wiederum schlossen sich zusammen. Um 600 v. Chr. gab es 16 solcher Königreiche. Das bedeutendste war das Königreich Maghada mit seinem König Bimbisara, der eine erfolgreiche Handels- und Expansionspolitik betrieb und eine funktionierende Verwaltung etablierte. Diesem Reich sollen rund 80.000 Dörfer und Siedlungen angehört haben. Diese Zahl dürfte aber wohl der Fantasie der Chronisten zu verdanken sein. Zur nahezu gleichen Zeit (563 v. Chr.) wurde Siddhartha Gautama in Lumbini im Norden Maghadas geboren. Der Sohn eines Fürsten ging unter dem Namen Buddha in die Geschichte ein.
Das klassische Zeitalter Indiens
Um 400 v. Chr. wurde in Maghada das Nanda-Reich gegründet, das nahezu den gesamten Norden des heutigen Indiens umfasste. Das Reich galt als sehr modern und dennoch sehr kurzlebig. Die Nanda-Dynastie erlosch kurz nach dem Einfall durch den griechischen bzw. makedonischen Feldherrn Alexander den Großen in Indien und wurde von Chandragupta Maurya abgelöst. Dies gilt als die Geburtsstunde des Maurya-Reiches, eines der größten und mächtigsten Staatsgebilde in der Geschichte des Subkontinents, das ebenfalls in Maghada seinen Ursprung hatte. Chandragupta kämpfte gegen Alexanders Truppen, die im Tal des Indus nach dessen Feldzug zurückgelassen wurden. Nicht nur als Feldherr machte sich der erste König Mauryas einen Namen. Er galt als geschickter Diplomat, der mit dem griechischen Militärführer ausgeklügelte Verträge aushandelte. Unter Chadraguptas Enkel Ashoka erreichte das Maurya-Reich seine Blütezeit und größte Ausdehnung. Es soll eine Fläche von 5 Millionen Quadratkilometern umfasst und eine Einwohnerzahl von etwa 60 Millionen Menschen gehabt haben. Dies hätte Maurya zum bevölkerungsreichsten Staat der Antike gemacht. Ashoka war ideologisch seiner Zeit voraus. Er konvertierte zum Buddhismus und machte das Prinzip des Friedens zur Staatslehre. Gewalt wurde abgelehnt und Konflikte wurden friedfertig beigelegt. Auch auf die Unterstützung von Hilfsbedürftigen wurde ein Schwerpunkt gelegt. Seine Herrschaft beschreibt eine Form der Staatsführung, die in den europäischen Großreichen der Antike unbekannt war.
Brihadratha war ein Enkel Ashokas und der letzte Vertreter der Maurya-Dynastie. Im Jahre 185 v. Chr. wurde er durch seinen General Pushymitra entmachtet und die Maurya-Dynastie erlosch. Dieser „Putsch“ markierte den Beginn des Shunga-Reiches, über das jedoch kaum Einzelheiten überliefert sind. Dieses Königreich hatte mit Pataliputra und Vidisha zwei große Metropolen. Die Armut an Quellen macht diese Zeit zum Gegenstand vieler Spekulationen. 73. v. Chr. wurde der amtierende König Devabhuti auf den Befehl seines Ministers Vasudeva durch einen Sklaven ermordet. Dies machte ihm den Weg zur Spitze des Reiches frei. Es folgte die sehr kurze Kanva-Dynastie, die nur 45 Jahre währte. Der Beweis, dass diese Herrscherlinie überhaupt existierte, ist nur dank der Erwähnung in den Puranas, den heiligen Schriften im Hinduismus, belegbar. Des Weiteren wurden Münzen gefunden, die während der Kanva-Dynastie geprägt wurden. Schon zu diesem Zeitpunkt besaß das einst große Reich nicht mehr die ursprüngliche Ausdehnung. Das Staatsgebiet zerfiel zumindest teilweise in separate Königreiche und Fürstentümer. Die Kanva-Dynastie wurde von den Shatavahana aufgelöst, die im zentralindischen Hochland seit 230 v. Chr. ihr eigenes Reich aufbauten. Die Shatavahanas wurden auch als Andhras bezeichnet, was auf eine ursprüngliche Herkunft in der gleichnamigen Region hindeutet. Andhra Pradesh ist auch heute noch ein Bundesstaat Indiens. Durch die Eroberer aus Zentralindien wurde das einst bedeutende Maghada zu einer Stadt in der Peripherie des Shatavahana-Reiches degradiert, dessen Zentrum die heutige Millionenstadt Nashik war. Das Shatavahana-Reich galt als modern. Die Herrscher unterstützten sowohl Brahmanen als auch Buddhisten finanziell. Auch das Bankwesen erlebte einen Aufschwung. So etablierten die Shatavahanas beispielsweise Zinsen. Das Reich währte bis etwa 220 n. Chr. Noch im 2. Jahrhundert wuchs der Einfluss in Zentralindien beachtlich, beispielsweise durch den Zusammenschluss mit der Nachbarregion Maharashtra, der aber genauso schnell wieder schwand. Es bahnte sich ein Konflikt mit den Saken an, die als Nomaden die Steppen Nordostindiens und Mittelasiens bewohnten. Sie galten als Vasallen des Kuschana-Reiches, einem großen Imperium im nordöstlichen Teil Indiens, das bis in seiner größten Ausdehnung um 250 n. Chr. bis ins heutige China reichte. Aus der dortigen Provinz Yuezhi entstammten auch die Herrscher von Kushana, indogermanische Nomaden. Diese Epoche wird von der indischen Geschichtsschreibung als „dunkles Zeitalter“ eingestuft, da Kushanas als Fremdherrscher wahrgenommen wurden. Auch die Übernahme des griechischen Alphabets wurde als Zeichen einer Fremdbestimmung gewertet. Dennoch brachte die Regierungsform der Kushanas einen Aufschwung in der Region. Es gab reichhaltige Handelsbeziehungen zu China und auch mit Rom bestanden diplomatische Kontakte, die nicht immer unbeschwert waren. So beklagten sich römische Beamte über den Umstand, dass die Kushanas keine eigenen Münzen fertigten, sondern römische Sesterzen umprägen ließen. Auf diesen Münzen fand sich bereits die Bezeichnung „Maharaja“ als Herrschertitel. Für das straffe Verwaltungssystem der Römer war dies ein Ärgernis. Nicht nur das Kushana-Reich, auch das Shatavahana-Reich pflegte enge Handelskontakte zum römischen Imperium. Exportiert wurden vor allem Luxusgüter: Elfenbein, Edelsteine, Seide, Gewürze und wohlriechende Parfüms gingen von Nordost- und Südindien nach Mitteleuropa. Die Handelsbilanz war unausgeglichen. Es gab in Indien keine vergleichbare Nachfrage an römischen Handelsgütern wie Glas oder Kupfer, so dass die Römer die importierten Güter mit Goldmünzen bezahlten, denen oben genanntes Schicksal widerfuhr und die somit aus dem Finanzkreislauf verschwanden. Diese negative Bilanz sorgte u.a. in Rom für eine echte Wirtschaftskrise. Warum das Kushana-Reich letztendlich um 250 n. Chr zum Niedergang verurteilt war, bleibt auch heutigen Historikern verborgen.