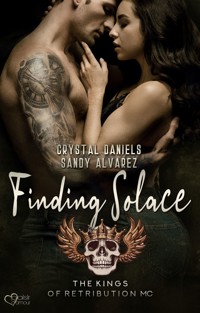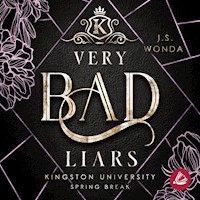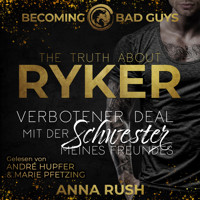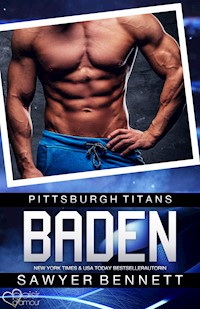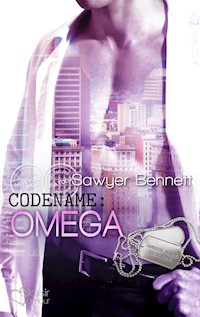5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NEXX Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Ist man jemals wirklich bereit für den Moment, in dem langgehegte Träume Wirklichkeit werden? Das letzte Spiel hat begonnen - und der große Stefan Volkan ist nicht mehr der Einzige mit Trümpfen auf der Hand: June erhält überraschend die Möglichkeit, die Fesseln ihrer Existenz als willenlose Marionette in Stefans Theaterstück Faden um Faden zu durchtrennen. Aber dabei muss sie erkennen, dass der richtige Weg zuweilen der schwerste ist und sich auch im hellsten Licht noch dunkle Schatten verbergen ... Steine werden ins Rollen gebracht, Schlingen ziehen sich allmählich zu – wer wird fallen und wer wird als Sieger aus diesem Spiel um Leben und Tod, Freiheit und Gefangenschaft hervorgehen? Mit der nexx edition bringen wir Bücher in die Welt – ohne Umwege, vom Autor direkt zum Leser. Erleben Sie diese besonderen Bücher und entdecken Sie ihre faszinierenden Geschichten für sich! nexx edition – WIR BRINGEN BÜCHER IN DIE WELT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Ähnliche
Madelaine Harder
Supposed to be Devotion
Roman
Madelaine Harder
Supposed to be Devotion
Roman
ISBN/EAN: 978-3-95870-704-7
1. Auflage
Umschlaggestaltung: Madelaine Harder,
Layout: nexx verlag
© nexx verlag gmbh, 2024
www.nexx-verlag.de
⊰ ❉ ⊱
Nur Du bist Du – und Du bist nur einmal
auf dieser Erde. Nutze das für Dich.
Sei stark und stolz und einzigartig.
Und lass Dir von niemandem sagen,
dass du anders besser wärst.
⊰ ❉ ⊱
Prolog
⊰❉⊱
Sag mir – gibt es Dinge in deinem Leben, die du nur für dich tust?
Kleine Dinge, vielleicht auch große, die rein nur für dich, dein Glück, deine Erfüllung da sind? Die keinem anderen Zweck dienen, als dein Leben ein kleines bisschen bunter, schöner zu machen?
Oder agierst du vielmehr ohne zu überlegen die meiste Zeit für andere? Tust unbewusst, was das Beste für diese Menschen ist, reagierst auf ihre Befindlichkeiten?
Warum tust du das?
Hinterfragst du selbst dein ‚Warum?‘ Und wenn du eben das nicht bewusst reflektierst, warum nicht?
Ich meine, es ist doch dein Leben, nur du kannst es für dich leben — tust du das nicht, bereust du es früher oder später. Denn seien wir ehrlich, was ist schon ein Menschenleben im endlosen Strom der Zeit?
Zeit ist schnell vergangen. Wir alle, ein jeder von uns, ist nicht mehr als ein Wimpernschlag in der Vergänglichkeit des Lebens, eine unbedeutende Momentaufnahme im unendlichen Universum.
Ein Sandkorn in der Wüste der Evolution. Unbedeutend. Was stellst du mit deinem Sandkorn an? Denkst du an alle anderen vergisst du unwillkürlich immer dich selbst.
Dabei reichen oft schon Kleinigkeiten aus um einen großen Unterschied zu machen — und doch neigen wir dazu, uns einzureden, dass eben das nicht möglich ist.
Warum?
Zwängen dich erlernte Gepflogenheiten in eine Bahn, die natürlicherweise nicht die deine wäre? Nennst du es Schicksal, wenn du deine Eigenverantwortung wie selbstverständlich, ohne darüber nachzudenken, abgibst, Tag für Tag?
Glaubst du daran, dass es der dir vorbestimmte Weg ist, das Spiel deines Lebens nach Regeln zu spielen, die ein anderer für dich aufgestellt hat? Ohne nach deinen Präferenzen zu fragen?
Ich wette, du tust das.
Jeden Tag.
So wie ich es tue. Und paradoxerweise bin dabei doch ich die einzige Person, die wirklich Einfluss auf mein Leben, mein eines Sandkorn hat, oder nicht?
Warum also tue ich was ich tue? Warum heiße ich es stillschweigend gut, wenn andere meine Lebensfäden spinnen, andere meine Spielzüge ausführen?
Warum gebe ich anderen so viel Macht über meine Momentaufnahme, wenn es doch mein wertvollster Besitz ist?
Weil es gesellschaftlich so anerkannt ist, sich einzufügen, zu einem wertvollen, nützlichen Mitglied zu werden, um nicht ausgegrenzt und vergessen zu werden? So funktioniert unser westliches Wertesystem einfach — ein kleines Zahnrad in der großen Maschinerie der Allgemeinheit. Immer größer werdender Druck, immer mehr meistern zu müssen, immer besser werden, schneller werden. Sich bewusst – oder unbewusst – über die kleine Stimme im Inneren hinwegsetzen, die schüchtern fragt, ob es nicht langsam genug ist ...
Denn die Antwort kennen wir bereits, wird uns vorgelebt, mit goldenen Löffeln in den Mund geschaufelt und wir schlucken brav.
Niemals bist du genug, achtest du zu oft auf deine eigenen Befindlichkeiten.
Das erscheint mir doch recht trist, unpersönlich. Bin ich auf der Welt, um zu funktionieren, hat mein Dasein keinen höheren Zweck? Ausgebeutet werden, solange ich einen Dienst an der Gemeinschaft vollbringe, danach werde ich ausgetauscht, vergessen?
Darf ich ehrlich sein, nur für einen Moment, ohne dafür verurteilt zu werden?
Genau genommen ist das mein Wunsch. Ausgetauscht zu werden, meinen angedachten Platz verlassen zu dürfen. Nicht mehr funktionieren zu müssen. Einfach vergessen zu werden, zumindest für eine Weile.
Einfach Dinge tun, die wirklich vollkommen und ausschließlich für mich sind, die ich nicht vorgaukeln muss, die nicht von mir erwartet werden als guter Mensch, als gute Freundin, als gute Frau — oder später als gute Mutter. Ich will einfach nur … frei sein.
Ich sein.
Für mich sein.
Nicht einmal immer ... nur dann und wann.
Warum?
Weil ich es wert bin. Oder es zumindest einmal wert war, vor sehr langer Zeit. Wie gern würde ich in diese Zeit zurück, weiß ich sie doch erst zu schätzen, seit sie vergangen ist. Stattdessen bin ich hier, an einem Punkt, an welchem ich einfach alles hinterfragen muss.
An einem Punkt, an welchen ich nie gelangt wäre, wenn ich weniger ein guter Mensch im Sinne der Gesellschaft, als ein guter Mensch im Sinne von June gewesen wäre.
Wie kann ICH der Gesellschaft denn von Nutzen sein, wenn ICH gar nicht ICH bin?
Kapitel 1
⊰ ❉ ⊱
„Hast du mich vermisst, Mädchen?“
Die Stimme, die zu vernehmen ich nicht fassen konnte, die Stimme eines beklagten, betrauerten Toten, eines verlorenen Geliebten, die Melodie meines Herzens, klang aalglatt, gefühllos, kalt. Beinahe unbekannt, fremd.
Ich schluckte schwer. Mein Atem kroch quälend langsam über meine geöffneten Lippen, obgleich mein Herz in meiner Brust zu explodieren drohte, mehr und mehr Sauerstoff einforderte. Und doch fiel das Luftholen endlos schwer, als ob meine Lungen ihren Dienst quittieren wollten.
Das konnte nicht sein. Das war schlicht nicht möglich. Mein Schädel pochte, dumpf dröhnte es in meinen Ohren, Blut pulsierte, rauschte. Ein schriller Ton übertünchte alle körpereigenen Geräusche, die ich mit einem Mal in der Unfassbarkeit dieses Moments wahrzunehmen schien, steigerte die unfassbare Kakophonie in meinem Schädel noch weit über das erträgliche Maß hinaus.
Meine Hände zitterten, eine Gänsehaut zog sich über meinen gesamten Körper, ließ mich frösteln.
Langsam, so langsam, wie in Zeitlupe drehte ich mich um, hielt die Augen auf den Boden gerichtet, furchtvoll, bangend, was ich erblicken würde. Spielten meine Ohren, mein Verstand mir einen grausamen Streich? Verlor ich vollkommen den Verstand? Meine Lippen bebten als ich Zentimeter für Zentimeter meinen Blick hob.
Kein Streich.
Keine Halluzination.
Er war es. Leibhaftig.
Er sah müde aus, ausgezehrt. Seine matten Augen lagen tief in den Höhlen, dunkle Schatten zogen sich bis tief in die eingefallenen Wangen. Sein Haar wirkte stumpf, glanzlos, seine Lippen schmal und farblos. Er schien an Gewicht verloren zu haben, wirkte bei seiner Größe nun fast etwas hager. Seine Kleidung schien ihm nicht recht zu passen, als wäre es nicht seine eigene. Sie wirkte abgenutzt.
Und doch war die Person in ihnen jene eine, die ich unter tausenden erkennen würde, weil ihr Herz im Einklang mit dem meinen schlug.
Er war es, unverkennbar.
Daniel.
Ich öffnete den Mund, doch kein Laut wollte über meine Lippen kommen. Meine Hand griff an meine Kehle, ich spürte meinen Kehlkopf zucken, als ich wiederholt schluckte.
Er stand nur da und starrte mich an, vollkommen ausdruckslos, die Augen so leer, sein Blick so stumpf, als sähe er vielmehr durch mich hindurch.
Als wäre er ... nicht wirklich hier.
Tausend Gefühle, Empfindungen schossen durch meinen Geist, meine Seele wand sich wie unter Schmerzen. Ich wollte ihn berühren, doch konnte mich nicht bewegen. Alles in mir schrie, ihn endlich in die Arme zu schließen, endlich an seiner Brust zur Ruhe zu kommen, endlich, nur einen Augenblick Frieden … doch ich war wie gelähmt.
Schnarrend drang ein Lachen über seine aufgesprungenen Lippen, es kratzte an meinen Nerven wie eine Gabel auf Porzellan.
„Oh, wie ich sehe freust du dich gar nicht, mich zu sehen. Ich hatte einen herzlicheren Empfang erwartet — auf der anderen Seite scheinst du dich gut, sogar ausgezeichnet von meiner Abwesenheit abgelenkt zu haben.“ Seine Stimme war rau, wirkte hohl, wie körperlos, was den beißenden Spott in seiner Stimme nur verletzender machte. Ich schlang die Arme fester um mich, fand irgendwo tief in mir endlich die Kraft zu sprechen.
„Daniel?“
Unsicher holperte meine Zunge über die wenigen Silben, unverständlich angesichts der Häufigkeit, mit welcher sein Name in meinem Gedanken, meinem Herzen, in meinem Mund war. Und zum Teufel, war das meine Stimme? Ich räusperte mich und versuchte es erneut, abwartend starrte er mich an.
„Wie kann das sein? Ich ... ich war auf deiner Beerdigung, habe eine Blume auf dein Grab gelegt ... Bist du es wirklich?“ Wieder entrang sich seinen schmalen Lippen ein hässliches Lachen.
„Ich enttäusche dich wirklich ungern, aber ja, ich bin es. Keine Ahnung, was genau du im Dreck verscharrt hast, ich jedoch war es nicht.“ Er trat einen Schritt auf mich zu, ich musste den Impuls unterdrücken zurück zu weichen. Das konnte nicht sein. Was geschah hier?
Noch zwei Schritte und er stand direkt vor mir. Ich spürte seine Wärme auf meinen nackten, von Gänsehaut überzogenen Armen, spürte, wie sein warmer Atem über die unordentlichen Strähnen auf meinem Kopf strich. Jedes Haar an meinem Körper sträubte sich noch mehr.
Ich sah zu ihm auf, sah in das so düstere, verwüstete Gesicht, das mir das liebste auf der Welt gewesen, nun so seltsam fremd war. Langsam, wie magnetisch von ihm angezogen, streckte ich die Hand nach seiner Wange aus, zitternd, bebend machten sich meine Finger auf den Weg, die Weichheit seiner Haut zu testen.
Kurz vor seinem Gesicht hielt ich inne, atmete schwer. Zögerte.
Was, wenn er verschwand, sowie ich ihn berührte? Was, wenn dies nur ein Trugbild meiner überreizten, sehnsüchtigen Fantasie war?
Würde ich es verkraften, ihn erneut zu verlieren?
Mit weit aufgerissenen Augen starrte ich ihn an, spürte, wie Tränen heiß hinter meinen Lidern lauerten, nur allzu bereit, sich über meine Wangen zu ergießen.
„Daniel …“, hörte ich meine Stimme heiser brechen. Und dieser Klang schien etwas in ihm auszulösen, ein Funken Leben erklomm in den stumpfen Augen, er neigte seinen Kopf, meiner Hand entgegen und endlich berührten meine zitternden, unsicheren Finger ihn.
Berührten ihn, fassten nicht durch ihn hindurch, er verschwand nicht, einem Geist gleich. Er war es.
Daniel.
Er stand hier, direkt vor mir, so dicht, dass ich den Puls an seinem Hals sehen konnte, seinen Atem wie schmeichelnden Windhauch auf meinem Gesicht spürte, die weiche Haut unter meinen Fingern fühlte.
Der so sorgsam Stein um Stein aufgeschichtete Damm in meinem Inneren brach mit einem lauten Bersten, erschütterte mich bis in mein tiefstes Inneres. Ich heulte auf und warf mich an seine Brust, deren Konturen so schmerzhaft vertraut waren, inhalierte tief seinen Duft, der mir stets Frieden geschenkt hatte, schlang die Arme um seine Taille, mein standhafter Fels in stürmischer See.
Ich wollte auf die Knie fallen und Gott, an den ich nicht glaubte, und alle Heiligen der ganzen Welt danken, dass er hier stand, vor mir, lebendig, wie durch ein Wunder. Mein kleiner Körper drohte zu brechen unter all den großen Emotionen die mein Innerstes zerpflücken, sich Raum machend, all die verlorenen Hoffnungen, die unbeachteten Träume.
Tränen strömten ohne Unterlass aus meinen Augen, versickerten im Stoff seines Shirts, dankbar, dass ich ihnen endlich keinen Einhalt mehr gebot, endlich meine Trauer zuließ, den emotionalen Ballast von mir gab, der mit zerstörerischer Kraft mein Innerstes so verwüstet hatte.
Trauer um eine Zukunft, die wie ein schmaler Schimmer am Horizont erloschen war, ehe auch nur eine Ahnung von ihr hatte eintreten können — eine Zukunft, deren warmer Schein mich nun einzuhüllen versuchte, eingebettet in den Armen des Mannes, den ich liebte.
Arme, die immer noch schwer zu seinen Seiten hingen, anstatt sich schützend um mich zu legen.
Arme, die meine Präsenz an seiner Brust vollkommen zu ignorieren schienen, statt mich willkommen zu heißen.
Ich löste meinen schweren Kopf von seinem Oberkörper, sah durch den Schleier der vielen tausend noch ungeweinten, so lange aufgestauten Tränen zu ihm auf. Er mustere mich distanziert, fast lieblos. Sofort spürte ich die Kälte in meine Seele zurückkehren, wie Eisblumen in eisigen Winternächten legten sich frostige Ranken um mein Herz, schnürten es schmerzhaft ein.
Die hoffnungsvolle Zukunftswärme schwand, wich der schweren, kalten Realität der Gegenwart.
Ernüchtert löste ich meine Umklammerung, trat stolpernd einen Schritt zurück, wischte mir unbeholfen salzige Bahnen von den Wangen, räusperte mich, zog die Nase hoch.
Er war hier — aber er war doch nicht hier, das konnte ich an seinem Blick deutlich erkennen.
Etwas hielt ihn zurück, ließ ihn nicht zu mir kommen, ankommen. Ich zitterte, nicht nur der Kälte in meinem Innern geschuldet.
Stumm standen wir voreinander, maßen uns mit Blicken, suchten zu verstehen, was der andere nicht aussprach. Er rührte keinen Muskel, flach nur hörte ich seine Atmung gehen. Ich schüttelte den Kopf, verständnislos. Diese abstruse Situation schien keinen Sinn zu haben. Meine Arme schlangen sich wieder schützend um mich, um meinen Bauch. Ein winziges Zucken seiner Augenbraue war seine einzige Reaktion.
„Bist du nur gekommen um mich anzustarren, willst du gar nichts sagen?“, brach es aus mir hervor, meine zitternde Stimme versteckte nur ungenügend meine verletzten Gefühle, meine tiefe Verwirrung.
„Was genau TUST du eigentlich hier?“ Er schnaubte auf, ein kalter Glanz in seinen blauen Augen, kalt wie Eis.
„Das ist eine ausgezeichnete Frage. Wenn ich dich so anschaue weiß ich auch nicht länger, was mich hierher gezogen hat.“
Mit offenem Mund starrte ich ihn an.
„Von was zum Teufel redest du?“ Ein kurzes, hartes Lachen antwortete mir, er trat zurück, fuhr sich durch die Haare, endlich ein kleines Zeichen von dem Daniel, den ich zu kennen meinte, ein Zeichen seiner inneren Aufruhr unter der emotionslosen Maske, die er zur Schau stellte.
Kein weiteres Wort kam von seiner Seite, beharrlich schwieg er, zerwühlte lediglich mit wütender Miene sein mattes Haar. Ich schüttelte entgeistert den Kopf.
„Das ist alles? Du tauchst hier auf, nach all den Wochen, nachdem du gegangen bist, ohne dich zu verabschieden — nachdem du gestorben bist, ohne dass ich dir Lebewohl sagen konnte – und nun schweigst du dich aus?!“
Meine Stimme überschlug sich, die Worte sprudelten ohne Unterlass aus mir heraus, nur mit Mühe konnte ich ein irres Kichern unterdrücken.
„Was stimmt denn nicht mit dir? Hast du so wenig Achtung vor mir, meinen Gefühlen? Ich habe getrauert! Meine Welt ist zerbrochen, ich lebe von Tag zu Tag, ohne Sinn und Verstand! Ich versuche immer noch schwimmen zu lernen im Ozean der einsamen Trauer, dessen Wellen an mir lecken, mich in die Tiefe ziehen wollen ... Ich wollte sterben, weil ein Leben ohne dich mir nicht lebenswert schien — und du kommst hierher, wie auch immer du noch leben kannst, und lachst mich aus?“
Ich zitterte am ganzen Leib, meine Zähne schlugen klappernd aufeinander, kurz vor einer Hyperventilation. Eine Ohnmacht erschien mir außerordentlich gnädig, doch sie wollte sich nicht einstellen.
Stattdessen musste ich beobachten, wie sich sein verhärmtes Antlitz zu einer hämischen Grimasse verzog. Mit ausgestrecktem, bebendem Finger zeigte er auf meinen Bauch, dessen kleine, kaum erkennbare Wölbung sich unter dem Shirt abzeichnete, seine Lippen waren weiß, die Augen schwarz vor Wut.
„Mit Worten konntest du schon immer gut umgehen, doch deine Taten sprechen um einiges lauter als die bittersüßen Töne, die von deinen Lippen tropfen!“ Er atmete keuchend durch, nur unzureichend beruhigt durch den frischen Sauerstoff in seinen Lungen.
„Wie sehr du um mich getrauert hast, kann ich gut erkennen. Verdammte Scheiße June, die ganze Welt, die für dich zerbrochen scheint, kann erkennen, wie schnell du die Scherben mit Stefans Kleber gekittet hast.“
Er trat auf mich zu, auch er zitterte, doch ihn brachte ein inneres Feuer, eine unvorstellbar hoch flammende Wut dazu, trieb ihn näher an mich heran. Wie gelähmt stand ich da, konnte nicht zurückschrecken, konnte ihn nur fassungslos anstarren.
Konnte nicht verhindern, dass die Flammen seines Zornes mich versengten.
„Du wagst es von Trauer zu reden, von sterben, von Leben, die nicht lebenswert sind — und doch bist du doch diejenige, die mich gerade umbringt. Für dich bin ich gestorben — und tue es gerade wieder, nur dieses Mal führst du selbst die Klinge. Ich habe dich für vieles gehalten, June, aber niemals für eine derart schamlose Lügnerin. An dir ist eine Schauspielerin verloren gegangen, fürwahr hat Stefan hier ganze Arbeit geleistet.“
Er streckte die Hand aus, legte sie mir an die Wange, lächelte so kalt, dass mein Herz vollends zu Eis erstarrte, kraftlos, lautlos den minimalsten Dienst verrichtete, um mich am Leben zu erhalten.
Um mich zu zwingen, seinen Worten zu lauschen.
„Du und er, ihr habt euch wahrhaft verdient, ein wundervolles Pärchen gebt ihr ab. Wäre ich doch nur wirklich verreckt, um mir das hier ersparen zu können.“
Kurz, einen Augenblick nur, ließ er seine Maske fahren und ich konnte den unsäglichen Schmerz dahinter sehen, einen kurzen Blick auf seine zerbrochenen Hoffnungen, sein Leid erhaschen, welches dem meinen so ähnlich war, dass ich meinte in einen Spiegel zu sehen ... Bevor er wieder jedwedes Gefühl weit von sich schob, mit harter Miene den Kopf schüttelte.
„Ich wünsche euch dreien ein gutes Leben, das tue ich wirklich. Du hast deutlich gemacht, dass hier kein Platz für mich ist – und damit hast du mich zum letzten Mal gesehen. Leb wohl.“
Und dann drehte er sich um und wollte gehen. Er war im Begriff, mich einfach so stehen zu lassen, wieder zu verschwinden, als wäre er nie da gewesen, als wäre er wieder tot, für immer weg. Etwas in mir, von dessen Existenz ich bisher nichts gewusst hatte, zersprang, bohrte spitze, giftige Scherben in meine im Stau liegende Seele. Wut brandete in mir auf, eine unsägliche, heiß brennende Wut, die alles vernichten wollte, was sich ihr in den Weg stellte.
„Bist du jetzt vollkommen übergeschnappt, du dämlicher Feigling?“
Er zuckte zusammen, blieb wie angewurzelt stehen. Es schien ihn seine gesamte Kraft zu kosten, sich nicht zu mir umzudrehen, denn nach einem winzigen Moment tat er einen weiteren Schritt in Richtung Tür, in Richtung verschwinden.
Den leichten Weg wählend, statt sich der Emotion zu stellen. Ich schnaubte, die Augenbrauen wütend zusammengezogen.
„Ja, geh nur, verschwinde, darin bist du besonders gut. Nimm die Beine in die Hand und verpiss dich. Wenn das deine Gedanken sind, wenn du nur hergekommen bist, um Gift und Galle zu sprühen, wenn dein Hass, wie unbegründet und unsäglich dumm er auch ist, dein einziger Beweggrund waren, hier aufzutauchen, dann verschwinde. Du hast uns nicht verdient.“
Nun fuhr er wie von der Tarantel gestochen herum und bot mir ein Bild des verzweifelten, zermürbenden Hasses, weg war seine Beherrschung, verschwunden seine Maske, nur noch ein pures Gemetzel an Emotionen auf seinem zerfurchten Gesicht. Seine Augen sprühten, sein Blick schwarz wie die Nacht, der Mund bis zur Unkenntlichkeit verzogen.
„Du willst wissen, warum ich hier bin, warum ich wirklich gekommen bin? Keine Frage ist leichter zu beatworten als diese, dachte ich doch jeden einzelnen Tag darüber nach, seit ich gegangen bin.“
Er trat einen raschen Schritt auf mich zu, bremste sich dann, die Fäuste geballt.
„Ich kam, um dem Licht meines Lebens zu sagen, dass ich noch auf dieser Welt bin. Ich kam, um dich zu holen. Ich kam, weil ich an die Liebe glaubte, die du mir versichert hast. Stattdessen muss ich sehen, dass das Licht, das ich für die Sonne hielt, nur eine billige Birne ist, deren Schalter von anderen bedient wird.“
Sein brennender Blick richtete sich auf meinen Bauch und mir wurde schlagartig klar, was hier vorging, worauf er hinauswollte, was ihn umtrieb, ihn so verletzte. War das sein verdammter Ernst? Mit weit aufgerissenen Augen starrte ich ihn an, konnte mich des ungläubigen Glucksens nicht erwehren, welches in meiner Kehle wuchs, immer größer wurde, bis es schließlich mit der Gewalt eines Sturmes aus meinem Mund brach. Schallend lachte ich auf, konnte die ganze absurde Situation nicht länger mit gestandener Neutralität betrachten. Tränen liefen über meine Wangen, während ich immer heftiger lachte, bis mir Seiten stachen und meine Lunge krampfte.
Daniel stand nur da und betrachtete mich, während ich langsam wieder zu Atem kam, seine Wut war Fassungslosigkeit gewichen.
„Das bin ich für dich, ein Scherz? Gott, du widerst mich an.“ Seine Stimme war kaum mehr als ein Hauch, schwer zu verstehen unter meinem heftigen Atem. Mit seltsam gebeugten Schultern wandte er sich wieder zur Tür, erneut schaffte ich es, ihn mit wenigen Worten zum Stehen zu bringen.
„Es ist deins.“
Kapitel 2
⊰ ❉ ⊱
Da stand er nun, unter dem Türbogen, wie versteinert. Kein Muskel rührte sich in seiner großen, hageren Erscheinung. Seine Anspannung war deutlich spürbar, strahlte bis zu mir, die ich mehrere Meter entfernt stand.
Ob er im Gegenzug das laute Klopfen meines Herzens vernahm, das mir bis zum Halse schlug, mich beinahe taub machte?
Mit einem Mal stieß er die angehaltene Luft aus und drehte sich schwungvoll zu mir um.
„Was hast du gesagt?“ Seine eisblauen Augen hatten etwas von ihrer strahlenden Kälte verloren. Der zarte Schimmer unschuldiger Hoffnung brachte die Eisblumen seiner Distanz zum Schmelzen.
Wenn diese Wärme doch nur im selben Maß mich erreichen konnte, den Schmerz lindern könnte ...
Ich legte eine Hand auf meinen Bauch und sah ihn fest an, legte die selbe Standhaftigkeit auch in meine Worte.
„Das hier, es ist dein Kind.“ Schwer schluckend schüttelte ich leicht den Kopf. Dahin war die Fassung.
„Wie konntest du auch nur einen Moment annehmen, ich hätte nach deinem … Verschwinden, deinem Tod … nichts Besseres zu tun gehabt, als zu Stefan ins Bett zu steigen und mir ein Kind machen zu lassen?“ Ich biss mir auf die Lippe, als sie zu zittern beginnen wollte, um Fassung bemüht, während in mir Fassungslosigkeit mit Wut rang.
„Das ist es, was du von mir denkst? Dass du mir so wenig bedeutest? Ich bin durch die Hölle gegangen, Daniel. Tue es immer noch, jeden Tag aufs Neue, lasse ein Leben über mich ergehen, dass ich meinem schlimmsten Feind nicht wünsche, ertrage es stumm. Und du kommst her und bezichtigst mich etwas Derartigem? Ich kann nicht glauben …“
Mit einigen schnellen Schritten überwand er den Abstand zwischen uns und riss mich an seine Brust, schlang seine Arme so fest um mich, dass ich kaum noch Luft bekam. Seine Nase war in meinem Haar vergraben, gedämpft meinte ich ein Schluchzen zu vernehmen, ein dumpfes Echo meines eigenen Schmerzes, den ich so lange unterdrückt hatte.
Meine überwältigende Trauer stand im ständigen Wechselspiel zu meinem stummen Zweifel, ob ich diesen Moment, ihn, wirklich genießen konnte. Nagende Furcht nahm mich angesichts seiner einnehmenden Nähe, seiner Wärme, meine Verwirrung immer wieder in Besitz, wie konnte er hier sein, hier vor mir stehen, mich im Arm halten, wie nur?
Er ließ für einen Moment von mir ab, nahm mein Gesicht in seine Hände, sah mich mit bebenden Lippen an. Die blauen Augen schwammen in Tränen, vereinzelte Bahnen der salzigen Flüssigkeit waren auf seinen eingefallenen Wangen ersichtlich.
„Daniel, wie …“ Wieder unterbrach er mich, diesmal mit seinen Lippen auf meinen, stürmisch, wenig liebevoll, nahm er meinen Mund gefangen. Ich schmeckte seinen Hunger auf meiner Zunge, schmeckte das Salz seiner Trauer, seiner Freude. Die Finger, die mein Gesicht streichelten, zitterten unentwegt. Ich konnte sein Herz in seiner Brust schlagen hören, dumpfe Trommeln des Lebens, der Freude.
Das schönste Geräusch der ganzen weiten Welt.
Schwer atmend legte er seine Stirn an meine, pfeifend entwich die Luft immer wieder seinen Lungen, strich über mein Gesicht, mischte sich mit meinem eigenen Atem. Ich kam nicht umhin die Augen zu schließen — wie sehr hatte ich seinen Geruch vermisst … das Gefühl seiner Haut unter meinen suchenden Fingern, die leise Ahnung von Zukunft, wenn ich in seine Augen sah. Er trat einen Schritt zurück, sein Blick wanderte zu meiner Körpermitte.
„Es ist meins?“ Seine Stimme klang so zögerlich, so gebrochen und dünn, wie ich ihn nie zuvor gehört hatte. Stumm nickte ich. Als er sich nicht rührte griff ich nach seiner schlaffen Hand und legte sie vorsichtig auf meinen Bauch. Langsam, als fürchte er sich davor, strich er darüber. Seine sanfte Berührung brannte auf mir, bekämpfte die bohrenden Zweifel.
Wieder erinnerte ich mich daran, dass wir nie über eine Zukunft geredet hatten. Nie über Kinder, eine Familie. Was, wenn das hier nicht das war, was er sich wünschte? Wenn ein Baby mit mir genau das Gegenteil von dem war, was er vom Leben erwartete?
Er zerschlug meine unausgesprochenen Gedanken und ging vor mir auf die Knie. Mit einer Zärtlichkeit die ihresgleichen suchte umfing er meinen Bauch, bevor er seine Lippen darauf drückte.
Ich schlug mir die Hand vor dem Mund um mein Schluchzen zu dämpfen. Das war zu viel, zu viel Gefühl, zu viel, das zeitgleich empfunden werden wollte und um die Vorherrschaft kämpfte. Mein Sichtfeld begann sich schwarz zu färben, mehr und mehr Sterne tanzten vor meinen Augen.
Er fing mich, als ich fiel. Mit Leichtigkeit nahm er mich auf seine Arme und trug mich ins Wohnzimmer, legte mich vorsichtig, als wäre ich aus Glas, auf das Sofa, strich mir die Haare aus der klamm verschwitzten Stirn, hielt meine kalten Hände zwischen seinen warmen, hauchte tausend Küsse auf meinen Körper.
„Ist in Ordnung, mein Mädchen, ich bin da. Ich bin hier, June, ich bin hier bei euch. Alles wird gut.“
Alles wird gut.
Oh, wenn ich ihm nur glauben könnte …
Wie in Trance lag ich da und starrte an die Decke über mir, wie gelähmt, meine Lippen bewegten sich unentwegt, doch kein Wort wollte über meine Zunge rollen, stumm ließ ich seine Berührungen, die Berührungen eines Toten, der nicht tot war, über mich ergehen. Meine Gedanken wirbelten ununterbrochen, ich konnte nicht erfassen, nicht verstehen, was hier gerade geschah — träumte ich?
Sowie meine Hand wieder auf meine Befehle reagierte tastete ich nach Daniel, fand seinen weichen Schopf an mich gedrückt. Ich streichelte sein halblanges Haar, fühlte die Wärme der Haut darunter. Nein, das war kein Traum, er war hier, wahrhaftig hier, wie auch immer das möglich war.
„Daniel … was ist mit dir geschehen?“ Brüchig kamen die Worte über meine Lippen, hinterließen ein eigenartig kratziges Gefühl auf meiner Zunge, das sich einfach nicht hinunterschlucken ließ.
Ich schloss die Augen, kniff sie fest zusammen.
Wie kannst du leben, wenn ich dich trauernd zu Grabe getragen habe?
Er schluckte hörbar, zögerte seine Antwort hinaus. Als ich schon dachte, er würde mir eine Erwiderung, eine Erklärung verweigern, drangen endlich Laute an meine Ohren, hastig zwischen zusammen gebissenen Zähnen hervorgestoßen.
„Das ist nicht wichtig, nicht jetzt. Ich bin hier June. Ich bin bei dir, bei euch, und das ist alles was zählt.“ Ich fand die Kraft mich halb aufzurichten und seine hagere Gestalt zu mustern.
„Nein, du verstehst nicht. Es ist von ungeheurer Wichtigkeit, für mich zumindest. Als ich hörte, dass du umgekommen wärst, Daniel, ich …“
Ich musste abbrechen, wieder wurde mir grau vor Augen. Ich ließ mich zurücksinken, atmete gepresst aus. Zögerte einen Moment, die düstere Wahrheit auszusprechen, doch wir lebten eine düstere Realität, was machte da ein wenig mehr Dunkelheit schon aus.
Wer ein Leben in den Schatten führte, den durfte die Finsternis nicht schrecken, vielmehr fürchtete ich das Licht ... ich schloss meine flatternden Augenlider um in die sanfte Schwärze dahinter zu fliehen.
„Ich wollte nicht mehr leben. Wäre er nicht bereits da gewesen, dann wäre ich nun nicht mehr hier — und wofür? Dafür, dass du nun doch lebst? Herrgott Daniel, es hätte nicht viel gefehlt, und ich hätte mich umgebracht. Und du bist hier. Es gab also nie einen triftigen Grund dafür zu gehen. Also sag mir nicht, dass es nicht wichtig ist …“
Wütend wischte ich die Tränen weg, die nun wieder über meine Wangen strömten, meine geschlossenen Lider ignorierend quollen sie hervor, verfluchte Schwäche, für sie gab es keinen Platz hier, ich musste stark sein, stärker denn je.
„Keiner Menschenseele wünsche ich, was ich in den letzten Wochen durchmachen musste. Schwanger von dir und meinem psychopathischen Mann ausgeliefert, was denkst du dir? Es ist nicht wichtig, verdammte Scheiße, und wie wichtig das ist!“
Ich öffnete schwer atmend die Augen um ihn anzustarren, zu sehen, wie sein Körper auf meine Wahrheit reagierte.
Er schluckte, sah auf seine Hände, die er in seinem Schoß grob knetete.
„Ich lag also gar nicht so falsch, was? Stefan weiß, dass du schwanger bist und dennoch bist du noch hier, an seiner Seite, als seine Frau, nicht verstoßen. Das kann nur eines bedeuten.“ Sein Blick schnitt tief in meine Seele.
„Er denkt, dass es sein Kind ist. Und das wiederum bedeutet, dass er und du ... dass du ... “
Ich hielt dem gequälten, fast vorwurfsvollen Blick seiner Augen stand, beantwortete sie mit meinem eigenen Schmerz, denn von diesem gab es mehr als genug.
Nein, dafür kann er mir keinen Vorwurf machen, nicht dafür ...
„Ich war alleine, Daniel. Du warst nicht da. Ich tat, was ich tun musste, um zu überleben, nicht für mich, sondern für das, was du und ich leichtsinnig verbockt haben.“ Meine Augen wurden schmal, als ich meine Worte eindringlich wiederholte.
„Ich war alleine. Du warst nicht da.“
Erregt fuhr er sich mit der einen Hand durch die Haare, die andere fuhr an seine Kehle, als wäre sie ihm zu eng, als behindere sie ihn beim Atmen.
Oh, ich kannte dieses Gefühl gut, das Gefühl zu ersticken, obwohl die Lungen beinahe barsten vor Sauerstoff. Das einengende Gefühl, wenn sich alles zusammenschnürte, taub wurde, die Ohren dröhnend den heftigen Herzschlag wiedergaben, sich alles nach Sterben anfühlte, obwohl man lebendiger kaum sein konnte …
„Verzeih mir, dass ich zu beschäftigt damit war, nicht wirklich zu sterben! Verzeih mir, dass ich dachte, ich hätte eine Situation unter Kontrolle, die niemals wirklich in meiner Entscheidungsgewalt lag! Verzeih, dass ich an einen kleinen guten Teil in Stefan glaubte, dass ich, geblendet von meiner Gutmütigkeit, beinahe sehenden Auges in meinen Untergang gerannt wäre! Verzeih mir, dass ich dich je angesprochen, dich je geküsst habe — verzeih, dass ich nicht schon gestorben bin, bevor wir uns kennen lernten, damit wäre dir mit Sicherheit viel Kummer erspart geblieben!“
War das sein verdammter Ernst?
Ich zischte halblaut und funkelte ihn zornig an, nicht gewillt, ihn dabei zu beobachten, wie er sich in Selbstmitleid suhlte.
„Oh ja, mach es dir leicht, wiege dich in der Rolle des Opfers, suhle dich in deiner Unschuld, als wäre die ganze Welt dein Feind und du allein müsstest dich allen Widrigkeiten stellen! Wem nutzt deine passive Aggressivität? Ich bin nicht dein Feind, Daniel!“
Schwer atmend starrten wir uns an, wütend, hasserfüllt, voll stummen Zorn und Unverständnis, blinder Anschuldigungen, gebrandmarkt und getrieben von den Entbehrungen der letzten Wochen. Ich leckte mir über die trockenen Lippen und senkte den Blick, gab der Wut Zeit um abzuklingen, um Neutralität und Verständnis Platz zu machen.
„Bist du fertig? Können wir nun reden? Richtig reden, über alles, was wir nicht voneinander wissen? Oder verschwenden wir unsere wenige, wertvolle Zeit für Hass und Vorwürfe?“ Er atmete tief durch, kniff sich in die Nasenwurzel, eine steile Falte zwischen den Augenbrauen.
„Ich weiß nicht June. Ich kann nicht hier sein, es erdrückt mich. Ich kann hier nicht frei reden, nicht in seinem Haus, nicht über das, was passiert ist.“
Ich griff nach seiner fahrig durch die Luft schlagenden Hand und umschlang seine Finger, richtete mich mit ihrer Hilfe auf.
„Dann lass uns woanders hingehen. Lass uns an einen Ort gehen, der niemandem gehört.“
Kapitel 3
⊰ ❉ ⊱
Er ging neben mir her, hielt meine Hand dabei fest umklammert, als fürchte er, sie gleich wieder auf unbestimmte Zeit loslassen zu müssen. Ein Gedanke, den ich gut verstand, nachvollziehen konnte, denn auch in mir herrschte noch immer Unglauben über all das, was sich an diesem Morgen zutrug.
Eine kalte Hand aus Eis hielt auch mein Herz immer noch in fester Umklammerung, warnte mich wortlos davor, mich zu sehr in dem Gefühl der Erleichterung, der fassungslosen Freude zu verlieren, gemahnte mich zur Vorsicht, zum Schutz vor mir selbst.
Ich war blind für den Weg, den er mich durch den großen Garten hinter dem Haus führte, meine Augen waren vielmehr ohne Unterlass auf ihn gerichtet, als wollte ich den Moment nicht verpassen, an welchem er sich vor meinen Augen auflösen, wieder verschwinden würde, mich zurück in Einsamkeit und Schmerz stoßen würde.
Die Wärme seiner Hand in meiner änderte nichts an dieser Furcht. Meine Sinne hatten mich schon oft betrogen und meine Wahrnehmung getäuscht, hatten mich Dinge sehen und fühlen lassen, die nicht wirklich da waren ...
„Er weiß nicht, dass es diesen Pfad gibt. Ich habe ihn beim Kauf des Grundstückes vor all den Jahren entdeckt und ihm nie davon berichtet. Als sein Bodyguard, sein Sicherheitsbeauftragter wäre dies zwar meine Pflicht gewesen – aber irgendwas in mir hat wohl gespürt, dass ich eines Tages froh um eine Möglichkeit der stillen Flucht sein würde ...“ Seine leise Stimme verklang, kurz ließ er meine Hand los, um einige Zweige beiseite zu halten, auf dass ich mich einfacher durch das Unterholz zwängen konnte.
Ein kurzer Kampf mit den Ästen einer jungen Tanne und ich stand im Freien. Das dichte Buschwerk verbarg ein Loch im Zaun, welches das Grundstück ansonsten zur Gänze umgab. Ich kräuselte die Lippen, wie schön wäre es gewesen, früher von diesem Ausweg gewusst zu haben.
Andererseits, was hätte es genutzt? Fliehen hätte ich ja doch nicht können, an keinen Ort, an welchem Stefan mich nicht schnell wiedergefunden hätte. Es war also einerlei – das Wissen darum würde mir dennoch ab jetzt die Gefangenschaft leichter gestalten.
Eine kleine Wiese lag vor uns, wenige Meter weiter grenzte ein Wald an. Ein Wildwechsel führte durch eine lichte Stelle im Gebüsch, gesäumt von mehreren alten, mit Moos überwucherten Baumstümpfen. Ohne auf Daniels Weisung zu achten tat ich einige Schritte, überquerte das Feld und ließ mich auf einem der weichen Sitzgelegenheiten nieder, verdrängte jeden Gedanken an das Krabbelgetier, dessen Zuhause ich gerade möglicherweise plättete.
Meine Augen suchten Daniel.
Er stand noch dort, wo wir das Grundstück verlassen hatten, verloren, die Hände in die Hosentaschen gesteckt, den brennenden Blick auf mich gerichtet. So unglaublich nah, näher, als ich ihm jemals hoffte wieder zu kommen und doch so unendlich weit entfernt ... Er sah so verhärmt aus, sein ganzes Erscheinungsbild zeugte von einer schlimmen Zeit, von Krankheit und Schmerz, von wenig Schlaf, noch weniger Essen, von einem Leben auf der Flucht. Doch vor was genau floh er? Oder besser noch, vor wem? Was hatte ihn nur so verwundet? Ich schluckte.
Langsam kam er mir entgegen. Sein Blick löste sich von mir, fixierte den Boden, bevor er sich dumpf aufstöhnend auf den nächsten Baumüberrest setzte.
Eine Weile schwiegen wir uns an. Keiner schien beginnen zu wollen ... vielleicht fehlte uns beiden der Mut. Vielleicht fehlte der Anfang – wo knüpft man an ein Leben an, das Lichtjahre entfernt, wie ein verschwommener Traum erschien? Ich rutschte nervös hin und her, brach schließlich das unangenehme Schweigen als Erste.
„Hier sind wir also. Wie du wolltest, außerhalb des Hauses. Also bitte, erzähl. Wo warst du, Daniel? Was ist passiert?“
Er antwortete nicht gleich, misshandelte stumm seine Hände in seinem Schoß, während sein Blick den Horizont suchte. Schwer schluckte er, seine Stirn runzelte sich tief, ließ die Schatten unter seinen Augen noch dunkler erscheinen.
„Was mir passiert ist ... June, das ist eine lange, unschöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich sie in einem so kleinen Zeitrahmen erzählen kann, denn du musst alle Fakten dazu kennen um das gesamte Ausmaß zu verstehen. Vielleicht reicht es für den Moment, dass ich lebe. Du allerdings solltest wissen, dass Stef ... dass dein Mann“, er spuckte mir das Wort geradezu vor die Füße, „noch durchtriebener ist, als ich es je angenommen hätte. Er ist ... er war mein bester Freund und ich glaubte ihn besser zu kennen, als jeder andere Mensch auf dieser Welt.“
Leise schnaubte er und schüttelte mit einem Ausdruck tiefer Verzweiflung den Kopf.
„Mein Gott, wie falsch ich doch lag. Rückblickend betrachtet hätte ich kaum naiver sein können.“
Mein Herz schlug mir bis zum Hals, ich fasste mir an die Kehle.
„Trägt er die Schuld an dem, was dir passiert ist? Daniel, hat er das zu verantworten? Du musst es mir sagen!“ In mir glomm der Wunsch auf ihn zu schütteln, bis er mir zufriedenstellende Antworten gab. Was sollte dieses verrückte Versteckspiel?
Er schüttelte wieder den Kopf. „Nicht jetzt June. Ich werde dir alles erzählen was ich weiß, aber nicht jetzt. Ich möchte, dass du mir vertraust, wie du es immer getan hast. Ich verspreche, ich schwöre dir, dass ich dich sofort wegbringen würde, wenn ich glaubte, dass du bei ihm nicht in Sicherheit wärst. Für den Moment muss dir das genügen, denn ich muss noch einiges organisieren um tun zu können, was ich plane ...“
Ich hieb wütend mit der Faust durch die Luft.
„Herrgott, kannst du aufhören, so kryptisch vor dich hin zu stammeln?! Daniel ich brauche Antworten! Ich brauche die Wahrheit. Ich, wir, verdienen die Wahrheit, nach allem, was wir die letzten Wochen durchleben mussten!“
Nun endlich richteten sich die schönen blauen Augen wieder auf mich, wurden schmal dabei.
„Zu gegebener Zeit werde ich alles auflösen. Sei versichert, dass nicht du ... ihr ... allein eine schwere Zeit hinter euch habt. Und denkst du nicht, dass auch ich die Wahrheit verdiene angesichts der Situation, zu der ich zurückkehre?“ Seine auslandende Handbewegung schloss mich und das Haus ein.
Mir war klar, auf was er hinauswollte, doch hatte das in seinen Augen wirklich die größere Dringlichkeit? Wollte er wirklich jetzt seine Wunden lecken, seinen verletzten Stolz pflegen? Mich in die Peinlichkeit bringen, zu erklären?
Ausdruckslos starrte ich ihn an, verengte die Augen.
„Du willst die Wahrheit? Nun gut, du kannst sie haben. Hoffentlich erleuchtet dir die billige Birne die Dunkelheit deiner Unwissenheit. Wir haben nicht verhütet, nicht einen Gedanken daran verschwendet, verantwortungsvoll zu handeln. Das Zeugnis davon wächst seit vier Monaten unter meinem Herz. Und deine Kombinationsfähigkeit ist beeindruckend, angesichts deines offensichtlich schlechten Zustandes.“
Mein Sarkasmus war beißend, das war mir bewusst, und doch ließ er sich nicht zurückhalten. Ich konnte nicht verhindern, dass meine Stimme scharf, anklagend wurde, als lastete ich ihm an, zu was ich gezwungen gewesen war, ganz ungeachtet der Tatsache, dass es mir in dem Moment, als es geschah, nicht gänzlich unrecht gewesen war.
Er machte nicht einmal den Versuch aufzubegehren, in sich zusammengesunken lauschte er meinen Worten, verbrannte das Gras zu seinen Füßen mit seinen Blicken.
„Ich habe mit Stefan geschlafen, hab mich von ihm ficken lassen, um das Baby, mich, und letztlich damit auch dich vor ihm und seiner Wut zu beschützen. Ist es das, was du so verzweifelt hören möchtest, die Wahrheit? Ich habe einen Vertrag unterschrieben, du erinnerst dich? Du weißt, wie Stefan sein kann unter all seinem zuckersüßen Gesäusel, unter der ganzen schönen, ernsthaften Fassade. Du hast hinter die Maske gesehen, kennst ihn seit Jahren.“
Ich atmete schwer, musste zu Boden schauen und mein wild schlagendes Herz beruhigen, um nicht laut zu werden, ihn nicht anzuschreien.
„Er hat meinen Kater getötet. Er hat das unschuldige Wesen vor meinen Augen erstochen, weil ich Jordan die Wahrheit gesagt habe. Und er hat damit gedroht, nächstes Mal eine nahestehende Person umzubringen, wenn ich mich ihm noch einmal widersetze.“
Meine Augen brannten, doch ich blinzelte die lästigen Tränen weg. Daniels Teilnahmslosigkeit machte mich unendlich wütend.
„Was genau hätte ich tun sollen, Daniel? Mich ihm alleine stellen? Du warst verdammt noch mal nicht da, du erinnerst dich? Hätte ich alleine zu ihm gehen, ihm beichten sollen, dass ich seinen besten Freund gevögelt habe und ein Kind von ihm erwarte, dass ich dich darüber hinaus liebe, am besten direkt mit ihm Schluss machen, die Scheidung verlangen? Was genau hättest du erwartet?“
Noch immer sah er mir nicht ins Gesicht, betrachtete tief in Gedanken versunken seine Hände. Stumm raufte ich mir das Haar, drehte mich halb von ihm weg, sein Anblick machte mich mit einem Mal krank. Ich würde mir hier nicht die Schuld zuweisen lassen.
Ich hatte getan, was ich für notwendig erachtet hatte, um zu überleben. Wofür genau verteidigte ich mich so sehr? Warum war es mir so wichtig, die Schuld möglichst weit weg von mir zu schieben, am besten in fremde Schuhe?
Weil du es genossen hast.
Ich schluckte schwer.
Weil du es gar nicht so furchtbar fandest, dich Stefan hinzugeben. Weil du wieder begonnen hast, an ihn, an euch zu glauben. Weil du Daniel vergessen wolltest für einige wenige Momente der Lust.
Gern hätte ich diese innere Stimme zum Schweigen gebracht, die diesen Gedanken nicht zum ersten Mal geäußert hatte. Doch wie konnte ich, wenn sie Recht hatte?
Ich fühle mich unendlich schuldig dafür, den Sex mit Stefan auf die Weise wahrgenommen zu haben, wie es letztendlich geschehen war. Es war irgendwann mittendrinn kein Akt der Aufopferung mehr gewesen – irgendwann hatte es begonnen, mir zu gefallen.
Irgendwann in den Wochen von Daniels Abwesenheit, vor dem Vorfall mit Luzifer, war es mir nicht mehr schwergefallen, mir eine Zukunft mit Stefan auszumalen. Er hatte sich solche Mühe gegeben ...
Und das Wissen um diese Wahrheit brannte ein Loch in mich.
Aber hatte ich denn nicht den Hauch von Glück verdient? Eine Chance auf eine Zukunft? Konnte ich mich für mein stilles Hoffen wirklich so sehr verachten?
Konnte er das, durfte er das?
Nein. Nein, er musste mich verstehen. Es musste ihm klar sein, dass es keinen anderen Weg gegeben hatte ...
Meine Hände strichen über meinen Bauch, versuchten Kraft aus dem kleinen Wunder darin zu ziehen. Ich konnte die Vergangenheit nicht mehr ändern, es war geschehen. Ich konnte nur den Kopf heben und dazu stehen.
„Du hättest warten sollen“, erklang seine tonlose Stimme. Er starrte auf den Boden, schüttelte den Kopf, wieder und wieder. „Du hättest auf mich warten sollen, June. Niemals hättest du zu ihm gehen dürfen ...“
Nun hob er doch den Kopf, seine Augen umwölkt, die Lippen nur ein schmaler, farbloser Strich. Sein Blick schnitt durch mich hindurch, verletzte mich mehr, als jede laute, wütende Anklage es gekonnt hätte.
„Du hättest warten sollen ...“
Ein tonloses Ächzen drang über meine Lippen. Sein Unverständnis traf mich mit der Wucht einer Abrissbirne, ließ mich auf meinem Sitz taumeln.
„Das ist alles, was du zu sagen hast?“ Meine Lippen bebten. Er antwortete nicht, starrte blicklos vor sich hin, als wäre alles gesagt.
Ohne ein weiteres Wort erhob ich mich steif und ging.
Er blieb stumm sitzen, machte keine Anstalten mir zu folgen – eine Tatsache, die ich unglaublich willkommen hieß.
♔♕♖♗♘♙
Ich zwang mich in Bewegung zu bleiben, rastlos, keinen Moment zu viel zum Nachdenken zu kommen. Ziellos wanderte ich durch das Haus, durchstreifte alle Zimmer ohne zu wissen, was ich eigentlich suchte. Vielleicht den Sinn des Lebens? Langsam würde mich der rote Faden hinter dieser seltsamen Tragödie meines Lebens brennend interessieren.
Daniel war mir nicht nachgekommen, er wusste vermutlich, dass es ab einer gewissen Uhrzeit nicht unwahrscheinlich war Marita über den Weg zu laufen. Und seine Anwesenheit hatte er nicht einmal mir erläutert, wieso sollte er der Haushaltshilfe erklären, warum er verdammt noch mal nicht tot war?
Ich kam nicht umhin immer wieder ungläubig den Kopf zu schütteln, während unsere Konversation auf meinem Rundgang durch das obere Stockwerk wieder und wieder durch mein oberes Stockwerk kursierte, sich wieder und wieder darin abspielte, mein ganz persönliches Kopfkino ... nahm er mir tatsächlich übel, was ich getan hatte? Gab es angesichts der letzten Wochen nichts Wichtigeres?
In einem Anflug von Wut biss ich die Zähne aufeinander und runzelte die Stirn. Mir fehlten tatsächlich die Worte. Meine unsägliche Freude darüber, dass der Mann, den ich liebte doch noch auf dieser Welt wandelte wurde beinahe zur Gänze überschattet von meinem Hass auf sein Gebärden, seit er über die Schwelle dieses Hauses getreten war.
Er erklärte nicht, was geschehen war, ließ die wage Vermutung im Raum stehen, dass Stefan etwas damit zu tun hatte und war ansonsten beschäftigt damit, mich zu verachten?
Mir die Schuld zuzuweisen, mein schlechtes Gewissen zu füttern bis es sich über mein gesamtes Inneres erstreckte, nachdem ich so schwer darum gekämpft hatte, mir selbst zu verzeihen, ein wenig Selbstliebe und Verständnis für mich aufzubringen?
Einem Orkan gleich trat er auf den Plan und fegte mein kleines Kartenhaus hinfort ... das hatte er schon immer gut gekonnt, alles davontragen, was ich zu wissen glaubte ...
Wütend trat ich gegen den Türrahmen, unter welchem ich sinnierend stehen geblieben war, eine irrationale Reaktion auf das Gefühlschaos in meinem Inneren, ein verzweifelter Versuch, das viel zu gewaltige Gefühlsgewitter in meinem Inneren zu entladen.
Und sofort mischte sich Schmerz zu dem ohnehin schon viel zu überlaufenen Emotionscocktail. Stöhnend hob ich mein Bein und umklammerte meinen Zeh, der mir meinen Jähzorn äußerst übelnahm.
„Verflucht“, knurrte ich mit zusammengebissenen Zähnen in mich hinein. Das tat gut. Schmerz verbalisieren. Ich versuchte es direkt noch einmal. „Verdammte Scheiße“, brüllte ich, während ich mich gegen das dunkle Holz sinken ließ. So ein verfluchter Mist, all das hier. Musste ich mir das wirklich geben? Waren die letzten Wochen nicht schwer genug gewesen?
Wann, verfickte Scheiße, würde es endlich leichter werden?
„June?“, wehte da Stefans Stimme zu mir nach oben, fragend. Ich runzelte die Stirn – wie viel Zeit war auf meinem nutzlosen Rundgang durch das Haus vergangen?
„June, ist alles in Ordnung?“ Mit schief gelegtem Kopf kam Stefan die Treppe nach oben und musterte mich, wie ich mit schmerzerfülltem Gesicht schwer atmend neben der Tür zu seinem – mittlerweile unserem – Schlafzimmer stand.
„Ja, alles perfekt“, brummte ich unwirsch. „Was machst du schon hier? Gibt es keinen Unglücksvogel, der sich beim Geldverschieben hat erwischen lassen und deine Unterstützung braucht?“ Er seufzte lautlos angesichts meines abwehrenden Tones und rieb sich die Stirn.
„Es ist zwei Uhr nachmittags, ich habe etwas früher Schluss gemacht heute. Es war mir ja nicht bewusst, dass du vollkommen eingenommen wirst hier. Vertreibst du dir damit meine Abwesenheit? Mit Kämpfen gegen unser Inventar?“
Sein beißender Sarkasmus war nervtötend. Mit einem finsteren Blick funkelte ich ihn an. „Irgendetwas muss ich mit mir ja anfangen. Und die letzte Zeit hat gezeigt, dass selbst Hartholz wie dieses nachgiebiger ist als mein Ehemann.“
Er musterte mich verblüfft, mit großen Augen, ehe er breit grinste und sich durch das Haar fuhr.
„Schön daheim zu sein, June. Du hast mir gefehlt. Das hier hat mir gefehlt.“ Er trat einen Schritt näher und küsste mich auf die Stirn, bevor er nach meiner Hand griff. „Komm. Wie ich dich kenne, hast du noch nichts zu Mittag gegessen und Marita hat etwas vorbereitet. Leistest du mir Gesellschaft?“
Ich folgte ihm wortlos, was sollte ich auch sonst mit mir anfangen?
♔♕♖♗♘♙
„Du begleitest mich heute Abend.“ Stefans grüne Augen lagen auf mir, ohne eine Miene zu verziehen führte er seine volle Gabel zum Mund und aß weiter. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es eine Aussage gewesen war, eine Feststellung, die keinerlei Reaktion bedurfte, oder ob er auf eine Antwort wartete. Ich räusperte mich.
„Ich begleite dich, in Ordnung. Und wohin genau gehen wir?“ Er kaute bedächtig, betrachtete mich ganz genau. Zu gerne hätte ich gewusst, wonach er suchte. Welches Indiz er zu entdecken hoffte. Ob er wusste, auch nur im Entferntesten einen Gedanken daran verschwendete, dass Daniel ... Ich schüttelte innerlich den Kopf.
Natürlich nicht, woher denn auch.
Er hatte immerhin seinen Tod bestätigt, hatte ihn betrauert, ebenso wie ich. Nun betrachtete ich meinerseits sein Gesicht aufmerksam, suchte für mich nach einer Schwachstelle in der makellosen Fassade. Konnte dieser Mann tatsächlich etwas mit Daniels Verschwinden zu tun haben? War er sich deshalb so sicher, dass sein bester Freund nicht zurückkehren konnte?
Es gab keine Schwachstelle. Keine Bruchlinie. Keinen Konstruktionsfehler in dieser hohen Mauer, die er um sich errichtet hatte. Und selbst wenn – er war gut genug um etwaige Makel zu übertünchen.
Seine melodische Stimme holte mich aus meinen Überlegungen ins Hier und Jetzt zurück. „Nicht, dass es von großer Wichtigkeit ist dich im Vorfeld zu instruieren, aber wir gehen Wulf und seine Frau besuchen. Es ist der erste Mittwoch im Monat, du erinnerst dich?“
Ich verdrehte unwillkürlich die Augen. War es nicht unfassbar, dass er sich immer seiner Machtposition zu versichern versuchte? Zu welchem Zweck – dem guten Gefühl in sich? Ich war hier, immer noch, man sollte meinen, dass dies Beweis genug für seine Macht war.
„Besuchen, ein interessanter Euphemismus für dieses dubiose Zusammenkommen zwielichtiger Geschäftspartner und deren einfältigen Frauen, meinst du nicht auch? Schuldest du ihm wieder einmal Geld oder was ist dieses Mal der Anlass für die Notwendigkeit unserer Anwesenheit?“
Ich legte den Kopf schief, betrachtete ihn bittend.
„Kann ich nicht zuhause bleiben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Anwesenheit von unglaublicher Wichtigkeit ist. Mir ist nicht danach das Haus zu verlassen und die giftige, falsche Atmosphäre einzuatmen, immerhin geht es nicht nur um mich dabei.“ Meine Hand strich bedeutungsschwer über meinen Bauch.
Er folgte meiner Bewegung nicht, sondern ließ seinen harten Blick auf meinem Gesicht liegen. Es fiel mir unendlich schwer unter seinen prüfenden Augen nicht nervös auf meinem Stuhl hin und her zu rutschen.
„Wie du mit Sicherheit festgestellt hast, habe ich keine Frage gestellt, sondern eine Aussage getroffen. Du wirst nicht immer unser Kind vorschieben können, wenn du keinerlei Verlangen verspürst, mich zu begleiten. Als meine Frau ist das nun einmal deine Aufgabe.“
Er seufzte und rieb sich die Augen, als er sie wieder auf mich richtete war sein Blick weich geworden und er lächelte leicht, ein ehrliches, beinahe liebevolles Lächeln.
Ein Lächeln, das mir in der Seele wehtat. Die Erschöpfung, die Müdigkeit, die Abgeschlagenheit, die mir in jeder Zelle saßen, waren so begierig danach, sich endlich einfach fallen zu lassen, sich in seiner Zuneigung zu sonnen.
Doch meine Vorsicht verbot mir das. Meine permanente innere Anspannung rief mich zur Räson. Ihm konnte ich nicht vertrauen, nie wieder, ganz gleich, wie sehr er sich bemühte in ein Raster zu fallen, dass er vor unserer Hochzeit, vor all jenen schrecklichen, unaussprechlichen Dingen an den Tag gelegt hatte.
Obgleich mir bewusst war, dass genau das zu den Grundzügen gehörte, die einen Narzissten ausmachen, verblüffte es mich, wie leicht er an den Mauern um mein Herz, meine Gefühle, meine Gedanken rütteln konnte, um Einlass zu finden. Er schaffte es immer wieder, dass ich versucht war, für einen Moment zu vergessen, wer er war. Wie er war.
Zu was er fähig war, wenn ich nicht auf der Hut war.
„Danke, dass du mich immer wieder daran erinnerst, warum ich dich geheiratet habe“, unterbrach seine leise Stimme meine Gedanken. Er hatte sein Kinn auf einer Faust aufgestützt und betrachtete mich mit einem schelmischen Funkeln in den Augen.
„Ich hatte schon befürchtet, die Schwangerschaft würde deinen ganzen Kampfgeist für sich beanspruchen, schön, dass du immer noch die Kraft hast, mir Widerworte zu geben. Mir fehlen unsere kleinen, spielerhaften Dispute sehr.“
Er schob seinen Teller von sich und stand auf, kam um den Tisch herum. Mit kaum sichtbarer Anstrengung drehte er meinen Stuhl mit mir darauf und kniete sich vor mir hin, das leichte Lächeln auf seinem schönen Gesicht wurde strahlender.
Warum nur fiel es mir so schwer, trotz allem, ihn abstoßend zu finden? Wie nur schaffte er es immer wieder, mich zu seinen Gunsten zu manipulieren? Ich schluckte, zwang mich ihm in die Augen zu sehen und sein Lächeln zu erwidern, während in meinem Kopf immer und immer wieder das gleiche Mantra ablief.
‚Er ist ein Narzisst. Er interessiert sich nicht für dich. Er manipuliert dich, zwingt dich so zu sein, wie er dich gerne hätte. Er ist nicht real.‘
Als höre er meine Gedanken und wäre bestrebt, sie zu widerlegen, griff er nach einer meiner schlaff im Schoß liegenden Hände und hauchte einen Kuss auf den Handrücken, während sein Blick nicht von mir wich.
„Es ist mir sehr wichtig, dass du heute Abend mit mir dort hingehst, in Ordnung? Du bist meine Frau. Und wir erwarten ein Kind – ich würde meinen Freunden, meinen Partnern diese Neuigkeit gerne persönlich überbringen und nicht die mit Sicherheit bald auf den Plan tretenden Klatschblätter vorschicken. Um deine Frage zu beantworten, nein. Ich schulde ihm weder Geld noch habe ich sonst ein Problem mit ihm. Es geht nur um ein Wiedersehen unter Freunden.“