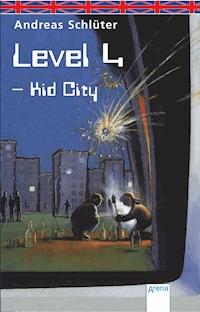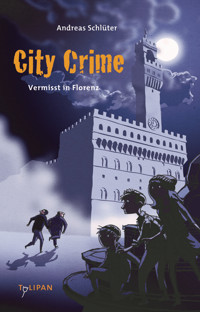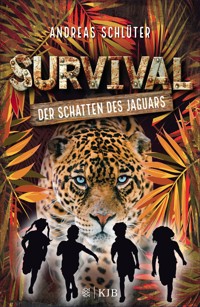
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Survival
- Sprache: Deutsch
Sie haben den Flugzeugabsturz überlebt. Doch jetzt sind sie verloren im Dschungel! Band 2 der neuen Abenteuerserie von Erfolgsautor Andreas Schlüter: actionreich und atemberaubend spannend! Mit vielen coolen Survival-Tipps und -Tricks! Mike, Elly, Matheus und Gabriel stoßen in den Tiefen des Dschungels auf einen Stamm Indios. Die Kinder schöpfen Hoffnung: Vielleicht können sie ihnen helfen, aus dem riesigen Amazonas-Regenwald heraus zu finden? Doch die Ureinwohner scheinen sich von der Zivilisation fernhalten zu wollen. Sollen die vier Freunde bei ihnen bleiben oder sich wieder alleine den Gefahren des Dschungels stellen? Bei Antolin gelistet Alle Bände der Serie: Band 1: Survival – Verloren am Amazonas Band 2: Survival – Der Schatten des Jaguars Band 3: Survival – Im Auge des Alligators Band 4: Survival – Unter Piranhas Band 5: Survival – Im Netz der Spinne Band 6: Survival – Der Schrei des Affen Band 7: Survival – Von Haien umzingelt Band 8: Survival – In den Krallen des Leguans Serie bei Antolin gelistet
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Andreas Schlüter
Survival
Der Schatten des Jaguars
Über dieses Buch
Mike, Elly, Matheus und Gabriel stoßen in den Tiefen des Dschungels auf einen Stamm Indios. Die Einheimischen sind Meister des Überlebens im Regenwald, und die Kinder können viel von ihnen lernen. Doch eines Tages wird die Siedlung von Weißen angegriffen: Es sind Holzfäller, die illegal tropische Bäume abholzen. Sollen die vier Freunde mit den Ureinwohnern noch tiefer in Regenwald fliehen oder sich den Schurken stellen, um möglicherweise nach Hause zu gelangen?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Bevor Andreas Schlüter, geboren 1958, mit dem Schreiben von Kinder- und Jugendbüchern begann, leitete er Kinder- und Jugendgruppen und arbeitete als Journalist und Redakteur. 1994 feierte er mit dem Kinderroman »Level 4 – Die Stadt der Kinder« einen fulminanten Erfolg und ist seitdem als Autor tätig. Andreas Schlüter verfasst zudem Drehbücher, unter anderem für den »Tatort«. Schon als Junge liebte er Abenteuerromane, in denen man die wildesten Sachen erleben kann, ohne nasse Füße oder Kratzer zu bekommen.
Stefani Kampmann, geboren 1971, zeichnete schon als Kind gerne und überall. Während ihres Studiums der Innenarchitektur nahm sie zahlreiche Aufträge als Illustratorin an und verfolgte diesen Weg danach weiter. Sie bebilderte zahlreiche Kinder- und Jugendbücher und veröffentlichte zwei Graphic Novels. Außerdem gibt sie Comic-Workshops für Jugendliche. In ferne Länder ist sie schon einige Male gereist, zum Glück musste sie dort aber (fast) nie ums Überleben kämpfen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden Sie unter www.fischerverlage.de
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Survival-Serie bei FISCHER KJB:
Band 1: Survival – Verloren am Amazonas
Band 2: Survival – Der Schatten des Jaguars
Band 3: Survival – Im Auge des Alligators
Band 4: Survival – Unter Piranhas
Band 5: Survival – Im Netz der Spinne
Band 6: Survival – Der Schrei des Affen
Band 7: Survival – Von Haien umzingelt
Band 8: Survival – In den Krallen des Leguans
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Atelier Seidel Verlagsgrafik
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Covergestaltung: Dahlhaus & Blommel Media Design, Vreden
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-4954-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Was bisher geschah
Der dreizehn Jahre alte Mike fliegt mit seiner jüngeren Schwester Elly nach Manaus, Brasilien. In der Großstadt am Rande des Amazonas-Regenwalds wird die Familie die nächsten Jahre leben, da der Vater dort an einem Bauprojekt arbeitet. Mike und Elly lernen die Söhne eines guten Kollegen und Freundes ihres Vaters kennen. Matheus (14), genannt Matti, und Gabriel (11) sind in Manaus zweisprachig aufgewachsen, sprechen also fließend Deutsch und Portugiesisch. Gemeinsam machen die vier Kinder einen Rundflug über das Amazonas-Gebiet – ein Geschenk der Eltern. Den alten, netten Piloten Luiz kennen die Väter von der Baustelle und haben volles Vertrauen zu ihm. Die Kinder sind begeistert und genießen den Rundflug. Aber dann der Schock: Luiz erleidet plötzlich mitten im Flug einen Herzinfarkt und stirbt. Matti, der einen Segelflugschein hat, versucht verzweifelt, das Flugzeug zu steuern. Aber es gelingt ihm nur gerade so eben, eine katastrophale Bruchlandung zu verhindern, als sie abstürzen.
Alle Kinder landen leicht verletzt, aber bewusstlos am Boden. Als sie aufwachen, finden sie sich mitten im Regenwald wieder. Sie haben nicht die geringste Ahnung, wo sie genau sind und wie man aus dem Wald herausfindet. Da sie nur auf einen kurzen Ausflug eingestellt waren, haben sie kaum Ausrüstung dabei – außer Mikes Überlebensgürtel und seinem Survival-Buch. Beides hatte er mitgenommen, um »Abenteuer« zu spielen. Jetzt könnte es ihnen das Leben retten.
Die vier Kinder müssen sich durch den Dschungel schlagen, in der Hoffnung, irgendwo auf Menschen zu treffen, die ihnen helfen und sie retten.
Nach einigen Tagen begegnen ihnen tatsächlich zwei Männer. Doch sie haben Waffen und nehmen die Kinder gefangen. Es sind Arbeiter der Mafia, die illegal große Teile des Regenwalds abholzen. Weil die Kinder sie entdeckt haben, betrachten die Banditen sie als Gefahr und sperren sie in ihrer Siedlung ein. Durch eine riskante Aktion können die Kinder aber fliehen. Nun sind sie wieder allein im Dschungel. Plötzlich bekommt Elly Fieber und wird krank. Die Kinder hören Stimmen. Werden sie gerade rechtzeitig gerettet? Können sie Elly ins Krankenhaus bringen? Dann spüren sie nur noch, wie sie von kleinen, dünnen Pfeilen getroffen werden. Danach wird ihnen schwarz vor Augen.
Indigene haben die vier gefunden, und der Schamane kümmert sich sofort um die kranke Elly. Die Kinder schöpfen Hoffnung: Haben die Indigenen Kontakt zu Weißen? Wollen und können sie den Kindern helfen und sie aus dem Dschungel führen?
Krankheit
Elly lag mit hohem Fieber in der kleinen Hütte, die sich etwas abseits von der großen Gemeinschaftshütte des Indigenenstammes befand. Mike und seine Freunde Matti und Gabriel hatten zuerst nur aus sicherer Entfernung einen Blick auf sie werfen dürfen. Jetzt aber schien der Schamane zu der Überzeugung gelangt zu sein, dass Elly von keiner ansteckenden Krankheit befallen war. Das vermutete Mike jedenfalls. Vielleicht wusste der Schamane auch nichts von ansteckenden Krankheiten, und es hatte einen ganz anderen Grund, dass er und die beiden Brüder nun endlich zu Elly gehen durften. Ellys Stirn glänzte schweißnass. Ihre Augen starrten irgendwo ins Leere, und sie phantasierte vor sich hin. Erst stöhnte sie nur leise, dann brabbelte sie unverständliche Worte und warf ihren Kopf hin und her, bis sie sich schließlich zu beruhigen und einzuschlafen schien. Doch schon im nächsten Moment riss sie erneut die Augen auf, und das Stöhnen und Brabbeln begann von neuem. Bestürzt betrachtete Mike seine Schwester und wandte seinen Blick ratlos und hilfesuchend zu Matti. Immerhin war dessen Vater Arzt. Vielleicht konnte er diese beängstigenden Symptome besser deuten?
Doch Matti zog die Schultern hoch. Er hatte auch keine Ahnung. »Dass sie phantasiert, muss nicht am Fieber liegen«, versuchte er trotzdem, Mike zu beruhigen, »sondern an den Drogen, die der Schamane ihr verabreicht hat.«
»Drogen?«, schreckte Mike auf. Das wäre ja noch schlimmer als die Krankheit, fand er.
Matti winkte ab. »Na ja, letztlich ist jede Medizin eine Droge. In anderen Dosierungen wären die meisten Medikamente, die wir kennen, pures Gift. ›Risiken und Nebenwirkungen‹. Kennt man doch aus dem deutschen Fernsehen. Der Schamane nutzt bestimmte Pflanzen zur Betäubung oder zur Heilung. Wir können froh sein, dass wir offenbar auf einen Stamm getroffen sind, der noch einen alten Schamanen hat.«
Mike verstand nicht so recht, was Matti ihm damit sagen wollte.
Mattis Bruder Gabriel erläuterte es ihm: »Viele indigene Stämme sind vom Aussterben bedroht. Sie werden immer weniger. Und mit ihnen stirbt das Wissen der alten Stämme. Auch hier siehst du, wie klein der Stamm ist.«
Früher lebten in Brasilien 11 Millionen Menschen in etwa 2000 verschiedenen Völkern. Hundert Jahre nach der ersten Kontaktaufnahme wurden 90 % der indigenen Völker – der Ureinwohner Brasiliens – durch eingeschleppte Krankheiten wie Grippe, Masern oder Pocken ausgerottet. Weitere Zigtausende starben bei der harten Arbeit als Sklaven auf Zuckerrohr- und Kautschukplantagen.
Mit noch 36000 Angehörigen sind die Tikuna das größte Amazonas-Volk Brasiliens, aber viele Amazonas-Völker haben heute längst weniger als 1000 Mitglieder. Die Awá haben zum Beispiel weniger als 500, die Akuntsu sogar nur noch vier (!) Angehörige.
Die Abholzung des Regenwalds, und damit die Vernichtung des Lebensraums der indigenen Völker, schreitet immer schneller voran. Zudem erkennt die brasilianische Regierung den noch verbleibenden Landbesitz der indigenen Völker nicht als deren Eigentum an. Systematisch werden weiterhin Dörfer abgebrannt und die heimatlosen Bewohner vertrieben, gejagt und getötet.
Gabriel zeigte in Richtung Hütteneingang. »Ich schätze mal, fünfzig Leute oder so. Früher waren das sicher mal ein paar hundert. Es kann sein, dass der Schamane der Letzte ist, der was von Heilkunde versteht. Wenn der mal stirbt, ist das Wissen weg. Für immer verloren.«
Mike hörte ihm bedrückt zu.
Matti nickte unterstützend. »Unser Vater hat mal erzählt, es gibt hier am Amazonas einen Indigenenstamm, der besteht nur noch aus einer einzigen Person. Er ist tatsächlich der letzte Verbliebene.«
Es fiel Mike schwer, sich das vorzustellen. »Ein einzelner Mann ist der gesamte Stamm?« Sein Opa hatte einen uralten Abenteuerroman in seinem Bücherbord, erinnerte Mike sich. Der hieß: Der letzte Mohikaner. Hier also war der Titel Wirklichkeit geworden. Der letzte Indigene eines Stammes!
Elly riss ihn aus seinen Gedanken. Sie hob den Kopf, stierte immer noch ins Leere und stöhnte: »Durst!«
Schon ließ sie ihren Kopf wieder zurücksinken, ohne den Blick von dem fernen unsichtbaren Fixpunkt abzuwenden.
»Haben wir etwas zu trinken?«, fragte Mike und schaute sich nach einer Flasche um. Doch er fand keine.
Auch Matti und Gabriel hatten nichts dabei und sahen sich um, allerdings nicht nach einer Flasche, was Mike zunächst gar nicht bemerkte. Erst als Gabriel auf etwas zeigte und rief: »Da!«
Er hob einen Beutel in die Höhe, der – das konnte Mike nicht genau erkennen – vielleicht aus Leder war oder einem Stoff. Vielleicht bestand er aber auch aus Rinde oder Blättern.
Gabriel schüttelte den Beutel, goss ein wenig der Flüssigkeit auf den Boden, hielt den Finger darunter und kostete. »Das ist Wasser!«
»Regenwasser?«, fragte Mike.
»Keine Ahnung!«, antwortete Gabriel. Er verstand, worauf Mike hinauswollte: War das Wasser hygienisch genug, um es zu trinken? Aber sie hatten keine Wahl. »Wenn die Leute hier es trinken, wird es wohl gut sein.«
Am Eingang der kleinen Hütte warteten drei Frauen, die sie beobachteten und wohl jederzeit bereit waren, hereinzukommen und Elly zu helfen, wenn sie Hilfe benötigte.
Gabriel hielt den Wasserbeutel halb in die Höhe und deutete mit fragender Geste darauf. Die drei Frauen nickten ihm zu.
»Bist du sicher, die wissen, was du gefragt hast?«, hakte Mike zweifelnd bei Gabriel nach.
»Nein«, gab Gabriel zu. »Vermutlich verstehen sie unser Problem gar nicht und fragen sich, weshalb man Wasser nicht trinken sollte.«
Die drei Jungs wechselten kurz Blicke, dann beugte sich Gabriel zu Elly hinunter und wollte ihr soeben aus dem Beutel zu trinken geben.
Im selben Augenblick standen zwei der drei Frauen neben ihm. Die eine nahm ihm den Wasserbeutel aus der Hand. Die andere hielt eine Schale, obwohl Mike sich sicher war, dass keine der Frauen zuvor etwas in Händen gehalten hatte. In der Schale waberte eine milchig-weiße, etwas angedickte Flüssigkeit, die die Frau Elly jetzt zum Trinken reichte. Dazu hob sie mit der linken Hand Ellys Kopf ein wenig an und führte ihr mit der rechten die Schale an die Lippen. Wie eine Krankenschwester, schoss es Mike durch den Kopf. Vermutlich hatten die drei Frauen genau diese Funktion.
Elly trank gierig, doch die Frau achtete darauf, ihr die Flüssigkeit nur schlückchenweise zu verabreichen.
»Was ist das für ein Getränk?«, fragte Mike.
Gabriel schaute ihn an. »Woher soll ich das wissen? Weißt du das, Matti?«
»Nein«, antwortete Matti ehrlich. »Aber ich denke, die wissen, was sie tun.«
»Hoffentlich!«, murmelte Mike leise.
Elly hatte das Schälchen beinahe leer getrunken.
Die Frau legte Ellys Kopf sanft zurück auf die Liege. Oder wie immer man das bezeichnen sollte, worauf sie Elly gebettet hatten.
In der großen Gemeinschaftshütte hatte Mike im Vorübergehen eine Menge Hängematten baumeln sehen. Elly aber lag lediglich auf einem flachen, aus Ästen geflochtenen Gestell knapp über dem Boden. Vielleicht befürchteten die Indigenen, sie würde aus einer Hängematte im Schlaf herausfallen?
Die Frau mit der Schale sagte etwas, das Mike nicht verstand. Auch Matti und Gabriel kannten die Sprache nicht. Portugiesisch war es nicht. So viel stand fest.
Die Frau bedeutete ihnen mit einer Geste, die erstaunlicherweise exakt jener entsprach, die vermutlich auch jeder Europäer benutzt hätte, dass Elly müde war und jetzt Schlaf benötigte.
Die drei Jungs warfen Elly besorgte Blicke zu und verließen die kleine, recht dunkle Hütte. Draußen warf die Sonne so helles Licht auf die Lichtung, dass die drei sich schützend ihre Hände vor die Augen halten mussten und ins Tageslicht blinzelten. Erst dann erkannten sie, dass sich eine große Gruppe des indigenen Volkes dort aufgebaut hatte und die drei Jungs schweigend, aber durchaus neugierig musterte. Obwohl Matti und Gabriel gebürtige Brasilianer waren, hatten sie durch ihre deutschen Eltern doch auffallend hellere Haut als die Dorfbewohner. Der Blasseste aber war Mike, der nicht einmal sonnengebräunt war. Mike spürte sofort, dass er Aufsehen erregte. Jetzt sah er auch, dass nur einer der Männer Badeshorts trug. Alle anderen Indigenen hatten lediglich Schnüre um und über ihre Geschlechtsteile gebunden. Doch die Shorts galten Mike als Indiz dafür, dass dieses Volk mindestens schon ein Mal Kontakt zu Stadtmenschen gehabt haben musste. Denn die Hose war garantiert nicht in diesem Dorf hergestellt worden.
Zu Hause in seiner Schulklasse hätte das Bild der nackten Gruppe, das sich ihm bot, vermutlich Gelächter und Gejuchze ausgelöst. Doch hier verschwendete Mike keinen Gedanken an solche Albernheiten. Vielmehr schlussfolgerte er sofort, dass dieses Volk nur sehr selten Kontakt zu Stadtmenschen hatte. Mike wusste nicht, ob das für sie ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war. Das Zweite, was ihm auffiel, war die geringe Größe der Indigenen. Mike war mit seinen dreizehn Jahren in etwa so groß wie die erwachsenen Männer, die ihm gegenüberstanden.
Unschlüssig, wie sie reagieren sollten, schwiegen die drei ebenfalls und warteten ab, was nun geschehen würde. Doch es geschah – zunächst – nichts!
Die Mitglieder des kleinen Stammes blieben einfach so stehen und schauten die Fremden stumm an. Mike kam sich schon vor wie ein Alien, der mitten in einem Wohngebiet gelandet war. Vermutlich war er für dieses kleine Volk auch nichts anderes. In Science-Fiction-Filmen sind es dann meist Kinder, die furchtlos und unbefangen auf die Außerirdischen zugehen. Und gerade, als Mike dieser Gedanke durch den Kopf ging, geschah genau das Gleiche. Aus der Gruppe der Indigenen trat ein Junge hervor, den Mike in etwa auf sein eigenes Alter schätzte, ging auf die Jungs zu, lächelte freundlich und machte eine Geste, die Mike eindeutig als die Frage deutete, ob er Hunger hatte. Denn er führte immer wieder seine Hand zum Mund und tat so, als würde er etwas kauen.
Mike nickte eifrig. Sein Magen hing ihm in den Kniekehlen, und nichts konnte er jetzt besser gebrauchen als eine kräftige Mahlzeit.
Der Junge ging zurück zu den anderen, drehte sich dann wieder zu Mike und seinen Freunden und winkte sie zu sich.
»Ich glaube, wir bekommen etwas zu essen«, sagte Mike leise, aber voller Hoffnung.
»Oh, das wär gut!«, seufzte Gabriel. »Ich hab tierischen Hunger!«
»Glaube ich nicht, dass die uns was zu essen geben«, widersprach Matti.
»Wieso nicht?«, wollte Mike wissen.
»Weiß nicht«, gab Matti zu. »Aber ich glaube, für die Mahlzeiten sind die Frauen zuständig.«
Mike schaute rüber zur Gruppe. In der Tat standen ihnen nur Männer gegenüber, wie ihm erst jetzt auffiel. Erneut winkte der Junge ihnen zu.
»Aber er hat doch eindeutig das Zeichen für Essen gemacht«, behauptete Mike.
»Wir werden sehen!« Matti ging auf den winkenden Jungen zu. Gabriel und Mike folgten unsicher.
Der Junge lächelte immer noch. Und Mike glaubte fast schon, sein Lächeln wäre doch eher ein schelmisches Grinsen und der Junge führte etwas im Schilde. Doch dann lösten sich drei weitere Jugendliche aus der Gruppe und gesellten sich zu ihnen, während die älteren Männer einfach so stehen blieben. Der lachende Junge nickte Mike aufmunternd zu, während ein zweiter ihm ein Blasrohr entgegenhielt.
»Was …?«, setzte Mike zu einer Frage an.
Auch Gabriel und Matti wurden solche Blasrohre angeboten.
»Was soll das?«, brachte Mike nun endlich hervor.
Matti war sich auch noch unsicher. Aber er vermutete: »Wir gehen auf die Jagd.«
»Hä?«, entfuhr es Mike.
»Das hatte er mit seiner Geste gemeint«, erklärte Matti. »Er hat uns nicht zum Essen eingeladen, sondern dazu, Essen zu besorgen! Das ist hier vermutlich Männersache.«
»Ach du Scheiße!«, kommentierte Mike, war jedoch froh, dass ihre Gastgeber ihn nicht verstanden.
Der lachende Junge sah ihn allerdings jetzt neugierig an und wiederholte: »Aduhschejse?«
Gabriel kicherte. »Wir sollten ihm andere Worte beibringen!«
Er tippte sich mit dem Zeigefinger auf die Brust und sagte: »Gabriel!«
Die indigenen Jungs rissen interessiert die Augen auf.
Gabriel wiederholte seine Vorstellung, zeigte dann auf Mike und Matti und nannte deren Namen.
»MEICK!« war am leichtesten nachzusprechen.
Mike nickte zustimmend und wiederholte. »Ich: Mike!«
Der Junge nickte, lächelte, tippte Mike an und sagte: »Ichmeik!«
Mike wollte gerade korrigieren, merkte dann aber, dass es zu kompliziert werden würde. Der Junge tippte sich an und nannte einen Namen, den Mike weder verstand noch nachsprechen konnte. Er traute sich aber auch nicht, nachzufragen. Irgendwie hätte er es peinlich gefunden.
Glücklicherweise wiederholte der Junge von selbst seinen Namen: »Daviuanuri.«
Jetzt hatte Mike es verstanden, wusste aber nicht, ob der Junge nun Daviuanuri hieß oder Davi Uanuri, also Davi mit Vornamen. Er versuchte es einfach und fragte: »Davi?«
Der Junge lachte wieder und nickte.
Mike war erleichtert. »Davi! Meik!«
Davi schüttelte den Kopf und wiederholte: »Davi Uanuri.«
Jetzt lachte auch Mike. So viel wusste er auch, dass der Junge nicht Davimeik hieß. Oder hatte er einen Witz gemacht? Egal, dachte Mike. Lachen schadet nie.
Er erinnerte sich, was ihm einmal sein Vater gesagt hatte: »Lachen ist zutiefst menschlich. Nur Menschen – und einige wenige Arten von Menschenaffen – lachen.« Insofern war es bestimmt gut, zu lachen, wenn man fremden Menschen begegnete.
Nun zeigte Davi wieder auf die Blasrohre, die ihnen die anderen indigenen Jungs noch immer geduldig entgegenhielten. Mike nahm sich zögerlich eines. Noch nie hatte er ein echtes Blasrohr in der Hand gehalten. Er erinnerte sich kurz an eine Situation zu Hause in der Schulklasse. Sie hatten in der Musikstunde Blockflöte spielen sollen. Stattdessen hatten Mike und seine Freunde die Mundstücke abmontiert, die Löcher zugehalten und die Flöten als Pusterohre für Papierkügelchen benutzt, um diese den Mädchen vor ihnen heimlich in die Kragen zu schießen. Aber das war natürlich etwas anderes gewesen. Diese Blasrohre waren richtige Waffen. Das hatte er am eigenen Leibe gespürt. Denn mit Pfeilen aus Blasrohren waren sie wohl betäubt und anschließend von den Jägern hierher ins Dorf verschleppt worden. Nun reichte Davi Mike noch drei kleine, dünne Pfeile für das Blasrohr. Er meinte es ernst! Mike scheute sich, die Pfeile anzufassen, denn er wusste, dass ihre Spitzen mit einem Gift präpariert waren.
Die indigenen Völker Südamerikas nutzen oft vergiftete Pfeile bei der Jagd. Sie tunken die Pfeilspitzen meist in Curare-Gift.
Das Curare-Gift wird, abhängig von der Region und der Volksgruppe, nach unterschiedlichen Rezepturen aus verschiedenen Kräutern, Wurzeln, Rinden und Blättern verschiedener Lianenarten zusammengebraut.
Die mit den Giftpfeilen erlegte Beute zu essen ist für den Menschen ungefährlich, weil das Gift nicht über den Verdauungstrakt wirkt.
Verschiedene Bestandteile der Rezepturen fanden Eingang in die Medizin. Heute sind sie jedoch durch künstlich hergestellte Stoffe ersetzt worden, da diese weniger Nebenwirkungen verursachen.
Nur mit äußerster Vorsicht nahm er sie entgegen und hatte keine Ahnung, wie er sie nun aufbewahren sollte. Hilflos schaute er zu Gabriel und Matti, die auch nicht so recht wussten, wohin sie mit den Pfeilen sollten. Die indigenen Jungs hatten dafür kleine Köcher, die sie an Gürteln aus geflochtenen Pflanzenfasern um den Bauch trugen. Außer diesem Gürtel um die Hüfte trugen die Jungs nichts. Keine Hose und – was Mike unter diesen Bedingungen viel schlimmer fand – nicht mal Schuhe oder etwas Ähnliches. Mike dachte an den mühevollen Weg durch den Dschungel, den sie bis hierher zurückgelegt hatten. Nicht einen Schritt hätte er geschafft, wenn er keine Schuhe getragen hätte. Barfuß über den mit Wurzeln und Pflanzen übersäten Boden, auf dem es vor Leben nur so wimmelte. Jeden Meter konnte man auf Schlangen, Spinnen, Tausende Insekten oder Kriechtiere treten, jedes einzelne von ihnen möglicherweise hochgiftig. Und diese Burschen liefen hier barfuß durch den Urwald, als spazierten sie am feinen Strand eines Touristenhotels!
Davi sagte etwas, das Mike als »Kommt mit!« deutete. Er wollte vorangehen, doch schon nach einem Schritt blieb Davi stehen, riss seine Augen weit auf, stierte in den Himmel und spitzte die Ohren. Auch die anderen Jungs waren von einer Sekunde auf die nächste hochgradig alarmiert. Sofort hielten sie ihre Blasrohre in Angriffsstellung schräg hoch in die Luft, noch ehe Mike auch nur ahnte, was geschehen war. Er, Gabriel und Matti schauten sich erstaunt um, suchten den Himmel ab, konnten jedoch nichts entdecken.
Bis Gabriel plötzlich ein Geräusch vernahm.
»Ein …!«, rief er, brach aber ab, wohl, weil er selbst nicht glauben konnte, was er da gehört hatte. Er lauschte noch mal, dann war er sich sicher: »Ein Flugzeug!«
Jetzt hörten Mike und Matti es auch.
Mike traute seinem Gehör im ersten Moment ebenso wenig. Das konnte doch nicht sein! Ein Flugzeug! Hier, im dichtesten Dickicht des Dschungels?
Das Geräusch wurde lauter und war immer klarer zu hören. Das war ein Flugzeug, kein Zweifel! Ihre Rettung! Das, worauf sie so lange gehofft hatten!
Unwillkürlich warf Mike sein Blasrohr beiseite, begann, mit den Armen zu wedeln, auf- und abzuspringen und laut zu rufen – obwohl noch nichts von dem Flugzeug zu sehen war. Aber das Motorengeräusch wurde immer lauter.
Auch Matti und Gabriel wollten sich nun bemerkbar machen und rissen ihre Arme hoch. Da war der Propeller des Flugzeugs schon zu erkennen.
»Hier!« Mike brüllte, so laut er konnte.
Doch im selben Moment spürte er einen harten Stoß. Ehe er begriff, was geschah, lag er schon bäuchlings auf dem Boden, das Gesicht halb in den Sand gedrückt. Davi lachte nicht mehr, sondern hielt ihn fest am Boden, so dass Mike sich nicht mehr rühren konnte. Halb aus den Augenwinkeln sah Mike, dass es Gabriel und Matti nicht besser erging. Auf Matti hatten sich sogar zwei Jungs geworfen. Weitere eilten herbei, die sie an den Beinen packten und in null Komma nichts von der Lichtung hinein ins Dickicht zogen, während die Männer, die bisher nur stumm dagestanden hatten, in Sekundenbruchteilen aktiv wurden. Sie hielten ihre Blasrohre abschussbereit in die Höhe, bereit, den Kampf gegen das fremde Ungetüm aufzunehmen.
»Halt! Nein! Nicht!«, wollte Mike rufen. Doch sobald er auch nur den Mund öffnete, um einen Laut von sich zu geben, presste ihm Davi, der immer noch auf seinem Rücken saß, wieder das Gesicht zu Boden. Mike war froh, überhaupt noch atmen zu können.
»Das Flugzeug ist unsere Rettung! Sie suchen uns!«, hätte Mike gern gerufen. Aber selbst wenn er es gekonnt hätte, die Indigenen hätten ihn nicht verstanden.
Es dauerte keine Minute, da war das Flugzeug über sie hinweggezogen. Das Motorengeräusch wurde leiser.
Eine kurze Zeitlang hoffte Mike noch, es würde zurückkehren. Er wusste, dass es hier im Dorf ohnehin nicht landen konnte. Aber vielleicht hatte ihr Winken und Rufen trotzdem etwas genützt? Vielleicht waren sie gesehen worden, und der Pilot des Flugzeuges kehrte zurück, um die genaue Position zu bestimmen und später einen Hubschrauber zu schicken?
Doch schon bald schwand Mikes Zuversicht. Die Indigenen betrachteten ein Flugzeug als Feind. Das war unübersehbar gewesen. So, wie sie sich verhalten hatten, war es nicht das erste Mal, dass sie ein Flugzeug gesehen hatten, vermutete Mike. Sonst wären sie wohl noch verschreckter und aufgebrachter gewesen. Stattdessen hatten sie eher Entschlossenheit und Kampfbereitschaft demonstriert. Auch hatten sie nur ihn, Gabriel und Matti ins Versteck gezerrt. Sie selbst hatten sich offen und angriffslustig gezeigt, statt sich zu verkriechen. Sie hatten also keine Angst vor etwas Unbekanntem gehabt, sondern stellten sich mutig einem Gegner entgegen, den sie möglicherweise vorher schon einmal gesehen hatten. Bedeutete dies, dass hier öfter ein Flugzeug vorbeikam?
Und wussten die Indigenen nicht, dass seine Schwester, er, Gabriel und Matti zu jenen gehörten, die das Flugzeug flogen? Warum wurden sie von den Indigenen versteckt? Wollten die ihnen etwa doch nicht helfen? Waren sie deren Gefangene?