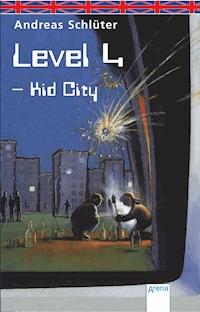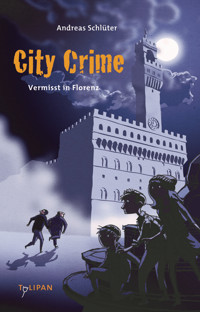6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Level 4-Reihe
- Sprache: Deutsch
Irgendetwas läuft schief in Level 4 Ben liebt Computerspiele über alles und besonders seine Neuerwerbung ›Die Stadt der Kinder‹. Doch irgendetwas läuft schief im 4. Level. Was eigentlich nur auf dem Bildschirm passieren sollte, wird unheimliche Realität: Alle Erwachsenen verschwinden aus der Stadt! Zunächst sind die Kinder davon begeistert. Endlich können sie all das tun, was sie schon immer mal machen wollten. Doch Ben und seine Freunde sind als Erste ernüchtert und überlegen, wie es weitergehen soll – so ganz ohne Erwachsene. Die Ernsthaftigkeit ihrer Lage wird ihnen bewusst... »Level 4 markiert eine Grenzüberschreitung, bei der Kindern Verantwortung und Solidarität zugetraut werden. Ein Highlight für Schmöker- und PC-Freaks.« Wochenpost
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Der erste Band der spannenden Level-4-Serie
Ben liebt Computerspiele über alles, besonders seine Neuerwerbung »Die Stadt der Kinder«. Doch irgendetwas läuft schief im 4. Level. Was eigentlich nur auf dem Bildschirm passieren sollte, wird plötzlich unheimliche Realität: Alle Erwachsenen verschwinden aus der Stadt! Zunächst sind die Kinder begeistert, endlich können sie all das tun, was sie schon immer mal machen wollten. Doch Ben und seine Freunde begreifen gleich den Ernst der Lage …
Von Andreas Schlüter ist bei dtv außerdem lieferbar:
Level 4.2 – Zurück in der Stadt der Kinder (Bd. 2)
Level 4.3 – Der Staat der Kinder (Bd. 3)
Der Ring der Gedanken – Ein Computerkrimi aus der Level-4-Serie
2049
Fünf Asse – Startschuss (Bd. 1)
Fünf Asse – Fallrückzieher (Bd. 2)
Level 4 Kids – Diebe im Netz (Bd. 1)
Level 4 Kids – Apollo 11 im Fußballfieber (Bd. 2)
Level 4 Kids – Die verräterische Datenspur (Bd. 3)
Level 4 Kids –Vampirjagd um Mitternacht (Bd. 4)
Die UnderDocks – Verschwörung in der Hafencity (Bd. 1)
Die UnderDocks – Das Auge der Fliege (Bd. 2)
Spacekids (Bd. 1)
Spacekids – Attacke aus dem All (Bd. 2)
Andreas Schlüter
Level 4
Die Stadt der Kinder
Das neue Computerspiel
Die Sonne warf ihren hellen Strahl durchs Fenster und traf Ben genau ins Auge. Ben blinzelte, schielte zu seinem Radiowecker und war im Nu hellwach. Sechs Uhr dreißig zeigte der Wecker. Eigentlich hätte Ben noch eine halbe Stunde schlafen können, aber an diesem Tag erschien es ihm unmöglich.
Aufgeregt sprang Ben aus dem Bett. Heute war der Tag der Tage. Heute bekam er endlich das neue Computerspiel. Frank, sein bester Freund, wollte es mit in die Schule bringen. Ben hatte ihm im Gegenzug das neue Sporttrikot versprochen, das er von seiner Oma geschenkt bekommen hatte. Ein stolzer Preis. Einen kurzen Moment überlegte Ben noch einmal, ob er auf das Tauschgeschäft tatsächlich eingehen sollte. Seine Großmutter wäre bestimmt nicht begeistert, wenn sie wüsste, dass er das Trikot gegen ein Computerspiel eintauschen wollte. Aber er hatte es sich zwei Wochen lang überlegt und nun eine Entscheidung getroffen. Das Computerspiel war ihm wichtiger.
In Windeseile zog Ben sich an. Er griff in die Schublade der Wäschekommode und erwischte zwei Socken, eine rote und eine grüne. Schnell noch Pullover und Hose. Minuten später steckte er den Kopf durch die Tür des Zimmers seiner Mutter. »Hallo, Mami! Gibt’s heute kein Frühstück?«
Bens Mutter schreckte aus dem Bett hoch. Hektisch blickte sie zum Wecker: sechs Uhr dreißig. Gott sei Dank, sie hatte nicht verschlafen.
»Ben?«, fragte sie erstaunt. »Es ist halb sieben. Du hast doch noch eine Dreiviertelstunde Zeit bis zum Frühstück. Warum bist du denn jetzt schon auf?«
»Ich muss heute eher los«, drängelte Ben. »Ich bekomme ein neues Computerspiel!«
»Das darf nicht wahr sein«, stöhnte Bens Mutter und ließ ihren Kopf zurück ins warme, kuschelige Kissen fallen. »Und deshalb weckst du mich eine halbe Stunde zu früh?«
»Das ist wichtig«, quengelte Ben.
»Klar«, antwortete seine Mutter und rappelte sich langsam wieder aus dem Bett hoch. Dabei fiel ihr Blick erneut auf Ben. Plötzlich lachte sie los.
»Was ist denn?«, wollte Ben wissen.
Kopfschüttelnd betrachtete seine Mutter den roten und den grünen Strumpf, wanderte mit den Augen hoch bis zu Bens Hosenbund, stellte fest, dass sein Hosenschlitz noch offen war, schaute noch ein Stückchen höher und erkannte, dass er den Pullover falsch herum angezogen hatte.
»Hast du heute schon mal in den Spiegel geschaut, du kleiner Clown?«, kicherte seine Mutter. »Ich wette, du hast dich vor lauter Wichtigkeit noch nicht einmal gewaschen.«
Waschen! Ich bekomme heute das neue Computerspiel und die fragt, ob ich mich gewaschen habe. Ben konnte es nicht fassen. Ich habe mich gestern Abend gewaschen, bin in ein sauberes Bett gestiegen und heute Morgen aus diesem sauberen Bett wieder aufgestanden. Mir soll mal jemand sagen, wo ich mich da dreckig gemacht haben soll.
»Ich bin nicht mehr klein«, antwortete Ben entrüstet. Er wollte so schnell wie möglich von dem unangenehmen Thema Waschen wegkommen.
»Natürlich nicht«, schmunzelte seine Mutter. »Allerdings auch noch nicht ganz erwachsen genug, um dich richtig anzuziehen, geschweige denn dir dein Frühstück zu machen.«
»Oh Mann«, stöhnte Ben. »Nie nimmst du mich ernst. Und jetzt ist es schon gleich zehn vor sieben. Ich muss doch los.«
»Es ist noch nicht mal zwanzig vor sieben«, korrigierte seine Mutter. »Aber es scheint ja ein wahnsinnig wichtiges Spiel zu sein, wenn du dafür so früh aufstehst.« Sie setzte sich auf den Rand des Bettes, rieb sich noch einmal verschlafen die Augen und griff zum Morgenmantel, der neben dem Bett auf dem Fußboden lag. »Woher bekommst du es denn?«, fragte sie.
»Von Frank!«, antwortete Ben postwendend. »Im Tausch.«
Kaum hatte Ben das gesagt, hätte er sich am liebsten auf die Zunge gebissen. Mist! Jetzt fragt sie bestimmt, wogegen ich es eintausche. Schnell huschte er Richtung Küche. Die erwartete Frage eilte ihm hinterher: »Im Tausch? Wogegen denn?«
Ben tat so, als habe er die Frage nicht gehört. Seine Mutter schlurfte in die Küche und wiederholte die Frage, während sie Milch, Butter und Marmelade aus dem Kühlschrank nahm.
Ben flüchtete in sein Zimmer. »Ich muss noch meine Schultasche packen«, erwiderte er so beiläufig wie nur möglich.
Als Ben im Zimmer ankam, schnarrte sein Radiowecker los, der auf Viertel vor sieben gestellt war. »… und haben deshalb in den parlamentarischen Gremien folgende Maßnahmen gegen die eskalierende Gewalt auf den Straßen diskutiert …«, leierte der Sprecher seinen Nachrichtentext. Ben drückte auf die Aus-Taste. Immer dieses langweilige Gerede, dachte er. Versteht doch ohnehin kein Mensch.
Er griff nach seiner Schultasche, wobei er hoffte, dass sich darin wenigstens ungefähr die Bücher befanden, die er heute brauchen würde. In den vergangenen drei Tagen hatte er mit seiner Schultaschen-Grundausstattung jedenfalls Glück gehabt. Ein Schreibheft, zwei Stifte und natürlich das Mathematik- und das Physikbuch. Die hatte Ben immer dabei. Bei seinen Lieblingsfächern ließ er nichts anbrennen. Sein Geschichtsbuch hingegen war schon seit drei Wochen spurlos verschwunden, aber das hatte in der Schule noch niemand bemerkt.
Er lief zurück in die Küche, wo seine Mutter wie jeden Morgen ein umfangreiches Frühstück vorbereitet hatte. Ihr Kaffeewasser gurgelte noch durch die Maschine. Ben trank sein Glas Milch in einem Zug leer, griff sich einen Apfel aus der Obstschale und verschwand auf den Flur.
»Willst du nicht frühstücken?«, wunderte sich seine Mutter.
»… ch … ha … edet«, grunzte Ben mit dem Apfel im Mund, während er seine Jacke anzog und gleichzeitig versuchte, mit dem rechten Fuß in einen Schuh zu schlüpfen, der natürlich noch zugeschnürt war.
»Wie bitte?«, fragte die Mutter.
Ben nahm den Apfel aus dem Mund und wiederholte ungeduldig: »Ich habe mich mit Frank verabredet. Und jetzt ist es schon so spät.«
Endlich war es ihm gelungen, die Schuhe anzuziehen, ohne sie vorher zu öffnen. Er nahm seine Schultasche, schnappte noch nach dem Schulbrot, das seine Mutter ihm reichte, und wollte gerade aus der Haustür stürzen.
Aber da war sie wieder – die Frage: »Wogegen tauschst du denn das Computerspiel?«
Jetzt musste es raus. »Gegen mein Trikot«, antwortete Ben so schnell, dass seine Mutter es hoffentlich nicht richtig verstehen würde.
Doch die verstand sehr gut. »Gegen das neue Trikot von Oma?«, bohrte sie nach.
»Ja«, gab Ben kleinlaut zu.
»Findest du das nett?«, fragte die Mutter und fügte hinzu: »Du hattest es dir doch gewünscht. Und Oma ist ziemlich viel herumgelaufen, um es zu bekommen.«
»Ich weiß«, nuschelte Ben, während er mit gesenktem Kopf auf den Fußboden starrte. »Aber … so viel Sport mach ich ja gar nicht. Und dieses Computerspiel ist nicht irgendein Spiel. Es ist ganz neu und aufregend. Noch niemand ist bis in die vierte Ebene gekommen. Denn immer werden wir vorher aus dem Kaufhaus geschmissen, wenn wir es ausprobieren und …«
Bens Mutter unterbrach den Redeschwall ihres Jungen. »So war es bei den anderen 500 Computerspielen doch auch, oder nicht?« Manchmal konnte Bens Mutter unerbittlich sein.
»148«, korrigierte Ben. Er hatte die Anzahl seiner Spiele exakt im Kopf. »Und die meisten davon habe ich kopiert. An dieses kommt man aber nicht heran!« Ben bemühte sich verzweifelt, gute Gründe dafür zu finden, warum das Trikot von seiner Großmutter jetzt dran glauben musste.
»Es ist dein Trikot«, bestimmte seine Mutter. »Du kannst damit machen, was du willst. Ich sage dir nur: Es wird nicht geschwindelt. Wenn Oma dich mal danach fragt, sagst du ihr ehrlich, was du damit gemacht hast. Überlege es dir also gut.«
»Ja, ja, mach ich«, versprach Ben und hoffte, seine Großmutter würde diese Frage niemals stellen.
Knapp zehn Minuten später kam Ben keuchend am Schultor an. Natürlich war er den ganzen Weg gelaufen. Mit jedem Schritt stieg in ihm die Aufregung. Nun sollte er endlich das neue Computerspiel bekommen. Noch weit vom Schultor entfernt blickte Ben in alle Richtungen, um Frank vielleicht schon irgendwo entdecken zu können. Aber Frank war nirgends zu sehen, auch nicht am Schultor. Das gibt’s doch nicht, dachte Ben und sah auf seine Armbanduhr, die anzeigte, dass es in Tokio 15 Uhr 15, in New York 1 Uhr 15, in Moskau 8 Uhr 15 und in Bens Schule 7 Uhr 15 war. Erst um halb acht war er mit Frank verabredet. Aber man muss ja nicht erst in letzter Minute kommen. Ben wurde immer ungeduldiger.
»Hallo, Ben«, rief eine Stimme über den Schulhof. Ben drehte sich um und sah, wie Thomas über den Schulhof in seine Richtung schlich. Der hat mir gerade noch gefehlt, dachte Ben. Ehe der hier ankommt, ist Schulschluss.
»Hast du die Mathe-Hausaufgaben? Ich muss sie noch irgendwo abschreiben«, brüllte Thomas noch immer von weit her, während zwei Lehrer an ihm vorbeihasteten und ihn verblüfft ansahen. Mathematik war zwar in der ersten Stunde dran. Das war für Thomas aber noch lange kein Grund, sich ausnahmsweise mal etwas schneller zu bewegen. In gewohntem Zeitlupentempo trottete Thomas auf Ben zu. Thomas war der Ansicht, dass zu große Geschwindigkeit nur dazu führte, die besten Dinge dieser Welt zu übersehen. Er war nämlich ein leidenschaftlicher Sammler von Fundsachen. Dabei kam es ihm gar nicht darauf an, was es war. »Das Entscheidende ist: Es ist umsonst und man braucht es sich nur zu nehmen«, belehrte Thomas seine Mitschüler immer dann, wenn er wieder etwas gefunden hatte. So war sein Zimmer zu Hause – einschließlich der Garage seiner Eltern – das wohl größte, unordentlichste und verrückteste Fundbüro der ganzen Stadt.
»Platz da!« Ben schrak auf und sprang instinktiv zur Seite. Unmittelbar neben ihm bremste ein Fahrrad mit quietschenden Reifen ganz knapp vor dem Schultor. Ein Wunder, dass es überhaupt noch vor dem Tor zum Stehen kam. Bens Herz pochte wie wild. Er schnappte nach Luft. Dann aber seufzte er erleichtert.
»Frank, endlich! Wo bleibst du denn so lange?«
»Ach, meine Mutter. Du weißt doch: Iss dein Brot, trink deine Milch, hast du alle Sachen, wo ist …«
»Ja, ja, wie bei mir zu Hause«, unterbrach Ben seinen Freund. »Und? Hast du’s dabei?«
»Ja, natürlich. Was denkst du denn?« Frank angelte ein dickes Knäuel aus Zeitungspapier aus seiner Jackentasche. Um Bens freudige Erwartung auch zur Genüge auszukosten, entfaltete Frank nun betont langsam mit einer feierlichen Handbewegung und würdevollem Gesicht das Zeitungspapier, so als würde er der Welt die größte Erfindung dieses Jahrhunderts vorstellen. Dabei war es nur das neue Computerspiel, das Frank von seinem Vater bekommen hatte. Oft beneidete Ben Frank um diese Quelle. Franks Vater arbeitete nämlich in einer Computerfirma und kam oft leicht an die neuesten Spiele heran. Frank selbst aber konnte mit dieser traumhaften Quelle wenig anfangen. Erstens interessierte er sich mehr für Sport als für Computer. Und zweitens scheiterte er bei den meisten Spielen schon im ersten Level.
Ein Gewirr aus gelbem Schaumstoff und roten Gummibändern kam zum Vorschein.
»Hast du nun die Matheaufgaben oder nicht?« Thomas war mittlerweile angekommen.
»Du nervst«, blökten Ben und Frank wie aus einem Munde. Thomas erstarrte, was bei seinen ohnehin langsamen Bewegungen aber kaum auffiel. Dahinter steckt sicher ein Geheimnis, ahnte er. Aber da Geheimnisse aller Erfahrung nach nicht umsonst zu lüften sind, drehte er sich um und schlurfte Richtung Klassenraum.
Frank hatte jetzt die Schaumstoff-Gummiband-Konstruktion aufgelöst. Aber es kam noch eine Schicht, diesmal aus Aluminiumfolie.
»Sag mal, ’ne vernünftige Schachtel hattest du wohl nicht zu Hause?«, jammerte Ben nervös.
»Nee, hättste ja mal Thomas fragen können. Der hätte bestimmt eine gehabt«, antwortete Frank und packte ruhig weiter aus: Nach der Alufolie kam Watte, nach der Watte ein Staubtuch, nach dem Staubtuch ein Taschentuch und nach dem Taschentuch – endlich – die CD-ROM mit dem heiß begehrten Spiel. Schon oft hatte Ben das Spiel im Kaufhaus gesehen und es selbst einige Male ausprobiert. Aber jedes Mal, wenn er kurz davor war, in die schwierigste Ebene des Spiels zu wechseln, kam irgend so ein unfreundlicher Verkäufer und machte dem Spaß ein Ende. »Lange genug gespielt«, musste Ben sich dann anhören, »schließlich wollen die Kunden, die wirklich was kaufen, auch mal gucken, wie das funktioniert.« Aber nun konnten Ben alle Verkäufer dieser Welt egal sein.
»Und?«, fragte Frank. »Was ist mit dem Trikot?«
Behutsam legte Ben die Silberscheibe in die Hülle, die er mitgebracht hatte. Dann zeigte er auf den Karton, den er dabeihatte. Frank schnappte ihn sich. Er grinste zufrieden.
»Tu mir nur einen Gefallen«, bat Ben. »Solltest du jemals meiner Oma begegnen, dann schwärm ihr nichts von deinem neuen Sporttrikot vor, verstanden?«
Während des Unterrichts konnte Ben sich gar nicht konzentrieren, noch nicht mal in Mathe. Ständig stellte er sich vor, in die vierte Ebene einzudringen und das Spiel an dieser schwierigsten Stelle mit der Rekordpunktzahl zu beenden. Ben war so in Gedanken, dass er zuerst nicht bemerkte, wie ihm von der rechten Seite des Klassenzimmers ein kleines Papierknäuel zuflog. Es landete direkt neben seinem Stuhl auf dem Fußboden.
Thomas boxte ihm von hinten in den Rücken. »Pst, da liegt ein Zettel für dich«, tuschelte er.
»Ein Zettel? Woher kommt der?«, fragte Ben.
Thomas grinste übers ganze Gesicht. »Na, woher schon«, antwortete er, »von da, wo er immer herkommt.« Dabei deutete er mit einem kurzen Kopfnicken in Richtung Jennifer.
Jennifer, die auf der anderen Seite des Klassenraums an der Fensterseite saß, blickte ungeduldig zu Ben hinüber und fragte sich, ob er jemals in diesem Leben den Zettel bemerken würde – oder zumindest rechtzeitig, bevor der Lehrer ihn entdeckte.
Ben faltete das Papierknäuel auseinander und las:
Hallo Ben!
Hab in Mathe echt noch nichts geblickt.
Und morgen schreiben wir die Klassenarbeit.
Kannst du mir helfen?
Heute Nachmittag.
Ist wirklich sehr wichtig.
Jennifer
Das hatte Ben gerade noch gefehlt. Er selbst hatte die Vorbereitung auf die Klassenarbeit schon in seinem Programm gestrichen. Genauer gesagt fieberte Ben dem neuen Computerspiel so sehr entgegen, dass er gar nicht mehr an die Klassenarbeit gedacht hatte. Es war auch egal. Mathe war wirklich kein Problem für Ben. Auch ohne Extraübungen hatte er in diesem Fach noch nie etwas Schlechteres als eine Zwei minus geschrieben.
Und nun kam Jennifer. Ohne ihre Hilfe wäre seine letzte Englischarbeit mit Sicherheit voll danebengegangen. Es half alles nichts.
Gereizt riss Ben eine Seite aus seinem Schulheft und kritzelte darauf:
Hallo Jennifer!
O. K.
Komm heute um vier bei mir vorbei.
Dann lernen wir.
Habe aber nicht viel Zeit. Ehrlich.
Ben
Ben faltete den Zettel zusammen, schrieb groß »Jennifer« drauf und gab ihn auf den gewohnten Postweg. Entlang dem von allen Schülern so genannten Postweg wanderte der Zettel unter den Tischen von Nachbar zu Nachbar, bis er endlich bei Jennifer ankam.
Sie entfaltete das Papier, las es hastig und schon breitete sich ein zufriedenes Lächeln auf ihrem Gesicht aus.
»Spitze«, zeigte sie wie in der Taubstummensprache mit Daumen und Zeigefinger zu Ben herüber. Ben rollte die Augen gegen die Zimmerdecke und ließ dann den Kopf schwer in die aufgestützten Hände fallen. Er wusste: Der Nachmittag war gelaufen.
Das Spiel beginnt
Endlich war Ben zu Hause.
Er rannte in sein Zimmer, schmiss die Schultasche in die Ecke und nahm die CD-ROM aus der Hülle. Seine Hände zitterten, teils vor Aufregung, teils, weil er den ganzen Schulweg zurückgelaufen war. Noch schwer atmend legte er die Scheibe ins Fach. Mit einer raschen Handbewegung wischte Ben alles vom Tisch, was beim Spielen störte. Dann schaltete er den Computer ein. Der Bildschirm flackerte. Ein kurzes Piepsen. Die üblichen Standardzeilen tauchten in gelber Leuchtschrift auf und verschwanden wieder. Ben begann das Spiel zu installieren. Schließlich quäkte eine schrille, einfache Melodie durch den Raum, dann meldete der Bildschirm:
DIE STADT DER KINDER
Das Superabenteuerspiel
der Computergames GmbH
und den anderen Quatsch:
Dieses Spiel ist geschützt
Zu bestellen bei …
und so weiter.
»Mach schon!«, brüllte Ben den Computer an. Endlich zeigte der Bildschirm eine Einkaufsstraße. Kleine Figuren gingen in die Läden hinein und kamen wieder heraus, immer dem gleichen Bewegungsablauf folgend. Auf der Straße fuhren in entgegengesetzter Richtung zwei Autos Schlangenlinien. In der unteren linken Ecke stand die Figur, die Ben mit dem Joystick bewegen konnte.
Er probierte die Bewegungsabläufe aus: links, rechts, nach vorn (im Bildschirm also nach oben), nach hinten. Gut, es konnte losgehen. Jetzt hieß es, sich zu konzentrieren.
Zuerst einmal die Straße hoch und in den letzten Laden hineingehen. Also Joystick nach vorn. Achtung vor den Autos. Die werden nämlich von Kindern gefahren, die keinen Führerschein haben. Deshalb waren sie unberechenbar. Plötzlich fiel ein Blumentopf aus dem zweiten Haus. Dicht neben der Figur prallte er auf die Straße und zersprang in tausend kleine Lichtpunkte, die sich auf dem Bildschirm in alle Richtungen verflüchtigten.
Das war knapp. In seiner Aufregung hatte Ben diese kleinen, heimtückischen Hindernisse völlig vergessen, die durch das Chaos in der Stadt entstanden. Er musste vorsichtiger sein, denn bis zur vierten Spielebene war es noch ein langer Weg. Und dummerweise ließen sich die ersten, leichteren Spiellevels nicht überspringen. Nach jedem groben Fehler fing das Spiel von vorne an. Unzählige Male hatte Ben diesen Anfang schon gespielt. Und doch entging ihm immer mal wieder eine dieser Kleinigkeiten wie der Blumentopf.
Diesmal hatte Ben Glück gehabt. Hinein in den Laden.Schon sprang das Bild auf eine neue Szene: das Innere des Ladens. Hinter dem Tresen stand eine zwielichtige Gestalt. Ben wusste, dass es kein normaler Verkäufer war. Er war ein heimtückischer Zauberer – einer der letzten Erwachsenen in der Stadt. Vorsicht war geboten. Jeder Schritt der Figur musste wohlüberlegt sein auf dem Weg zu der Glasvitrine, wo der Schlüssel zum nächsten Bild versteckt war. Dazwischen, das wusste Ben von seinen zahlreichen Versuchen im Kaufhaus, lauerte eine Falltür im Fußboden auf eine unbedachte Bewegung der Spielfigur.
Entschlossen packte Ben den Joystick. Und schon … »rring-rrring!«, klingelte es an der Haustür.
»Das darf doch nicht wahr sein!«, fluchte Ben. Ein Blick auf seinen Radiowecker holte ihn in die Wirklichkeit zurück. Es war vier Uhr nachmittags. Jennifer wollte für die Mathearbeit üben.
Zögernd schob Ben sich von seinem Sitz. Langsam ging er einige Schritte auf die Zimmertür zu, ohne auch nur einen Augenblick den Bildschirm aus den Augen zu lassen. Wer weiß, welchen Schabernack der Zauberer mit seiner Figur treiben würde, wenn er zu lange an einer Stelle stehen blieb? »Rring!«, wiederholte die Haustürklingel erbarmungslos.
»Ja doch!«, rief Ben ärgerlich. Dann rannte er los, riss die Haustür auf, hechelte ein kurzes »Hallo« hinaus auf die Straße und stürzte schnurstracks wieder zurück in sein Zimmer. Jennifer blieb mit offenem Mund vor der Haustür stehen.
»Was war denn das?«, fragte Miriam. Jennifers beste Freundin hatte nach Schulschluss die tolle Idee gehabt, Jennifer zu begleiten. Schließlich war auch Miriam nicht gerade die Beste in Mathematik. Und ein Nachmittag mit Jennifer versprach eigentlich immer auch eine Menge Spaß, selbst beim Mathelernen.
Ben hatte in seiner Eile gar nicht bemerkt, dass sie zu zweit gekommen waren. Langsam tasteten sich die beiden Mädchen hinter Ben her. Schließlich standen sie in Bens Zimmer. Himmel, wie es dort aussah! Auf dem Fußboden lag ein Haufen Computerzeitschriften wild durcheinander. Um diesen größten Papierhaufen, den Jennifer je in einem Zimmer gesehen hatte, lagen Schraubenzieher, Lötkolben, Drähte, Schräubchen, Schaltpläne und Steckdosen. Durch dieses Ersatzteillager schlängelten sich die Reste einer elektrischen Autobahn, die aber dort endete, wo ein auf den Kopf gestelltes Mountainbike offensichtlich darauf wartete, wieder ein Hinterrad zu bekommen. Das aber würde bestimmt noch eine Weile dauern, erkannte Jennifer sofort. Denn das Hinterrad diente einem selbst gebauten Fernrohr gerade als drehbares Stativ, das gleich neben einem alten Schwarzweißfernseher mit offener Rückwand stand. Jennifer wagte nicht einen Schritt weiterzugehen. Sie hatte Angst, irgendein Elektroteil zu zertreten. So blieb sie regungslos an der Türschwelle stehen und fragte sich, wo man hier Mathematik lernen sollte.
Miriam hatte weniger Probleme. Sie stützte sich auf Bens Stuhllehne, blickte ihm über die Schulter und betrachtete interessiert die Ereignisse auf dem Bildschirm. Egal, was es war, wenn es ums Spielen ging, war Miriam immer schnell zu begeistern.
»Verdammt!«, schimpfte Ben. »Das gibt’s doch gar nicht.«
»Was ist denn los?«, fragte Miriam, die sich schon die ganze Zeit darüber wunderte, dass Ben wie wild auf die Tasten haute.
Ben war ganz rot im Gesicht vor Aufregung. Abwechselnd sah er Miriam und Jennifer mit verwirrtem Blick an. Schließlich stieß er einen tiefen Seufzer aus und sagte niedergeschlagen: »Der Zauberer ist weg!«
Eine schreckliche Entdeckung
Ben war mit seinen Gedanken überhaupt nicht bei der Sache. Jennifer hatte schließlich darauf gedrängt, Mathematik zu üben. Und Ben hatte sich dem Schicksal gefügt. Aber er musste ständig an sein Computerspiel denken. Warum funktionierte es nicht? Noch nie war während des Spiels der Zauberer verschwunden und damit das Spiel beendet. Sooft er den Computer ausschaltete, um ihn neu zu starten und das Spiel ein weiteres Mal zu laden: Die Fehler im Spiel wurden nur noch größer. Jetzt war nicht nur der Zauberer verschwunden, sondern es fuhren auch keine Autos mehr auf dem Bildschirm. Nur die kleine Figur, die mit dem Joystick zu steuern war, hopste noch durch die Computerwelt. Nichts ging mehr. Das Spiel stand still.
»Mensch, Ben. Wie geht denn diese Aufgabe jetzt? Du hörst mir überhaupt nicht zu«, klagte Jennifer. »Ich denke, wir lernen zusammen?«
»Ja, du erklärst das gar nicht richtig«, fing nun auch Miriam an zu mosern. Wenn sie schon keinen Spaß mehr haben sollte, wollte sie wenigstens auch ein bisschen was für die bevorstehende Mathearbeit mitbekommen. Aber daran war gar nicht zu denken. Ben murmelte nur unverständlich einige Formeln vor sich hin. Dabei schielte er mit einem Auge auf seinen Computer.
»Ich hol mir mein Trikot von Frank wieder«, sagte er schließlich. »Das Spiel ist total kaputt.«
»Oh Mann«, stöhnten die Mädchen wie aus einem Munde.
Jennifer wurde es jetzt wirklich zu dumm. »Du und dein bescheuertes Computerspiel!«, schimpfte sie. »Dann lassen wir das Lernen eben. Komm, Miriam, wir hauen ab. Mit dem ist heute sowieso nichts anzufangen.«
»Ist gut«, pflichtete Miriam ihrer Freundin bei. »Ich will nur mal gucken, ob meine Eltern schon zu Hause sind. Sonst können wir ja vielleicht noch ein Eis essen gehen!« Schon war Miriam auf dem Weg zum Telefon. Nach einer Minute war sie bereits zurück.
»Keiner da«, sagte sie.
»Gut, dann gehen wir«, entschied Jennifer und machte einen Schritt Richtung Zimmertür. Ein knirschendes Geräusch hielt sie auf.
»Pass doch auf!«, schimpfte Ben. »Jetzt hast du meine Lichtschranke zertreten!«
»Wo soll man hier denn sonst hintreten, wenn überall so viel Müll rumliegt?«, verteidigte sich Jennifer.
»Das ist kein Müll. Das ist Technik. Aber dafür bist du wohl zu dämlich!«, wütete Ben.
Jennifer drehte sich beleidigt um. »Komm!«, sagte sie zu Miriam und ging energisch zur Tür, ohne darauf zu achten, wo sie hintrat. Eine Glühbirne, zwei Elektroschalter und ein Stecker fielen ihren stampfenden Schritten zum Opfer.
Eine Minute später waren die Mädchen draußen auf der Straße. Endlich!, dachte Ben und setzte sich sofort wieder an den Computer.
Fast zwei Stunden saß er vor dem Bildschirm, ohne zu merken, wie die Zeit verging. Ein ums andere Mal wiederholte er die gleichen Handbewegungen: Computer ausstellen, Computer anstellen, bis der Kasten bereit war, das Spiel laden, zuschauen, wie das Spiel beginnt, den Joystick kontrollieren, mit der Figur in den Laden mit dem Zauberer gehen. Und dann passierte es immer und immer wieder: Der Zauberer blieb verschwunden, das Spiel stand still.
Allmählich bekam Ben Hunger. Er blickte auf seinen Radiowecker. Kurz nach halb sieben.
Längst war Abendbrotzeit. Komisch, dass seine Mutter noch nicht da war. Zum Abendessen war sie sonst pünktlich auf die Minute und das hieß: Um sechs Uhr gab’s Essen. Das wusste Ben sehr genau. Denn meistens war es natürlich genau dann sechs Uhr, wenn es an jedem anderen Ort gerade tausendmal interessanter war als am Küchentisch. Ob im Schwimmbad oder auf dem Fußballplatz, vor dem Computer oder einfach vor dem Haus auf der Wiese, stets musste Ben sich auf den Weg machen, wenn es am schönsten war. Nur, weil um sechs Uhr gegessen wurde. Bens Mutter bestand darauf.
In allen anderen Fragen, das musste Ben zugeben, hatte er große Freiheiten, konnte er über alles mit seiner Mutter reden – zumindest bot sie es ihm immer an. Nur beim Abendessen blieb sie stur. Wenigstens einmal am Tag, zu einem festen Zeitpunkt, wollte sie in Ruhe mit ihrem einzigen Sohn zusammen sein.
Ben verstand das nicht so richtig. Seit sich seine Eltern vor fünf Jahren hatten scheiden lassen, besuchte er nur dreimal im Monat seinen Vater, der am anderen Ende der Stadt wohnte. Seine Mutter sah er jeden Tag. Warum das nun aber immer unbedingt abends um sechs Uhr sein musste, blieb für ihn eines der vielen Rätsel, die die Erwachsenen ihm aufgaben.
Und nun war es schon nach halb sieben. Irgendetwas stimmte da nicht. Selbst wenn etwas dazwischengekommen wäre – und es war noch nie etwas dazwischengekommen –, dann hätte Bens Mutter mit Sicherheit von unterwegs angerufen. Ben ging in die Küche und blickte in den Kühlschrank. Zumindest auf den war Verlass. Aufschnitt, Käse, Butter, Cola, sogar einige Würstchen befanden sich in der weißen, kühlen Schatztruhe. Egal, an welchem Tag oder zu welcher Uhrzeit Ben hier einen Blick hineinwarf, irgendetwas Brauchbares fand sich darin immer. Ben machte sich erst einmal ein köstliches Abendbrot. Vielleicht, dachte Ben bei sich, würde seine Mutter endlich einmal sehen, wie gut er auch schon allein zurechtkam. Schließlich war er schon fast dreizehn. Seine Mutter allerdings schien manchmal zu glauben, er würde in zwei Wochen bestenfalls seinen achten Geburtstag feiern.
Mit drei heißen Würstchen und reichlich Ketchup, zwei Scheiben Brot, die doppelt mit Wurst belegt waren, und einer kühlen Dose Cola setzte Ben sich an den Küchentisch und sah aus dem Fenster. Von hier aus konnte er fast die ganze Straße überblicken. Wenn seine Mutter käme, würde er sie von dieser Stelle aus bestimmt nicht übersehen.
Aber auf der Straße tat sich nichts.
Nicht nur, dass Bens Mutter nicht kam. Nein, auf der Straße war überhaupt nichts zu sehen. Kein Mensch jedenfalls. Irgendetwas war sehr seltsam an dieser Straße. Sie war auf beiden Seiten mit Autos zugeparkt wie immer. Die Geschäfte – der Bäcker, der Zeitungsladen, die Wäscherei, der kleine Supermarkt – hatten natürlich schon geschlossen. So schien es jedenfalls. Trotzdem: Dass überhaupt niemand auf der Straße war, kam Ben sehr merkwürdig vor. Nicht einmal ein Auto fuhr durch die Straße.
Das war’s! Es fiel Ben erst jetzt auf. Es fuhr kein einziges Auto auf der Straße. Das gab es sonst nie! Wenn kein Auto durch die Straße kam, dann musste irgendetwas los sein. Wahrscheinlich hatte sich am Anfang der Straße ein schlimmer Unfall ereignet und die Polizei hatte die Straße gesperrt. Ben zögerte keinen Augenblick. In Windeseile zog er sich Schuhe und Jacke an und stürmte hinaus.
Kurz darauf stand er an der Straßenkreuzung, wo er den Unfall vermutete.
Nichts.
Kein Unfall, keine Polizei. Auch hier fuhr kein einziges Auto. Im Gegenteil: Einige Autos standen mitten auf der Straße, aber sie waren leer. Bei manchen lief sogar noch der Motor. Kein Mensch war zu sehen. Ben kam sich vor wie in einer Geisterstadt. Mutterseelenallein stand er auf der Kreuzung, drehte sich mehrmals um sich selbst und blickte in alle Richtungen. Was war los? Wen konnte er fragen?
Jennifer! Sie war doch vor knapp zwei Stunden noch bei ihm gewesen. Dann war sie gemeinsam mit Miriam ein Eis essen gegangen. Wenn sich also innerhalb der letzten beiden Stunden etwas Merkwürdiges ereignet hatte, müsste sie es mitbekommen haben. Zum Glück wohnte Jennifer nur zwei Straßen weiter.
Ben klingelte Sturm an Jennifers Haustür. Sofort wurde die Haustür aufgerissen und Ben sah in das erstaunte Gesicht von Jennifer, das sogleich tiefe Enttäuschung signalisierte.
»Was machst du denn hier?«, seufzte das Mädchen. »Ich hatte gehofft, es wären endlich meine Eltern. Ich warte schon über eine Stunde auf sie. Sie wollten doch mit mir ins Kino gehen.«
»Deine Eltern sind auch weg?«, fragte Ben.
In kurzen Sätzen erzählte er Jennifer von seinen Beobachtungen und setzte dann nach: »Was ist denn bloß passiert? Ist dir nichts aufgefallen, als du mit Miriam Eis essen warst?«
»Wir waren ja gar kein Eis essen«, erzählte Jennifer. »Wir wollten zwar gerne, aber es war kein Verkäufer in der Eisdiele. Wir haben fünf Minuten gewartet und gerufen. Nichts passierte. Da sind wir eben wieder gegangen.«
Plötzlich machten sich völlig verrückte Gedanken in Bens Kopf breit: Zum ersten Mal erscheint meine Mutter nicht zu Hause, auf der Straße fährt kein einziges Auto, die Stadt ist wie leer gefegt, in der Eisdiele ist niemand und Jennifers Eltern sind auch weg. Das ist »… wie im Computerspiel«, sagte Ben plötzlich laut.
»Wie bitte?«, fragte Jennifer gereizt. »Kannst du niemals an etwas anderes denken als an deinen idiotischen Computer?«
»’tschuldigung«, murmelte Ben nur. Jennifer hatte ja recht. Wie konnte er jetzt nur wieder an seinen Computer denken? Dennoch: Es war wie in seinem neuen Computerspiel. Auch dort verschwinden von Bild zu Bild immer mehr Menschen aus der Stadt, und zwar nur die Erwachsenen. Aufgabe des Spiels ist es, mit der Figur so viele Kinder wie möglich zu versammeln und die Stadt zu retten. Für jede Funktion in der Stadt, die man am Leben erhält, gibt es Punkte. So geht das Spiel – wenn es funktioniert. Aber das Spiel war kaputt. Und seitdem vermisste er seine Mutter, wartete Jennifer auf ihre Eltern …
»Das ist doch Blödsinn!« Wieder sprach Ben seinen letzten Gedanken laut aus.
»Was ist Blödsinn? Geht es dir noch gut?« Jennifer wusste nicht, was sie von Ben halten sollte. Er stand da, stierte ins Leere und murmelte irgendwelche Sätze ohne Sinn vor sich hin. Aber Ben hatte jetzt eine Entscheidung getroffen.
»Hör zu!«, sagte er zu Jennifer. »Von mir aus kannst du mich für verrückt halten. Aber lass uns alle anderen anrufen und fragen, was bei denen los ist.«
»Welche anderen?« Jennifer kapierte überhaupt nichts mehr.
»Na, all unsere Freunde«, antwortete Ben. »Frank, Miriam, Thomas und so weiter.«
Jennifer hielt das für eine ausgesprochen dumme Idee. Was sollte Miriam damit zu tun haben, dass ihre Eltern nicht nach Hause kamen? Aber Ben schien so überzeugt, dass sie ihm nicht widersprach. Sie holte ihr kleines rosafarbenes Telefonbüchlein, in dem all ihre Freundinnen notiert waren, hockte sich neben Ben ans Telefon und sie begannen, einen nach dem anderen anzurufen. Schon nach einer Viertelstunde war für Ben die Sache klar.
»Miriam wartet ebenfalls auf ihre Eltern. Thomas’ Großmutter, bei der er zurzeit wohnt, ist plötzlich verschwunden. Und Franks großer Bruder ist auch noch nicht aufgetaucht, obwohl er auf die Wohnung achten soll, solange sein Vater auf Geschäftsreise ist. Ich weiß nicht, wieso, aber ich sage dir: Alle, die älter sind als fünfzehn Jahre, sind verschwunden!«
»Wie kommst du gerade auf fünfzehn?«, fragte Jennifer. »Willst du mir nicht endlich erklären, welche geheimnisvollen Rätsel du die ganze Zeit zu lösen versuchst?«
Ben erklärte ihr die Regeln seines Computerspiels.
»Verstehst du?«, sagte er weiter. »Im Computerspiel verschwinden alle Menschen, die älter sind als fünfzehn Jahre. Und genau das ist in unserer Stadt passiert!«
»Du meinst, dein Computerspiel ist Wirklichkeit geworden?«
»Genau das meine ich, auch wenn es verrückt klingt.«
»Du spinnst doch!«
»Dann erkläre mir, wo die Eltern, Großmütter und älteren Geschwister von Miriam und Thomas und Frank sind.«
»Aber das gibt es doch gar nicht!«, schrie Jennifer. Ihre Stimme zitterte. Eine Gänsehaut kroch ihr langsam die Arme hinauf. Ihre Augen wurden feucht. Ihr war zum Heulen zumute. Noch aber unterdrückte sie die Tränen. Nein, solange sie nicht vollkommen sicher war, dass Bens verrückte Theorie stimmte, wollte sie auch noch nicht weinen.
»Komm!«, rief sie Ben zu. »Ich will wissen, ob das stimmt, was du sagst.«
Was jetzt?
Jennifer zog Ben zum Telefon.
»Was hast du vor?«, fragte Ben.