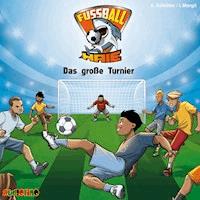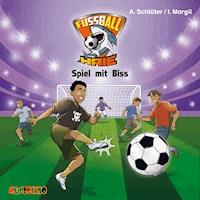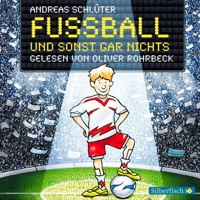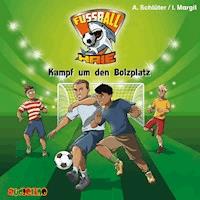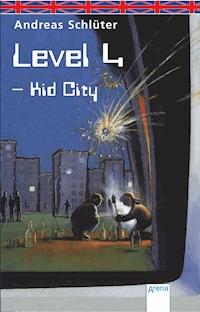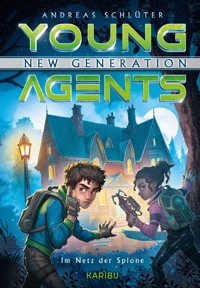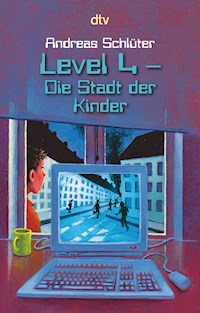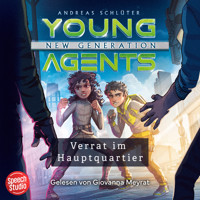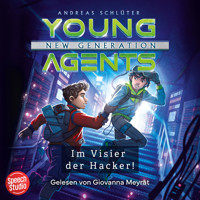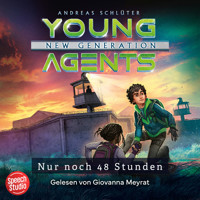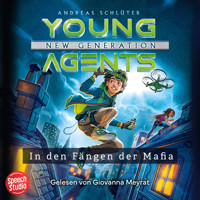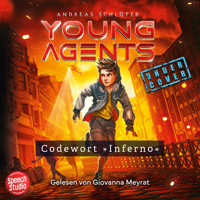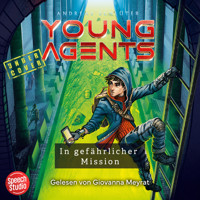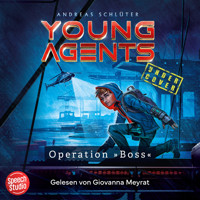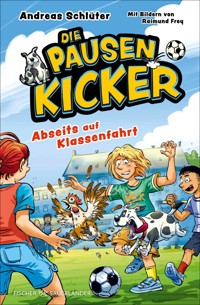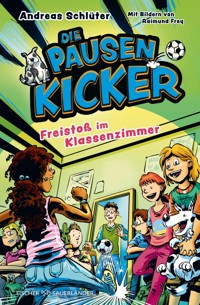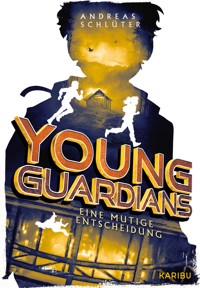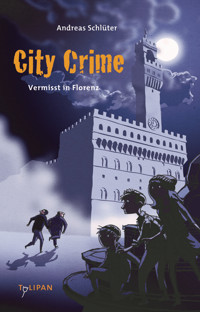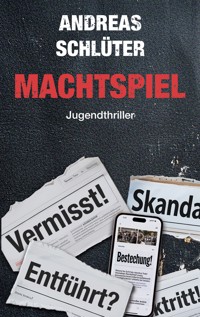
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nathalie Hofmeister, Tochter eines prominenten Politikers, erlebt die Schattenseiten des Rampenlichts. Als ihr Vater in einen politischen Skandal verwickelt wird, gerät auch sie ins Kreuzfeuer der öffentlichen Aufmerksamkeit. In der Schule wird sie zur Zielscheibe, während zu Hause der Druck unerträglich wird. Zwischen politischen Intrigen und persönlichen Krisen sucht Nathalie nach einem Weg, ihre Identität und Unabhängigkeit zu bewahren. "Machtspiel" ist ein packender Roman über die Verstrickungen von Macht und Medien, die Suche nach Wahrheit und das Erwachsenwerden unter außergewöhnlichen Umständen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Geschichte ist frei erfunden.
Jede Ähnlichkeit mit tatsächlich existierenden Personen,
Politikern, Amtsinhabern, Kandidaten, Wahlstrategen
oder Parteien ist nicht beabsichtigt und rein zufällig,
aber mitunter schwer zu vermeiden.
Inhaltsverzeichnis
Wahlen
Montag, 7 Uhr 55
Zwischenfall
Montag, 8 Uhr 00
Alltag
Montag, 8 Uhr 00
Erinnerung
Montag, 8 Uhr 30
Verzweigungen
Montag, 9 Uhr 00
Besuch
Montag, 15 Uhr 00
Denkzettel
Montag, 16 Uhr 00
Ein überraschender Anruf
Montag, 16 Uhr 30
Verschwunden
Montag, 17 Uhr 00
Angst
Montag, 17 Uhr 30
Vermisst
Montag, 17 Uhr 30
+++ Eilmeldung +++
Montag, 22 Uhr 00
Nachrichtenagentur +++ Eilmeldung +++
Angst, Mut, Hoffnung
Dienstag, 7 Uhr 00
Schock
Dienstag, 7 Uhr 30
Stimmungswandel
Dienstag, 8 Uhr 00
Mut
Dienstag, 9 Uhr 00
In der Schule
Dienstag, 8 Uhr 00
Der Drohbrief
Dienstag, 9 Uhr 00
Nachrichten
Dienstag, 11 Uhr 00
Suche
Dienstag, 11 Uhr 30
Zeugen?
Dienstag, 12 Uhr 00
Ein kurzer Blick!
Dienstag, 12 Uhr 30
Lebenszeichen
Dienstag, 13 Uhr 00
Heiße Spuren
Dienstag, 14 Uhr 00
Gescheitert
Dienstag, 14 Uhr 30
Die Wende
Mittwoch, 7 Uhr 55
Machtspiele
Mittwoch, 10 Uhr 00
Besondere Gedanken
Mittwoch, 10 Uhr 30
Nichts als die Wahrheit
Mittwoch, 18 Uhr 00
Tat ohne Täter
Mittwoch, 19 Uhr 00
Begegnungen
Mittwoch, 20 Uhr 00
Allein
Mittwoch, 20 Uhr 15
Ein seltsamer Anruf.
Mittwoch, 21 Uhr 00
Todesmutige Schritte
Mittwoch, 21 Uhr 15
Die Wende
Mittwoch, 21 Uhr 30
Aus und vorbei!
Mittwoch, 21 Uhr 33
Eine gute Idee
Mittwoch, 21 Uhr 45
Erleuchtung im Dunkeln
Mittwoch, 22 Uhr 00
Entscheidung
Mittwoch, kurz vor Mitternacht
Ärger!
Donnerstag, 1 Uhr 00
Zwei Opfer für den Sieg
Donnerstag, 1 Uhr 30
Ein erster Hinweis
Donnerstag, 1 Uhr 35
Die Zeit läuft
Donnerstag, 1 Uhr 40
Zu spät
Donnerstag, 1 Uhr 50
Fehler?
Donnerstag, 2 Uhr 05
Die letzten Sekunden
Donnerstag, 2 Uhr 07
Pressemeldung
Freitag, 18 Uhr 00
Nachrichtenagentur +++ Eilmeldung +++
Wahlen
Montag, 7 Uhr 55
Der Name war nicht das Einzige, was in ihrem Leben nicht stimmte. »Nathalie« stand in ihrem Ausweis. In Wahrheit aber war sie zu Nadja geworden, doch darüber sprach sie nicht. Mit niemandem. Über ihren Namen nicht und über ihr Leben erst recht nicht. Das taten andere. Viel zu viel. Immer wieder. Aber die sprachen über Nathalie. Erst seitdem Nadja aufgetaucht war, konnte sie das Gerede über Nathalie ertragen. Nicht dass es leicht geworden wäre; in diesen Wochen schon gar nicht. Aber es war auszuhalten, seit es Nadja gab.
Nadja ahnte schon, was Nathalie am heutigen Tag in der Schule blühen würde. Am liebsten wäre sie zu Hause geblieben. Aber das durfte sie nicht. Sie hätte es auch nicht gekonnt, nicht einmal heimlich – wie andere Schülerinnen ihres Alters. Es gab keine Heimlichkeiten. Nicht für Nathalie Hofmeister, Tochter von Christoph Hofmeister – dem Christoph Hofmeister. Würde sie heute die Schule schwänzen, könnte sie es morgen in allen Zeitungen nachlesen. Keinen Schritt durfte sie machen, ohne beobachtet zu werden. Nathalie war ein Mädchen der Öffentlichkeit geworden. Ohne dass sie es gewollt oder sie jemand gefragt hätte. Sie war im Sog ihres Vaters mitgestrudelt und an die Oberfläche gespült worden, für jeden jederzeit sichtbar, hilflos zappelnd, stumm nach Hilfe schreiend.
Gestern war ihr Vater wieder im Fernsehen gewesen. Vorgestern auch. Und am Tag davor. Jeden Tag. Mehrfach. Auf allen Kanälen. Nicht einmal zappen half. Schaltete man von einem Kanal fort, erschien ihr Vater auf dem nächsten. Schlimmer als eine Naturkatastrophe. Andere Schüler hätten sich vielleicht darüber gefreut, wären stolz gewesen den eigenen Vater so oft auf dem Bildschirm zu sehen. Vielleicht hätte auch Nathalie sich daran gewöhnt, wenn ihr Vater Popstar gewesen wäre oder ein berühmter Schauspieler. Selbst mit dem Moderator einer Nachmittags-Talkshow wäre sie vermutlich klargekommen – obwohl das schon sehr heftig gewesen wäre. Nicht aber mit den unzählbaren Interviews, Verlautbarungen, Erklärungen, Dementis und Pressekonferenzen ihres Vaters. Es war schlimmer als alle Berufe, die man sich vorstellen konnte – einschließlich Bestattungsunternehmer oder Klärgrubenreiniger. Ihr Vater war Politiker. Ausgerechnet Politiker! Nicht irgendeiner, etwa verantwortlich für Familienangelegenheiten im Dorf Hintertupfingen, der auf Wohltätigkeitsfesten die Sahnetorte anschneiden musste. Auch nicht irgendeiner dieser unsichtbaren 734 Bundestagsabgeordneten, die, unbemerkt von der Öffentlichkeit, in irgendwelchen Ausschüssen arbeiteten, wie Bauarbeiter jedes Wochenende von der Montage nach Hause zur Familie zurückkehrten und die ansonsten niemand kannte.
Nein, Nathalies Vater war Spitzenkandidat der Freien Sozialen Demokratischen Union (FSDU) für die Bundestagswahl. Mit der Chance als Koalitionspartner die Regierung mitzubilden und Vizekanzler zu werden! Vizekanzler! Ihr Vater!
Der Tag, an dem Christoph Hofmeister vom Parteitag zum Kandidaten gekürt wurde, war der Tag gewesen, an dem Nadja geboren worden war. Nadja, das zweite Ich, hinter dem Nathalie sich verstecken konnte.
Nadja blieb vor dem Schultor stehen. Es schien, als hätte niemand sie bemerkt. Aber der Schein trog. Nadja wusste das. Obwohl sich viele ihrer Mitschüler nicht für Politik interessierten, war Nathalie in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt. Für Wahlen interessierten sich alle. Zumindest für Bundestagswahlen. Erst recht, wenn der Vater einer ihrer Mitschülerinnen vermutlich bald Mitglied der Regierung war. Nadja erinnerte sich an den letzten Eurovion Song Contest. Neben den üblichen Schlagersternchen hatte ein Frisör aus dem Stadtteil bei der Vorausscheidung teilgenommen und immerhin den zweiten Platz belegt. Alle in der Schule hatten sich die Fernsehübertragung angesehen und mit ihren Handys mitgewählt. Sie hätten es einfach lustig gefunden, wenn ein Frisör aus der Gegend vor 110 Millionen Fernsehzuschauern in der Endausscheidung mitgeträllert hätte.
Die Stimmung vor diesen Bundestagswahlen in ihrer Schule war ähnlich. Nur dass niemand die Wahl mit seinem Handy mitentscheiden konnte. Aber alle würden es als lustig empfinden, wenn der Vater ihrer Mitschülerin plötzlich in der Bundesregierung sitzen würde. Nathalie war in den vergangenen Monaten zum Frisör-Ersatz geworden.
Schon allein deshalb hätte Nathalie sich gern in den letzten Winkel dieses Planeten zurückgezogen, um erst wieder aufzutauchen, wenn ihr Vater die Wahlen verloren hatte und die Konsequenzen aus der Niederlage hätte ziehen müssen, indem er von allen Ämtern zurücktrat. Das war Nadjas sehnlichster Wunsch, von dem Nathalie natürlich nie etwas erzählen würde. Aber seit zehn Tagen war alles noch schlimmer geworden.
Zwischenfall
Montag, 8 Uhr 00
Umfragen bedeuteten nichts, versuchte er sich zu beruhigen. Er hämmerte es sich in den Schädel und sagte es sich laut vor dem Spiegel vor: »Umfragen bedeuten nichts! Jeder weiß das!«
Aber er konnte sich selbst nicht überzeugen. Sie machten ihn nervös, diese verdammten Umfragen, die seit zehn Tagen in den Keller gegangen waren wie Aktienkurse an einem schwarzen Freitag. Bei 16 Prozent hatten sie schon gelegen! Sensationelle 16 Prozent, die niemand der kleinen Partei zugetraut hätte und die klar eine Regierungsbeteiligung verhießen. Die großen Parteien begannen zu schwitzen. Siegessicher war der Spitzenkandidat der FSDU durch die Lande gereist, hatte eine Kundgebung nach der anderen bravourös bewältigt, und das alles, weil seine Strategie aufgegangen war. Er war es, der diesen Kandidaten aufgebaut hatte. Er hatte die Mosaiksteinchen des Kandidaten-Images zusammengefügt zu einem Gesamtkunstwerk: Mann in den besten Jahren, gut aussehend, staatsmännisch, korrekt gekleidet, ohne bieder zu wirken. Mit attraktiver Ehefrau; immer noch die erste. Keine Affären. Weltmännisch und doch mit liebenswerter Familie im trauten Heim. Erfolgreich und entscheidungsfreudig, gleichzeitig kumpelhaft locker und sportlich. Erfahren und seriös und doch jung geblieben. Am Puls der Zeit, was durch die Tochter symbolisiert wurde. Die schöne Nathalie! Ein Geschenk für jeden Wahlstrategen. Schön, intelligent und brav, die 15-Jährige.
Er hatte alles ersonnen und geschickt in der Öffentlichkeit platziert: die Homestorys in der Yellowpress, die glückliche Familie auf den Plakaten, den Blick ins gläserne Büro des eifrig arbeitenden Kandidaten und in dessen private (selbstverständlich nur kleine Alltags-) Sorgen. Gespickt mit Fotos aus Nathalies Kindheit: Nathalie mit Schnupfen, Nathalies aufgeschlagenes Knie nach den ersten Versuchen auf dem Fahrrad, Nathalies Einschulung. Und immer der Kandidat als treu sorgender Vater zur Stelle: am Krankenbett, das Fahrrad haltend, während der Schulfeier. Dort, wo er real gefehlt hatte, der viel beschäftigte Vater, hatte er ihn ins Bild hineinkopieren lassen. Das war heute kein Problem mehr mit dem Computer. Wen interessierte die Wahrheit, wenn die Story gut war?
Alles hatte der Kandidat ihm zu verdanken, dem jüngsten Wahlstrategen aller Zeiten: Gernot Dremel, Kommunikationswissenschaftler und Pressereferent, ehemaliger stellvertretender Chefredakteur einer großen Boulevardzeitung, mit gerade mal 35 Jahren schon an den Hebeln der Macht. Ein kometenhafter Aufstieg.
Und dann das! Diese Dummheit der Parteibürokraten, die ihm vor zehn Tagen beinahe das Genick gebrochen hätte. Parteispendenaffäre! Im Wahlkampf! Der Geschäftsführer hatte der Partei etwas Gutes tun wollen und mindestens eine Million Euro an Spenden organisiert. Es war Jahre her und auch nicht weiter schlimm. Im Gegenteil. Ohne großzügige Spenden war eine große Partei nicht zu finanzieren. Alle Parteien lebten von Steuergeldern, an denen sich jede Partei nach den Wahlen reichlich bediente, und von Spenden. Nur dass dieser Dummkopf von Parteisekretär das Geld nicht etwa ordnungsgemäß als Spende verbucht, im Kassenbericht erwähnt und die Spende – wie es sich gehörte – als Einnahme der Partei versteuert hatte. Nein, die Million war auf noch ungeklärtem Wege statt auf das Parteikonto in drei geheime Schließfächer einer großen Bank in der Schweiz gelandet. Von dort wurden einzelne Beträge bar in Koffern abgeholt und an »verdiente Mitarbeiter für besondere Leistungen« ausgezahlt. Das Dumme daran: Mindestens drei dieser »verdienten Mitarbeiter« gehörten zum engsten Kreis des Kandidaten und waren nun wegen Verstoßes gegen das Parteispendengesetz und wegen Verdachts auf Korruption angeklagt.
Die Quittung war prompt gefolgt. Wochenlang hatte Dremel das Fernsehduell vorbereitet, zu dem die Spitzenkandidaten der Parteien geladen waren. Wahlen wurden heutzutage nicht mehr nach Programmen gewonnen. Kaum ein Wähler schaute sich je ein Parteiprogramm an. Wozu auch? Es stand ohnehin in fast allen das Gleiche. Nicht weil alle Parteien die gleiche Politik machen wollten, sondern weil alle sich auf derart allgemeine und unverbindliche Aussagen zurückzogen, dass sie sich beinahe bis zur Wortgleichheit anpassten. So kam es dann zu Arbeit und Wohlstand für alle oder der Priorität für neue Arbeit; zu einer Steuerpolitik: gerecht und leistungsfördernd oder man warb für solide Finanzen, gerechte Steuern, starkes Land und für die Bildung: Fundament für die Zukunft unserer Gesellschaft oder Chancen durch Bildung. Auf jeden Fall wollten die Parteien ein menschliches Deutschland gestalten und eine gute Zukunft für Familien. Dabei selbstverständlich Sicherheit für alle – überall in Deutschland.*1
Die Wahlkampfmanager der Parteien wussten, dass es schon lange nicht mehr darauf ankam, was die Parteien forderten, weil sie mehr oder weniger alle das Gleiche versprachen. Es war auch nicht wichtig, wie die Parteien ihre Versprechen einlösen wollten. Denn die Mehrheit der Wähler glaubte den Ankündigungen aus Parteiprogrammen ohnehin nicht. Entscheidend war geworden, wer in einer Regierung die Probleme anzupacken versprach. Wahlen waren zu Personalentscheidungen geworden, vergleichbar mit einem Casting für eine Modeloder Popstar-Karriere. Ebenso wie dort kam es auf jede Kleinigkeit an, die vor den Medien präsentiert wurde. Ein Spitzenkandidat stotterte? Das signalisierte Unsicherheit, also musste man ihm das Stottern abgewöhnen. Er lächelte zu wenig? Also brachte man ihm bei, seine Gesprächspartner häufiger mal freundlich anzuschauen. Schulungen für Schuhverkäufer und Vorbereitungen für Politikerduelle im Fernsehen gewannen beachtliche Ähnlichkeit, wobei der Schuhverkäufer nur eine Grundhaltung gegenüber dem Kunden trainierte, während der Spitzenpolitiker werbewirksame Gesten und Mimiken zu lernen hatte wie ein Schauspieler: nicht so oft am Ohr kratzen, das Zucken der Mundwinkel einstellen, die Hände öffnen, keine Fäuste ballen. Wichtig waren auch Kleidung und Benehmen: Selbstbewusst musste das Auftreten sein, aber nicht arrogant; man hatte seinen Gesprächspartner ausreden zu lassen und gleichzeitig dafür zu sorgen, mehr Redeanteil als der Gegner zu erobern. Man musste höflich und bescheiden wirken und sich dennoch niemals vom Journalisten unterbrechen lassen, es galt, geschickt jede Nachfrage zu umschiffen, nichts Konkretes zu äußern, dabei aber verständlich zu wirken.
Mehr als 50 Videos von Hofmeisters Auftritten in Interviews und Reden hatte Dremel analysiert, so wie ein Fußballtrainer den Gegner vor einer Weltmeisterschaft. Detail für Detail war er mit seinem Kandidaten durchgegangen, hatte ihn auf Schwächen aufmerksam gemacht und dessen Stärken herausgestellt. Sein Spitzenkandidat war zu einem perfekten Medienmann herangewachsen. Er hätte die Fernsehrunde sicher auch mit Bravour gemeistert, wäre nicht kurz vorher dieser verdammte Spendenskandal aufgeflogen. Immer und immer wieder hatten sowohl die Moderatoren als auch die Spitzenkandidaten der anderen Parteien auf dieser Affäre herumgehackt. Wenigstens der Kanzler und der Spitzenkandidat der großen Oppositionspartei hatten sich vornehm zurückgehalten, denn beide hielten sich die Option offen, mit Hofmeister und seiner Partei eine Koalition einzugehen. Hofmeister war geschickt jedem Angriff ausgewichen und geduldig immer wieder auf die Themen zu sprechen gekommen, die ihn auszeichneten, doch es hatte alles nichts genützt. Der Korruptionsvorwurf stand im Raum und konnte nicht restlos entkräftet werden, weil es zu wenig Informationen gab. Da nützten der schönste Anzug, das freundlichste Medienlächeln und die professionellsten Worthülsen nichts. Hofmeisters Glaubwürdigkeit hing an einem seidenen Faden und schon waren die Umfragewerte in den Keller gestürzt.
Gernot Dremel zerknüllte die Zeitung mit der neuesten Umfrage, nach der die FSDU auf sieben Prozent abgerutscht war, und feuerte sie in die Ecke.
Mit der Aufklärung der Parteispendenaffäre hatte er zum Glück nichts zu tun. Er wollte gar nicht wissen, wie viel Dreck in dem Korruptionssumpf da noch aufgewühlt werden würde. Er hatte ganz andere Sorgen. Er musste den Spitzenkandidaten retten. Niemand würde nach der Wahl noch von der Spendenaffäre reden: Wenn sie die Wahl mit Pauken und Trompeten verloren, konnte der Wahlkampfmanager seine Karriere in die Tonne kloppen. So lief das Geschäft. Wie im Fußball. Verlor die Spitzenmannschaft ein wichtiges Spiel, wurde der Trainer gefeuert, selbst wenn das Spiel nur wegen eines unberechtigten Elfmeters verloren worden war.
Gernot Dremel konnte nicht auf Mitleid oder gar Einsicht hoffen. Zu viel stand auf dem Spiel. Wenn er gestärkt und mit verbesserten Karrierechancen aus dem Wahlkampf hervorgehen wollte, brauchte sein Kandidat den Erfolg.
Gernot Dremel ging ins Badezimmer, warf sich eine der Tabletten ein, die ihm halfen, den Tag zu überstehen und sah auf die Uhr. In einer halben Stunde traf er sich mit dem Kandidaten. Er hatte eine Idee, wie er den Karren aus dem Dreck ziehen konnte. Natürlich hatte er die. Es gehörte zu seinem Job, Ideen zu haben. Nur leider war diese Idee aus jener Kategorie, die man lieber für sich behielt. Er musste sich überlegen, welche andere Vorgehensweise er dem Kandidaten auftischte. Es wurde Zeit, sich eine Geschichte einfallen zu lassen.
1 *(Die Losungen sind den jeweiligen »Regierungsprogrammen« von SPD und CDU für die Bundestagswahl am 22.9.2002 entnommen. Welche Losung welcher Partei zuzuordnen ist, mag der Leser selbst herausfinden.)
Alltag
Montag, 8 Uhr 00
Ole war der Schlimmste. Nathalie wusste nicht, warum er sie nicht mochte. Sie sprach nicht mit ihm, sie ging ihm aus dem Weg – sofern ihr das gelang. Die anderen, die sie nicht mochten, blieben ihr fern, gingen ihrer Wege und taten, als ob Nathalie Luft wäre. Doch Ole war anders. Ole verfolgte sie, so schien es ihr. Egal, wann und wo Nathalie auftauchte, Ole war schon da oder erschien kurz darauf wie ein unheilvoller Geist. Nur bis zu Nadja war er noch nicht vorgedrungen. Nadja war Nathalies Rettungsinsel. Auch jetzt war Ole schon da. Er stand in der Tür zum Klassenraum, die Schulter lässig an den Rahmen gelehnt, und sah Nathalie auf sich zukommen.
Nathalie starrte auf den Boden. Ole grinste. Nur noch zehn Schritte trennten sie. Mit der Zunge benetzte er seine Lippen, wohl damit ein neuer dummer, beleidigender Spruch besser aus seinem Lästermaul flutschen konnte. Aber er würde Nathalie nicht treffen. Nathalie blieb stehen und ließ Nadja den Vorrang. Mit jedem Schritt verkroch sich Nathalie weiter hinter Nadja. Als sie sich auf gleicher Höhe mit Ole befand, war Nathalie verschwunden. Nadja schritt erhobenen Hauptes an Ole vorbei, den Blick geradeaus, die Nase emporgestreckt.
»Hallo, Naddel«, schwoll es aus Oles nassen Lippen hervor. »Ist dein Papi schon im Knast?«
Nathalie hätte ihm antworten können, dass ihr Vater nichts mit dem Spendenskandal zu tun hatte und ebenso überrascht war wie viele andere in seiner Partei. Aber das hätte Ole ihr ohnehin nicht geglaubt. Außerdem war Nathalie gar nicht da. Sie war verschwunden, versteckt hinter Nadjas schützendem Wall. Nadja kannte keinen Vater, der Politiker war. Sie war frei und stark und regelte die Dinge auf ihre Art. Sie war es auch, die Oles feuchte Lippen nicht als gemeine anzügliche Beleidigung ansah, sondern als einen Tick. Unentwegt fuhr Ole sich mit der Zunge über die Lippen, die dadurch feucht glänzten. Nathalie ekelte sich vor diesem feuchten Mund, der nichts als gemeine Gehässigkeiten über sie ausspuckte. Nadja hingegen wusste Oles Tick als Waffe gegen ihn zu verwenden. Sie blieb weder stehen, noch drehte sie sich zu Ole um, als sie ihm trocken an den Kopf warf: »Du sabberst!«
Mehr sagte Nadja nicht. Nur diese zwei Worte. Mit einer chirurgischen Präzision, als hätte das erste Wort das Skalpell an Oles Kehle gelegt und das zweite den Schnitt vollzogen: »Du sabberst!«
Ole sah ihr sprachlos hinterher. Sein Mund stand offen. Und tatsächlich tropfte ihm ein kleiner Speichelfaden aus dem Mundwinkel. Ole erwachte wie aus Hypnose, bemerkte die feuchte Stelle an seinem Kinn, lief rot an, wischte den Speichel ab und rief ihr hinterher: »Arrogante Zicke! Eines Tages bekommst du die Quittung!«
Nathalie war stolz auf Nadja. Doch zugleich meldete sich in ihr ein mulmiges Gefühl der Reue. Sie musste sich vorsehen, durfte nicht frech und vorlaut wirken. Sie stand unter Beobachtung. Die kleinste Kritik eines Lehrers an ihrem Verhalten, der geringste Hinweis an ihre Eltern würde genügen für ein »eingehendes Gespräch«, wie ihre Eltern es nannten. Früher war es leichter gewesen, als ihr Vater noch ein gewöhnlicher Politiker war. Aber das war nur von kurzer Dauer gewesen. Blitzartig hatte er Karriere gemacht, war als erster Vertreter der FSDU überhaupt Bürgermeister einer Großstadt geworden und ebenso rasant nur kurze Zeit später schon zum Wirtschaftsminister des Landes aufgestiegen.
Mit der Wahl zum Minister war es strenger zu Hause geworden, doch seitdem er einer der Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl war und damit maßgeblich die Bildung der neuen Regierung mitbestimmen würde, herrschte eine unerträgliche Stimmung in der Familie. »Die Zeiten des Wahlkampfes sind für uns alle nicht leicht«, würde Mutter wieder sagen. »Es ist ja nicht mehr lange.« Als ob es besser werden würde, wenn ihr Vater tatsächlich zum Bundesminister und Vizekanzler gewählt wurde! Nathalie war doch nicht blöd. Sie wusste: Dann würde alles noch viel schlimmer werden.
Das kam zu allem noch hinzu: Es war nicht nur ihr Vater, der ein braves, züchtiges, öffentlichkeitswirksames Verhalten von ihr erwartete. Seit Vater Spitzenkandidat war, hatte auch Mutter sich offen auf seine Seite geschlagen.
»Er kann nur gewinnen, wenn wir alle zu ihm halten und jeder seinen Teil dazu beiträgt«, hatte sie erklärt.
Nicht erklärt hatte sie hingegen, weshalb ihr Vater gewinnen musste. Wieso musste ihr Vater in die Bundesregierung und dort Minister werden? Warum ausgerechnet er? Deutschland hatte doch genug Politiker. Genügten die nicht? Musste ausgerechnet ihr Vater die künftige Regierung mitbilden? Würde es der Republik mit ihm als Minister und Vizekanzler tatsächlich besser gehen? Nathalie wusste es nicht. Sie wusste nur, seit er Spitzenkandidat war, war es zu Hause schlechter geworden.
Nathalie setzte sich auf ihren Platz. Der Sitz neben ihr blieb leer. Ein Unglück kam eben selten allein. Bea, ihre beste – weil einzige – Freundin fehlte seit fast zwei Wochen zunächst wegen starker Unterleibsschmerzen, schließlich akuter Entzündung des Blinddarms und nun wegen der Operation. Natürlich besuchte Nathalie sie nachmittags im Krankenhaus, aber dann sprachen sie nicht über ihre Sorgen, sondern über Beas Befinden.
Nathalie stützte den Kopf in die Hände und beobachtete, wie Herr Thomsen den Raum betrat, sich vorn am Pult aufbaute, seinen Blick durch die Klasse schweifen ließ und wie jedes Mal den Unterricht mit der immer gleichen Frage eröffnete: »Wer fehlt?«
Wieso lernte er es nicht?, fragte sich Nathalie. Weshalb konnte ein Lehrer, der sie dreimal pro Woche unterrichtete, sich nicht merken, dass die Klasse aus 26 Schülern bestand? Wieso galt jeder einzelne der Schüler dem Lehrer offenbar so wenig, dass er dessen Fehlen nicht bemerkte? Nach welchen Kriterien – so fragte sich Nathalie – nahm der Lehrer am Ende des Schuljahres die Bewertung der einzelnen Schüler im Zeugnis vor, wenn ihm nicht einmal auffiel, ob jemand anwesend war oder nicht?
Wie immer seit fast zwei Wochen meldete sich Nathalie, um Beas Fehlen anzuzeigen. Es hatte fünf Unterrichtsstunden gedauert, ehe Herr Thomsen sich von selbst erinnern konnte: »Ach ja, der Blinddarm!«
Nathalie fragte sich, ob man Beas Fehltage im Zeugnis verringern konnte, wenn man ihre Abwesenheit einfach nicht meldete. Würde Herr Thomsen irgendwann beginnen, Bea von selbst zu vermissen, oder sie gänzlich aus dem Gedächtnis streichen und sie womöglich nach ihrer Gesundung sogar als neue Schülerin begrüßen? Nathalie hätte über ihren Gedanken geschmunzelt, wenn sie die Gleichgültigkeit des Lehrers nicht als so beschämend empfunden hätte. Man fühlte sich bei ihm wie ein Stück Ware in einem Supermarktregal. Solange das Regal nicht gänzlich leer war, war die Welt in Ordnung. Mit einer Ausnahme, dachte Nathalie verärgert. Ihre An- oder Abwesenheit wurde immer sofort registriert. Und meistens auch kommentiert. Nathalie wartete regelrecht darauf. So wie Ole ließ es sich auch Herr Thomsen nicht nehmen, Nathalie in jeder Unterrichtsstunde daran zu erinnern, wer ihr Vater war. Besonders, seit ihr Vater sich in einem Fernsehinterview einmal sehr kritisch über das Engagement der Lehrer im Allgemeinen geäußert hatte.
Herr Thomsen hatte diese Bemerkung nicht als kritisch, sondern als unverschämt empfunden. Nathalie hatte die Äußerung ihres Vaters wieder einmal auszubaden. Obwohl, selbst wenn ihr Vater allen anderen Lehrern Unrecht getan hatte, auf Herrn Thomsen traf seine Kritik zu. Nathalie wusste, was nach der routinemäßigen Feststellung der Anwesenheit folgte. Herr Thomsen stellte seine zweite, immer wiederkehrende Frage: »Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben?«
»Wie bereitet der eigentlich seinen Unterricht vor?«, hatte Nathalies Vater verblüfft und empört gefragt, als sie einmal zu Hause davon erzählt hatte. In dem Moment hatte Nathalie begriffen, dass die Aussagen ihres Vaters über die Qualifikation von Lehrern viel mit ihren Erzählungen über Herrn Thomsen zu tun hatten. Seitdem hielt Nathalie sich mit Erzählungen zurück, was leider nichts an Thomsens Rachegelüsten geändert hatte.
Die Schüler kramten in ihren Unterlagen, doch noch ehe jemand seine Aufzeichnungen aus der vergangenen Unterrichtsstunde gefunden hatte, meldete sich Ole: »Wir müssen noch unseren Grillabend planen!«
Herr Thomsen winkte ab. »Klärt das mit eurem Klassenlehrer!«
Ole setzte nach: »Würden wir gern. Aber Frau Heimann-Laubach ist seit einer Woche krank. Und das Fest sollte bei ihr stattfinden!« »Krank?«, fragte Herr Thomsen nach. Nathalie seufzte leise.
Nicht einmal das wusste der! Was bekam ihr Lehrer überhaupt noch von der Schule mit, in der er arbeitete?
»Dann wird das wohl nichts mit eurem Grillfest«, lautete Thomsens einfache Schlussfolgerung. In das enttäuschte Murren hinein ergänzte er: »Es sei denn, ihr regelt das unter euch. In der Pause natürlich. Ihr seid doch alt genug.« Herr Thomsen erntete beleidigte Gesichter. Aber das schien ihn nicht zu stören. Für Nathalie war das Thema beendet. Sie verspürte ohnehin nicht allzu viel Lust auf das Grillfest. Schon gar nicht ohne Bea. Sie hatte sich schon vorgenommen dem Fest fernzubleiben.
Unerwartet hakte Thomsen nach: »Feiert doch bei der Ministertochter!«
Nathalie schreckte auf und starrte in das feist grinsende Gesicht ihres Deutschlehrers. Völlig frei von jeglichem Taktgefühl fügte Thomsen amüsiert an: »Ihr habt sicher genug Platz in eurer Villa.«
Er wandte den Blick von Nathalie ab, schaute in die Klasse und krönte seine hämische Bemerkung mit: »Wenn ihr euch daran gewöhnen könnt, unter Aufsicht von Bodyguards zu grillen!«
Manche in der Klasse kicherten, andere waren immer noch verärgert, weil nicht ernsthaft über ihr Grillfest diskutiert wurde. Nur Ole schaute böse zu ihr hinüber. Nathalie bemerkte es sofort.
Warum tat Thomsen das?, fragte sie sich. Glaubte der wirklich, sie wohnte in einer Villa, die von Bodyguards bewacht wurde? Wie stellte der sich das Leben einer Politikertochter vor: wie das einer Popdiva? Gut, vor dem Haus auf der Straße parkte rund um die Uhr ein Streifenwagen mit wechselnder Besetzung. Aber deswegen hockte noch lange kein Bodyguard mit Anzug und Sonnenbrille vor ihrem Zimmer, wenn sie schlafen ging. Warum machte ihr Lehrer solche Sprüche? Was fand er so interessant daran, sie vor der gesamten Klasse bloßzustellen? Sie hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Was konnte denn sie für die Aussagen ihres Vaters? Wenn es nach ihr ginge, wäre ihr Vater nicht der Spitzenkandidat seiner Partei; so viel war sicher. Aber sie war nicht gefragt worden. Nathalie wäre am liebsten aufgesprungen und nach Hause gelaufen. Sie hatte genug von den ewigen Anspielungen, Sprüchen und Seitenblicken. Doch stattdessen wurde sie angesprochen: »Nathalie, wie lautet dieser Satz von Kant? Ihr solltet ja, wie ich mich erinnere, als Hausaufgabe einen Satz von Immanuel Kant interpretieren und diskutieren, nicht wahr?« Nathalie musste ihr Heft nicht aufschlagen. Auswendig sagte sie das Zitat auf: »Aber denken kann ich, was ich will, wenn ich mir nur nicht selbst widerspreche . . . aus seiner Schrift Kritik der reinen Vernunft.«
Herr Thomsen grinste sie wieder auf diese unverschämte Weise an. »Na, wenn das kein Satz für Nathalie ist. Vielleicht wird ihr Vater ja sogar noch Bildungsminister!«, frohlockte er.
Dann kannst du dich schon mal nach einem neuen Job umgucken, lag Nathalie auf den Lippen. Aber sie verkniff sich diese Bemerkung. Genau diese Großkotzigkeit der Politiker und ihr Gehabe waren ihr zuwider. Sie wollte nicht auch so tun, als läge ihr die Welt zu Füßen. Sie war Nathalie Hofmeister, ein ganz normales 15 Jahre altes Mädchen. Und so wollte sie auch behandelt werden! Nathalie kochte vor Wut, aber ihr fiel keine passende Antwort ein, was sie noch wütender machte.
»Ich finde, diesen Satz von Kant könnte sich auch der eine oder andere Lehrer mal hinter die Ohren schreiben!« Ganz unverhofft hatte Nadja sich in den Vordergrund gedrängt, die brave, schüchterne Nathalie beiseite geschoben und dem Lehrer die passende Antwort versetzt. Herr Thomsen zuckte kurz mit der Augenbraue. »Mal sehen, ob deine Hausarbeit auch so klug geworden ist wie deine Sprüche. Bitte . . .«
Mit einer Handbewegung befahl er Nathalie aufzustehen und vorn am Pult Platz zu nehmen, um ihre Hausarbeit vorzulesen.
Ich hätte einfach zu Hause bleiben und schwänzen sollen, dachte Nadja. Aber die blöde Nathalie traut sich das ja nie! Wenigstens die Hausarbeit ließ wenig Möglichkeiten, sie anzugreifen. Sie war zu gut. Das wusste Nathalie selbst ohne Nadjas Hilfe. Lange hatte sie in der vergangenen Woche daran gesessen. Nicht weil sie ihr so schwer gefallen wäre, sondern weil – in der gehässigen Spitze des Lehrers lag ein Körnchen Wahrheit – dieser Satz tatsächlich etwas für die Tochter eines Politikers war. Zumindest, wenn diese Tochter Nathalie hieß. Über Wahrhaftigkeit hatte Nathalie nachgedacht. Über Persönlichkeit und Rückgrat, über Selbstverleugnung und Charakter. Sie wusste von einer solchen Situation, in der ihr Vater einmal als Bürgermeister der Stadt gesteckt hatte. Nathalie war zu jung gewesen, um sich selbst daran zu erinnern. Damals kümmerte sie sich noch nicht um solche Dinge. Sie wusste es aus Erzählungen. Ihr Vater hatte damals vor seiner Wahl zum Bürgermeister versprochen, sich persönlich für den Erhalt einer Kleingartenkolonie einzusetzen. Nur ein halbes Jahr nach der Wahl wurde das Gebiet als Bauland freigegeben für die Erweiterung des Messegeländes. 89 Pächter mussten ihre Gärten räumen. Planierraupen rissen allein mehr als 300 Obstbäume aus dem Boden, hatten Häuschen platt gemacht, in die die Pächter teilweise mehr als 20 Jahre all ihre Freizeit und ihre Liebe investiert hatten. 89 Menschen die Idylle zu zerstören galt eben nichts gegen die wirtschaftlichen Interessen des Messeunternehmens. Die Erweiterung der Messe brachte etlichen Baufirmen neue Aufträge und insgesamt waren mehr als 200 neue Arbeitsplätze entstanden. Das alles hatte Nathalie erst vor kurzem in Zeitungsarchiven nachgelesen. Für sie bestand kein Zweifel: Ihr Vater hatte sein Wort gebrochen, wenngleich er es anders erklärt hatte. Niemals habe er den Erhalt der Gartenkolonie versprochen, behauptete er heute, sondern den Erhalt nur für erstrebenswert gehalten. Das wäre ein wesentlicher Unterschied und er immer nur falsch zitiert worden. Im Übrigen hätte er sich ja – wie versprochen – für den Erhalt eingesetzt, es wäre aber eben nicht machbar gewesen. Von all dem erwähnte Nathalie in ihrer Hausarbeit nichts. Dennoch hatte sie zum Thema gemacht, weshalb so vieles, was bei normalen Menschen als widersprüchlich oder Wortbruch geahndet werden würde, bei Menschen, die Machtpositionen einnahmen, neue Begriffe bekam: Es gab keine Lügen oder Irrtümer, sondern nur neue Erkenntnisse oder andere Konstellationen. Schuld hieß: Man werde eine Sache lückenlos aufklären. Wer sich dem Rücktritt wegen einer Verfehlung verweigerte, klebte nicht etwa an seinem Posten, sondern wollte sich der Verantwortung nicht entziehen. Nathalie hatte in ihrer Hausarbeit ausdrücklich nicht von der Politik gesprochen. Ihr Vater hätte ihr eine solche Hausarbeit nie verziehen. Geschickt hatte Nathalie nur angedeutet und offen gelassen, ob sie Politiker meinte oder aber einfach nur ihre Lehrer, den Schuldirektor oder die Eltern ihrer Mitschüler. Machtverhältnisse gab es in jeder Familie und ebensolche Widersprüche zwischen Versprechen und Einlösung, zwischen Worten und Taten. »Aber denken kann ich, was ich will, wenn ich mir nur nicht selbst widerspreche.« Dieser Satz war in Nathalies Gedanken immer präsent gewesen und natürlich hatte sie dabei an niemand anderes gedacht als an ihren Vater. Dachte der eigentlich immer, was er sagte? Doch Nathalie kam gar nicht dazu, ihre Hausarbeit vorzulesen, denn das Thema Grillabend war noch nicht abschließend geklärt. Thomsens Bemerkungen hatten bei einigen zwar für Erheiterung gesorgt, aber das Problem nicht gelöst: Wo konnte der Grillabend stattfinden und wann? Es war Ole, der das Thema erneut ansprach.
Thomsen wollte gerade auf ihn losgehen, als sich Yvonne schnell meldete: »Ich werde meine Eltern fragen, ob wir es bei uns machen können!«
Die Klasse klatschte Beifall. Herr Thomsen nickte zufrieden. »Dann ist das ja endlich geklärt!«, seufzte er und gab Nathalie erneut ein Zeichen.
Nathalie ordnete ein letztes Mal ihre Papiere, öffnete den Mund, um endlich ihre Hausarbeit vorzutragen, als Ole ihr plötzlich zurief: »Warum nicht bei dir, Nathalie? Ihr habt doch einen großen, unbeschädigten Garten, oder?« Wieso unbeschädigt? Nathalie verstand den tieferen Sinn dieser Bemerkung nicht.