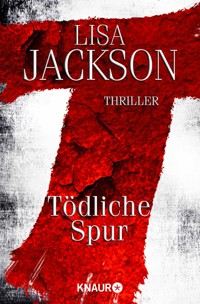
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Weihnachtsabend auf Church Island, einer kleinen Insel vor der Küste Washingtons. Ein kleiner Junge verschwindet spurlos. Da er zuletzt am Bootsanleger gesehen wurde, wird ein tragischer Unfall vermutet. Nur seine Mutter Ava will das nicht glauben, sie erleidet einen Zusammenbruch und wird in die Psychiatrie eingewiesen. Zwei Jahre später darf Ava nach Hause – und fühlt sich dort seltsam fremd. Sie beschließt, sich auf die Suche nach Spuren zu begeben. Niemals hat sie an die Geschichte des tragischen Unfalls geglaubt, die man ihr immer über das Verschwinden ihres Sohnes erzählt hat. Auf ihrer Suche gerät sie in ein bizarres Netz aus Lügen und Intrigen, Rache und Hass.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 784
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Lisa Jackson
T - Tödliche Spur
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Kristina Lake-Zapp
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der kleine Noah verschwindet spurlos aus seinem Elternhaus. Das Kind scheint im Meer ertrunken zu sein, vermutet die Polizei. Nach einem Nervenzusammenbruch kehrt Noahs Mutter Ava aus der Klinik in das düstere Herrenhaus zurück. Ava traut keinem in der Familie. Sie ist entschlossen, endlich die Wahrheit über das Verschwinden ihres Sohnes herauszufinden, und gerät dabei in ein gefährliches Netz aus Lügen, Intrigen, Rache und Hass.
Inhaltsübersicht
Prolog
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Kapitel vierunddreißig
Kapitel fünfunddreißig
Kapitel sechsunddreißig
Kapitel siebenunddreißig
Kapitel achtunddreißig
Kapitel neununddreißig
Kapitel vierzig
Kapitel einundvierzig
Kapitel zweiundvierzig
Kapitel dreiundvierzig
Kapitel vierundvierzig
Kapitel fünfundvierzig
Kapitel sechsundvierzig
Kapitel siebenundvierzig
Lisa Jackson bei Knaur
Montana-»To Die«-Reihe
1. Der Skorpion (Left to Die)
2. Der Zorn des Skorpions (Chosen to Die)
3. Zwillingsbrut (Born to Die)
4. Vipernbrut (Afraid to Die)
New-Orleans-Reihe
1. Pain. Bitter sollst du büßen (Hot Blooded)
2. Danger (Cold Blooded)
3. Shiver (Shiver)
4. Cry (Absolute Fear)
5. Angels (Lost Souls)
6. Mercy (Malice)
7. Desire (Devious)
San-Francisco-Reihe
1. Dark Silence (If She Only Knew)
2. Deadline (Almost Dead)
West-Coast-Reihe
1. Sanft will ich dich töten (Deep Freeze)
2. Deathkiss (Fatal Burn)
Savannah-Reihe
1. Ewig sollst du schlafen (The Morning After)
Stand Alone
Wehe dem, der Böses tut (See how she dies)
S - Spur der Angst (Without Mercy)
Prolog
Wieder dieser Traum.
Es ist ein grauer, nebelverhangener Tag, und ich bin in der Küche, telefoniere mit jemandem … Dieser Teil ist übrigens jedes Mal anders. Mal spreche ich mit meinem Ehemann Wyatt, dann mit Tanya und manchmal auch mit meiner Mutter, obwohl sie schon lange, lange tot ist. Aber so ist das nun mal.
Aus dem Wohnzimmer, das hier in diesem Haus an die Küche grenzt, höre ich den Fernseher. Ein Zeichentrickfilm läuft, und ich weiß, dass Noah auf dem Teppich vor dem Flachbildschirm mit seinem Spielzeug beschäftigt ist.
Ich habe Brot gebacken, die Küche ist noch warm vom Ofen, und ich denke an Thanksgiving. Als ich aus dem Fenster blicke, stelle ich fest, dass es draußen schon fast dunkel ist, die Abenddämmerung senkt sich herab. Es muss kalt sein, die Bäume zittern im Wind, ein paar störrische Blätter hängen noch an den dünnen, skelettartigen Zweigen. Auf der anderen Seite der Bucht sehe ich die Stadt Anchorville, verschleiert vom Nebel.
Hier drinnen, in dem alten Herrenhaus, das mein Ururgroßvater erbaut hat, ist es gemütlich.
Sicher.
Es duftet nach Zimt und Muskat.
Plötzlich bemerke ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung vor dem Küchenfenster. Es ist sicher Milo, unser Kater, denke ich, doch dann fällt mir ein, dass Milo, eine prächtige Tigerkatze, tot ist, und zwar schon seit Jahren.
Auf einmal wird mir mulmig zumute. Ich kneife die Augen zusammen und versuche, durch den immer dichter werdenden Nebel, der vom Meer heraufzieht, etwas zu erkennen. Ich weiß, dass da draußen etwas ist, im Garten, hinter der Rosenhecke, wo die windzerzausten Sträucher stehen.
Quiiieeetsch!
Ein Schatten huscht an der Veranda vorbei. Ich bekomme eine Gänsehaut.
Für den Bruchteil einer Sekunde fürchte ich, dass etwas Böses hinter den pfeilförmigen Spitzen des schmiedeeisernen Zauns lauert, der das Grundstück umgibt.
Quiiieeetsch! Wumm! Das Tor fliegt auf und schwingt im stürmischen Wind hin und her.
In diesem Augenblick fällt mein Blick auf Noah, meinen Sohn, mit seinem kleinen Kapuzenpullover und den hochgekrempelten Jeans. Er hat sich aus dem Haus gestohlen und spaziert durch das offene Tor aus dem Garten. Fröhlich hüpft er durch die Dämmerung Richtung Anleger, als würde er hinter irgendetwas herjagen, dem Hund oder einem Eichhörnchen vielleicht.
»Nein!«
Ich lasse den Hörer fallen.
Wie in Zeitlupe prallt er gegen mein Wasserglas, dessen Inhalt sich über die Küchenanrichte ergießt.
Ich wirbele herum, bestimmt habe ich mich getäuscht und er sitzt noch auf dem Teppich vor dem Fernseher … Nein, das Wohnzimmer ist leer, über den Bildschirm flackert irgendein Disneyfilm, Aladin, glaube ich.
»Noah!«, schreie ich aus voller Lunge und wende mich wieder Richtung Küche.
Ich trage ein Nachthemd, und meine Füße fühlen sich an, als steckten sie in Treibsand fest, ich komme nicht schnell genug von der Stelle. Aus den Fenstern, die auf die Bucht blicken, sehe ich, wie der Kleine durch die aufziehende Dunkelheit läuft und sich mehr und mehr dem Wasser nähert.
Ich poche mit der Faust gegen eins der alten Fenster.
Die Scheibe zerspringt.
Glassplitter fliegen durch die Luft.
Blut spritzt.
»Noah!«
Er hört mich nicht. Ich versuche, die Glastür zur Veranda zu öffnen, doch sie lässt sich nicht bewegen. Nicht mal ein winziges Stückchen. Blut läuft an der Scheibe hinab.
Ich quäle mich in Zeitlupe durchs Zimmer, den Gang entlang, rufe nach meinem Sohn, nach Wyatt, bis ich endlich die Haustür erreiche. Sie ist unverschlossen, ein Türflügel schwingt mit einem lauten Ächzen auf. Jetzt stehe ich auf der Vortreppe. »Noah!«
Ich weine. Schluchze. Panik steigt in mir auf, und beinahe wäre ich auf den feuchten Stufen ausgerutscht. Ich laufe an tropfnassen Rhododendren und sturmgepeitschten Kiefern vorbei, die überall auf dieser gottverlassenen Insel stehen, die Insel, die mir für den Großteil meines Lebens ein Zuhause war. »Noah!«, rufe ich wieder, doch meine Stimme geht im Tosen der See unter. Ich kann meinen Jungen nicht mehr sehen, er ist hinter den verwelkten Rosensträuchern verschwunden, als habe ihn der tiefhängende Nebel verschluckt.
Bitte, lieber Gott, mach, dass ihm nichts zustößt!
Die kühle Luft des Pazifiks lässt mich frösteln, doch das ist nichts, verglichen mit der Kälte, die ich in meinem Herzen empfinde. Ich renne den mit Austern- und Venusmuschelschalen bestreuten Weg entlang, die scharfen Kanten schneiden mir in die nackten Füße, dann stürme ich über den Bootsanleger bis dorthin, wo die glitschigen Planken im Nebel verschwinden. »Noah!« Um Himmels willen! »Noah!«
Niemand da.
Die Pier ist leer.
Er ist verschwunden.
Verschluckt vom Nebel.
»Noah! Noah!« Ich stehe auf dem Anleger und rufe seinen Namen. Tränen laufen mir übers Gesicht, Blut tropft von meiner zerschnittenen Hand ins brackige Wasser. »Noah!«
Die Brandung umspült die Pier und bricht sich tosend am Ufer.
Mein Junge ist fort.
Verschlungen von der See, in Luft aufgelöst – ich weiß es nicht.
»Nein, nein … nein!« Verzweifelt sinke ich auf die Planken, starre ins Wasser und überlege, ob ich in die dunklen, eisigen Tiefen springen und meinem Leben ein Ende setzen soll. »Noah … bitte. Gott, beschütze ihn …«
Mein Gebet verweht im Wind.
Dann wache ich auf.
Ich liege in meinem Bett, in dem Raum, der schon seit Ewigkeiten mein Schlafzimmer ist.
Im ersten Augenblick verspüre ich Erleichterung. Ein Traum … es war nur ein Traum. Ein schrecklicher Alptraum.
Dann trifft mich die Erkenntnis, dass ich mich irre.
Plötzlich ist mein Herz wieder schwer.
Tränen brennen in meinen Augen.
Ich weiß es.
Ich weiß, dass mein Sohn wirklich fort ist. Verschwunden. Es ist jetzt zwei Jahre her, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe.
Auf dem Anleger?
In seinem Bettchen?
Beim Spielen, draußen, unter den Tannen?
Du liebe Güte, denke ich niedergeschlagen und mit schmerzendem Herzen.
Ich kann mich nicht erinnern.
Kapitel eins
Ich meine es ernst, du darfst das keiner Menschenseele erzählen«, flüsterte eine rauchige Frauenstimme. »Ich könnte meinen Job verlieren.«
Ava Garrison öffnete ein schlaftrübes Auge. Von ihrem Bett aus hörte sie die Stimme hinter der schweren Eichentür, die einen Spaltbreit offen stand.
»Sie hat keine Ahnung, was los ist«, stimmte eine weitere Frau zu. Ihre Stimme war tiefer als die erste, und Ava meinte zu wissen, wem sie gehörte. Pochender Kopfschmerz machte sich hinter ihren Augen bemerkbar, wie immer, wenn sie einen Alptraum gehabt hatte. Der Schmerz würde nachlassen, doch in den ersten Minuten nach dem Aufwachen hatte sie stets das Gefühl, eine Horde eisenbeschlagener Pferde galoppiere durch ihr Gehirn.
Sie holte tief Luft und blinzelte. Im Zimmer war es dunkel, die Vorhänge waren vorgezogen, das Rumpeln der uralten Heizung übertönte das Gespräch der beiden Frauen. Ava konnte nur einzelne Fetzen verstehen.
»Schscht … sie müsste bald aufwachen …«, sagte die rauchige Stimme. Ava versuchte, sie einer Person zuzuordnen, und kam auf Demetria, Jewel-Annes griesgrämige Pflegerin. Obwohl sie noch keine dreißig war, trug die großgewachsene, hagere Demetria stets einen mürrisch-strengen Ausdruck zur Schau, der zu ihrem schwarz gefärbten, straff im Nacken zusammengefassten Haar passte. Ihr einziges Zugeständnis an die Launen der Jugend war eine Tätowierung, eine tintenblaue Ranke, die sich unter der breiten Schildpatthaarspange hervorringelte und hinter ihrem Ohr auslief. Das Tattoo erinnerte Ava an einen schüchternen Kraken, der vorsichtig einen Arm aus seinem Versteck hervorstreckte.
»Also, was gibt’s? Was ist los mit ihr?«, fragte die zweite, tiefere Stimme ein wenig barsch. Oh, mein Gott, gehörte sie tatsächlich Khloe? Ava verspürte einen Stich ob dieses Vertrauensbruchs. War es möglich, dass Khloe sie so hinterging? Sie wusste, dass die beiden Frauen über sie sprachen. Khloe war einst ihre beste Freundin gewesen, sie waren zusammen auf dieser abgeschiedenen Insel aufgewachsen. Doch das war schon Jahre her, lange bevor sich die frische, unbekümmerte Khloe in eine unglückliche Seele verwandelt hatte. Sie konnte einfach nicht ihre große Liebe vergessen, die bei einem Unfall so abrupt aus dem Leben gerissen worden war.
Weiteres Geflüster …
Natürlich. Es war fast so, als wollten die zwei, dass sie ihr Gespräch mit anhörte.
Ava bekam nur einzelne Fetzen mit, die ebenso zusammenhanglos wie wahr waren.
»… verliert langsam den Verstand …« Khloe?
»Das geht doch schon seit Jahren so. Armer Mr. Garrison.« Die rauchige Stimme.
Armer Mr. Garrison? Meinte sie das ernst?
Khloe, wenn sie es denn war, stimmte ihr zu. »Er leidet wirklich sehr.«
Wyatt? Leiden? Ach. Der Mann, der sich alle Mühe gibt, dir auszuweichen, weg ist, immer nur weg? Der Mann, von dem du dich bei mehr als einer Gelegenheit hast scheiden lassen wollen? Ava bezweifelte, dass ihr Ehemann auch nur einen einzigen Tag seines Lebens gelitten hatte. Am liebsten hätte sie sich bemerkbar gemacht, doch sie wollte hören, was die Frauen noch sagten, welcher Klatsch in den langen Fluren von Neptune’s Gate kursierte, diesem hundert Jahre alten Haus, errichtet und benannt von ihrem Ururgroßvater.
Neptune’s Gate – die Pforte des römischen Meeresgottes.
»Nun, etwas muss doch passieren, die sind doch reicher als Gott!«, murmelte eine der Frauen. Ihre Worte verklangen, als würde sie sich von der Tür entfernen.
»Um Himmels willen, sprich leise! Die Familie sorgt immerhin dafür, dass sie die bestmögliche Pflege bekommt …«
Die Familie?
Avas Kopf hämmerte, als sie die dicke Federdecke abwarf und mit nackten Füßen auf den flauschigen Teppich trat, der auf dem Hartholzboden lag. Tannen … Der Boden war aus Tannenholz, fiel ihr ein, die Planken zugesägt von der Sägemühle, die einst das Herz von Church Island gewesen war. Derselbe Ururgroßvater, der Neptune’s Gate erbaut hatte, hatte auch der Insel ihren Namen gegeben.
Ein Schritt, zwei … Ava verlor das Gleichgewicht und klammerte sich an den hohen Bettpfosten.
»Die Familie braucht Antworten …«
»Brauchen wir die nicht alle?« Ein leises, boshaftes Kichern.
Bitte, lieber Gott, mach, dass das nicht Khloe ist.
»Aber uns gehört nichts von dieser verfluchten Insel.«
»Das wäre was … wenn sie uns gehörte, meine ich.« Die Stimme klang sehnsüchtig.
Ava machte einen weiteren Schritt und spürte, wie ihr übel wurde. Sie schmeckte Galle auf der Zunge und fürchtete schon, sich übergeben zu müssen, doch dann schluckte sie mühsam, holte tief Luft und unterdrückte den Brechreiz.
»Sie ist völlig durchgedreht, trotzdem wird er sie nicht verlassen«, sagte eine der beiden Frauen jetzt. Ava verharrte in der Bewegung und verfluchte im Stillen ihre getrübte Erinnerung, ihr umwölktes Gehirn.
Früher einmal war sie blitzgescheit gewesen, hatte stets zu den Klassenbesten gezählt. Und später war sie eine tüchtige Geschäftsfrau gewesen.
Mit zusammengebissenen Zähnen tappte sie weiter bis zur Tür und spähte vorsichtig hinaus. Zwei Frauen gingen zur Treppe in der Mitte der Galerie. Keine von beiden war Khloe, wie Ava befürchtet hatte. Ava sah Virginia Zanders, Khloes Mutter, eine Frau, in die ihre Tochter zweimal hineingepasst hätte. Sie war die Köchin von Neptune’s Gate. Die andere Frau war Graciela, die aushilfsweise als Hausmädchen arbeitete. Als habe sie gespürt, dass Ava in der Tür stand, warf sie einen Blick über die Schulter. Ihr Lächeln war so sacharinsüß wie der Eistee, den Virginia an heißen Sommertagen zubereitete. Anders als ihre Begleiterin war Graciela klein und zierlich, ihr glänzend schwarzes Haar hatte sie im Nacken zu einem Knoten geschlungen. Wenn sie wollte, konnte Graciela so strahlend lächeln, dass es den Zuckerguss eines M&M’s zum Schmelzen gebracht hätte. Heute erinnerten ihre Lippen eher die der Grinsekatze aus Alice im Wunderland - als hüte sie irgendein großes, dunkles Geheimnis.
Über ihren Arbeitgeber. Oder ihre Arbeitgeberin.
Die Härchen auf Avas Unterarmen sträubten sich. Ein Frösteln rieselte ihr das Rückgrat hinunter. Gracielas dunkle Augen funkelten rätselhaft, dann verschwand sie mit Virginia die Treppe hinunter. Ihre Schritte verklangen.
Mit einem Ruck zog Ava die Tür zu und wollte automatisch absperren, aber das Schloss fehlte. An seiner Stelle hatte man eine optisch passende Scheibe angebracht, um das Loch in der Tür zu verdecken.
»Gott steh mir bei«, flüsterte sie, überlegte kurz, ob sie die Kommode davorschieben sollte, doch dann lehnte sie sich bloß mit dem Rücken gegen das Türblatt und atmete tief durch, um sich zu beruhigen.
Lass dich nicht unterkriegen. Lass nicht zu, dass sie dich zum Opfer machen. Wehr dich!
»Wogegen?«, fragte sie ins dunkle Zimmer hinein, dann tappte sie hinüber zu den Fenstern, abermals verärgert über ihren benebelten Zustand. Wann war sie ein solcher Schwächling geworden? Wann? War sie nicht immer stark gewesen? Unabhängig? Ein Mädchen, das mit seiner Stute auf den Klippen oberhalb des Meeres entlanggaloppiert war, das die steilsten Gipfel auf dieser Insel erklommen hatte, das nackt in den eisigen, schäumenden Wassern des Pazifiks geschwommen war, dort, wo sie in die Bucht hineinstrudelten? Sie war gesurft, geklettert und … und nun kam es ihr so vor, als sei das tausend, nein, Millionen Jahre her. Mindestens.
Jetzt war sie hier gefangen, in diesem Zimmer, während all die gesichtslosen Leute um sie herum mit gedämpften Stimmen sprachen und davon ausgingen, sie könne sie nicht hören, doch sie hörte sie. Natürlich hörte sie sie!
Manchmal fragte sie sich, ob die anderen wussten, dass sie wach war, ob sie das absichtlich taten. Vielleicht waren ihre ganzen Beileidsbekundungen, das Mitgefühl, das sie ihr entgegenbrachten, nichts als Fassade, und sie war gefangen in diesem grauenvollen Labyrinth, aus dem es kein Entrinnen gab.
Sie vertraute niemandem. Doch dann fiel ihr ein, dass all das zu ihrem Krankheitsbild gehörte, zu ihrer Paranoia.
Taumelnd kehrte sie zum Bett zurück und ließ sich auf die weiche Matratze mit der teuren Bettwäsche fallen. Hoffentlich klang der Kopfschmerz bald ab. Sie versuchte, den Kopf zu heben, doch das tat so weh, dass sie anfing zu zittern. Sie musste sich auf die Lippe beißen, um nicht laut aufzuschreien.
Niemand sollte so leiden müssen. Gab es dafür keine Schmerztabletten? Migränemittel? Andererseits nahm sie schon so viele Medikamente, weshalb sie sich manchmal fragte, ob der Kopfschmerz nicht genau daher rührte.
Sie verstand nicht, warum offenbar alle darauf aus waren, sie zu quälen, sie glauben zu machen, sie sei verrückt. Und sie war sich ziemlich sicher, dass sie sich das nicht nur einbildete. Alle steckten unter einer Decke: die Pflegerinnen, die Ärzte, das Hausmädchen, die Anwälte und Wyatt, ja, allen voran ihr Ehemann.
Mein Gott, klang das paranoid.
Vielleicht war sie tatsächlich verrückt.
Sämtliche Kräfte zusammennehmend, stieg Ava erneut aus dem Bett. Irgendwann würde der Schmerz schon vergehen. Das tat er doch immer. Nur beim Aufstehen war es die Hölle.
Vorsichtig durchquerte sie das Zimmer, trat an eines der Fenster, schob die Vorhänge zurück und öffnete die Jalousien.
Es war ein grauer, trüber Tag, genau wie damals, als … als Noah …
Nein, denk nicht daran! Es bringt nichts, wenn du dich immer wieder mit der Erinnerung an die schlimmsten Momente deines Lebens peinigst!
Sie blinzelte, zwang ihre Gedanken, in die Gegenwart zurückzukehren, und starrte durch das schlierige Bleiglas im ersten Stock dieses alten, ehedem prachtvollen Herrenhauses. Der Herbst ging in den Winter über, und sie kniff die Augen gegen das Zwielicht zusammen. Ihr Blick fiel auf den Anleger, der umwabert war von Nebelschwaden.
Es war gar nicht Morgen, es war fast Abend, wurde ihr klar, wenngleich ihr das merkwürdig vorkam. Hatte sie tatsächlich so lange geschlafen, Stunden … Tage vielleicht?
Zerbrich dir deswegen nicht den Kopf, jetzt bist du ja wach.
Sie legte eine Hand auf die kühle Scheibe. Langsam nahm sie die Umgebung deutlicher wahr. Das Holz des Bootshauses am Ufer war mit den Jahren grau geworden, der Anleger, der daneben in das vom Wind aufgewühlte Wasser der Bucht führte, ebenfalls. Die Flut kam, schäumende Wellen rollten an die Küste.
Genau wie an jenem Tag …
Ein Schauder, kalt wie die Tiefen des Meeres, überlief sie, ein Frösteln, das tief aus ihrem Innern kam.
Das Fenster beschlug von ihrem Atem, als sie die Stirn gegen das Glas lehnte.
Sie spürte den vertrauten Kloß in ihrem Hals, wusste, was nun kommen würde.
»Bitte …«
Die Augen zusammengekniffen, starrte sie auf das Ende der Pier.
Und da war er, ihr kleiner Sohn, am Rande des Abgrunds, ein geisterhafter Schemen im Nebel.
»Noah«, flüsterte sie, plötzlich außer sich vor Angst. Ihre Finger glitten voller Panik die Scheibe hinab. »O Gott, Noah!«
Er ist nicht hier. Dein angeschlagener Verstand spielt dir einen Streich.
Doch sie durfte es nicht darauf ankommen lassen. Was, wenn diesmal, dieses eine Mal, wirklich ihr Junge auf dem Anleger stand? Er trug seinen roten Kapuzenpullover und hatte ihr im feuchten Nebel den Rücken zugedreht. Ihr Herz zog sich schmerzhaft zusammen.
»Noah!«, rief sie und hämmerte gegen das Glas. »Noah! Komm zurück!«
Hastig versuchte sie, das Fenster zu öffnen, doch anscheinend hatte man es zugenagelt.
»Komm schon, bitte!«, schrie sie und zerrte mit aller Kraft am Rahmen. Ihre Fingernägel brachen. Das verdammte Fenster gab keinen Millimeter nach. »Oh, mein Gott …«
Barfuß, beflügelt von ihrer Furcht, riss sie die Tür auf, stürzte aus ihrem Zimmer und den Gang entlang zur Hintertreppe, ihre nackten Füße klatschten auf den glatten Holzboden. Runter, runter, runter … Eine Hand am Geländer, flog sie die Stufen hinab. Noah, mein lieber, süßer Junge. Noah!
Unten angekommen, rannte sie in die Küche, dann zur Hintertür hinaus, über die windgeschützte Veranda, durch den riesigen Garten und weiter Richtung Ufer.
Jetzt konnte sie laufen. Schnell sogar. Die Abenddämmerung senkte sich herab.
»Noah!«, rief sie, während sie über die grasüberwucherten Wege rannte, an verwelkten Rosenbüschen und tropfnassen Farnen vorbei zur Pier, deren Ende vom Nebel und der Dunkelheit verschluckt war. Keuchend stieß sie den Namen ihres Sohnes hervor, verzweifelt und doch voller Hoffnung, dass er aus dem Nebel auftauchen und sie mit seinen großen, vertrauensvollen Augen anschauen würde …
Der Anleger war leer. Die Nebelschwaden warfen zuckende Schatten aufs Wasser, in der Ferne kreischten Möwen.
»Noah!«, schrie sie und rannte über die schlüpfrigen Planken. »Noah!«
Sie hatte ihn gesehen, ganz bestimmt!
O Liebling … »Noah, wo bist du?«, fragte sie schluchzend, als sie das Ende der Pier erreicht hatte. »Ich bin’s, Schätzchen, Mama …«
Ein letzter gehetzter Blick über den Anleger und das Bootshaus bestätigten ihr, dass er nicht da war. Ohne zu zögern sprang sie ins eisige Wasser. Die Kälte fuhr ihr in die Glieder, sie schmeckte Salzwasser auf ihren Lippen, während sie hektisch mit Armen und Beinen ruderte und verzweifelt nach ihrem Sohn Ausschau hielt.
»Noah!«
»Du lieber Himmel, wo kann er nur sein?«
Sie tauchte unter, kam hustend und spuckend wieder an die Oberfläche. Nichts. Trotzdem tauchte sie wieder und wieder unter, in der Hoffnung, ihn in der trüben, dunklen Tiefe zu entdecken.
Lieber Gott, bitte mach, dass ich ihn finde. Bitte hilf mir, ihn zu retten! Lass ihn nicht sterben! Er ist doch ein unschuldiges Kind!
Ihr Nachthemd bauschte sich auf der Wasseroberfläche, sie hatte ihr Haarband verloren, nun schwebten die langen Haare wie ein Fächer um ihren Kopf. Langsam machte sich die Erschöpfung bemerkbar. Als sie wieder einmal auftauchte, stellte sie fest, dass sie ein gutes Stück vom Anleger abgetrieben war. Plötzlich meinte sie, eine Stimme zu vernehmen.
»He!«, rief ein Mann. »He, Sie da draußen!«
Sie tauchte erneut unter, zwang sich, die vom Salzwasser brennenden Augen zu öffnen und die Luft anzuhalten, bis sie das Gefühl hatte, ihre Lungen würden zerreißen. Wo ist er? Noah, o Gott, mein Kleiner … Sie spürte, wie ihr schwindelig wurde, doch sie durfte jetzt nicht aufhören zu suchen. Musste ihren Sohn finden … Das Wasser um sie herum wurde dunkler und kälter. Noch immer keine Spur von Noah.
Plötzlich war jemand neben ihr.
Starke Arme umschlossen ihren Brustkorb. Sie war schwach, stand kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren, als sie an die Oberfläche gezogen wurde.
Hustend schnappte sie nach Luft, spuckte Salzwasser aus und blickte in das ernste, entschlossene Gesicht eines Fremden.
»Sind Sie verrückt geworden?«, fragte er. Doch bevor sie eine Antwort geben konnte, knurrte er: »Ach, zum Teufel!«, und fing an, sie mit kräftigen Beinschwüngen zum Ufer zurückzuschleppen. Im hüfthohen Wasser angekommen, wurde ihr klar, wie weit sie von der Pier abgetrieben war. Der Mann ließ sie los, stützte sie nur noch mit einem Arm und half ihr durch die ausrollenden Wellen ans sandige Ufer.
Ihre Zähne klapperten, und sie zitterte am ganzen Körper, doch Ava fühlte nichts außer ihrer tiefen, alles überwältigenden Trauer. Sie schluckte mühevoll, schmeckte das Salz auf ihren Lippen, dann endlich sah sie ihren Retter an. Wer mochte er sein? Sie war ihm noch nie zuvor begegnet.
Oder doch? Er kam ihr vage vertraut vor, dieser etwa dreißigjährige, ungefähr eins fünfundachtzig große Mann mit seinem nassen, langärmeligen Hemd und den durchweichten Jeans. Er wirkte abgehärtet, rau, als hätte er die größte Zeit seines Lebens draußen verbracht.
»Was haben Sie sich bloß dabei gedacht?«, schimpfte er und wischte sich das widerspenstige Haar aus den Augen. »Sie hätten ertrinken können!« Und dann: »Ist alles in Ordnung?«
Natürlich nicht. Gar nichts war in Ordnung. Und sie war sich absolut sicher, dass nichts mehr jemals auch nur ansatzweise wieder in Ordnung kommen würde.
»Ich bringe Sie ins Haus.« Ohne ihren Arm loszulassen, half er ihr den Weg zum Herrenhaus hinauf, vorbei an seinen Stiefeln, die er scheinbar hastig ins Gras geworfen hatte.
»Wer sind Sie?«, fragte sie.
Er musterte sie von oben bis unten. »Austin Dern.« Als sie nicht reagierte, fuhr er fort: »Und Sie sind Ava Garrison? Ihnen gehört diese Insel?«
»Ein Teil davon.« Sie wrang das kalte Salzwasser aus ihren Haaren.
»Der Großteil davon«, korrigierte er und blickte sie mit zusammengekniffenen Augen an. Sie bibberte. »Und Sie wissen nicht, wer ich bin?«
»Nein. Ich habe keinen blassen Schimmer.« Obwohl sie unter Schock stand, merkte sie, wie sehr er sie verunsicherte.
Er murmelte etwas Unverständliches, dann sagte er: »Nun, das ist interessant. Sie haben mich angestellt. Erst letzte Woche.«
»Ich?« O Gott, hatte sie wirklich ein so schlechtes Erinnerungsvermögen? Konnte das wirklich sein? Kopfschüttelnd ließ sie sich von ihm zum Haus führen. Eisiges Wasser lief ihr das Rückgrat hinunter. »Das kann ich mir nicht vorstellen.« Sie hätte sich mit Sicherheit an ihn erinnert.
»Genau genommen war es Ihr Ehemann.«
Oh. Wyatt. »Ich vermute, er hat vergessen, mich davon in Kenntnis zu setzen.«
»Tatsächlich?« Wieder musterte er sie eindringlich, und für einen kurzen Augenblick fragte sie sich, ob ihr tropfnasses Nachthemd womöglich durchsichtig war.
»Na dann«, sagte sie, seine zweifelnde Frage ignorierend, »herzlich willkommen.«
Er lächelte nicht. Sie betrachtete seine harten Züge in der zunehmenden Dunkelheit: tiefliegende Augen, deren Farbe im Dämmerlicht nicht auszumachen war, markantes Kinn mit Bartschatten, rasiermesserdünne Lippen und eine leicht schiefe Nase. Sein Haar war dunkel wie die Nacht, tiefbraun oder schwarz.
Plötzlich flog die Fliegengittertür zur hinteren Veranda auf und schlug mit einem Knall hinter einer Frau wieder zu, die aus dem Haus gestürzt kam.
»Ava? Oh, mein Gott, Ava! Was ist passiert?«, rief Khloe ihnen entgegen. Auf ihrem Gesicht spiegelte sich Sorge wieder. »Lieber Himmel, du bist ja klatschnass!«
Austin Dern lockerte seinen Griff um Avas Arm.
»Was um Himmels willen hast du getan?« Khloes Gesichtsausdruck schwankte zwischen Mitleid und Furcht. »Oh, sag nichts. Ich weiß es.« Sie drückte Ava an sich; es schien ihr nichts auszumachen, dass ihre eigenen Sachen nass wurden. »Du musst damit aufhören, Ava. So kann das nicht weitergehen. Komm, ich bringe dich ins Haus.« Ihre Augen richteten sich auf den Fremden, und sie fügte hinzu: »Sie auch. Du liebe Güte, ihr seid ja beide nass bis auf die Knochen!«
Khloe und der Fremde wollten Ava den Muschelschalenweg zum Haus hinaufführen, doch sie schüttelte ihre helfenden Hände ab und erschreckte dabei Virginias schwarzen Kater, Mr. T., der sich hinter einem Rhododendronstrauch versteckt hatte. Fauchend schoss er unter die Veranda, gerade als Avas Cousin Jacob aus seiner Räuberhöhle vom Apartment im Souterrain des alten Hauses herbeigeeilt kam.
Etwas von Avas altem Schneid kehrte zurück. Sie hatte es satt, das Opfer zu sein und mitleidsvoll angestarrt zu werden, war der wissenden Blicke überdrüssig, die die anderen sich zuwarfen, als wollten sie sagen: »Die Arme.« Sie hielten sie für verrückt.
Na und?
Es war schließlich nicht so, als hätte sie ihre geistige Gesundheit nicht selbst infrage gestellt, das letzte Mal vor ein paar Minuten, trotzdem ging ihr die allgemeine Besorgnis langsam mächtig auf die Nerven.
»Was ist passiert?«, wollte Jacob wissen. Seine Brille saß schief, sein rötliches Haar war zerzaust, als habe er geschlafen.
Ava ignorierte ihn, genau wie die anderen, und stieg tropfend die Stufen hinauf, das Nachthemd klebte an ihrem Körper. Sollten sie doch denken, was sie wollten! Sie wusste, dass sie Noah gesehen hatte, ganz egal, was Khloe oder der Cowboy von Retter dachten, ganz egal, was diese nervtötende Seelenklempnerin, Ms. Evelyn McPherson, dachte: Sie war nicht verrückt. War nie verrückt gewesen. War nicht reif für die Klapsmühle.
»Warte, ich helfe dir«, versuchte Khloe es erneut, doch Ava wehrte ab.
»Danke, es geht schon.«
»Du bist gerade in den Ozean gesprungen, Ava! Ich glaube nicht, dass du jetzt allein sein solltest!«
»Lass mich einfach in Ruhe, Khloe.«
Khloe warf Dern einen Blick zu, dann trat sie mit erhobenen Händen einen Schritt zurück. »Na gut.«
»Kein Grund, melodramatisch zu werden«, murmelte Ava.
»Ach, jetzt bin ich also die Dramaqueen!« Khloe seufzte. »Nur fürs Protokoll: Wer hat sich vor ein paar Minuten in die Fluten gestürzt?«
»Schon gut, schon gut.« Ava öffnete die Fliegengittertür. »Ich hab’s kapiert.« Die Wärme im Haus, der würzige Duft nach Tomaten und Muscheln, der durch die Flure wehte, traf sie wie ein Schlag. Sie eilte an der Reihe von Fenstern vorbei, die auf den Garten hinausgingen, dann blieb sie stehen und warf einen raschen Blick nach draußen. Abgesehen von ein paar Außenlaternen war es mittlerweile völlig dunkel, der Nebel zu dicht, um die Pier auch nur als Schemen sichtbar zu machen. Ihr Herz schmerzte bei dem Gedanken an ihren Sohn, doch sie verdrängte ihren Kummer.
Zumindest hatte der Kopfschmerz nachgelassen; zwar war er nicht vollständig verschwunden, doch er hämmerte nicht mehr ganz so heftig gegen ihre Stirn. Sie konnte wieder klarer denken. In der Küche schlug die Fliegengittertür zu. Sie wusste, dass ihre Konfrontation mit Khloe und womöglich auch mit dem Mann, der sie aus dem Wasser gezogen hatte, noch nicht vorbei war.
Super. Genau das, was sie jetzt brauchte!
Mit heftig klappernden Zähnen lief sie durchs Foyer, als sie plötzlich den Fahrstuhl neben der Haupttreppe hörte, der sich rasselnd in Bewegung setzte. Zischend glitten die Türen auseinander.
Sie betete, dass nicht Jewel-Anne zum Vorschein kommen würde, doch natürlich hatte sie Pech. Ihre pummelige Cousine rollte mit ihrem elektrischen Rollstuhl heraus und warf der nassen, durchgefrorenen Ava durch ihre dicken Brillengläser einen wissenden Blick zu.
»Na, warst du wieder schwimmen?«, fragte sie mit dem selbstgefälligen Grinsen, das Ava ihr am liebsten aus dem Gesicht gewischt hätte. Jewel-Anne zog einen Ohrhörer ihres iPhones aus dem Ohr, und Ava vernahm die Klänge von Elvis’ »Suspicious Minds«, die aus dieser Entfernung blechern klangen.
»We’re caught in a trap«, trällerte er, und Ava fragte sich, wie eine Frau, die lange nach dem Tod der Rock-’n’-Roll-Legende auf die Welt gekommen war, ein so fanatischer Fan hatte werden können. Im Grunde kannte sie die oberflächliche Antwort, denn sie hatte ihrer Cousine diese Frage erst im vergangenen Jahr gestellt. Jewel-Anne hatte, einen Ohrhörer eingesteckt, ihre Haferflocken gegessen und sie mit todernstem Gesicht angesehen. »Wir haben am selben Tag Geburtstag«, hatte sie verkündet und einen zweiten gehäuften Esslöffel braunen Zucker über ihre Zerealien gegeben. Irgendwie war es Ava gelungen, sich eine sarkastische Bemerkung zu verkneifen. Stattdessen erwiderte sie nur: »Du warst doch noch gar nicht geboren, als …«
»Er spricht mit mir, Ava!« Jewel-Anne presste die Lippen aufeinander. »Er war eine so tragische Persönlichkeit« – sie widmete sich wieder ihrem süßen, kalorienreichen Frühstück –, »genau wie ich.«
Nach einer Weile hatte sie aufgeschaut und Ava mit einem unschuldigen Blick bedacht, der dieser wie immer einen Stich versetzte. Wie jedes Mal war es ihrer querschnittsgelähmten Cousine gelungen, schwere Schuldgefühle in ihr hervorzurufen.
Du bist nicht die Einzige, zu der er spricht, hätte sie am liebsten gesagt. Jeden Tag berichten Hunderte Leute von Elvis-Erscheinungen, und vermutlich »plaudert« er auch mit diesen Irren. Anstatt jedoch einen endlosen Streit vom Zaun zu brechen, hatte sie ihren Stuhl zurückgeschoben, die Reste ihres Frühstücks in den Abfalleimer geleert und ihre Schüssel in die Spülmaschine gestellt, gerade als Jacob, Jewel-Annes einziger Vollbruder, in die Küche geschlendert kam. Ohne ein Wort zu sagen, nahm er sich einen getoasteten Bagel und spazierte zur Hintertür hinaus, den Rucksack über die breite Schulter gehängt. Früher einmal war er einer der landesbesten Ringer gewesen, doch inzwischen hatte sich Jacob, der ewige Student, mit seinem lockigen roten Haar und dem aknenarbigen Gesicht, in einen absoluten Computerfreak verwandelt, der schon genauso merkwürdig war wie seine Schwester.
Die gerade wieder einmal versuchte, die bibbernde Ava von ihrer Verbindung mit dem King of Rock ’n’ Roll zu überzeugen. Ja, sicher, Elvis spricht zu Jewel-Anne. Rasch wandte sich Ava der Treppe zu und lief, zwei Stufen auf einmal nehmend, hinauf.
Warum sollte sie sich Gedanken um ihre geistige Gesundheit machen, wenn sie inmitten einer Gruppe von Menschen lebte, die irgendwann mit Sicherheit durchdrehen würden – wenn sie nicht längst verrückt waren?
Kapitel zwei
Das Licht flackerte zweimal, als Ava unter der heißen Dusche stand. Jedes Mal, wenn es im Badezimmer dunkel wurde, zuckte sie zusammen und legte eine Hand auf die geflieste Wand, doch zum Glück fiel der Strom nicht aus. Gott sei Dank. Das war das Problem mit dieser Insel vor der Küste von Washington. Sie hatten keine Verbindung zum Festland außer mit Booten: mit ihrem Privatboot, einem schnittigen Kajütenkreuzer, den Wyatt angeschafft hatte, einem Ruderboot, mit dem man es nicht wirklich bis auf die andere Seite schaffte, oder mit der Fähre, die zweimal am Tag nach Anchorville übersetzte, vorausgesetzt, das Wetter erlaubte es.
Ava wusste, dass Church Island eine Zufluchtsstätte für ihre Ururgroßeltern gewesen war, die sich hier niedergelassen und den Großteil der Insel erworben hatten. Mit Holzfällerei und ihrer Sägemühle hatten die beiden ein Vermögen gemacht. Als weitere Menschen auf die Insel gezogen waren, hatte Stephen Monroe Church ihnen Bauholz und Vorräte geliefert, und – was das Wichtigste war – Arbeit gegeben.
Ava hatte sich immer gefragt, warum die Leute damals wohl nach Church Island gekommen waren. Warum hatten sie die Annehmlichkeiten des Festlands aufgegeben? Welches Ziel hatten sie vor Augen gehabt, oder, was wahrscheinlicher war, wovor waren sie davongelaufen?
Wie auch immer ihre Gründe ausgesehen haben mochten, sie hatten Stephen und seiner Frau Molly dabei geholfen, dieses grandiose Zuhause zu errichten, mit zwei Treppen, zwei Stockwerken – Erdgeschoss und Obergeschoss -, mit ausgebautem Dachboden samt den ehemaligen Dienstbotenquartieren sowie mit dem Untergeschoss, das heute nicht nur Jacobs Apartment beherbergte, sondern auch Lagerräume und Wyatts Weinkeller. Errichtet im viktorianischen Stil an einem der höchsten Punkte der Insel, bot Neptune’s Gate von dem westlichen Türmchen aus, das sich über dem Witwensteg erhob, eine Dreihundertsechzig-Grad-Aussicht. Der Witwensteg – so nannte man früher in Kapitänshäusern einen Aussichtspunkt, eine Art Balkon hoch oben auf dem Dach, von dem aus die Frauen nach ihren zur See fahrenden Männern Ausschau hielten. Soweit Ava wusste, war ihr Ururgroßvater Kapitän gewesen und hatte die Sägemühle erst später errichtet. Doch nicht nur vom Witwensteg aus hatte man einen fantastischen Blick aufs Meer, sondern auch aus den vielen Fenstern, die im Sommer das Licht der Sonne reflektierten. Jetzt, um diese Jahreszeit, in der Nebel und Regen, Graupel und Hagel vorherrschten, brachen sich die hellen Strahlen nur selten darauf.
Mit Lavendelseife und einem garantiert milden Shampoo wusch sich Ava Salz und Schmutz von Haut und Haaren. Das angenehm warme Wasser spülte die Furcht fort, die ihre Seele zu zerreißen drohte, linderte den Kummer und die Sorge um ihren verschwundenen Sohn.
Was hatte sie sich vorhin nur gedacht?
Noah war nicht auf der Pier gewesen.
Es war ihr getrübter Verstand, der ihr bereitwillig Streiche spielte, Überbleibsel des Traumes, die sie verwirrten.
Trotzdem wollte das Bild des Kleinen, wie er im wabernden Nebel auf dem Anleger stand, nicht weichen. Es war so unheimlich real.
Es ist nun zwei Jahre her … du musst loslassen …
Sie duschte den Schaum ab und stellte sich ihren Sohn als Vierjährigen vor, denn so alt wäre er jetzt, würde er noch leben.
Tränen stiegen ihr in die Augen, sie verspürte einen Kloß im Hals. Abrupt drehte sie sich um und wandte ihr Gesicht dem Wasserstrahl zu, damit er die Tränen fortspülte.
Als sie sich angezogen und die Knoten aus dem Haar gekämmt hatte, fühlte sie sich besser. Entspannter. Als stünde sie nicht länger mit einem Fuß über dem seelischen Abgrund.
Sie kam gerade aus dem Bad, als sie ein Klopfen an ihrer Schlafzimmertür vernahm.
»Ava?«, rief eine leise Männerstimme, dann öffnete sich die Tür, und Wyatt, ihr Ehemann, erschien auf der Schwelle.
»Ich dachte, du seist in Seattle«, sagte sie.
»Portland.« Er lächelte schief. Sein Gesicht drückte Besorgnis aus, sein hellbraunes Haar war zerzaust, als habe er mit den Fingern darin herumgewühlt.
»Oh. Richtig.« Sie erinnerte sich, dass er nach Süden gefahren war. Sein Kunde aus Seattle besaß Immobilien in Oregon, gegen ihn lief irgendeine Klage.
»Egal.« Wyatt machte einen Schritt auf sie zu. Sie spürte, wie sie sich verspannte, aber sie wich nicht zurück, nicht einmal, als er ihr eine verirrte Locke aus der Stirn strich. Seine Fingerspitzen fühlten sich auf ihrer Haut warm und vertraut an.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte er und sah sie mit seinen haselnussbraunen Augen besorgt an. Immer wieder dieselbe Frage. Es war gleichgültig, wie sie darauf antwortete, es hatte ohnehin jeder längst seine eigenen Schlüsse gezogen.
»Ich würde deine Frage gern bejahen, aber …« Sie presste die Handflächen gegeneinander. »Sagen wir mal, es geht mir besser als vor einer Stunde.«
Sie dachte daran, wie sie sich in ihn verliebt hatte, zumindest hatte sie geglaubt, sie sei in ihn verliebt. Sie hatten sich auf dem College kennengelernt … auf einer kleinen Privathochschule in der Nähe von Spokane vor mehr als zehn Jahren. Er war ein gutaussehender, athletischer junger Mann gewesen und höllisch sexy, was sich mit den Jahren nicht geändert hatte. Selbst jetzt, mit seinem zerstrubbelten Haar und dem Bartschatten, sah er gut aus. Stattlich. Um nicht zu sagen umwerfend. Ein kühner, entschlossener Anwalt, der im Augenblick leicht derangiert wirkte, sein Anzug zerknittert, die Krawatte gelockert, das weiße Hemd am Hals geöffnet. Ja, Wyatt Garrison war immer noch ein äußerst attraktiver Mann.
Und sie traute ihm keinen Millimeter über den Weg.
»Was ist passiert?«, fragte Wyatt und setzte sich auf die Bettkante, auf »seine« Seite. Die Matratze gab unter dem Gewicht leicht nach.
Wie oft hatte sie in diesem Bett in seinen Armen gelegen? Wie viele Nächte hatten sie sich geliebt … Und wann hatte das aufgehört?
»Ava?«
Sie kehrte aus ihrem Tagtraum zurück. »Oh. Du weißt schon. Immer dasselbe.« Sie blickte aus dem Fenster. »Ich dachte, ich hätte Noah gesehen. Auf der Pier.«
»Ach, Ava.« Er schüttelte den Kopf. Bedächtig. Traurig. »Du musst aufhören, dich zu quälen. Er ist tot.«
»Aber –«
»Kein Aber.« Die Matratze ächzte, als er wieder auf die Füße kam. »Ich dachte, du würdest dich langsam erholen. Als sie dich aus St. Brendan entlassen haben, waren die Ärzte überzeugst, du befändest dich auf dem Weg der Genesung.«
»Vielleicht ist das ein holpriger Weg.«
»Aber er sollte keine Kehrtwendungen haben.«
»Ich war auf dem Weg der Besserung«, stellte sie fest. Sie wollte lieber nicht an das Krankenhaus denken, aus dem sie vor kurzem entlassen worden war. »Ich meine natürlich, ich bin auf dem Weg der Besserung!« Sie schluckte schwer bei der Vorstellung, in die geschlossene psychiatrische Abteilung des Krankenhauses auf dem Festland zurückkehren zu müssen. »Mir machen bloß diese Alpträume zu schaffen.«
»Hast du in letzter Zeit mit Dr. McPherson gesprochen?« Evelyn McPherson war die Psychiaterin, die Wyatt höchstpersönlich zu Avas Betreuung auserkoren hatte. Er behauptete, seine Wahl sei auf sie gefallen, da sie in Anchorville praktiziere und bereit sei, Ava auf der Insel aufzusuchen. Das ergab durchaus Sinn, doch irgendetwas an der Frau störte Ava. Es war, als höre sie ihr allzu aufmerksam zu, sei allzu besorgt.
»Natürlich habe ich mit ihr gesprochen. Hat sie dir das nicht erzählt?« Wann war das gewesen? »Erst letzte Woche.«
Seine dunklen Augenbrauen schossen ungläubig in die Höhe. »Wann letzte Woche?«
»Ähm … Freitag, glaube ich. Ja, genau, am Freitag.« Warum glaubte er ihr nicht? Und was kümmerte ihn das eigentlich? Seit Noahs Verschwinden lief ihre Ehe bestenfalls auf Sparflamme. Die meiste Zeit über hielt sich Wyatt in Seattle auf, wo er in einem Hochhaus wohnte, nur einen Steinwurf von dem Bürogebäude entfernt, in dem er als Juniorpartner einer bekannten Anwaltskanzlei arbeitete. Er hatte sich auf Steuerrecht und Kapitalanlagen spezialisiert.
Sie vermutete, dass sein Interesse an ihr nachgelassen hatte, dass sie eine Belastung für ihn war, eine »verrückte« Frau, die am besten auf der kleinen Insel vor der Küste Washingtons versteckt blieb.
»Ich hatte Angst, ich würde dich verlieren.« Er klang ernst, und für eine Sekunde schnürte sich ihre Kehle zu.
»Tut mir leid. Diesmal hat’s nicht geklappt.«
Er sah sie an, als habe sie ihm eine Ohrfeige verpasst.
»Schlechter Scherz.«
»Ein sehr schlechter.«
Sie musste unbedingt das Thema wechseln, und zwar schnell. »Du hast also Austin Dern eingestellt«, sagte sie deshalb und zog die Vorhänge zusammen.
Wyatt nickte. »Für die Tiere.« Er warf Ava einen Blick zu. »Machen wir uns doch nichts vor. Ian ist nicht gerade zum Rancharbeiter geboren, die Arbeit mit Pferden und Rindern liegt ihm nicht. Ich dachte, er könnte die Ranch weiterführen, nachdem Ned nach Arizona in den Ruhestand gegangen ist, aber ich habe mich getäuscht.«
»Ich habe mich doch immer um die Pferde gekümmert.«
»Früher einmal«, erwiderte er mit einem schwachen Lächeln. »Und selbst da warst du nicht unbedingt die Beste im Zäuneausbessern oder im Reparieren von Scheunendächern oder eingefrorenen Wasserpumpen. Dern ist Handwerker, ein richtiger Do-it-yourself-Mann.«
»Wie bist du auf ihn gekommen?«
»Er hat für einen meiner Klienten gearbeitet, der seine Ranch verkauft hat.« Wyatts linker Mundwinkel zuckte in die Höhe. »Ich wollte Ian gern ein wenig entlasten.«
»Das wird er zu schätzen wissen«, erwiderte Ava und dachte an ihren Cousin, Jewel-Annes Halbbruder. Ian war nicht gerade ambitioniert. Sie trat ans Fußende des Bettes und lehnte sich gegen einen der hohen Pfosten. »Ich bin überrascht, dass du hier bist.«
Fast unmerklich spannten sich seine Kinnmuskeln an. Fast. »Ich war ohnehin auf dem Weg hierher. Jacob hat mit dem Boot auf mich gewartet.« Jacob, Jewel-Annes Bruder, der Computerfreak, der tonnenweise Elektronik in seinem beengten Souterrain-Apartment untergebracht hatte. Eigentlich war er der Chauffeur seiner Schwester, doch seit man Ava den Führerschein abgenommen hatte, fuhr er auch sie.
»Khloe hat mich auf dem Handy angerufen«, fügte Wyatt hinzu. »Zum Glück war ich da schon kurz vor Anchorville.«
»Wie nett von ihr.«
Seine Mundwinkel verzogen sich missbilligend nach unten. »Du solltest dich mal hören. Immerhin war Khloe deine beste Freundin.«
Das stimmte. »Sie ist doch diejenige, die sich zurückgezogen hat.«
»Tatsächlich?« Er hob die Hände und schüttelte den Kopf. »Bist du dir da sicher?« Als sie nicht antwortete, fügte er mit einer Spur von Sarkasmus hinzu: »Wenn du meinst. Übrigens ist Dr. McPherson auf dem Weg hierher. Du solltest mit ihr reden.«
»Wenn du meinst«, äffte sie ihn nach, doch als sie den verletzten Ausdruck in seinen Augen bemerkte, hätte sie ihre barschen Worte am liebsten zurückgenommen.
»Ich gebe es auf.« Binnen Sekunden war er zur Tür hinaus, und wieder einmal verspürte sie einen Kloß im Hals.
»Ich auch«, flüsterte sie. »Ich auch.«
»Sie wissen, dass Sie Noah nicht wirklich gesehen haben«, sagte Dr. McPherson freundlich, wenngleich leicht herablassend. Sie war eine hübsche, schlanke Frau in Rock und Stiefeln, deren gesträhntes Haar bis auf die Schultern fiel. In ihren Augen stand Besorgnis. Meistens wirkte sie ernst, mitfühlend, doch Ava traute auch ihr nicht. Hatte ihr nie getraut. Lag das wirklich nur an ihrer Paranoia?
Jetzt saßen sie in der Bibliothek mit den vom Boden bis zur Decke reichenden Regalen voller alter Bücher. Im Kamin flackerte ein Gasfeuer.
»Ich habe ihn gesehen«, beharrte Ava. Sie saß auf der betagten Couch, die Hände im Schoß zu Fäusten geballt. »Ob er wirklich da war, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass ich ihn gesehen habe.«
»Und du weißt, wie das klingt.« Ihr Ehemann stand in einer Ecke, die Krawatte noch weiter gelockert, einen finsteren Ausdruck im Gesicht.
»Es ist mir egal, wie das klingt, es ist nun einmal die Wahrheit.« Trotzig begegnete sie Wyatts Blick. »Ich dachte, ich soll ehrlich sein.«
»Das sollen Sie auch, selbstverständlich«, beschwichtigte Dr. McPherson sie mit einem raschen Kopfnicken. Sie saß auf der Kante des Sessels, der zwischen Kamin und Sofa stand, das Licht der Flammen fing sich in ihren hellen Strähnchen. Obwohl sie ihre Praxis auf dem Festland führte, setzte sie häufig auf die Insel über, das hatte sie mit Wyatt so vereinbart.
Evelyn warf Wyatt einen Blick über die Schulter zu, und für den Bruchteil einer Sekunde meinte Ava, Zärtlichkeit darin zu erkennen, die blitzschnell wieder der Fassade wich. Vielleicht hatte sie sich auch getäuscht.
»Ich denke, es wäre das Beste, wenn Sie uns allein lassen«, schlug die Psychiaterin ihm vor.
»Es ist schon in Ordnung«, lenkte Ava ein. »Es macht mir nichts aus, wenn er dabei ist. Vielleicht können wir die Sitzung ja in eine Eheberatung umwandeln, anstatt unbedingt nachweisen zu wollen, dass ich durchgedreht bin.«
»Das hat doch niemand behauptet«, entgegnete Wyatt. Er trat ans Feuer und drehte das Gas ab. Die Flammen zogen sich zurück wie verängstigte Schnecken in ihre Häuser.
»Ich weiß, das klingt verrückt. Selbst für mich. Trotzdem sage ich euch, dass ich meinen Kleinen im Nebel auf dem Anleger gesehen habe.« Sie wollte die Überlegung hinzufügen, dass die Medikamente, die man ihr verabreichte, eventuell Halluzinationen verursachten, doch damit hätte sie die Psychiaterin in die Enge getrieben, weil sie ihr ja die Tabletten gegen ihre Angstzustände und Depressionen verschrieben hatte.
Wyatt trat hinter die Couch und drückte ihre Schulter. Liebevoll? Frustriert? Sie blickte zu ihm auf und sah nichts als Sorge in seinem Gesicht. »Du musst deine Wunschvorstellungen loslassen, Ava. Noah kommt nicht zurück.« Damit verließ er die Bibliothek und schloss leise die Tür hinter sich.
Die Psychiaterin sah ihm nach. Als die Tür zugefallen war, wandte sie sich wieder ihrer Patientin zu. »Was denken Sie, Ava, was hier vorgeht?«, fragte sie dann.
»Ich wünschte, ich wüsste es.« Ava schaute zu den Fenstern, hinaus in die Dunkelheit. »Ich wünschte bei Gott, ich wüsste es.«
Doch noch bevor sie diesen Punkt vertiefen konnten, ertönte ein Klopfen an der Tür, und Wyatt steckte erneut den Kopf ins Zimmer. »Sheriff Biggs ist da.«
»Warum?«, fragte Ava.
»Khloe hat ihn angerufen.«
»Weil ich ins Meer gesprungen bin?«
»Ja. Sie dachte, du wolltest Selbstmord begehen.«
»So ein Unsinn!«
»Du kannst es ihr nicht übel nehmen. Biggs ist ihr Onkel.«
»Na prima. Was soll das?« Sie blickte von ihrem Ehemann zur Therapeutin. »Versuchst du etwa zu erreichen, dass ich wieder eingewiesen werde?«
»Natürlich nicht.«
»Gut, denn eins solltest du wissen, Wyatt: Man muss mich keineswegs wegen Suizidgefahr unter Beobachtung stellen!«
»Davon redet doch niemand –«
»Dazu braucht es keine Worte. Ich verstehe auch so.« Sie sprang auf und eilte zur Tür. »Wo ist er?«
»In der Küche.«
Ohne etwas hinzuzufügen, ließ sie ihren Mann mit der Therapeutin allein. Sollten sie ruhig ohne sie über ihren ach-so-labilen Geisteszustand reden! Entschlossen marschierte sie durchs Esszimmer mit der angrenzenden Anrichte und Speisekammer, an deren Rückseite eine Tür zur Dienstbotentreppe führte, in die Küche. Der große, warme Raum war gelb gestrichen, es duftete nach Kaffee und Backwerk. Die schwarz-weißen Fußbodenfliesen waren abgetreten, die weißen Küchenschränke hätten dringend eines neuen Anstrichs bedurft, dennoch war dieser Raum zweifelsohne der freundlichste im ganzen Haus. Von der Küche aus führte ein Durchgang ins Wohnzimmer, in dem bequeme Sofas, ein Flachbildfernseher und eine Spielzeugkiste standen. Heute Abend hingen der Duft nach frisch gebackenem Brot und das würzige Aroma von Virginias sämiger Muschelsuppe in der Luft.
Sheriff Biggs hielt, was sein Name versprach. Er saß auf einem Stuhl, dessen Sitzfläche viel zu klein für seinen gewaltigen Leibesumfang war, vor sich auf dem großen, gesprungenen Marmortisch eine Tasse Kaffee, die Virginia ihm angeboten hatte. Virginia steckte bis zu den Ellbogen im Spülwasser und tat so, als würde sie das bevorstehende Gespräch zwischen ihrer Arbeitgeberin und Biggs, der zufällig ihr Ex-Schwager und Khloes Onkel war, nicht im Mindesten interessieren.
Wie immer trug sie ein schlichtes Hauskleid und hatte eine knallbunte Schürze vor ihre ausladende Taille und die schweren Brüste gebunden. Ausgetretene Tennisschuhe und dunkle Strümpfe vervollständigten ihren Aufzug. Ava hatte sie selten anders gekleidet gesehen; selbst Jahre zuvor, noch bevor sie in Neptune’s Gate angefangen hatte und für Ava nur die Mutter ihrer Klassenkameradin Khloe gewesen war, hatte sie schon so ausgesehen … Mein Gott, war das lange her, und welche Schicksalsschläge hatten sie alle seit jenen unbeschwerten Grundschuljahren hinnehmen müssen …
»Hallo, Ava.« Biggs stand auf und streckte ihr die Hand entgegen, die sie beklommen schüttelte. Sie waren sich schon früher begegnet, doch stets unter wenig erfreulichen Umständen.
»Sheriff.« Sie nickte und zog ihre Hand zurück. Ihre war klamm, seine unangenehm kalt.
»Ich habe gehört, Sie hätten ein Bad genommen«, sagte er, ließ sich wieder auf den Stuhl fallen und umschloss mit beiden Händen seine Tasse. Dann blickte er Ava mit zusammengekniffenen Augen an. Argwöhnisch. Biggs und sie waren nie miteinander warm geworden. Schon gar nicht nach dem Tod ihres Bruders Kelvin vor fast fünf Jahren. »Möchten Sie sich näher dazu äußern?«
»Ist das etwa ein Verbrechen?«
»Schwimmen zu gehen? Aber nein. Natürlich nicht. Trotzdem haben sich ein paar Leute große Sorgen um Sie gemacht.« Er hatte ein feistes, fleischiges Gesicht und tiefliegende, durchdringende Augen. Über seine Wangen zog sich ein Netz aus geplatzten Äderchen, doch er machte keinen unfreundlichen Eindruck.
Die Küchentür öffnete sich, und Wyatt kam herein. Er nickte dem Sheriff zu.
Biggs erwiderte seinen Gruß, dann deutete er auf die in der Küche Anwesenden. »Alle hier dachten, Sie stünden unter Hypnose oder würden schlafwandeln.«
»Ich habe Onkel Joe angerufen«, sagte Khloe, die eben durch die Fliegengittertür getreten war, gefolgt von ihrem neuen Angestellten, Austin Dern. Dern hatte sich ebenfalls geduscht und umgezogen, sein dunkles Haar war noch nass und aus dem Gesicht gestrichen. Er trug ein frisches Langarmshirt und trockene, verwaschene Jeans. Als er Ava ansah, stellte sie im Licht der Küchenlampe fest, dass seine Augen die Farbe von Schiefer hatten. Wieder überlegte sie, wo sie ihm schon einmal begegnet sein könnte, doch sie konnte ihn nicht einordnen.
»Ich – ähm, ich dachte, wir bräuchten Hilfe.«
»Dann ist das also ein inoffizieller Besuch?«, hakte Ava nach.
Ohne den Blick von ihr zu wenden, antwortete Khloes Onkel: »Meine Nichte hat mich angerufen, also habe ich auf einen Sprung vorbeigeschaut.«
»Ich habe mir eben Sorgen gemacht, das ist alles«, erklärte Khloe. Virginia zog die Hände aus dem Spülwasser, griff nach einem Handtuch und trocknete sich ab, dann trat sie mit gerunzelter Stirn an die Fliegengittertür und schloss mit einem kräftigen Schwung die schwere Holztür zur Veranda. Ob sie wollte, dass es drinnen warm blieb, oder ob sie ungebetene Lauscher aussperren wollte, blieb offen.
Er hat »auf einen Sprung vorbeigeschaut«, ist an einem nebligen Abend einfach so mit dem Boot des Departments nach Church Island gekommen? Aber sicher doch. Ava glaubte ihm kein Wort. Selbst Virginia, die jetzt wieder ans Spülbecken getreten war, warf einen ungläubigen Blick über die Schulter.
Etwas weniger kratzbürstig fügte Khloe hinzu: »Komm schon, Ava, wäre es umgekehrt und ich würde an einem nebligen Novemberabend in die Bucht springen, wärest du auch panisch geworden. Schließlich sind wir keine Kinder mehr, die sich mitten in der Nacht aus dem Haus stehlen, um nackt im Mondschein zu baden!«
Ava sah sie beide vor sich, wie sie vor Jahren zum Ufer geschlichen waren, während der Mond sein schimmerndes Licht auf die stille See geworfen hatte. Sie und Khloe und Kelvin … Gott, was hätte sie dafür gegeben, je wieder so sorglos zu sein!
Khloe hatte recht. Das musste sie zugeben.
Ava spürte, wie die Blicke aller im Raum Anwesenden auf ihr lagen. Khloe, Wyatt, Dern, der Sheriff und Virginia schienen auf eine Antwort zu warten.
»Ich habe einen Fehler gemacht, das ist alles.« Ava streckte ihnen kapitulierend die erhobenen Handflächen entgegen. Es gab keinen Grund zu lügen, also erklärte sie: »Ich meinte, meinen Sohn am Ende der Pier gesehen zu haben, und bin hinausgerannt, um ihn zu retten. Offenbar habe ich mich geirrt.«
»Der Junge ist jetzt wie lange verschwunden? Fast zwei Jahre, oder?«, fragte Biggs Dr. McPherson, die unbemerkt die Küche betreten hatte und nun schweigend neben der Speisekammer stand.
»Ja.« Avas Stimme klang zögerlich, als sei sie auf der Hut; sie spürte, wie ihre Beine schwach wurden. In der Hoffnung, niemand würde es bemerken, lehnte sie sich gegen den Kühlschrank. »Aber mittlerweile geht es mir besser, Sheriff«, log sie und zwang sich zu einem Lächeln. »Ich danke Ihnen für Ihre Fürsorglichkeit und dafür, dass Sie extra den langen Weg hierher auf sich genommen haben.«
»Kein Problem.« Ihre Augen begegneten sich, und Ava stellte fest, dass sie beide logen. Es widerstrebte ihr, sich so gefügig zu zeigen, doch sie wusste, dass sie ihre Karten vorsichtig ausspielen musste, wollte sie nicht in der geschlossenen Abteilung landen.
Wieder einmal.
Unter dem Vorwand, starke Kopfschmerzen zu haben, was nicht einmal gelogen war, nahm Ava das Abendessen in ihrem Zimmer ein, auch wenn das vermutlich feige war. Pech. Es war ihr unangenehm, Biggs im Haus zu haben, wenngleich sie nicht einmal genau sagen konnte, warum. Er hatte nicht vor, sie zu verhaften oder ihr auf irgendeine Art und Weise zu schaden, dennoch wurde sie das Gefühl nicht los, er habe sich mit den anderen gegen sie verbündet oder würde zumindest darauf warten, dass sie einen Fehler beging.
Und was für ein Fehler sollte das bitte schön sein?
Du darfst nicht zulassen, dass deine Paranoia die Oberhand über deinen Verstand gewinnt.
»Ich bin nicht paranoid«, flüsterte sie. Sie musste sich neu orientieren, sich zusammennehmen und herausfinden, wem, wenn überhaupt jemandem, sie vertrauen konnte.
Gedankenverloren blickte sie aus dem Fenster in Richtung Pier, tauchte das knusprige Brot in Virginias würzige Muschelsuppe und nahm einen Bissen, obwohl sie eigentlich gar keinen Appetit hatte. In klaren Nächten waren aus diesem Fenster die Lichter von Anchorville auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht zu sehen, man konnte sogar die Scheinwerfer der Autos erkennen, die durch die verschlafene Kleinstadt fuhren.
Während sie kaute, fragte sich Ava, warum Khloe es so eilig gehabt hatte, den Sheriff anzurufen. Nicht die Neun-eins-eins, sondern Biggs höchstpersönlich. Weil er ihr Onkel war? Damit nicht extra ein Rettungsteam zur Insel übersetzen musste? Um einen Skandal zu vermeiden oder die Familie nicht in Verlegenheit zu bringen? Das kam ihr unwahrscheinlich vor.
Ihr Blick fiel auf das Boot vom Büro des Sheriffs, das am Anleger vertäut war. Im dichten Nebel war es nur als dunkler Schemen zu erkennen, und das auch nur, weil jemand – vermutlich Virginia oder Khloe – die Außenbeleuchtung und die Lampe am danebenstehenden Bootshaus angelassen hatte, damit Biggs wohlbehalten über die grasüberwucherten Wege und rutschigen Planken zurückfand.
»Seltsam«, murmelte sie und schob ihren Teller zur Seite, obwohl sie kaum etwas gegessen hatte. Auf Church Island war es ohnehin unmöglich, etwas zu vertuschen, Gerüchte machten hier rasend schnell die Runde. Klatsch und Tratsch gehörten zur Insel wie die Buchten und Auswaschungen in den zerklüfteten Felsen. Sie fröstelte und ergriff ihre braune Strickjacke, die wie immer am Fußende des Bettes lag. Rasch schlüpfte sie in die Ärmel, zog ihr Haar aus dem Halsausschnitt, dann schnürte sie den Gürtel eng um ihre Taille.
Klopf, klopf, klopf.
Sie wäre fast aus der Haut gefahren vor Schreck, als plötzlich ein Pochen an ihrer Tür ertönte.
»Ava?« Die Tür öffnete sich, und Khloe steckte ihren Kopf ins Zimmer. »He, wie geht’s dir?«
»Was denkst du denn?«, fragte sie mit wild klopfendem Herzen. Mein Gott, war sie eine nervöse Gans!
»Ich wollte dich nicht erschrecken.«
»Das hast du auch nicht getan.« Was, wie sie beide wussten, eine glatte Lüge war. Ava setzte sich wieder an den Tisch und blickte auf die Suppe, die bereits anfing, fest zu werden. »Warum hast du Biggs gerufen?«
»Das habe ich doch schon gesagt: Ich habe mir Sorgen um dich gemacht!« Khloe rieb sich die Arme, als würde auch sie plötzlich frösteln. »Ist das kalt hier drinnen!«
»Immer«, bestätigte Ava. »Und du weichst mir aus.«
Ihre ehemals beste Freundin setzte sich auf die Bettkante. »Was, wenn dir etwas zugestoßen wäre, und wir hätten es nicht gemeldet? Du hättest ertrinken, im Wasser ohnmächtig werden können! An Unterkühlung sterben oder Gott weiß was!«
»Es ging mir recht gut.«
»Du warst am Leben. Halbwegs zumindest. Trotzdem, du standest doch komplett neben der Spur!« Sie runzelte besorgt die Stirn. »Ich hätte den Notruf wählen sollen, doch ich hatte Angst, dass sie dich wegbringen würden und …« Sie zuckte die Schultern, dann fuhr sie sich frustriert mit den Fingern durch ihr kurzes, blauschwarzes Haar. »Um die Wahrheit zu sagen, Ava – manchmal weiß ich einfach nicht, was ich tun soll.«
Nun, das galt auch für sie. »Ich auch nicht.«
»Ähm … Onkel Joe ist noch hier, komm doch einfach wieder mit runter und setz dich zu uns. Zeig ihm, dass alles okay ist.«
»Du meinst, ich soll so tun, als ob?«
»Ich meine, du sollst aufhören, dich aufzuführen wie eine Verrückte. Sag Joe und dieser Psychiaterin, du weißt, dass du Noah nicht gesehen hast.«
»Aber –«
»Schscht! Widersprich mir nicht!« Khloe blickte sie mit ihren großen Augen beschwörend an. »Behaupte einfach, du warst verwirrt wegen der Medikamente, auf die man dich gesetzt hat, doch inzwischen sei dir klar, dass du Noah unmöglich gesehen haben kannst. Joe ist inoffiziell hier, wirklich. Er ist nur mir zuliebe gekommen –«
»In einem Boot des Departments.«
»Das war die schnellste Möglichkeit. Wenn ich es doch sage: Es ist ein inoffizieller Besuch. Er will sich nur persönlich vergewissern, dass es dir gutgeht. Er hat sogar mit uns zu Abend gegessen.«
»Ganz bestimmt?«
Sie zuckte ihre schmalen Schultern. »Ich würde mich einfach besser fühlen, wenn du noch mal mit ihm redest, schließlich habe ich ihn hergerufen. Beweis ihm, dass du …«
»Dass ich zurechnungsfähig bin? Meine fünf Sinne beisammen habe? Nicht selbstmordgefährdet bin?«
»Ja. Was auch immer.« Sie nickte. »Tu mir den Gefallen, okay?«
Scheinbar blieb ihr keine andere Wahl, als dem Sheriff erneut gegenüberzutreten. »Na schön. Aber bitte ruf beim nächsten Mal nicht gleich wieder die Kavallerie.«
»Es wird kein nächstes Mal geben, verstanden?«
Hoffentlich, dachte Ava, doch sie erwiderte nichts. Stattdessen nahm sie ein frisches Twinset aus dem Kleiderschrank und zog sich um.
»Ich denke, ich kann mich glücklich schätzen, dass man Sea Cliff geschlossen hat. Sonst hätte mich Biggs womöglich noch dorthin verschleppt.«
»Sehr komisch«, bemerkte Khloe, ohne zu lächeln, als Ava die alte Nervenklinik erwähnte. Sea Cliff an der südlichen Spitze der Insel war eine geschlossene Anstalt für kriminelle Geisteskranke gewesen, bis sie vor etwas mehr als sechs Jahren aufgegeben worden war. Sämtliche Bewohner von Neptune’s Gate waren zutiefst erleichtert gewesen, als die Nervenklinik geschlossen wurde, nachdem einer der gefährlichsten Verbrecher in der Geschichte Washingtons, der mehrfache Mörder Lester Reece, den dicken Mauern und verrosteten Toren der Einrichtung entkommen war.
Kapitel drei
Sie folgte Khloe die Treppe hinunter durchs Esszimmer, wo Graciela bereits die Suppenterrine nebst Tellern abgeräumt hatte, in die Küche, und wappnete sich gegen die Befragung, die ihr womöglich erneut bevorstand.
Auf der Küchenanrichte türmte sich das schmutzige Geschirr. Ava stellte ihren benutzten Teller dazu, dann ging sie gemeinsam mit ihrer ehemaligen Klassenkameradin in die Bibliothek, wo Biggs es sich in einem Polstersessel bequem gemacht hatte, eine große Tasse in der fleischigen Hand.
Ihr Cousin Ian und Jewel-Anne hatten sich in dem anheimelnden Raum mit den Tiffanylampen, der breiten alten Couch und den gemütlichen Sesseln zu ihm gesellt, auch Wyatt und Dr. McPherson leisteten ihm Gesellschaft. Sie unterhielten sich gedämpft; scheinbar führten sie ein sachliches Gespräch, und scheinbar ging es – wie sollte es auch anders sein? – um sie. Jewel-Anne hörte ausnahmsweise einmal nicht ihre Elvis-Musik, doch sie hatte eine ihrer abscheulichen Puppen mitgebracht, diesmal eine Kewpie mit riesigen, dumpf stierenden Augen, übertrieben langen Wimpern und einem knallroten Mund, der zu einem Lolita-Schmollen verzogen war. Ava hatte keine Ahnung, ob das Ding mit den langen, blonden Locken ein Kind oder ein Teenager sein sollte. Das Verstörendste aber war, dass Jewel-Anne die Puppe im Arm hielt, als sei sie ihr Kind.
Ian, Jewel-Annes Halbbruder, schien die Kewpie gar nicht zu bemerken. Ihr fiel auf, dass er immer wieder in seine Brusttasche griff, wo er früher stets eine Schachtel Zigaretten griffbereit aufbewahrt hatte. Vor einer Weile hatte er das Rauchen aufgegeben, behauptete er zumindest, doch Ava hatte gesehen, wie er sich am Anleger heimlich eine Zigarette anzündete. Warum er den anderen etwas vormachte, konnte sie nicht sagen. Ian war groß, über eins fünfundachtzig, schlaksig und hatte braunes, lockiges Haar, durch das sich bereits ein paar graue Strähnchen zogen. Vor ein paar Jahren hatte er eine Stelle als Handwerker hier auf der Insel angenommen, später hatte Wyatt ihn auf der Ranch beschäftigt. Ava hatte sich oft gefragt, warum er nicht fortzog, weg von Church Island. Genau wie ihren anderen Cousins hatte ihm einst ein Teil der Insel gehört, »ein Stück Fels in der Brandung«, wie sein Vater früher zu sagen pflegte – eine Anspielung auf den alten Werbeslogan einer Versicherungsgesellschaft, die seine Sicht, das Erbe seiner Väter betreffend, widerspiegelte.
Als sich Ava zu den anderen gesellte, verstummten sie.
Na großartig, dachte sie, als sich das unangenehme Schweigen immer länger hinzog und der Knoten in ihrem Bauch schmerzhaft zu zwicken anfing.
»Ava«, sagte Wyatt schließlich, sprang auf die Füße und trat zu ihr. Er warf einen raschen, fragenden Blick in Khloes Richtung, als sei er ungehalten, weil sie Ava dazu überredet hatte, sich in die Bibliothek zu begeben. »Ich dachte, du hättest Kopfweh«, flüsterte er seiner Frau zu.
»Hatte ich auch, aber es ist schon erstaunlich, was ein paar Migränetabletten bewirken können.«
»Ich nahm an, der Sheriff würde Ava gern noch ein paar Fragen stellen«, sagte Khloe steif.
»Das ist richtig«, mischte sich Biggs ins Gespräch ein.
»Gut.« Khloe drehte sich zu Ava um und sagte: »Ich hole dir einen Becher heiße Schokolade.« Doch das war gar nicht nötig. Als habe sie nur auf Avas Rückkehr gewartet, erschien Demetria, Jewel-Annes Pflegerin, mit einer dampfenden Tasse Kakao, in dem kleine Marshmallows schwammen. Sie reichte sie ihrem Schützling. »Ich habe schon eine weitere Tasse in die Mikrowelle gestellt«, verkündete Demetria, die nun etwas weniger streng dreinblickte und die dünnen Lippen sogar zum Ansatz eines Lächelns verzogen hatte. »Eine Sekunde noch.«
»Ich helfe Ihnen«, bot Avas Therapeutin an und folgte ihr in die Küche.
»He, könntest du mir eine Tasse Kaffee mitbringen?«, rief Ian Jewel-Annes Pflegerin mit einem breiten Lächeln nach.





























