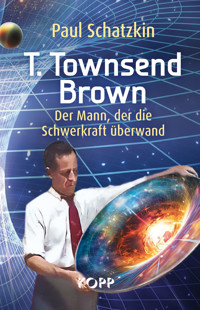
23,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kopp Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Eine unglaubliche Geschichte über Raum und Zeit - und die Geheimnisse dazwischen
Paul Schatzkin hat die Biografie eines Mannes geschrieben, dessen Geschichte man eigentlich nicht erzählen kann. Es ist der wahre, aber kaum bekannte Bericht über einen genialen Wissenschaftler, der vielleicht mehr entdeckt hat, als die Menschheit verkraften kann.
Die spektakulären Schwerkraft-Experimente des T. Townsend Brown
Dieses Buch führt den Leser an die Grenzen der modernen Wissenschaft. Es wurde in Zusammenarbeit mit den Erben Townsend Browns - und mit der Hilfe diverser anonymer Quellen aus Militär- und Geheimdienstkreisen - verfasst und deutet auf einen Bereich weit fortgeschrittenen Wissens hin, der den Menschen bis heute auf mysteriöse Weise vorenthalten wird. Obwohl Townsend Browns Name häufig in einem Atemzug mit Nikola Tesla und Albert Einstein genannt und seine Person sogar mit dem »Philadelphia-Experiment« in Verbindung gebracht wird, kennt kaum jemand den Mann, der die Schwerkraft überwand.
Die geheime Geschichte der Antigravitation
Bei den Recherchen wurde Paul Schatzkin schnell klar: Ab einem bestimmten Zeitpunkt im Leben des Thomas Townsend Brown führte der Forscher seine Experimente, die die Grenzen von Raum, Zeit und Gravitation infrage stellten, nur noch im Verborgenen durch.
Dieses Buch zeichnet das bislang vollständigste Bild von dem Leben und der Forschung Townsend Browns. Paul Schatzkins einzigartige Recherche bietet Fakten und Details über den Gravitations-Revolutionär, wie es sie bislang nicht gegeben hat.
»Einige Kenner von Townsend Browns Werken glauben, dass er die physikalische Manifestation dessen entdeckt hat, was Einstein nur mathematisch berechnen konnte: eine Methode, mithilfe von Elektrizität künstliche Gravitationsfelder zu erzeugen. Wenn es sich bei der Gravitation, wie Einstein behauptet, tatsächlich um eine Verformung im Gewebe der Raumzeit handelt, dann hat Brown durch die Manipulation der Gravitation die Pforten zur intergalaktischen Kommunikation, interstellaren Navigation und ... ja, wirklich ... zu Reisen in der Zeit geöffnet.« Paul Schatzkin in seiner Einleitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
1. Auflage Februar 2025
Copyright © 2023 by Paul Schatzkin
Titel der amerikanischen Originalausgabe:The Man Who Mastered Gravity
Copyright © 2025 für die deutschsprachige Ausgabe bei Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung aus dem Amerikanischen: Peter Hiess Satz und Layout: Mohn Media Mohndruck GmbH, Gütersloh Umschlaggestaltung: Martina Kimmerle
ISBN E-Book 978-3-98992-089-7 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-10 Fax: (07472) 98 06-11
Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de
Widmung
Für Josephine und Ellen
Zitate
Das Universum ist voll der wunderbaren Dinge, die geduldig darauf warten, dass unsere Sinne schärfer werden.
Eden Phillpotts
Es gibt eine höchste Intelligenz im Universum, die sich nach Verbundenheit mit uns sehnt.
Elizabeth Gilbert
Einleitung zur Ausgabe von 2023
Das Geheimnis des Lebens ist kein Problem, das gelöst werden muss, sondern eine Realität, die es zu erfahren gilt.
Frank Herbert, Der Wüstenplanet
Von 2003 bis 2008 recherchierte und schrieb ich die Biografie eines Mannes namens Thomas Townsend Brown. Oder auch Townsend Brown. Oder nur »Dr. Brown« für die Leute, die ihn näher kannten.
Das Werk sollte der Nachfolger meines ersten veröffentlichen Buches, einer Biografie über Philo T. Farnsworth, werden. Als The Boy Who Invented Television [dt. etwa: »Der Junge, der das Fernsehen erfand«] im Jahr 2002 erschien, hatte ich das Gefühl, meine neue Berufung als »Biograf obskurer Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts« gefunden zu haben. Die Townsend-Brown-Bio sollte die erste Fortsetzung sein.
Das glaubte ich so lange, bis mich der gefürchtete »Fluch des zweiten Albums« traf, den es anscheinend auch in der Buchbranche gibt.
2009 gab ich das Townsend-Brown-Projekt dann auf, weil ich nach 6 Jahren der Recherche und des Schreibens immer noch keine Ahnung hatte, worüber ich da eigentlich schrieb.
In den folgenden Jahren hatte ich unzählige Gespräche, die sich etwa so abspielten:
Zuhörer: »Sie hatten doch an einem Buch gearbeitet. Was ist daraus geworden? Worum ging es darin?«
Ich: »Haben Sie je vom Ionic-Breeze-Luftreiniger gehört?«
Zuhörer: »Meinen Sie dieses Ding, das immer in den Katalogen von Sharper Image beworben wurde?«
Ich: »Genau das. Das Gerät, das ohne bewegliche Teile die Luft zirkulieren lässt.«
An dieser Stelle nickt der Zuhörer wissend. Und dann lege ich los:
»Der Ionic Breeze basiert auf einem anomalen elektrischen Effekt, den Thomas Townsend Brown als Teenager in den 1920er-Jahren entdeckt hat …«
Bei meinen Recherchen stieß ich auf eine Art loses Netzwerk von Leuten, die davon überzeugt sind, dass Townsend Browns Entdeckung, sofern man sie auf etwas andere Art und mit anderen Materialien umsetzt, einen »Antigravitations«-Effekt erzeugt (obwohl Brown selbst diesen Begriff ablehnte).
Im Folgenden wollen wir um der Diskussion willen annehmen, dass diese Behauptung wirklich stimmt.
***
In seinem Hauptwerk, das die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie behandelt, postulierte Albert Einstein, dass die Gravitation durch eine Krümmung im Raum-Zeit-Kontinuum erzeugt wird. Das bedeutet, dass massereiche Objekte wie Planeten und Sterne den Raum um sich herum physisch verformen.
In den letzten Jahren seines Lebens versuchte Einstein eine »einheitliche Feldtheorie« – die »Weltformel« – zu formulieren, die eine mathematische Verbindung zwischen Elektrizität, Magnetismus und Gravitation herstellen könnte.
Einige Kenner von Townsend Browns Werken glauben, dass er die physikalische Manifestation dessen entdeckt hat, was Einstein nur mathematisch berechnen konnte: eine Methode, mithilfe von Elektrizität künstliche Gravitationsfelder zu erzeugen. Wenn es sich bei der Gravitation, wie Einstein behauptet, tatsächlich um eine Verformung im Gewebe der Raumzeit handelt, dann hat Brown durch die Manipulation der Gravitation die Pforten zur intergalaktischen Kommunikation, interstellaren Navigation und … ja, wirklich … zu Reisen in der Zeit geöffnet.
Ich wollte das ebenfalls glauben.
Im Lauf von 6 Jahren erforschte ich das Leben von Townsend Brown, wobei ich mich auf das kleine Archiv aus den Papieren stützte, die er seiner Familie hinterlassen hatte. Auch der ausgiebige Kontakt mit Browns Tochter Linda, einige Behördenanfragen gemäß dem amerikanischen Gesetz zur Informationsfreigabe und die ausführliche Korrespondenz mit wenigstens zwei Personen, die behaupteten, über intime Kenntnisse aus erster Hand über Browns Aktivitäten zu verfügen, unterstützten mich bei meinen Recherchen. Die letztgenannten Quellen spielten auf tiefgreifende Verbindungen des Forschers zu den US-Militärgeheimdiensten und dem nationalen Sicherheitsapparat an – und deuteten auch häufig auf unsichtbare Kräfte dahinter hin.
Schließlich gelang es mir, ein Manuskript von mehr als 570 Seiten Umfang fertigzustellen.
Ich ging dabei nach dem Michelangelo-Prinzip vor. Als man den berühmten Künstler einmal fragte, wie er sein Meisterwerk, die David-Statue, geschaffen hatte, antwortete er: »Ich habe einfach einen Marmorblock genommen und alle Teile entfernt, die nicht David waren.« Für mich war meine erste Manuskriptversion der unbehauene Marmorblock – und als ich an der zweiten Fassung arbeitete, musste ich nur noch die Teile entfernen, welche die Geschichte nicht voranbrachten. Doch etwa in der Hälfte der Überarbeitung stieß ich hinsichtlich dieser Methodik an meine Grenzen. Ich hatte keine Ahnung, wie mein »David« eigentlich aussehen sollte.
Mit Sicherheit konnte ich über Townsend Brown nur sagen, dass »er die Hälfte seines Lebens mit geheimen militärischen Forschungen zugebracht hatte – und die andere Hälfte mit geheimen nachrichtendienstlichen Operationen, um die geheimen militärischen Forschungen zu vertuschen«.
Mit anderen Worten: Ich hatte »die Biografie eines Mannes verfasst, dessen Geschichte man nicht erzählen kann«.
***
An dieser Stelle des Gesprächs wende ich mich meist meinem Zuhörer zu und sage: »Na gut, jetzt bist du dran. Frag mich doch einfach: ›Paul, was ist denn das für ein Buch?‹«
Nach einigem Zureden bringe ich ihn oder sie dann tatsächlich dazu, zu fragen: »Also schön, Paul – was ist das denn für ein Buch?«
»Es ist ein Buch mit etwa 570 verdammten Seiten.«
***
Ich ging das Townsend-Brown-Projekt im Frühjahr 2003 an.
Die erste Manuskriptfassung entstand im Lauf von 3 Jahren, von 2005 bis 2008. In dieser Zeit veröffentlichte ich die fertigen Kapitel auf meiner Website und stellte sie zur Diskussion.
In den ersten Wochen des Jahres 2009 war ich mit meiner Weisheit am Ende und gab die Arbeit an dem Projekt auf. 1
Dieser abrupte Abbruch hatte etliche negative Konsequenzen. Ich nahm meine Entscheidung damals zwar nicht zurück, zögerte jedoch, mich ganz und gar von dem Material zu trennen. Dann wurde mir bewusst, dass es dank der neuen Medien, die mir zur Verfügung standen – und die ich bereits genutzt hatte, um ein erstes Publikum für die Geschichte zu finden –, eigentlich keinen Grund gab, das Material nicht selbst zu »veröffentlichen«.
Da man ja nie weiß, was die Zukunft bringen wird, ließ ich das Rohmanuskript unter dem Verlagsnamen »Embassy Books and Laundry« erscheinen – eine bewusste Anspielung auf die Zeit in den 1950er-Jahren, als Townsend Brown sagte, er sei »fertig mit der Wissenschaft«. 2 Ich nahm an, dass ich irgendwann auf die Geschichte zurückkommen würde, so wie Brown sich nie ganz von der Wissenschaft abgewandt hatte.
Ich glaubte nur nicht, dass bis dahin 13 Jahre ins Land gehen würden. Aber vielleicht braucht man so lange, um wirklich trocken zu werden, nachdem man von einem kosmischen Feuerwehrschlauch bis auf die Knochen durchnässt worden war …
***
Mike Williams ist einer meiner ältesten Freunde; ich lernte ihn kennen, als ich 1994 nach Nashville übersiedelte. Er bekam eine Kopie meines Manuskripts in die Hände. Mike und seine Frau Kathy veranstalteten die wöchentlichen »6-Chair Pickin’ Parties«, die einen Teil der Inspiration für das Internet-Musikunternehmen lieferten, das ich 1995 ins Leben rief. 3 Als ich über einen Titel für mein erstes Buch nachgrübelte und Mike erzählte, dass es darin um »den Jungen geht, der das Fernsehen erfand«, sagte er sofort: »Da hast du doch deinen Titel!«
Da war es nur gerecht, dass Mike auch beim neuen Buch mitzureden hatte.
Er hatte mehrmals erwähnt, wie sehr ihn die Geschichte und das Geheimnis dahinter faszinierten und dass er die Herausforderung reizvoll finde, sie zu erzählen. Nachdem ich ihm eine digitale Kopie des Manuskripts hatte zukommen lassen, überreichte er mir im Jahr 2018 eine umfassende Überarbeitung. Er hatte es sich nicht einmal nehmen lassen, seine redigierte Fassung zu paginieren und mit einem festen Einband zu versehen, um sie mir als eine Art »echtes Buch« zu präsentieren – das erste Mal, dass ich mein Werk in einer solch »handfesten« Form zu sehen bekam.
Mikes Lektorat zeigte mir, wie schrecklich weitschweifig und übertrieben mein erster Entwurf gewesen war. Das Ganze hatte sich so gelesen, als hätte ich den Umstand, dass ich nicht wirklich wusste, welche Geschichte ich erzählen wollte, hinter einem Schwall an Wörtern zu verbergen gesucht. Doch auch wenn es so aussah, als hätte ich das Projekt aufgegeben, ließen mir bestimmte grundlegende Fragen so lange keine Ruhe, bis ich sie einfach nicht mehr ignorieren konnte.
2022 verschaffte eine Veränderung meiner persönlichen Lebensumstände – sozusagen ein innerer Hausputz – dem Projekt dann wieder oberste Priorität.
***
Die eigentliche Geschichte befindet sich im Zentrum eines Mengendiagramms, wo sich die Kreise von Wissenschaft, Science-Fiction und Pseudowissenschaft, Verschwörungstheorie und Realität überschneiden. Oft ist es nicht leicht, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Im Laufe meiner Arbeit wurde ich häufig mit der Aussage konfrontiert, das Leben von T. Townsend Brown stelle nur eine Phase eines »Mehrgenerationenprojekts« dar, das sich am Faden der menschlichen Evolution entlang entwickelt.
20 Jahre nach den Anfängen hat mein Beitrag zu dieser Geschichte nun anscheinend die zweite Phase erreicht.
Paul Schatzkin
5. Februar 2023
Zu den Endnoten, der Bibliografie und den Anhängen
Links zu den in den Endnoten angegebenen Onlinequellen sind zu finden unter:
https://ttbrown.com/footnotes
Das Literaturverzeichnis steht nur online zur Verfügung:
https://ttbrown.com/biblio
Die Anhänge sind zugänglich unter:
https://ttbrown.com/apxs
Vorwort
Hinein in den Kaninchenbau
Augenblicks sprang Alice ihm nach, ohne auch nur kurz darüber nachzudenken, wie in aller Welt sie da wohl wieder herauskäme.
Lewis Carroll, Alice im Wunderland
Dies ist kein Märchen. Aber vielleicht sollte die Geschichte trotzdem mit den folgenden Worten anfangen:
Es war einmal ein T. Townsend Brown – ja, wirklich.
Irgendwie vereinen sich alle großen Geheimnisse des vergangenen Jahrhunderts – Atomphysik, Relativität, Quantenmechanik, Ufos, Verschwörungen zur Vertuschung von Kontakten mit Außerirdischen sowie die Geheimoperationen des militärisch-industriellen Komplexes – im wechselhaften Leben dieses einen Mannes.
Wir wissen, wo er zur Welt kam und wo er aufwuchs. Wir wissen, wer seine Eltern waren, seine Frau, seine Kinder und sogar seine Enkel. Wir kennen die meisten der Dutzenden Orte, an denen er gelebt hat. Wir wissen, wo er starb und wo er begraben ist.
Darüber hinaus ist Townsend Brown jedoch ein Phantom. Ein Windgeist. Ein Mythos.
***
Im Sommer 2002 gab ich gerade meinem Buch The Boy Who InventedTelevision den letzten Schliff. Es handelt sich um die Biografie von Philo T. Farnsworth, der tatsächlich das Fernsehen erfunden hat. Jeder der Milliarden Videobildschirme auf unserem Planeten, einschließlich der winzigen Monitore, die wir heute alle in der Hosentasche herumtragen, lässt sich auf eine Skizze zurückführen, die Farnsworth 1922 im Alter von nur 14 Jahren für seinen Highschool-Lehrer in Naturwissenschaften zeichnete. Dass sein Name nicht bekannter ist, ist eines der großen Rätsel unserer Zeit. 4
Ich hörte 1973 zum ersten Mal von Philo Farnsworth. Damals hatte ich gerade meinen Abschluss am Antioch College in Maryland gemacht und war auf dem Weg an die Westküste, wo ich mein Glück im Fernsehgeschäft versuchen wollte. Meine Neugier auf Farnsworth wurde durch ein Porträt des Erfinders in einer Publikation namens Radical Software5 geweckt, doch wirklich fasziniert war ich erst, als ich von seiner unvollendeten Forschung in Sachen Fusionsenergie hörte – dem bis heute ungelösten Rätsel »Wie füllt man einen Stern in eine Flasche?«.
Von diesem Rätsel erfuhr ich erstmals im Sommer desselben Jahres im kalifornischen Santa Cruz, genauer gesagt auf einem Felsvorsprung mit Blick auf den Pazifik. Dort brachte mir ein Bekannter das Konzept der Kernfusion näher und erzählte von den vielversprechenden Forschungen zu einer sauberen, sicheren, billigen und im Überfluss vorhandenen Energieform, an denen Farnsworth in den 1960er-Jahren angeblich gescheitert war. 6
30 Jahre später sollte mich diese Konversation zu Townsend Brown führen.
Nachdem ich meine Farnsworth-Biografie abgeschlossen hatte, vermeinte ich, eine neue Berufung gefunden zu haben: das Recherchieren und Verfassen von »Biografien obskurer Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts«. Und nun dachte ich über mein nächstes Projekt nach.
Das Universum muss wohl meine Gedanken gelesen haben, denn am 9. Juli 2002 tauchte diese E-Mail in meinem Posteingang auf:
T. Townsend Brown ist ein weiterer heute vergessener Erfinder, dessen Schaffen völlig unter den Teppich gekehrt wurde. Er starb 1985 auf Catalina Island.
Die Wissenschaft in den späten 1950er-Jahren behauptete, dass seine Arbeit gegen die Gesetze der Physik verstoße, doch die Regierung stufte seine Aktivitäten als geheim ein. Seit seinem Tod forschen Auftragnehmer der amerikanischen Regierung und diverser anderer Staaten an seinen Erkenntnissen weiter.
Wo sind die Ergebnisse dieser Forschung und Entwicklung also gelandet? Wenn Sie nachts in der Wüste etwa 200 Kilometer südwestlich von Las Vegas unterwegs sind, werden Sie ein weit entferntes Objekt herumfliegen sehen, das von einem bläulichen Schleier umgeben ist. Dort sind sie.
Außerdem bietet das Unternehmen Sharper Image im Kabelfernsehen einen Luftreiniger um 60 Dollar an. Auch dafür hat er nie Tantiemen kassiert.
Die Nachricht war nur mit »Janoshek« unterzeichnet, und der Absender war nicht nachverfolgbar.
Ich googelte zu einer Website, die dem Leben und Werk dieses T. Townsend Brown gewidmet war. 7 Schon in den ersten Absätzen erfuhr ich Folgendes:
Der amerikanische Physiker Thomas Townsend Brown war führend in der Entwicklung von Theorien über die von Dr. Albert Einstein postulierte Verbindung zwischen elektromagnetischen und Gravitationsfeldern. Mit der Entwicklung fester, scheibenförmiger Geräte, von denen angenommen wird, dass sie temporäre, lokalisierte Gravitationsfelder erzeugten und nutzten, gelang ihm der Schritt von der Theorie zu deren Anwendung.
Browns Arbeit galt als höchst umstritten, da sie Ähnlichkeiten mit der vermuteten Antriebsmethode diverser beobachteter Ufos aufwies. Sein Name wird auch häufig in einem Atemzug mit dem »Philadelphia-Experiment« genannt, als möglicher Kandidat neben Nikola Tesla, A. L. Kitselman und Albert Einstein.
Gravitationsfelder? Einsteins einheitliche Feldtheorie? Das klang doch alles recht vernünftig. Aber »scheibenförmige Geräte und Ufos«? Hallo? Ich schreibe ernsthafte wissenschaftliche Biografien, keine pseudowissenschaftlichen Schmöker. Und ich lasse mich nicht so leicht von Verschwörungstheorien einwickeln, ob es darin nun um Ufos oder um andere Themen geht.
Ich fand die E-Mail-Adresse des Websitebetreibers und schickte ihm eine Nachricht. Da ich nicht allzu wissbegierig klingen wollte, stellte ich ihm ein paar harmlose Fragen darüber, weshalb er die Website ins Leben gerufen hatte und warum ihm Townsend Brown ein Anliegen war.
Danach vergaß ich die ganze Sache erst einmal.
Einen Monat später erhielt ich Antwort von einem gewissen Andrew Bolland. Seine Beziehung zur Familie Brown hatte Mitte der 1980er-Jahre ihren Anfang genommen. Was er mir erzählte, machte mich neugierig, weil es in mancher Hinsicht meiner gerade erschienenen Farnsworth-Biografie ähnelte und dann doch wieder ganz anders war. Ich schlug vor, eine Biografie über T. Townsend Brown zu verfassen.
Wieder verging ein Monat ohne Antwort. Dann schrieb Andrew:
Ich habe mit Browns Tochter gesprochen. Sie findet die Idee gut und würde gern dabei mitwirken. Sie war seine wichtigste Forschungsassistentin – sie baute Prototypen und so weiter. Teilen Sie mir doch bitte mit, ob Sie an der Sache dranbleiben wollen.
Und so, Alice, öffnet sich ein Kaninchenbau.
Teil 1: Weiß
TEIL 1:
Weiß
Stellen Sie sich vor, Sie hätten Ihr Kind verloren – und es gäbe eine Technologie, die Sie an den Tag davor zurückreisen lässt, damit Sie das verhindern können. Sie würden doch alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Insofern müsste es ein streng geheimes Programm sein, von dem fast niemand weiß.
Emily St. John Mandel
Prolog: Jeder Taxifahrer in Catalina
PROLOG
Jeder Taxifahrer in Catalina
(1985)
Linda und Townsend in den 1980er-Jahren auf Catalina Island
»Daddy, das kannst du doch nicht machen! Du wirst dich umbringen! Mutter und ich werden deine Leiche aus San Antonio abholen müssen!«
Townsend Brown packte seine Reisetasche, eine abgenutzte Ledertasche, wie sie Ärzte früher zu Hausbesuchen mitnahmen. Dann stopfte er Papiere in einen ebenso ramponierten Aktenkoffer. »Ich muss das tun«, sagte er. »Ich muss diese Papiere nach San Antonio bringen.«
»Aber wer zum Teufel ist denn in San Antonio, Daddy? Warum können die nicht hierherkommen? Und wieso schickst du die Papiere nicht mit der Post?«
Linda Brown war fast 40 Jahre alt. Ihr Vater war 80 und nicht mehr der Gesündeste. 10 Jahre zuvor hatte man ihm den linken Lungenflügel entfernt. Die Ärzte vermuteten, dass das Organ durch das Ozon und die Strahlung geschädigt worden war, die sein Körper während der jahrzehntelangen Experimente mit hohen Spannungen und starken elektrischen Feldern aufgenommen hatte. Auch im rechten Lungenflügel zeigten sich mittlerweile Symptome.
Townsend und seine Frau Josephine, mit der er seit mehr als 50 Jahren verheiratet war, wohnten mit Linda, ihrem Mann George sowie deren Tochter in einer verwitterten Wellblechhütte auf der Insel Santa Catalina vor der Küste von Südkalifornien. Die Diskussion zwischen Vater und Tochter fand in einem winzigen Schlafzimmer statt, das mit elektronischen Instrumenten und Sensoren vollgestellt war. Sie waren die letzten Relikte seines Lebenswerks, der Erforschung der geheimnisvollen kosmischen Kraft, die er »siderische Strahlung« nannte.
»Du darfst mich nicht begleiten«, sagte Townsend.
Dieser Satz traf Linda schmerzlich. Sie hatte beinahe 2 Jahrzehnte an der Seite ihres Vaters im Labor gearbeitet, Geräte transportiert, Drähte in seinen Erfindungen verdrillt – was auch immer nötig war und er von ihr verlangte. Und jetzt hatte sie Angst, ihn nicht lebend wiederzusehen.
Townsend hatte einen Hubschrauber organisiert, der ihn nach Long Beach bringen sollte, wo er in ein Privatflugzeug umsteigen würde. Nun brauchte er aber noch ein Taxi für die Fahrt zum Helikopter. Er griff zum Telefon.
»Mach schon, Daddy!«, rief Linda aufgeregt. »Aber vergiss nicht, dass ich jeden Taxifahrer auf dieser Insel kenne. Wenn ich es nicht will, wird dich keiner von ihnen irgendwohin fahren.«
Als das Taxi kam, ließ Townsend seinen zerbrechlichen Körper auf den Rücksitz sinken. Er lehnte sich aus dem Fenster und nahm die Hand seiner Tochter. »Mach dir keine Sorgen, mein Schatz«, sagte er in dem beruhigenden Ton, den er schon bei so vielen Abschieden angeschlagen hatte. »Es wird alles gut werden.«
Linda ließ die Hand ihres Vaters los und sah dem Taxi nach.
Der Hubschrauber landete in Long Beach, wo schon eine Limousine wartete, die Townsend zum Charterflieger bringen sollte. Als er durch die Windschutzscheibe spähte, war er erfreut, einen muskulösen Mann in militärischer Haltung am Steuer sitzen zu sehen – seinen Protegé, den er 20 Jahre zuvor rekrutiert hatte: Morgan.
Kapitel 1: Der Junge mit dem kastanienbraunen Haar
KAPITEL 1
Der Junge mit dem kastanienbraunen Haar
(1963)
Ashlawn, in der »Main Line« von Philadelphia: das Haus der Familie Brown von 1963 bis 1964
Die Great Valley High School in der Vorstadt Malvern in der »Main Line« [einer historischen Vorstadtregion entlang einer ehemaligen Bahnlinie; Anm. d. Übers.] von Philadelphia öffnete ihre Pforten im Herbst 1963. Mit ihrer hoch aufragenden Architektur aus Stahl und Glas, den langen, breiten Korridoren, der hellen Neonbeleuchtung und den glänzenden Kunststoffböden war sie typisch für das anbrechende Weltraumzeitalter. Mithin unterschied sie sich stark von den Gebäuden aus der Zeit vor dem Krieg, die im georgianischen oder im Kolonialstil erbaut worden waren. Die neue Schule zehrte von der Tradition der Gegend. Ihre Sportmannschaften nannten sich »The Patriots« – die Patrioten –, und ihr Maskottchen war ein musketenbewehrter Minuteman [Milizkämpfer aus der Zeit der britischen Kolonien; Anm. d. Übers.] mit vorspringendem Kinn, Bajonett und Dreispitz.
Der große, kräftig gebaute Morgan hatte wegen des Fremdsprachenprogramms der Highschool, in dem auch Russisch angeboten wurde, an die Great Valley gewechselt. Er wollte die Sprache erlernen, um seinem Land im Kalten Krieg dienen zu können. Auch las er eine Menge Agentenromane und hegte die romantische Vorstellung, einmal als Spion zu arbeiten.
Die Great Valley High School begrüßte ihre ersten Schüler mit dem Geruch frischer Farbe und kahlen Flurwänden; auch waren in den Gängen noch keine Spinde aufgestellt worden. »Wir mussten unsere Bücher dauernd mit uns herumschleppen«, erinnert sich Morgan, »also ging praktisch niemand in die Bibliothek, um sich weitere zu holen.« Morgan war aber dennoch dort und traf zwischen den Bibliotheksregalen auf eine Mitschülerin mit welligem, kinnlangem braunen Haar und wissbegierigen Augen. Er sah zu, wie Linda Brown mit den Fingern über die Buchrücken strich, als wären die Bände alte Freunde. Sie blätterte in einem Roman von James Joyce; der schwer verständliche irische Literat war einer von Morgans Lieblingsautoren.
Ihre Blicke trafen sich. Linda nickte Morgan mit einem gedankenvollen kleinen Lächeln zu und konzentrierte sich dann wieder auf das Buch.
»Hmm«, dachte Morgan. »Die ist anders als die anderen.«
In der übernächsten Schulstunde setzte sich Morgan im Kurs »Politische Bildung« neben das Mädchen. »Gut, dass der Stuhl leer war«, erklärte er, »sonst hätte ich ihn wohl eigenhändig freiräumen müssen.«
»Er war ein gut aussehender Typ mit kastanienbraunem Haar und einem Princeton-Haarschnitt«, erinnert sich Linda noch lange danach. »Man sah ihm zwar an, dass er aus ›Main Line‹ kam, aber er war trotzdem ganz anders. Er war Mitglied im Schachklub und zugleich ein preisgekrönter Ringer. Ich fand ihn faszinierend.« In den Wochen danach wurde Linda Zeugin, wie die anderen Mädchen an der Great Valley sich geradezu überschlugen, um Morgan auf sich aufmerksam zu machen.
»Ich war ein ziemlicher Blödmann«, sagt Morgan, »aber irgendwas an mir muss interessant gewirkt haben. Es gab jede Menge Mädchen, die mit mir ins Bett wollten, und ich war sowieso ganz begeistert davon, wie viel Spaß Sex macht. Dass ich diesbezüglich keine Skrupel hatte, schien mich komischerweise noch anziehender zu machen.«
Linda hatte einen festen Freund namens Howie, aber das hielt sie nicht davon ab, sich intellektuelle Wortgefechte mit ihrem neuen Klassenkameraden zu liefern. In »Politische Bildung« diskutierten sie über die nationale Sicherheit, wobei Linda für Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte eintrat, wohingegen Morgan die Sicherheitsbedürfnisse des Staates verteidigte.
»Sie wagte als Einzige, sich mit mir zu streiten«, erinnert sich Morgan. »Aber sie ließ mich auch links liegen, wenn es angebracht war, mich zu ignorieren. Ich neckte sie, wie ein Bruder seine Schwester neckt, doch wir waren beide nicht besonders gut in solchen Dingen. Tatsächlich hatte ich keine Ahnung, wie man so was anstellt, und sie wusste nicht, wie sie darauf reagieren sollte, also hatten wir irgendwann eine Pattstellung. Es dauerte eine Weile, bis wir registrierten, dass die Chemie zwischen uns stimmte.«
Linda bemerkte es auch, reagierte aber ganz anders darauf: »Ich hätte mich in den Hintern treten können, weil ich so direkt gewesen war. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich gegen alle Flirtregeln verstoßen hatte!«
Morgan wiederum machte sich Gedanken über Lindas Familie. »In der Schule ging das Gerücht, dass ihr Vater – ein liebenswürdiger Wissenschaftler – in Wirklichkeit ein Mitglied der Mafia war. Die Schüler an der Great Valley sagten: ›Er wirkt zwar wie ein Gentleman, aber sein Assistent muss ein Auftragskiller sein.‹«
Besagter Assistent war ein magerer, mürrischer Kerl namens Charles Miller, der Linda, Howie und ihre Freunde oft in einer Limousine zu ihren Verabredungen fuhr. Lindas Freundinnen waren der Meinung, dass eine eigene Limousine »einfach das Coolste überhaupt« war, aber dieser Charles war allen ein Rätsel. Eines Abends holte er die Jugendlichen vom Kino ab und brachte sie alle nach Hause – ohne sie vorher gefragt zu haben, wo sie wohnten.
Als die Limousine vor seinem Haus am Ende einer entlegenen Nebenstraße anhielt, fragte Howie: »Woher weiß der denn, wo ich wohne? Ich hab ihm sicher nicht gesagt, wie man hier raus kommt. Tatsächlich hat ihm keiner von uns seine Adresse genannt – er ist einfach direkt zu unseren Häusern gefahren!«
Linda schaute nach vorn und sah Charles mit tief heruntergezogener Mütze in den Rückspiegel starren, als wollte er sagen: »O Mist, ich hab’s vermasselt.« Sie sprang ihm schnell mit der Ausrede zur Seite, dass Charles schon bei ihrem ersten Date eine Wegbeschreibung bekommen habe. »Das ist schließlich sein Beruf«, sagte Linda. Damit gab sich Howie zufrieden und erwähnte den Vorfall nie mehr – doch auch Linda war an diesem Tag klar geworden, dass Charles mehr über ihre Freunde wusste als sie.
Derlei Vorfälle weckten Morgans Interesse an der streitbaren Schulkollegin noch mehr. Er begann Linda zu beschatten. Wenn sie mit Howie ausging, begegnete Morgan den beiden wie zufällig; wenn sie mit ihren Freundinnen unterwegs war, lief er ihnen ebenfalls über den Weg. Allerdings ging diese Taktik oft nach hinten los. Sobald die anderen Mädchen anfingen, mit Morgan zu flirten, senkte Linda den Blick und machte sich davon.
Familie Brown wohnte in einem vornehmen Steinhaus im Kolonialstil, das den Namen »Ashlawn« trug. Zwischen dem Haus und der Valley High lag nur ein Maisfeld. Als der Winter kam, veranstaltete Linda auf dem Teich hinter Ashlawn immer wieder Eislaufpartys. An einem kalten Nachmittag sah sie zwei ihrer Freundinnen durch das Feld herankommen. Zwischen ihnen ging der hochgewachsene Junge mit dem kastanienbraunen Haar.
Morgan war nicht sonderlich am Schlittschuhlaufen interessiert. Als sich die Jugendlichen zum Teich aufmachten, spazierte er allein durch das große Haus. Er schaute durch die Tür eines holzgetäfelten Zimmers und sah Lindas Vater, der gerade an etwas auf seinem Schreibtisch herumbastelte. Morgan beobachtete ihn von der Tür aus.
Townsend blickte auf und sagte in einem Tonfall, als hätte er genau diesen Besucher erwartet: »Ah, hallo.«
Kapitel 2: Keine beweglichen Teile
KAPITEL 2
Keine beweglichen Teile
(1963)
Als Morgan das Arbeitszimmer betrat, arbeitete Townsend Brown gerade an einer Erfindung, die ohne bewegliche Teile die Luft bewegen konnte. Der ein Quadratmeter große Holzrahmen, der aussah wie ein überdimensionaler Fensterventilator, stand auf einem dreieckigen Sockel. Auf seiner Vorderseite waren Dutzende von parallel laufenden Metallstreifen und Drähten wie Jalousielamellen angeordnet. Obwohl das Gerät weder Rotorblätter noch einen Elektromotor hatte, strömte lautlos und stetig Luft durch die Leitbleche.
Morgan blickte prüfend durch die Frontblende. Er spürte die Luft auf seinem Gesicht. Dann spazierte er rund um die Vorrichtung und suchte auf der Hinterseite nach dem Geheimnis des Magiers. Wie war es möglich, dass sich die Luft ohne Ventilator bewegte?
Townsend erklärte, dass ein elektrisch induziertes Kraftfeld die Luft zusammenpresse, »so wie man mit dem Finger einen Wassermelonenkern zerdrückt«.
Sehr cool, dachte Morgan und versuchte mit dieser Erklärung klarzukommen, die allem widersprach, was er bisher zu wissen geglaubt hatte.
Townsend betätigte einen Schalter, und plötzlich wurde aus dem Ventilator ein Lautsprecher, aus dem ein klarer, heller Klang kam, ohne dass eine Membran oder Magnetspule die Schwingungen erzeugt hätte.
»Er drehte lauter«, erinnert sich Morgan, »und in meinem Kopf explodierte eine Bombe.«
Laut Townsend entstand dabei keine Verzerrung, weil das Gerät keine beweglichen Teile besaß; daher konnte die Frequenz weit über den Bereich eines herkömmlichen Lautsprechers hinausgehen. Und hätte man ein zusammengehöriges Paar, würde eines davon als Sender und das andere als Empfänger fungieren.
»Wenn es keine Frequenzbeschränkung gibt, könnte man es ja auch als Kommunikationsgerät nutzen«, bemerkte Morgan. »Sendet man damit ein Signal, dann kann es niemand anderer hören, oder?«
»Nein, sagte Townsend mit einem Lächeln. Er setzte seine Brille auf und machte sich wieder an die Arbeit.
Linda stand in der Tür und hörte den beiden zu. »Im Gegensatz zu meinen anderen Freunden, die den Ventilator in Betrieb gesehen hatten, stellte Morgan einsichtsvolle, intelligente Fragen«, erinnert sie sich. »Ich merkte, dass sich Daddy über das Interesse freute. Keiner meiner Bekannten hatte die Möglichkeiten, die sich aus dem Gerät ergaben, auch nur annähernd verstanden.«
»Kommst du mit uns eislaufen?«, fragte Linda.
Morgan: »Ich erfand irgendeine Ausrede und verschwand nach einer hastigen Verabschiedung und einem aufrichtigen ›Danke‹ an Lindas Vater so schnell wie möglich. Ich musste einfach raus in die kalte Luft und in der Nacht ein wenig für mich sein. Erst nach einem Fußmarsch von fast einem Kilometer wurde mir klar, dass ich gerade einen wichtigen Wendepunkt in meinem Leben überschritten hatte.«
***
Morgan hatte Übung darin, Menschen einzuschätzen sowie ihre Stärken und Schwächen herauszufinden, bevor er agierte. Doch bei Linda Brown versagten seine üblichen Verführungstricks.
»Ich ertappte mich bei den seltsamsten und blödesten Dingen. Ich fuhr im alten Auto meines Bruders vor ihr Haus, saß dort wartend im Dunkeln, hörte die klassische Musik aus dem Arbeitszimmer ihres Vaters und roch den Holzrauch aus dem Kamin. Einmal stampfte ich sogar meine Initialen in den Schnee auf ihrem Rasen.«
Linda bemerkte nichts davon.
»In der Schule war ich gut«, erinnert sich Morgan. »Ich hatte durchweg ausgezeichnete Noten und war in den meisten Fächern der Beste. Ich strengte mich wirklich an, war immer gut vorbereitet und beherrscht, machte meine Hausaufgaben. Aber Linda fing im Unterricht Diskussionen mit mir an und blieb dabei stets Siegerin. Damals beschloss ich, dass ich sie unbedingt verführen wollte. Ich machte mir einen Plan, der mit einem Telefonanruf beginnen sollte – mit der einfachen Frage, ob sie mit mir ausgehen wollte. Aber ich bekam nicht Linda an den Apparat, sondern jenen steifen und kurz angebundenen Mann namens Charles, der beteuerte, dass ›Miss Brown an diesem Abend nicht abkömmlich‹ sei. Ich bin nicht leicht einzuschüchtern, aber vor diesem Charles hatte ich eine Scheißangst.«
Als Morgan es endlich schaffte, mit Linda persönlich zu sprechen, lehnte sie seine Einladung mit der Begründung ab, sie sei schon mit Howie zusammen.
Morgan hatte in der Schule Gerüchte darüber gehört, dass Howie im Frühling zur Grundausbildung der Nationalgarde gehen wollte.
»Ja, er reist im Mai ab«, bestätigte Linda.
»Dann melde ich mich wieder«, sagte Morgan und war überzeugt, in Lindas angedeutetem Lächeln einen Anflug von Erleichterung zu erkennen.
Der Winter ging langsam in den Frühling über, Howie verließ die Stadt Anfang Mai, und Morgan erfuhr über mehrere Ecken, dass Linda ihrem Freund seinen Ring zurückgegeben hatte. Jetzt setzte er alles daran, ihr irgendwo über den Weg zu laufen. Aber er dachte nicht nur ständig an sie, sondern mindestens ebenso häufig an das seltsame Gerät, das er im Arbeitszimmer ihres Vaters gesehen hatte.
Kapitel 3: Eine bittere Pille
KAPITEL 3
Eine bittere Pille
(Notizen aus dem Kaninchenbau Nr. 1)
»Hast du das Rätsel schon gelöst?«, wandte sich der Hutmacher wieder an Alice.
»Nein, ich gebe es auf«, antwortete Alice. »Wie lautet die Lösung?«
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung«, sagte der Hutmacher.
»Ich auch nicht«, sagte der Märzhase.
Alice seufzte müde. »Ich finde, ihr könntet die Zeit besser nutzen«, sagte sie, »als sie mit Rätseln zu verschwenden, die keine Lösung haben.«
Lewis Carroll, Alice im Wunderland
Meine Korrespondenz mit dem einzigen überlebenden Kind Townsend Browns begann im Spätherbst 2002, 5 Monate nachdem ich Andrew Bolland über dessen Townsend-Brown-Website kontaktiert hatte.
Andrew hatte mir erklärt, warum Linda noch zögerte, schmerzhafte Erinnerungen aufzuwärmen:
Dass Linda ein Teil der Townsend-Brown-Familie ist, hat sie zu einer ziemlichen Einsiedlerin gemacht. Die meisten Leute glauben, dass sie vor ein paar Jahren ums Leben gekommen ist, und das ist ihr gar nicht unrecht. Ihr Vater hat die Ufo-Organisation NICAP 8 gegründet und wurde wegen seiner Forschungen über Gravitationsfelder mit dem Ufo-Phänomen in Verbindung gebracht. Das gibt Ihnen sicher eine Vorstellung davon, wer die Leute sind, die mit Linda Kontakt aufnehmen wollen.
Ich ließ Linda über Andrew ein Exemplar meiner mittlerweile erschienen Farnsworth-Biografie The Boy Who Invented Television zukommen. Ein paar Wochen später schickte sie mir eine erste Mail. Sie begann gleich mit einer Warnung, auf die ich lieber hätte hören sollen:
Ich würde am liebsten alles so lassen, wie es jetzt ist. Es wird schwierig und gelegentlich schmerzhaft für mich sein, die Vergangenheit aufleben zu lassen, das weiß ich. Hoffentlich verstehen Sie, dass ich meine Bedenken habe, inwieweit ich Ihnen überhaupt eine Hilfe sein kann. Ich hatte nur mit jener Erfindung meines Vaters zu tun, die er als »elektrohydrodynamischen Ventilator/Lautsprecher« bezeichnete. Unsere ganze Familie war während meiner gesamten Teenagerzeit und bis in meine frühen Zwanziger untrennbar mit »dem Ventilator« verbunden. Dass wir so sehr für etwas leiden mussten, das sich später scheinbar als nichts herausstellte, war eine bittere Pille.
Eine Variante des Geräts, das Morgan damals schier umgehauen hatte, erlangte in den 1990er-Jahren eine gewisse Bekanntheit – als Luftreiniger namens Ionic Breeze von The Sharper Image, der rund um die Uhr in Dauerwerbesendungen angepriesen wurde. Lindas Bemerkungen schienen das zu bestätigen, was in der ersten, anonymen E-Mail stand: Die Arbeit ihres Vaters hatte Gewinne abgeworfen, die aber leider nicht ihrer Familie zugutegekommen waren.
Meine Erinnerungen entstammen der Perspektive einer 20-Jährigen. Aus der Tatsache, dass sich keine unserer Erwartungen erfüllt hat, resultierte diese große bittere Pille. Wir haben uns immer gefragt, wie wir in diese Sackgasse gelangen konnten.
Ich schrieb zurück:
Mich faszinieren die Geheimnisse im Leben von T. Townsend Brown ebenso, wie mich die Geheimnisse im Leben von Philo T. Farnsworth fasziniert haben. Irgendwo im Herzen dieser Geheimnisse verbirgt sich die wichtige Erkenntnis darüber, in welcher Art von Universum wir wirklich leben.
Und das waren die ersten Schritte auf einer Suche, die man mir schon sehr früh warnend als »Mehrgenerationenprojekt« beschrieben hatte.
Kapitel 4: Der zweite Edison
KAPITEL 4
Der zweite Edison
(1915)
Der künftige Jungelektriker (im Alter von etwa 10 Jahren) mit seinen Eltern Mary Townsend und L. K. Brown, um 1915
Im Frühjahr 1915 beobachtete ein Besucher des Hauses von Mr. und Mrs. Lewis K. Brown im vornehmen Terrace-Bezirk der Stadt Zanesville in Ohio etwas Seltsames: Ein etwa 10-jähriger Junge ging am schmiedeeisernen Zaun entlang, der das Grundstück begrenzte, und pflückte lässig Regenwürmer vom gepflegten Rasen, die er sodann in einen Eimer warf.
»Was machst du da?«, fragte der Besucher.
»Ich sammle Würmer«, antwortete der Junge.
»Aber du gräbst doch gar nicht danach. Die kriechen ja alle an der Oberfläche herum!«
»Das liegt daran, dass ich den Zaun unter Strom gesetzt hab«, sagte der Junge und zeigte auf eine Batterie, die er an das metallene Gestänge angeschlossen hatte. »Der Strom im Boden regt die Würmer an und treibt sie an die Oberfläche.«
»Und was hast du mit den ganzen Würmern vor?«
»Angeln gehen.«
***
Thomas Townsend Brown kam am 18. März 1905 als Sohn einer der angesehensten Familien von Zanesville zur Welt – im selben Jahr, als ein damals noch unbekannter Angestellter am Schweizer Patentamt, ein gewisser Albert Einstein, einen wissenschaftlichen Aufsatz zum Thema »spezielle Relativitätstheorie« publizierte.
Da Thomas der einzige männliche Vertreter seiner Generation war, erwartete man von ihm, dass er einmal die Verantwortung für das Vermögen der Familie übernehmen würde. Den Grundstein dafür hatte sein Großvater mütterlicherseits gelegt. Thomas Burgess »T. B.« Townsend war Amerikaner der zweiten Generation. Seine Eltern William Townsend und Harriett Burgess hatten einander irgendwo auf dem Nordatlantik kennengelernt, an Bord des Schiffs, das sie 1834 oder 1835 aus ihrer Heimat im englischen Gloucestershire in die Neue Welt brachte. Das Paar heiratete in Pittsburgh, und T. B. war das erste ihrer dreizehn Kinder. Einer hagiografischen Familiengeschichte zufolge hatte T. B. Townsend »nicht einen einzigen Dollar, als er sein eigenes Leben begann«. Seine offizielle Schulausbildung beendete er mit 9 Jahren, und »insgesamt hatte er die Schule nur etwa 6 Monate lang besucht«.
Im Teenageralter arbeitete T. B. als Lehrling im Ziegel- und Steinmetzbetrieb seines Vaters in Beverly, Ohio. Mit 19 Jahren machte er sich dann »in den fernen Westen auf«. Er fuhr auf einem Dampfschiff den Mississippi stromaufwärts bis Burlington in Iowa, wo er Arbeit beim Schneiden und Verlegen von Steinen für den neuen Gouverneurssitz des Bundesstaats fand.
Ein paar Jahre später kehrte T. B. nach Beverly zurück und übernahm die Baufirma seines Vaters, »die er mit stetig wachsendem Erfolg weiterführte … wobei seine Kundschaft an Umfang und Bedeutung stetig zunahm«. Er erweiterte seine geschäftlichen Aktivitäten auf Marmor- und Granitsteinbrüche. Als dieser Unternehmenszweig florierte, verlegte er den Firmensitz nach Zanesville, das zu dieser Zeit »das Zentrum des Großhandels mit Marmor und Granit war«.
In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts lieferte T. B. Townsend die Bausteine für viele Gebäude in Zanesville und das umliegende Muskingum County, darunter auch das klassisch verzierte Gerichtsgebäude von Tuscarawas County, das heute noch als Zeugnis für die Extravaganz des »Gilded Age« [wörtlich: »vergoldetes Zeitalter«; die wirtschaftliche Blütezeit in den USA nach dem Sezessionskrieg; Anm. d. Übers.] steht.
Mit Anbruch des neuen Jahrhunderts war T. B. damit beschäftigt, einen Großteil der Infrastruktur der Gegend aufzubauen – angefangen mit dem ersten Straßenbahnsystem von Zanesville. Nachdem er seine Anteile an diesem Unternehmen verkauft hatte, begann er »einen Großteil der Straßen in Zanesville zu pflastern und baute die meisten Abwasserkanäle«. Mit Steinen aus seinen eigenen Steinbrüchen errichtete er Fundamente für mehr als ein Dutzend Brücken über den Muskingum River.
Neben seinen »anderen wichtigen Investitionen« war Mr. Townsend besonders stolz auf seine weitläufige und wertvolle Ranch mit 14,5 Quadratkilometern Fläche in Marion County, Kansas, wo er unter anderem »Rinder, Schweine und Pferde züchtete sowie Mais, Luzernen und Sorghumhirse anbaute«. Das Grundstück wurde von einem mehr als 80 Kilometer langen Zaun umgeben, der aus 16 500 Pfählen und mehr als 320 Kilometer Stacheldraht bestand.
T. B. Townsends Frau Sybil Nulton Townsend brachte fünf Kinder zur Welt, von denen drei bis ins Erwachsenenalter überlebten. Der älteste Sohn Orville wurde Vizepräsident und Geschäftsführer der Baufirma Townsend Brick and Contracting Company; die Tochter Hattie heiratete Rufus Burton, der dort als Sekretär und Kassenverwalter fungierte; und die andere Tochter Mary sorgte mit ihrem Mann L. K. Brown für den einzigen männlichen Nachfahren der nächsten Generation – Thomas Townsend Brown.
In der 1905 erschienen Biografie von T. B. Townsend heißt es in der typisch blumigen Sprache dieser Zeit: »Das Ausmaß und die Bedeutung der geschäftlichen Interessen, die seine Aufmerksamkeit verlangten, und der Erfolg, der seinen Bemühungen zuteilwurde, machen seine Geschichte so bemerkenswert. … Er ist ein Mann mit einer ausgeprägten, starken Persönlichkeit, einer umfassenden Geisteshaltung und einem reifen Urteilsvermögen, der Gelegenheiten schnell zu erkennen und zu nutzen weiß; darin liegt das Geheimnis seines Wohlstands.«
Das waren die Fußstapfen, in die der Junge, der Regenwürmer elektrisierte, einmal treten sollte.
***
Aus Respekt vor seiner Mutter ließ sich Thomas mit seinem zweiten Vornamen anreden. Seine Experimente mit Elektrizität führten dazu, dass er 1917 – als man mit Funkwellen kaum mehr als Morsezeichen übertragen konnte – sein erstes Funkgerät zusammenbastelte. Das brachte ihm die Aufmerksamkeit einer Lokalzeitung ein, die einen Artikel mit der Titelzeile »Townsend Brown hat ein komplettes Funkgerät« brachte.
In dem Artikel wurde er als »Zanesvilles zweiter Edison« bezeichnet; der Verfasser merkte aber auch an, dass der junge Brown die verschlüsselten Nachrichten, die er da empfing, kaum verstehen konnte. »Herr Brown hat sich in erster Linie mit der mechanischen Seite der drahtlosen Telegrafie befasst und ist noch nicht in der Lage, die Nachrichten kompetent zu entschlüsseln. Er übt jedoch fleißig.« Ein anderer seiner Apparate wird in dem Text als »drahtloses Telefon« bezeichnet. »Wenn er draußen spielt, trägt er ein drahtloses Telefon am Ohr. Seine Angehörigen können ihn anrufen, wo auch immer er sich aufhält, indem sie einfach in den drahtlosen Empfänger im Haus sprechen, und er hört sie dann perfekt.«
Auch die US-Bundesregierung wurde auf die Experimente des Wunderkinds aufmerksam. Da in Europa gerade der Erste Weltkrieg tobte, tauchte ein Postbeamter im Haus der Browns auf und forderte Thomas auf, die Antenne abzubauen, die er auf dem Dach montiert hatte. Es kursierte nämlich das Gerücht, dass der Junge damit Funksignale aus Deutschland empfangen könne – und die Behörden fürchteten, dass jemand die Vorrichtung dazu nutzen könnte, Botschaften an den Feind zu schicken.
Das war Townsend Browns erste Begegnung mit dem Thema »Nationale Sicherheit«.
***
Aus der Schulzeit des Jungen sind nur wenige Aufzeichnungen erhalten, und es gibt kaum Belege über besondere Verdienste und Auszeichnungen.
In den Jahren 1922 und 1923 besuchte Townsend die Doane Academy in Granville, auf halber Strecke zwischen Columbus und Zanesville in der Mitte von Ohio. Granville war ein von Bäumen gesäumtes Dorf mit einer Kirche an jeder Ecke der Hauptkreuzung. Auf einem Hügel über der Ortschaft ragt die Denison University auf, die im Jahr 1831 von der Ohio Baptist Education Society gegründet wurde und nach William S. Denison – ebenfalls aus Zanesville – benannt ist; zum Dank für seinen großzügigen finanziellen Beitrag zur Errichtung der Lehranstalt.
Am Rand des Hochschulgeländes stand mit dem Swasey-Observatorium das markanteste Bauwerk der Denison University. Es war ein rechteckiger Betonbau mit einem weißen, von einer drehbaren Kuppel gekrönten Turm und galt als eines der besten akademischen Observatorien im ganzen Land. Von 1911 bis 1934 wurde es von Dr. Paul Alfred Biefeld, dem Astronomieprofessor der Universität, verwaltet.
Townsend verbrachte 2 Jahre an der Doane Academy und bereitete sich darauf vor, nach seinem Abschluss im Jahr 1923 an der Denison University zu inskribieren. In Fächern wie Latein, Algebra und Englisch hatte er nur Zweien und Dreien; seine einzigen Einsen brachte er in Physik und Geschichte nach Hause.
Stolz war er vor allem auf den ersten Radiosender der Schule, den er um eine De-Forest-Audion-Röhre herum konstruiert hatte. Diese hatte er von Lee de Forest selbst erhalten, nachdem Brown den berühmten Erfinder während einer Reise mit seiner Mutter nach New York dortselbst aufgespürt hatte. Mit einem Signal von nur 10 Watt war die Denison Station 8YM bis nach Kalifornien zu hören. An Samstagabenden übertrug der Sender Konzerte einer lokalen Band namens The Green Imps. Als die Schule die Stromversorgung des Radiosenders abzuschalten versuchte, um eine Sperrstunde um 22 Uhr zu verhängen, baute Townsend sein eigenes kleines DELCO-Kraftwerk, erzeugte Strom und ließ die Musik bis spät in die Nacht laufen.
In den persönlichen Erinnerungen, die er Jahre später verfasste, resümierte Brown seine universitäre Laufbahn mit den Worten: »Ich übernachtete im Physikraum.«
Kapitel 5: Eine andere Quelle
KAPITEL 5
Eine andere Quelle
(Notizen aus dem Kaninchenbau Nr. 2)
»Du liebe Zeit! Wie verquer heut alles ist! Und gestern lief noch alles wie gewöhnlich. Ob ich wohl in der Nacht ausgewechselt worden bin? Lass mich mal überlegen: War ich wirklich dieselbe, als ich heute Morgen aufstand?«
Lewis Carroll, Alice im Wunderland
In der Geschichte der Wissenschaft und der Erfindungen kommt es immer wieder vor, dass aus Forschung und Vorbedacht mit einem Schlag Zufälle und Eingebungen werden.
Mein privates Interesse an solchen Dingen geht auf einen warmen Frühlingstag im Jahr 1960 in Rumson, New Jersey, zurück. Ich war zwar erst in der dritten Klasse, aber meine Mutter machte sich Sorgen, dass ich nicht genug las. Also schleppte sie mich in die Oceanic Public Library, eine öffentliche Bücherei an der Avenue of Two Rivers, und sagte, ich solle mir ein Buch aussuchen. Ich entschied mich für eine Biografie von Thomas Edison aus der »Signature Series« und verschlang sie so schnell, wie ein 9-Jähriger das eben konnte. 9 Im darauffolgenden Jahr spielte ich in der Theateraufführung der vierten Klasse Edison und begeisterte meine Schulkameraden, indem ich auf der Bühne in der Aula der Forrestdale School die Glühbirne erfand.
Ungefähr 12 Jahre später stieß ich – in einer anderen Bücherei, diesmal im kalifornischen Santa Monica – auf die Geschichte von Philo T. Farnsworth, dem 14-jährigen Bauernjungen aus Idaho, der 1922 an der Highschool eine Skizze für seinen Naturwissenschaftslehrer anfertigte und sagte: »Das ist meine Idee für elektronisches Fernsehen.« 10 Die Technologie hat sich in den Jahrzehnten seit damals zwar weiterentwickelt, doch jeder Videobildschirm, den es heute auf unserem Planeten gibt, geht auf diese Skizze zurück (die der Lehrer aufbewahrte und 10 Jahre später in einen Patentstreit einbrachte). Ich war fasziniert von den Fotos aus der Vorgeschichte des Fernsehens in den 1920er- und 1930er-Jahren und von der Inspiration, die rotierende Räder und Spiegel durch Elektronen ersetzte, die in einer Vakuumröhre herumspringen.
Zu dieser Zeit war ich bereits ein begeisterter Fan der Bücher von Marshall McLuhan, der das Motto »Das Medium ist die Botschaft« erfunden hatte. Was er damit sagen wollte: »Gesellschaften werden seit jeher mehr durch die Art der Medien geformt, mit denen Menschen kommunizieren, als durch den Inhalt der Kommunikation.«
Dies war während der späten 1960er-Jahre, einer Zeit großer Umbrüche und Turbulenzen, die zu einem bedeutenden Teil durch neue Technologien wie Fernsehen und Satellitenkommunikation ausgelöst wurden. Um es mit McLuhan zu sagen: Wir lebten in einem »globalen Dorf«. Der Kommunikationstheoretiker schien uns verkünden zu wollen, dass der Weg zur Bestimmung der Menschheit mit neuen Geräten und technischen Gadgets gepflastert sein würde. Wenn das zutraf, dann waren es meiner Meinung nach die Erfinder dieser neuen Technologien, die auf der Welt wirklich etwas veränderten.
Dies war der Beginn meiner Beschäftigung mit »Biografien obskurer Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts«, die ihren ersten Ausdruck darin fand, dass ich eine Biografie über Philo Farnsworth schrieb, die 2002 erschien. 11
Farnsworth und andere wie er vertreten die Idee, dass Erfinder und Wissenschaftler – wie auch Künstler, Musiker und Schriftsteller – mit bestimmten Ideen und Informationen, die in ihrem Gehirn bereits auf spezifische Weise vorcodiert sind, geboren werden. Wie es scheint, verfügen diese bahnbrechenden Genies über die einzigartige Fähigkeit, aus einem anderen Quell des Wissens zu schöpfen als der Rest der Menschheit. An einem bestimmten Punkt im Leben, meist im Teenageralter, zapfen solche besonders inspirierten Menschen diese Quelle an und gewinnen aus ihr die Ideen für Erfindungen und Technologien, die das Leben auf unserem Planeten dauerhaft verändern.
Diese großen Geister haben also einen speziellen Zugang zum »Universum der magischen Dinge« und kommen entsprechend »programmiert« in diese Welt, um der Menschheit das zu bringen, was im modernen Fachjargon so gern als »Technologietransfer« bezeichnet wird.
Wir wissen also, dass und wohin Technologien transferiert werden. Doch wäre es nicht ungleich interessanter zu erfahren, woher sie transferiert werden?
Kapitel 6: Zwerge auf den Schultern von Riesen
KAPITEL 6
Zwerge auf den Schultern von Riesen
(1687–1923)
Ein Pantheon von Riesen. Von links nach rechts: Benjamin Franklin, Heinrich Hertz, Isaac Newton, James Clerk Maxwell, Albert Einstein, Hans Christian Oersted, Michael Faraday, Max Planck
Die moderne Wissenschaft hat ihren Ursprung im 17. Jahrhundert – dem sogenannten Zeitalter der Aufklärung.
Im Jahr 1687 publizierte Sir Isaac Newton die PhilosophiaeNaturalis Principia Mathematica [»Die mathematischen Grundlagen der Naturphilosophie«], seine ausführliche Darstellung eines fest gefügten und stabilen Universums, in dem die Zeit absolut und unveränderlich ist, weil sie überall und für jeden gleich schnell vergeht. 12 Die Principia bildeten die Grundlage für eine explosionsartige Zunahme der wissenschaftlichen Erkenntnisse im 18. und 19. Jahrhundert.
Jede Entdeckung beruht auf denen, die ihr vorausgegangen sind. Wie Newton selbst gesagt hat: »Wenn ich weiter gesehen habe als andere, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stand.«
Mit Anbruch des 20. Jahrhunderts begannen die soliden Grundlagen von Newtons Universum zu wackeln. Jetzt wurde nämlich ein Phänomen erforscht, das zu seiner Zeit noch unbekannt war: die Elektrizität. Sie war nicht wirklich etwas Neues; Elektrizität hatte es in der einen oder anderen Form immer schon gegeben, sei es in der statischen Entladung eines kalten Metallstücks oder dem heftigen, grellen Energieausbruch eines Blitzschlags. Die Wissenschaft begann diese geheimnisvolle Kraft jedoch erst im 18. Jahrhundert zu meistern. Bedenkt man, wie sehr die Elektrizität unsere moderne Welt heute antreibt, erscheint es nachgerade seltsam, dass uns diese mittlerweile unverzichtbare Kraft erst seit etwa 200 Jahren zur Verfügung steht – nicht einmal ein kurzer Augenblick in der Menschheitsgeschichte.
Im 18. Jahrhundert fanden neue Riesen Eingang in das Pantheon.
1752 ließ Benjamin Franklin während eines Gewitters einen Drachen steigen, um die elektrische Entladung eines Blitzes einzufangen. Im Jahr 1820 bemerkte der dänische Wissenschaftler Hans Christian Oersted, dass ein Strom führender Draht eine Kompassnadel ablenken kann; damit war die erste aufgezeichnete Beobachtung des Zusammenhangs von Elektrizität und Magnetismus gelungen. Es sollte aber noch ein weiteres Jahrzehnt vergehen, bevor der englische Wissenschaftler Michael Faraday die Entdeckung von Oersted umkehrte und nachwies, dass ein Magnet in einem Metalldraht elektrischen Strom induzieren kann.
In den 1860er-Jahren formulierte Faradays Schützling, der Schotte James Clerk Maxwell, die Gleichungen, mit denen bewiesen werden konnte, dass Elektrizität und Magnetismus eine der Grundkräfte der Physik bilden: den Elektromagnetismus.
Maxwell beobachtete außerdem, dass Wellen elektromagnetischer Energie sich mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum bewegen können. Diese Idee wurde später von Heinrich Hertz – der wiederum ein Protegé Maxwells war und nach dem die Frequenzeinheit benannt ist – überprüft. Maxwell formulierte zudem die These, dass das Licht selbst eine Form dieser elektromagnetischen Strahlung ist; diese Idee stellte letztlich die Grundsätze infrage, die ihn in seiner Forschung überhaupt erst an diesen Punkt gebracht hatten.
Am Beginn des 20. Jahrhunderts postulierte der Physiker Max Planck, dass Materie Wärmeenergie aufnimmt und diskontinuierliche Lichtenergie in Form von »Klumpen« aussendet. Diese Planck’schen Klumpen, die er als »Quanten« bezeichnete, begründeten das neue Forschungsfeld der Quantenmechanik.
Der Durchbruch, der das 20. Jahrhundert von allen vorangegangenen unterschied, ereignete sich jedoch im »Annus mirabilis« – dem Jahr der Wunder 1905 –, als Albert Einstein nicht eine oder zwei, sondern gleich vier bahnbrechende Arbeiten veröffentlichte und damit die Welt veränderte.
In seinem ersten Aufsatz aus dem erwähnten Jahr analysierte der theoretische Physiker den fotoelektrischen Effekt, bei dem bestimmte Metalle Elektronen abgeben, wenn Licht auf ihre Oberfläche trifft. 13 Für die Bestimmung der Beziehung zwischen Licht und elektrischer Energie erhielt Einstein den Nobelpreis für Physik des Jahres 1921. In seinem zweitem Aufsatz befasste er sich mit dem Verhalten von Atomen unter Bedingungen, die als »Brownsche Bewegung« bezeichnet werden, und bewies damit die Existenz von Atomen, die zu dieser Zeit noch stark umstritten war.
Es war jedoch Einsteins dritte Arbeit, »Zur Elektrodynamik bewegter Körper«, die sämtliche Paradigmen der Physik neu ordnete und eine völlig neue Kosmologie schuf. Sie enthielt die spezielle Relativitätstheorie, die Newtons unveränderliches Universum aus den Angeln hob.
Newtons nach wie vor gültige Berechnungen zur Gravitation brachten Menschen in den 1960er-Jahren zum Mond und zurück. Doch das »Warum?« der Gravitation – die Frage, woher sie kommt und wie sie funktioniert – sollte nach dem »Annus mirabilis« noch ein Jahrzehnt lang unbeantwortet bleiben, bis Einstein seine wichtigste Theorie publizierte.
1916 deutete er nämlich in seiner allgemeinen Relativitätstheorie die Gravitation als eine Krümmung des Raums, eine Verzerrung, die durch die Anwesenheit eines massereichen Objekts wie eines Planeten oder Sterns verursacht wird. Albert Einstein stand auf den Schultern aller seiner Vorgänger, fasste alles von Newton bis Planck zusammen und beförderte die Menschheit in ein Universum, in dem sich der Raum krümmen lässt und die Zeit dehnbar ist.
Einsteins Erklärung der Gravitation wird oft durch ein massereiches Objekt wie die Erde illustriert, die das Gewebe der Raumzeit dehnt – wie eine Kugel, die auf einer Membran liegt; in der so entstandenen Krümmung umkreist der Mond unseren Planeten
***
Im Herbst 1923 schrieb sich der 18-jährige Townsend Brown am California Institute of Technology ein und begann mit der Einrichtung eines Privatlabors im kalifornischen Wohnsitz der Familie in Pasadena.
Unterdessen war Einstein noch nicht damit fertig, das Gewebe des Universums zu dehnen und zu krümmen. Zu Beginn des Jahres legte er die erste von mehreren Dissertationen vor, deren Thema den Rest seines Lebenswerks bestimmen sollte – die Suche nach der einheitlichen Feldtheorie. Er hatte die Gravitation neu definiert und spähte nun über den Rand des Raum-Zeit-Kontinuums auf der Suche nach einer Gleichung, mit der sich die Gravitation mit der anderen zu dieser Zeit bereits bekannten Grundkraft der Physik verbinden ließ: dem Elektromagnetismus.
Einstein konnte nicht ahnen, dass auf der anderen Seite der Welt ein Caltech-Student den physikalischen Beweis für das gefunden hatte, was er selbst nur als Theorie formulieren konnte.
Kapitel 7: Eine rohe, plumpe Kraft
KAPITEL 7
Eine rohe, plumpe Kraft
(1923)
Es gibt keine Berichte über den genauen Augenblick der Inspiration. Wir wissen nichts über einen Apfel, der Townsend Brown auf den Kopf gefallen wäre, über einen Blitz, der in ein himmelwärts gerichtetes Objekt einschlug, oder über parallele Furchen in einem Zuckerrübenfeld. Wir haben nur Browns beharrliche Behauptung, dass er das, was auch immer er gewusst hat, »alles auf einmal gewusst hat«. Einen Einblick in diese Erfahrung gab Brown in einem autobiografischen Abriss, den er Jahrzehnte später seiner Frau diktierte:
Im Sommer oder Herbst 1923 machte ich nicht nur in Chemie, sondern auch in Physik erhebliche Fortschritte. Ich erfand ein Röntgenspektrometer für astronomische Messungen, vor allem solche der Sonne, und begann die Theorie zu entwickeln, dass eine andere Strahlung als das Licht im Universum vorherrschend ist, unabhängig von unserem Sonnensystem. Ich hatte das Gefühl, dass diese Strahlung die Gravitation sein könnte, dass sie einen (wenn auch geringen) Druck auf alle Formen der Materie ausübte. Daraus entstand meiner Ansicht nach eine neue Theorie der Gravitation, die besagte, das die Gravitation ein »Druck« und kein »Zug« ist. Das schien mir logisch, weil die Natur jegliche Art von Vakuum verabscheut. Jetzt brauchte ich nur noch einen theoretischen Mechanismus für die Übertragung von Gravitation.
Die Theorie, die durch diese Aussage schimmert und im Endeffekt zum zentralen Begriff wurde, mit dem sich Browns Vorstellungskraft für den Rest seines Lebens befasste, lautet: »eine andere Strahlung als Licht im Universum vorherrschend ist« …
***
Eine weitere biografische Skizze über Townsend Brown stammt von A. L. Kitselman, den seine Freunde »Beau« nannten und der bei den Geheimprojekten für die US-Landesverteidigung in den 1940er- und 1950er-Jahren Browns Kollege war. Beau und seine Frau gehörten zu den engsten Freunden, die die ständig umherziehende Familie Brown je hatte. Kitselman veröffentlichte in einem Pamphlet mit dem Titel Hello Stupid [dt. etwa: »Hallo, Dummkopf«] eine vernichtende Kritik an den etablierten Wissenschaftlern, die Townsend Brown und dessen Ideen abgelehnt hatten. 14 Diverse Varianten der in diesem Pamphlet enthaltenen Geschichten bildeten die Grundlage für spätere Berichte über Browns frühe Jahre.
Laut Kitselman hatte der junge Thomas Brown seinen Blick auf den Himmel gerichtet, träumte von Reisen zwischen den Sternen – und dachte über Antriebsmethoden nach, die ihm dies ermöglich könnten. Raketenantriebe verwarf er als »eine rohe, plumpe Kraft« und stellte sich die Frage, ob man die Entfernung zu den Sternen vielleicht eher mithilfe der Elektrizität überwinden könne als mit der kontrollierten Explosion brennbarer Gase.
Derartige Gedanken schwirrten ihm durch den Kopf, als im Caltech-Physikunterricht Experimente mit einer Röntgenröhre durchgeführt wurden. Während seine Kommilitonen sich auf die Röhre konzentrierten, beachtete »Tom« vor allem die Kabel, die die Röhre mit einer Starkstromquelle verbanden. Ihm fiel auf, dass diese Kabel beim Anlegen der Spannung mit schlangenartigen Zuckungen hochsprangen. Dadurch, so Kitselman, gelangte der Möchtegernraumfahrer genau in diesem Moment zu seiner Theorie über Weltraumreisen.
Leider war das California Institute of Technology aber die Art von akademischer Institution, die ihre Studienanfänger eher zur Anpassung als zum Experimentieren anhielt. Es dauerte nicht lange, bis der begeisterte Student mit den kühnen Ideen sowohl in Chemie als auch in Physik durchfiel. »Sobald ich ein Experiment aufgebaut hatte«, erinnerte er sich, »läutete die Glocke, die Stunde war zu Ende, und ich musste alles wieder abbauen. Ich konnte nie ein Experiment beenden!«
Um dieses institutionelle Handicap auszugleichen, richtete Browns Vater ihm ein Privatlabor im ersten Stock des Familienhauses ein, das mit dem am Caltech mithalten und in dem der junge Forscher ungehindert experimentieren konnte.
Kapitel 8: Unmöglich und nicht überlegenswert
KAPITEL 8
Unmöglich und nicht überlegenswert
(1923)
1923, in Townsend Browns erstem Studienjahr am Caltech, erhielt sein Physikprofessor Dr. Robert Andrews Millikan den Nobelpreis für Physik. Damit war er das erste Caltech-Fakultätsmitglied, dem man diese Auszeichnung verlieh. Bei seiner Ehrung brachte man ihn sogar noch mit dem berühmtesten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts in Verbindung. Millikan bekam den Preis für das Ermitteln der negativen Elementarladung eines Elektrons sowie die Bestätigung der Berechnungen über den fotoelektrischen Effekt, für die Albert Einstein 2 Jahre zuvor den Nobelpreis bekommen hatte.
Millikan war nur ungern zur Physik gekommen. Als Student am Oberlin College waren ihm eigentlich Mathematik und die klassischen Sprachen lieber. Erst als sein Griechischprofessor ihn ersuchte, einen Grundkurs in Physik zu unterrichten – mit den Worten »Jeder, der gut Griechisch kann, kann auch Physik unterrichten« – begannen seine Interessen sich zu verlagern. Nachdem er 1891 seinen Bachelorabschluss in klassischer Altertumskunde gemacht hatte, belegte Millikan an der Columbia University Physik und erwarb 1895 den ersten Doktortitel der Hochschule auf diesem Gebiet. Mit dem Doktorat in der Hand folgte er dem Rat eines Professors und verbrachte ein Jahr mitten im damaligen Zentrum der theoretischen Physik in Deutschland.
Nach seinem Auslandsjahr nahm Millikan die Einladung an, als Assistent von Albert A. Michelson – dem Mitverantwortlichen für das berühmteste gescheiterte Experiment der Wissenschaftsgeschichte 15 – in den Lehrkörper der Columbia University einzutreten.
Im Jahr 1887 hatten Michelson und sein Kollege Edward Morley eine Reihe von Experimenten durchgeführt, mit denen sie das Medium vermessen wollten, durch das sich Licht- und Funkwellen ausbreiten. Angeregt durch eine Idee aus der Zeit des Aristoteles, hatte James Clerk Maxwell im 19. Jahrhundert die Theorie aufgestellt, dass sich elektromagnetische Wellen durch den »Licht tragenden Äther« bewegen, so wie Schallwellen durch die Luft. Das Michelson-Morley-Experiment war ein Versuch, die Bewegung der Erde durch dieses kosmische Medium zu messen. Die ebenso aufwendige wie kostspielige Versuchsanordnung der beiden Forscher konnte jedoch nicht einmal einen Hauch von Äther feststellen und warf stattdessen noch mehr Fragen über die Natur von Licht und Energie auf. Immerhin waren Michelson und Morley dadurch aber zu einer Fußnote in den Annalen der theoretischen Physik geworden.
Obwohl man ihm nur ein bescheidenes Gehalt angeboten hatte, ging Robert Millikan als Assistent Michelsons nach Chicago, weil man ihm zugesagt hatte, dass er dort reichlich Zeit für seine eigenen Forschungen haben würde. Statt sich seinen eigenen Weg zu bahnen, musste sich Millikan jedoch mit akademischen Pflichten beschäftigen und verfasste mehrere Lehrbücher, während Max Planck, Albert Einstein und andere mit ihren revolutionären Ideen über Teilchen und Wellen die Welt veränderten. Mit 38 Jahren war Millikan immer noch außerordentlicher Professor – und das in einem Fachbereich, wo die Mitarbeiter mit durchschnittlich 32 Jahren ordentliche Professoren wurden.
Einsteins »Annus mirabilis« brachte ihn dazu, sich neu zu orientieren. In seiner Autobiografie schrieb er: »Im Jahr 1906 wusste ich, dass ich bisher keine Ergebnisse von herausragender Bedeutung publiziert und mit Sicherheit noch keine wirklich bedeutende Position als forschender Physiker erlangt hatte.« 16 Wahrscheinlich war es nicht göttliche Inspiration, die Millikan antrieb, sich einen Namen zu machen, sondern sein Ego. Er beschloss, dass es von Nutzen wäre, die genaue elektrische Ladung eines Elektrons – jenes subatomaren Teilchens, das der englische Wissenschaftler J. J. Thompson 1887 entdeckt hatte – zu bestimmen. Millikan vermutete zu Recht, dass die Bestimmung dieser Größe wertvolle Erkenntnisse zur Natur von Materie und Elektrizität liefern würde.
4 Jahre lang sprühte Millikan Öltröpfchen aus einem Parfümzerstäuber. Sollte es ihm gelingen, die genaue Ladung zu ermitteln, mit der sich seine Ölteilchen gegen die Schwerkraft in Schwebe halten ließen, dann konnte er so die Elementarladung in den Tröpfchen berechnen. 17 1910 publizierte er die Ergebnisse dieser Experimente, in denen er die Ladung eines einzelnen Elektrons auf einen konstanten Wert berechnet hatte (circa 1,602 × 10-19 Coulomb, wenn Sie es genau wissen wollen). Noch im selben Jahr erhielt er endlich eine ordentliche Professur an der Universität Chicago.
***
Im Jahr 1917 wechselte Millikan von der University of Chicago ans Caltech, wo er eine wichtige Rolle dabei spielte, diese Institution zu einer der weltweit bedeutendsten Ausbildungsstätten für Wissenschaft zu machen. 1921 wurde er zum Direktor des Norman-Bridge-Laboratoriums für Physik am Caltech ernannt.
2 Jahre später, im Herbst 1923, tauchte der junge Townsend Brown in genau diesem Labor auf und war frustriert über die Protokolle und Verfahren, die dort vorgeschrieben waren. Im folgenden Frühling hatte er endgültig genug von den Beschränkungen, die man seiner Arbeit auferlegte. Er brauchte dringend einen Mentor, der sich seine Ideen anhörte, ohne gleich ein Urteil darüber zu fällen. In Robert Millikan, dem vor Kurzem mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Caltech-Wissenschaftler, hoffte er ein offenes Ohr zu finden.
Townsend bereitete seine Experimente im Heimlabor vor und lud Studenten wie Professoren zu einer Vorführung ein. Zur anberaumten Stunde klopfte allerdings niemand an die Tür des großen Hauses in Pasadena. Kein Mensch wollte Townsend Browns Erfindungen sehen. Seine Kommilitonen an der Uni belächelten ihn und rissen hinter seinem Rücken Witze.
Zu den Leuten, die Townsends Einladung ignoriert hatten, gehörte auch Dr. Millikan. Doch der junge Mann schluckte seinen verletzten Stolz herunter und spürte Millikan in dessen Büro auf dem Caltech-Gelände auf. Da sich Millikan einem Gespräch nun nicht mehr entziehen konnte, hörte er widerwillig zu, wie ihm sein Student erklärte, dass er eine Verbindung zwischen Elektrizität und Gravitation entdeckt habe. Als Townsend fertig war, wies Millikan ihn schroff ab und sagte, dass das, was er gerade gehört hatte, »total unmöglich und nicht überlegenswert« sei.
»Er ermahnte mich, erst meine Ausbildung fortzusetzen, bevor ich über solche Dinge nachdachte«, schrieb Townsend später in seiner kurzen Autobiografie.
Doch er hatte nicht lange Zeit, sich mit seiner Enttäuschung aufzuhalten. Trotz der Ablehnung durch den Lehrkörper und die Studenten des Caltech standen Townsend Browns Entdeckungen kurz davor, der Welt offenbart zu werden.
Kapitel 9: Ein »Druck«, kein »Zug«
KAPITEL 9
Ein »Druck«, kein »Zug«
(1924)
Foto aus dem Los Angeles Evening Express, 26. Mai 1924
Ein geladener Gast, der tatsächlich zu Townsend Browns Präsentation kam, war Reporter für den Los Angeles Evening Express. Die Leser dieser Zeitung wurden am Montag, den 26. Mai 1924, mit der Überschrift »Behauptet, dass Schwerkraft ein Druck ist und kein Zug« konfrontiert.
Experimente, die ein 18-jähriger Jugendlicher derzeit in einem Privatlaboratorium in Pasadena durchführt, könnten die gesamte Theorie der Gravitation, wie sie von Sir Isaac Newton aufgestellt wurde, revolutionieren.





























