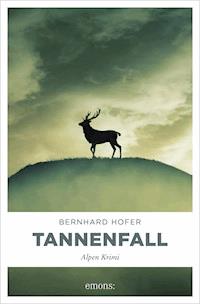Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Tannenfall
- Sprache: Deutsch
Die dunkle Welt des Wahns. Staatsanwältin Marlene Castor zieht sich nach einem beruflichen Rückschlag in die Abgeschiedenheit der Natur im österreichischen Semmering zurück – doch die Idylle währt nicht lange: Marlenes Tochter verschwindet auf mysteriöse Weise. Eine fieberhafte Suche beginnt. Bei ihren Nachforschungen begegnet Marlene immer wieder der unheimliche Ort Tannenfall. Die Zeit drängt, denn nicht nur sie ist auf der Suche nach ihrer Tochter ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: heikihei/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Lothar Strüh
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-528-2
Roman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für Alma und Larissa. Meine Töchter.
Das Wesen der Dingehat die Angewohnheit, sich zu verbergen.
EINS
Es wird eine neue Kälte sein,
die die Seele der Menschen frisst.
DIE NEUE KÄLTE
Eines Tages wird es zwei Gesellschaften geben. Eine, die führt, und eine, die dient. Da es für beide Gesellschaften zu wenige Ressourcen auf dieser Welt geben wird, werden wir der dienenden die Anzahl der Luftzüge vorgeben, die jeder Mensch pro Tag zu sich nehmen darf. Das wird sie sein. Die Neue Ordnung.
Ich öffnete die Augen. Das Salzwasser klebte mir an den Lippen. Das ruhige Atmen der Wellen schlug an meinen Hals. Es roch nach feuchter Erde. Ich hatte meinen Körper verlassen und eroberte ihn nur langsam wieder zurück. Es war, als würde ich ein verlassenes Schlachtfeld wieder betreten, durchzogen mit tiefen Gräben, Bombentrichtern und dem schwefeligen Geruch eines inneren Krieges.
Meine Therapeutin beugte sich über mich. Sie versuchte zu lächeln. Hatte sie die Tränen bemerkt, die als ständige Besucher in mir wohnten? Die steinernen Tränen? Alles war vergebens. Ich wollte dieses Becken nie mehr verlassen. Draußen war es so kalt. Die Leere, die ich im Wasser fand, beruhigte mich für einen Augenblick. Dabei hatte ich solche Angst vor der Leere. Dem Nichts. Dem Loslassen. Ich hatte Angst vor den Bildern, die dann auftauchen würden. Die Gerüche, die Gefühle, die Klänge, der Abgrund. Seit Jahren war ich immer wieder in diesen Abgrund gestürzt und dann gefangen gewesen in einem Labyrinth, gebaut aus hohen weißen Wänden. Dann war ich aufgewacht. Ich hatte geschrien, und sie hatte mich zurückgeholt, da ich Angst hatte, hinter diese Wände zu sehen.
Jetzt schrie ich nicht mehr. Ich hatte keine Kraft mehr dazu. Lya war verschwunden.
Ich lehnte mich an den Beckenrand und sah an meiner Therapeutin vorbei, die mich mit fragenden Blicken durchbohrte. Sie trug einen weißen Kittel und hatte ihr gewelltes braunes Haar hochgesteckt. Sie sah müde aus. An der Wand hinter ihr hing ein Bild. Sein Rahmen war golden. Es zeigte einen Hirsch, der von einem Rudel Wölfe gejagt wurde. Nach dem Ende jeder Rückführung blickte ich zu diesem Bild. Ich fühlte mich mit dem Hirsch auf eine innige Weise verbunden. Was fühlte er, wenn die Zähne der Wölfe seine Haut durchstießen? Waren es dieselben Schmerzen, die ich spürte, die mich überfielen und niederstreckten, wenn ich dachte, dass ich genug gelitten hatte? Das Maul des Tieres war weit aufgerissen. Es sah nach oben zum Himmel, der in dicken Ölfarben über ihm hing. Ich suchte die Sterne darin, aber die waren längst verschwunden, als hätten sie Angst vor den Wölfen.
»Haben Sie nicht auch manchmal Angst, dass die Wölfe wiederkommen?«, fragte ich, ohne meinen Blick vom Bild abzuwenden.
»Seit die Wölfe zum Abschuss freigegeben wurden, habe ich keine Angst mehr«, sagte die Therapeutin, bemüht, mich langsam aus meiner Welt zurückzuholen.
»Alle folgen dem einen großen Wolf. Er ist es, der als Erster seine Zähne in den Hals des Hirsches stößt. Sehen Sie das? Dann folgen die anderen, die aufstrebenden Wölfe, die weiblichen, die jungen, selbst die schwachen, die sich ganz hinten in einigem Abstand einreihen, werden ihm folgen und es ihm gleichtun und ihre Zähne in den längst schon toten Kadaver des Tieres stoßen.«
Die Therapeutin folgte auf dem Bild meinen Worten, die nach dem salzigen Wasser im Becken schmeckten.
»Sehen Sie ihn? Den kleinen Wolf? Ganz hinten? Er hat Mühe, Schritt zu halten. Er scheint schwach zu sein, kann nicht mithalten mit den Großen. Und wenn er nicht aufpasst, dann verliert er den Anschluss und stirbt. Allein da draußen.«
Vor mir tauchte der Abgrund wieder auf, und die eisige Hand meiner Trauer würgte meine Stimme.
Die Therapeutin gab mir ein Handtuch und fasste meine zitternde Hand.
»War diesmal etwas anders? Haben Sie etwas gesehen, was Sie zuvor übersehen hatten?«
Ich schüttelte den Kopf, stieg wankend aus dem Becken und schlang meinen Körper in das warme Handtuch. Meine Therapeutin wirkte nervös. Angespannter als sonst. Hatte sie Angst? Aber wovor? Bevor ich erwachte, blitzte eine kurze Erinnerung auf. Doch sie verschwand wie die Nacht, die sich im Morgengrauen hinter dem Tag versteckt.
»Es ist immer dasselbe«, sagte ich.
»Konnten Sie diesmal hören, was sie Ihnen zugerufen haben?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Ich habe nichts verstanden. Alles war voller Schnee. Eine Wand aus Schnee.«
Ich griff nach dem Stuhl, der neben dem Floating-Tank stand, und setzte mich darauf. In wenigen Jahren würde ich fünfzig werden. War ich dann noch in der Lage, so zu leben? Wie sollte ich dieses Dasein nur ertragen? Gefangen in diesem Dilemma. Die Suche nach meiner verschwundenen Tochter hatte mir alles geraubt, was mich früher so stark gemacht hatte. Meine Selbstsicherheit, meinen wachen Verstand, meine Entschlossenheit und meinen Glauben an die Leidenschaft, die wie ein Feuer alles erfasst hatte. Früher hatte ich geglaubt, überall diese Feuer zu sehen. Jetzt waren sie erloschen, erstickt unter hohem Schnee.
»Ich kann das nicht mehr«, sagte ich mit zerrissener Stimme, die klang wie von jemandem, der immer weiter vom Ufer abtrieb.
»Dann müssen Sie den Krieg in sich beenden. Sie müssen akzeptieren, dass sie fort ist.«
»Kann sie nicht einfach wiederkommen?«
»Sie haben alles versucht.«
»Aber war alles denn genug?«
»Was wollen Sie noch mehr geben?«
»Ich könnte über die Grenze gehen. Hinter diese weiße Wand. Hinter den Schnee.«
Ich bemerkte, wie die Therapeutin mit sich rang, als wollte sie jedes ihrer Worte abwägen.
»Jeder Mensch hat Angst, über die Grenze zu gehen. Jeder Mensch hat Angst vor der Leere, vor dieser Wand. Dabei würden wir darin die Wahrheit entdecken. Aber unser Gehirn hindert uns daran. Dafür müssten unsere Gedanken weniger werden. Unser Gehirn müsste Hemmsignale aussenden, damit es ruhiger wird und eine andere Frequenz, einen anderen Rhythmus findet. Doch diese Hemmsignale werden gejagt von den Neurotransmittern, die uns befehlen, ständig wachsam zu sein. Es ist ähnlich wie auf dem Bild. Die Wölfe jagen die Hirsche. Dabei ist der Weg einfach: Zähme die Wölfe, dann können die Hirsche wieder ihren Weg gehen. Dann spürt man den neuen Rhythmus und kann die Leere betreten. Das ist der Weg.«
»Und was finde ich am Ende des Weges?«
»Die Wahrheit. Vielleicht auch eine schreckliche.«
»Lya ist nicht tot … Sie ist vielleicht nur … woanders.«
Meine Therapeutin nahm einen Stuhl und stellte ihn dicht vor mich. Dann setzte sie sich darauf und blickte mir in die Augen. Ich sah ihre Angst darin. Tief schlummernd in ihrer inneren Kammer.
»Wo ist dieses Woanders?«
Ich schwieg.
»Am Semmering?«, fragte sie leise. Dann senkte sie ihre Stimme noch weiter. »Wo ist dieses Tannenfall?«
Mein Herz schlug schneller. Tränen flossen über meine Wange. »Ich weiß, es ist –«
»Sie dürfen sich jetzt nicht verlieren. Ich weiß, dass der Verlust, den sie erfahren haben, das Schlimmste ist, was eine Mutter erleben kann. Und ich weiß, dass viele daran zerbrechen. Aber wenn Sie zerbrechen, dann zerbricht auch die Erinnerung an Ihre Tochter. Sie müssen versuchen, stark zu bleiben, wie ein Feuer auf dem Gipfel eines Berges. Ein helles Feuer, damit sie Sie sieht, wenn sie tatsächlich dort draußen durch den Schnee irrt und ihren Weg nach Hause sucht.«
Ich dachte an die Fahrt im Auto. Ich hatte sie zur Schule gebracht. Ich hatte gesagt, dass ich sie wieder abholen würde. Sie würde auf mich warten. Dann hatte ich meine Hand erhoben, und meine Tochter hatte eingeschlagen. Das Klatschen der Hände war wie ein Schwur gewesen. Eine geheime Abmachung, aufeinander zu warten. Doch wie klang dieses Klatschen mit nur einer Hand? Ich schloss die Augen.
Ich spürte, dass die Therapeutin ganz nah zu mir kam. Ich stand wieder am Abgrund. Warum konnte ich nicht einfach loslassen und hinter den Schnee gehen? Die alten Tannen der Vergangenheit fällen?
Ich sank nieder. Mein Blick verfing sich wieder an dem Bild der Hirschjagd. Ich dachte an den schwachen kleinen Wolf.
»Ich will es ein letztes Mal versuchen.«
»Das ist zu früh. Sie müssen sich zuerst ausruhen.«
»Wie kann ich mich ausruhen, während meine Kleine da draußen erfriert? Ich muss sie finden.«
Ich erhob mich mit letzter Kraft und stieg wieder in das Becken. Das Wasser war noch warm und schimmerte in einem fremden Blau.
»Ich gehe noch einmal zurück, und diesmal finde ich sie.«
Ich sah, wie die Therapeutin mit sich kämpfte. Die Risiken einer Rückführung waren mitunter tödlich. Schließlich konnte der Geist in Gebiete vordringen, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hatte. Sie wusste, dass es dort Grenzen gab – dort, wo ich Lya verloren hatte. Bei jeder Rückkehr hatte ich versucht, einen Teil von mir abzustreifen, da ich alles ablegen wollte, woran ich früher geglaubt hatte: die Regeln, die Gesetze. Dort draußen galt nichts davon. Ich musste alles neu entdecken, mich selbst neu finden, um zur Grenze vorzustoßen, zum Schnee. Ich musste alles geben, um sie zu retten, selbst mein Leben, wenn es notwendig war.
»Dann atmen Sie jetzt tief ein … und aus!«, sagte die Therapeutin und injizierte das psychotrope Meskalin.
»Sobald sich die Wirkung entfaltet, müssen Sie an den Beginn gehen. Sehen Sie sich dort ganz genau um! Meistens verdrängen wir die Dinge am Anfang und am Ende der Geschichte. Versuchen Sie, das Wesen der Dinge zu erkennen. Dahinter liegt die Wahrheit. Erinnern Sie sich und nehmen Sie sich in Acht vor den Spähern! Sobald ich bemerke, dass etwas nicht stimmt, hole ich Sie zurück, hören Sie?«
Das Wasser umhüllte mich wie eine zweite Haut. Ich schob mein Becken nach oben und begann wieder zu schweben. Ich verließ meinen Körper und spürte, wie der blaue Schatten mein Wesen berührte. Ich blickte zu meiner Therapeutin. Die Angst hatte sie zunehmend fester im Griff. Sie sah immer wieder zur Tür des Behandlungsraumes. Als die Tür aufging und ein Mann das Zimmer betrat, war ich nicht sicher, ob das ein Teil meiner Erinnerung war oder nicht. Aber das war jetzt egal, denn die Stimme des Richters hatte sich längst erhoben.
FROST
Ich hatte mich verloren. Irgendwo in der alten Welt hinter den Wäldern. Ich öffnete die Augen und nahm meinen ersten Atemzug. Ich hatte es mir zur Gewohnheit gemacht, ohne Wecker aufzuwachen. Es gelang mir nun schon um einiges besser als noch wenige Tage zuvor, als ich immer außer Atem aus dem Schlaf gehetzt war. Das Gefühl, etwas Entscheidendes verpasst zu haben, hatte mich unruhig in meinem Bett liegen lassen. Ich hatte mich schlecht gefühlt in jener Zeit, schuldig. Wie hätte ich schlafen können, wo ich doch vorangehen musste.
Du schläfst schon wieder? Die vorwurfsvollen Worte, die mir mein Vater mein Leben lang zugeflüstert hatte, hatten mich wie ein dunkles Kind begleitet. Dabei hatte ich doch nur genügen wollen. Ich hatte diesen Gedanken immer wieder verdrängt. Er war mir zu einfach gewesen. Der Mensch musste doch mehr sein als ein unsicheres Kind, das nach der Liebe seiner Eltern bettelte. Welchen Nutzen hätte sonst die Ausbildung, hätten all die Erfahrungen, die Entscheidungen gehabt, wenn es nur darum ging, zu genügen, geliebt zu werden? Nach meinem Zusammenbruch hatte ich lernen müssen, diese einfachen Gedanken zuzulassen.
Ich sah aus dem Fenster. Ein großer Baum wartete mit ausladenden Ästen davor. Als ich die Villa bezogen hatte, hatte ich die Vorhänge zugezogen, da ich Angst vor dem stummen Riesen hatte. Ich hatte das Gefühl, der Baum würde mich beobachten. Als würde er mich entlarven mit seiner Einfachheit. Ich hatte nicht zulassen können, dass mein Leben, das ich auf Regeln und Gesetzen aufgebaut hatte, bloßgestellt wurde. Der Gedanke, dass ich schon in jungen Jahren falsch abgebogen war, hatte mir ebenfalls Angst gemacht. Auch wenn ich gewusst hatte, dass ich eines Tages genau das feststellen müsste, hatte ich es vorgezogen, hinter verschlossenen Vorhängen zu schlafen. Jetzt war es anders. Denn ich hatte begonnen, mich zu öffnen.
Es war kühler geworden. Das erstickte Kaminfeuer mischte sich mit den frischen Atemzügen des Waldes. Ich mochte diesen Geruch. Bei meiner Ankunft hatte mich das Kratzen im Hals gestört, das die rauchige Kaminluft auf meine Schleimhäute gelegt hatte. Jetzt waren sie widerstandsfähiger, rauer, hatten sich an das Leben auf dem Land gewöhnt. Ich hielt den Atem an, um nach Regen zu hören. Kein Regen, nur ein weiterer später Novembertag im Nebel. Ich stand auf.
Hätte man mich am Beginn meines Lebens gefragt, für welches Dasein ich mich entscheiden würde – für eines, in dem ich unter der sengenden Hitze der Wüste in einer Strafkolonie arbeiten müsste, oder eines, in dem ich ganz allein in einem Raum mit dem simplen Nichtstun beschäftigt wäre: Ich hätte mich für die Strafkolonie entschieden. Doch mich hatte niemand gefragt, und jetzt war ich in diesem stillen Raum gelandet. Mit nichts anderem als mir selbst und meiner Angst, einen Schritt vor die Tür zu setzen. War es selbstsüchtig gewesen, meine Tochter zu überreden, mitzukommen?
Es wird dir guttun. Du brauchst die Ruhe genauso wie ich. In der Abgeschiedenheit der Natur wirst du dich selbst finden und erkennen, was du mit deinem Leben anstellen willst.
Lya hasste das Leben hier. So wie ich es hasste. Aber ich konnte ihr nicht sagen, dass ich mich geirrt hatte. Und dass es hier in diesen verlorenen Zimmern nichts zu finden gab. Außer dem stillen Kissen der Einsamkeit, das einen jeden Tag mehr erstickte. Nein, ich konnte meinen Fehler nicht eingestehen. Sobald ich irgendetwas in dieser Abgeschiedenheit fand, was ich mitnehmen konnte in mein altes Leben, könnte ich Lya um Verzeihung bitten, dass ich ihr diese Zeit zugemutet hatte. Aber ich hatte noch nichts gefunden, und der Gedanke, wieder zurück in den Gerichtssaal zu gehen, löste allein durch die Erinnerung diesen furchtbaren Schwindel aus. Nein, ich musste hier ausharren, zurückgeworfen auf mich selbst.
Der Sommer war heiß gewesen. Obwohl ich mir jedes Mal vorgenommen hatte, ein wenig mehr Zeit einzuplanen, um rechtzeitig einen der vorderen Warteplätze am Bahnsteig zu erreichen, war es mir in diesem Sommer kein einziges Mal gelungen. Und so hatte ich jeden Morgen eng gepresst im Regionalzug von Potsdam nach Berlin gestanden. Trotz der Enge hatte ich die Zeit nutzen wollen, um mich auf die Verhandlung vorzubereiten. Mit verrenktem Arm hatte ich die Akten aus der Tasche gezogen und war die entscheidenden Stellen durchgegangen, immer darauf bedacht, keinem meiner unbekannten Bahnbegleiter einen Einblick zu gewähren.
Mein Leben bestand damals aus Disziplin. Ich musste die Zeit nutzen. Jede Minute musste sinnvoll verbracht werden. Nichts durfte verloren gehen. Regeln und Gesetze waren der Halt der Menschheit. Wer davon abließ, verlor den Tritt und fiel ab. Die Werte der Kaderschmiede der Wilhelm-Pieck-Schule bewachten wie eine unnachgiebige Lehraufsicht die Welt meiner Gedanken.
Nachdem ich in Berlin in die U-Bahn umgestiegen war, drängte ich mich durch träge Touristengruppen. Ich war mir sicher, auf vielen Erinnerungsfotos im Hintergrund aufzutauchen – als eherne graue Eminenz, selbstsicher und unnahbar deutsch, die ihrer Pflicht folgend entschlossen zu ihren Terminen schritt.
»Meine ostdeutsche Sphinx«, hatte mir der General einmal mit heißem Atem zugeflüstert, »meine zeitlose Schönheit, meine Göttliche.« Würde ich auf diesen Fotos als Göttin bemerkt werden? Oder eher als blasse, hochgewachsene Frau mit geheimnisvollen Augen, schmalen Lippen und einer Haut weiß wie Schnee? Paul hatte mich einmal mit Greta Garbo verglichen. Aber das war lange her, und anders als die schwedische Filmgöttin hatte ich kein einziges Mal gelacht. Warum auch? Was zählte, war Wissen. Und das erzielte man durch Beobachtungen aus der Distanz. Gefühle hätten Brücken zu all dem gebaut, was lebendig war, hätten Nähe zulassen. Aber Nähe bedeutete, dass man verwundbar wurde, und das hätte ich mir als Staatsanwältin nicht leisten können. Zu jeder Zeit musste ich aussehen, als hätte ich alles im Griff. In Wahrheit aber war mir alles entglitten.
Ich verließ die U-Bahn und wechselte am Franziskanerkloster die Straßenseite zum Gericht. Mit einem Blick auf die Uhr wartete er schon auf mich. Ich kontrollierte noch einmal alles, zupfte das Jackett meines Hosenanzuges zurecht und strich die Seiten meiner Haare glatt. Hatte ich vergessen, Parfüm aufzutragen? Ich führte die Innenseite meines Handgelenkes zu meiner Nase und roch daran. Nichts. Kein Duft. Oder doch? Ich wusste es nicht.
Wie ein Ritter, der vor dem Turnier erkannte, dass ein kleines Stück seines Harnisches aus den Fugen geraten war, konzentrierte ich mich auf den Rest meiner Rüstung. Der Anzug war frisch gereinigt, das Haar saß, das Make-up zauberte Lebendigkeit und Lebenskraft auf mein Gesicht, und meine Gedanken waren geordnet. Ich würde an diesem wichtigen Tag nicht verlieren. Ich hatte noch nie verloren. Außer gegen ihn. Am Ende gewannen immer die Tüchtigen und Fleißigen. Und, mein Gott, das war ich mit jeder Faser meines Körpers!
»Bist du bereit für den großen Schlag?«, fragte der Generalstaatsanwalt und küsste mich auf die Wange. Ich nickte und schlüpfte in Gedanken bereits in die samtige Robe der Staatsanwältin. Das kühle Foyer empfing uns, und ich ging, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, zum Aufzug.
»Sie will dich sprechen«, sagte der Generalstaatsanwalt und blickte auf die Etagenanzeige.
»Das heißt, heute Abend bei ihr?«
Er nickte.
Ich mochte die Ministerin. Schon in der Kaderschmiede war sie die Einzige gewesen, die meinen Sinn für soziale Gerechtigkeit verstanden hatte wie keine andere. Bis jetzt kämpfte sie mit eisernem Willen und mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung standen, gegen die kapitalistischen Imperialisten. Natürlich hinter vorgehaltener Hand. Die Zeiten hatten sich geändert, und der Kapitalismus war zu einem gefräßigen Monster geworden, das die Moral der Menschen schluckte und sie mit Geld beruhigte. Ich kannte das Feuer, das in ihr brannte. Jetzt, Jahrzehnte nach der Wende, war das Feuer dasselbe – nur die Feindbilder waren andere.
»Sie will nach dem Urteil heute eine Entscheidung treffen. Sie weiß, was sie an dir hat.«
»Eine eigene Abteilung?«
»Vielleicht mehr als das. Es geht um einen neuen Fall. Das Spektrum.«
Ich ging ans Fenster. Der Boden unter meinen nackten Füßen knarrte. Der Nebel war dicht ans Haus getreten, und die Arme des Baumes ragten daraus hervor, als wollte er nach mir greifen. Ich hatte am Vortag zu wenig getrunken. Drei Liter sollte man zu sich nehmen, um die Zellteilung zu unterstützen. Die Gedanken an damals taten mir nicht gut. Ich musste lernen, neu zu denken. Musste lernen, einen Baum zu betrachten, das Geräusch des Wassers in meiner Kehle zu hören und das Knistern des Nebels auf meiner Haut zu spüren. Ich konnte nichts von dem, denn ich war immer noch Gefangene meines alten Lebens.
In wenigen Minuten begann der Prozess, und ich wechselte in den Status der Konzentration und Fokussierung. Das war das Geheimnis meines Erfolges, das machte mich zur Besten meiner Zunft. Wenn es eine Herrin des Ermittlungsverfahrens gab, dann war ich das. Unfehlbar. Frei von quälenden Hoffnungen und Emotionen.
Doch was brachte es, in einem Spiel der beste Spieler zu sein, wenn die Regeln außer Kraft gesetzt wurden? Wozu brauchte es Staatsanwälte und Richter, wenn das Gesetz, auf das sich alle bezogen, nicht durchgesetzt wurde? Das Gegenüber hatte längst begriffen, dass die Regeln, welche die Gesellschaft zusammenhalten sollten, nicht mehr die Kraft besaßen wie früher. Ich verabscheute den Gedanken, denn er wäre der Anfang vom Ende. Doch als ich den Alten sah, der mit aller Kraft gegen den Tod kämpfte, als wollte er auch dessen Regeln brechen, wusste ich, dass ich verloren hatte. Dass ich immer schon verloren hatte, da mein Leben auf den falschen Säulen erbaut war. Aber ich wollte das nicht einsehen. Damals nicht, und auch jetzt wollte ich diese Wahrheit nicht annehmen.
Dr. Merten erhob sich aus seinem Stuhl und reichte mir die Hand. Sie war dünn, wirkte zerbrechlich, und ich hatte Angst, dass sie zu Staub zerfallen würde, wenn ich zu fest zudrückte.
Ich hatte Durst, vermochte aber nicht, mich vom Fenster wegzubewegen. Wie der Baum stand ich angewurzelt da. Was uns unterschied, war, dass der Baum lebte, er trieb, zog Wasser aus den Wurzeln, bildete ein unsichtbares Netzwerk mit einer mir unbekannten Welt da draußen. Ich aber lebte nicht mehr. Ich erinnerte mich an das Gemälde der Medusa von Franz von Stuck. Ich hatte es im Wiener Belvedere gesehen.
Hatte es damals angefangen? Waren die versteinernden Blicke damals in mich eingedrungen? Wann hatte es begonnen? Wann hatte ich begonnen, mich in einen Stein zu verwandeln?
Ich spürte die Hand des Generalstaatsanwaltes an meiner. Sie war kalt. So wie meine. Ich zog sie weg. Ich konnte nicht, ich war verheiratet und musste zudem arbeiten, da der Prozess es nicht erlaubte, nie erlaubte, dass ich mich auf etwas Unkontrollierbares einließ. Und Begehren war unkontrollierbar. Es war wie Feuer, das einen verbrannte. Also entschied ich, nicht zu verbrennen, und wurde zu Stein. Hatte es damals begonnen?
»Womit wir es hier zu tun haben, ist ein perfides System aus Korruption. Ein Korruptionsgeschwür, das seine Metastasen bereits in der ganzen Welt gebildet hat. Getragen wird dieses System nicht nur von diversen Unternehmen wie der europäischen Fondsgesellschaft Liquid Asset Management, kurz: LAM, sondern von Männern wie ihrem Vorsitzenden, Dr. Merten … Mitglieder des organisierten Verbrechens. Seit Jahrzehnten Handlanger der Khalbergs, der Schwarzen Familie.«
Ein Raunen ging durch den Gerichtssaal.
»Einspruch!«, rief der Anwalt des Beklagten und lächelte mich an. Die Maske des ewigen Lächelns. Ich beneidete mein Gegenüber für diese Gabe. Ich wusste, dass in meinem Gesicht keine Emotion mehr Platz fand. Der Stein hatte es längst erreicht. Für Gefühle, auch wenn sie nur gespielt waren, hatte ich keine Zeit, keinen Raum.
Ich war mit der Verlesung der Anklageschrift zufrieden und sicher, dass diesmal die Beweislage ausreichen würde, um den gebürtigen Georgier endlich zu überführen. Mir war klar, dass ich mich mit dem Vorwurf, dieser Dr. Merten wäre ein Teil des organisierten Verbrechens, zu weit vorgewagt hatte, aber ich wollte provozieren.
Ich wartete, bis der Richter den Einspruch behandelte, und fuhr mit der Verlesung fort.
»Hier und heute liegt neben dem Strafbestand der Bestechung auch jener der Geldwäsche vor.« Ich verwies auf die langen Papierschlangen, die hinter mir an der Wand des Gerichtssaales hingen, und klopfte auf den Ordner, den ich zuvor von meiner Assistentin erhalten hatte. Ich hatte sämtliche Zahlungen und Geldbewegungen auswerten lassen. Exakt, ohne den geringsten Fehler! Wieder ging ein Raunen durch den Saal.
Ich genoss dieses Raunen. Ich fühlte mich in diesem Moment mächtig und stark. Ich war mir sicher, dass ein kleines Lächeln über meinen schmalen Mund glitt, das in mein geradliniges Gesicht vorsichtig weiche Züge malen wollte. Die prüfenden Blicke meiner Assistentinnen verrieten allerdings nichts Gutes, und ich wusste, dass ich gut daran täte, wieder meine gewohnte Miene aufzusetzen.
»Sie hat sich mit dem General eingelassen«, sagte meine Assistentin zu einer Kollegin, die neben ihr saß. Ich konnte ihre Lippen lesen. Sie trug einen ähnlichen schwarzen Hosenanzug wie ich unter meiner Wollrobe, nur quollen aus ihrem Dekolleté zwei prächtige weibliche Brüste statt einer zugeknöpften klassischen dunklen Designerbluse hervor. Die andere war ein geduckter und gedrungener Charakter mit hinterlistigen Augen und einem billigen Geschmack.
»Was? Die Spröde? Wer lässt sich denn mit der ein?«
Die erste Assistentin erzählte mit zischenden Worten von ihrer Beobachtung und ihren Schlussfolgerungen. Ich dachte an Wien und sah zu ihr. Sie genoss es, über mich zu reden, blickte immer wieder zu mir und schickte mir aufmunternde Gesten zu. »Jetzt wissen wir, wie sie Karriere macht. Die letzte Waffe der Armen.«
Ich blickte zum Richter, einem geduldigen Mann um die sechzig, der mir aufmerksam zugehört hatte. Nach einer kurzen Pause – hatte er auch bemerkt, dass mein Duft fehlte? – ergriff er das Wort und bat die Anwesenden, laut zu sprechen, da die Akustik im Landgericht in der Littenstraße immer wieder zu Verständnisschwierigkeiten führte. Dann besah er die Handakten, die an seiner rechten Seite lagen, und nahm einen tiefen Atemzug. Er suchte nach dem Duft. Natürlich. Er hatte es bemerkt. Ich hatte vergessen, ihn aufzutragen. Dabei machte ich keine Fehler. Ich machte keine Fehler. Es würde nie wieder vorkommen. Nie wieder. Der Richter nahm einen Schluck Wasser und schien auf etwas zu warten.
Ich hatte Durst und ging in die Küche, wo ich Wasser in ein Glas laufen ließ.
Ich wurde zu Stein, wollte keine falsche Bewegung machen, keine Fehler. Ich hatte das letzte Jahr Tag und Nacht damit zugebracht, die Beweise gegen LAM und vor allem gegen Dr. Merten zu sammeln. Jetzt, da der Richter diese kurze Pause machte, war ich verwundert. Ich hatte mich auf einen Schaukampf eingestellt, der mit einem Startschuss begonnen hatte und sich nun verzögerte. Ein mulmiges Gefühl kroch durch meinen Magen. Ich blickte zu Dr. Merten, der geduldig und mit einem gelassenen Lächeln auf der Anklagebank saß und auf sein Recht wartete.
Ich trank und dachte an diesen Moment. Ich konnte ihn kaum ertragen, da ich spürte, dass die Gerechtigkeit der Gesetze wieder einmal wie Wasser nur die Haut benetzte, aber letztendlich im Abfluss versickerte.
Die Blicke des Publikums lagen auf mir. Ich sah in jedem einzelnen Gesicht eine tiefe Ablehnung mir gegenüber. Auch wenn der Angeklagte, Dr. Merten, vermutlich einer der gefährlichsten Männer Europas war, so war er doch alt. Und eine Frau aus Stein stellte den Sterbenden, dessen dürre Hände zitternd bei seinen Anwälten nach Erbarmen suchten, an den Pranger. Doch der Tod stand hier nicht unter Anklage: Es ging um Korruption – und das war die einzige Front, an der ich gegen LAM und die Schwarze Familie kämpfen konnte. Fußte die moderne Gesetzgebung noch auf Gerechtigkeit oder längst auf Moral? Kam es aber auch dabei im Grunde nur auf die Perspektive an, die man einzunehmen gewillt war? Hatte ich das Recht, zu töten, wenn ich selbst verfolgt wurde? Hatte ich das Recht, zu töten, wenn ich alt war? Hatte ich das Recht, Böses zu tun, wenn mir Böses angetan worden war? Das Gesetz hatte längst aus den Tätern Opfer gemacht und aus den Opfern Täter.
Ich trank und wusch mein Gesicht. Ich hatte es in meinem alten Leben weit gebracht. Ich war gut vernetzt und beherrschte meinen Beruf bis zur Perfektion. Ich war im Osten aufgewachsen und hatte jede Gelegenheit genutzt, um meine politischen Ansichten dem Westen anzupassen. Irgendwie war es skurril, dass ich, die seit jeher gegen den Kapitalismus gewettert hatte, nun selbst genügend Kapital besaß, um Menschen für mich arbeiten zu lassen. Doch was zählte die politische Einstellung bei einem Staatsanwalt?
Ich nutzte die Zeit und ordnete mein Pult. Dabei stapelte ich die Anklageschriften exakt aufeinander und entschloss mich, um beschäftigt zu wirken, eine Akte in meine Tasche zu schieben, da sie für den weiteren Verlauf unnötig war. Mit gespitzten Lippen schob ich die Akte unter die kleine Wollmütze, die ich einst von meinen Eltern um fünfzig Pfennig geschenkt bekommen hatte. Diese Mütze war das einzige Andenken an sie. Mein Talisman. Bevor ich die Tasche wieder schloss, strich ich mit dem Daumen über die gestickte blaue Blume auf der Mütze. Ich brauchte Kraft. Jetzt.
War Lya schon aufgewacht? Ich hatte vergessen, auf die Uhr zu sehen.
Ein Gerichtsdiener lief aufgeregt durch den Saal und gab dem Richter einen Umschlag. Der Richter rollte die Ärmel seiner Robe hoch und öffnete das Kuvert. Sein Blick verriet, dass er die Information, die sich darin befand, bereits kannte. Dann sah er zu mir und zum Anwalt des Angeklagten. Dr. Merten wagte er nicht ins Gesicht zu blicken.
»Wie ich soeben erfahren habe, hat die Anti-Korruptionsbehörde bestätigt, dass sich Liquid Asset Management verpflichtet hat, neunhundert Millionen Euro zu bezahlen, um die im Raum stehenden Korruptionsvorwürfe aus der Welt zu schaffen. In erster Linie geht es hier um die Länder USA, Iran, Indonesien und China. Als Gegenleistung erklärt sich die Behörde dazu bereit, das Verfahren gegen Dr. Merten einzustellen. Ebenso wird das Verfahren wegen Geldwäsche eingestellt, da mittlerweile alle betreffenden Beträge wieder rücküberwiesen wurden und der einstige Geschäftspartner der Familie Khalberg leider an einer langen, schweren Krankheit verstorben ist. Somit ist das Verfahren zu beenden. Noch Fragen?«
Der Richter sah mir mit versteinerter Miene ins Gesicht. Hatte er ebenfalls längst aufgegeben? Hatte auch er eingesehen, dass es vergebens war, auf das Gesetz zu bauen? Es gab keine Gesetze mehr.
Ich blickte zu den selbstsicheren Anwälten des Angeklagten, die nur darauf warteten, dass ich endlich begriff: Mein Kampf für Recht und Ordnung war ein Kampf gegen Windmühlen. Ich hasste Niederlagen. Ich hasste die dazugehörige Ohnmacht. Aber noch viel mehr war mir diese Arroganz und Selbstgerechtigkeit zuwider, der ich hilflos gegenüberstand. Diesen Menschen auf der Anklagebank war es zu verdanken, dass der Westen an seiner eigenen Gier zugrunde ging, dachte ich. Zypern, Malta, Luxemburg, Österreich. Die geheimen Schaltstellen dieses Wahnsinns. Mir aber blieb nichts anderes übrig, als zu schweigen und geduldig zu verlieren.
»Dem ist nichts hinzuzufügen!« Der Richter blickte in die Menge und nickte meiner Assistentin zu, damit sie der Staatsanwältin eine Kopie des Beschlusses anfertigte.
Ich erhob mich, ordnete mich. Jetzt, wo alle Menschen im Saal wisperten und raunten, fehlte mir der Schutz meines Parfüms. Ich war ausgeliefert und kam mir mit einem Mal selbst vor wie eine Angeklagte. Ich fühlte mich wie damals, als ich die Eltern einer vergewaltigten und grausam ermordeten jungen Frau vertreten hatte. Auch damals hatte ich verloren und in die stolzen Gesichter selbstsicherer Männer geblickt.
Schweigend ordnete ich die Akten, klemmte sie unter meinen Arm und wollte, ohne ein Wort zu sagen, den Gerichtssaal verlassen, als mir meine Assistentin ein keckes »Für Sie« nachrief und mir nicht nur die Kopie des Richters, sondern auch ihren jungen Busen entgegenstreckte.
Ich bemerkte, dass meine Hände zitterten. Ich fühlte mich von allen beobachtet. Ein Kribbeln lief durch meine Nervenbahnen. Ich war es nicht gewohnt, zu versagen. Ich sah meiner Assistentin nach, die wie ein artiges Hündchen dem Generalstaatsanwalt hinterherstakste, der enttäuscht den Saal verließ. Ich dachte an seine kalte Hand vor dem Bild der Medusa.
Als ich die beiden verschwinden sah, kam der Schwindel. Ich wusste nicht, warum, aber insgeheim war mir klar, dass der General mich an diesem Abend nach dem Essen mit der Ministerin verlassen würde. Dann würde sie wiederkommen, diese Einsamkeit, die ich gemeinsam mit meinem Mann, mit Paul, fristen musste. Nein, allein der Gedanke daran war unerträglich. Niemals! Hätte ich gekonnt, ich hätte geheult wie ein Mädchen – vor Scham, vor Schuld, vor Demütigung.
»Guten Morgen!« Lya kam in die Küche.
»Hast du gut geschlafen, mein Schatz?«
»Geht so.«
Ich schwieg.
»Wollen wir gemeinsam frühstücken?«
»Keinen Bock.«
»Wollen wir dann rausgehen? Ein wenig die Gegend hier erkunden? Vielleicht finden wir ja schöne Plätze. Dort können wir uns dann unterhalten.«
Jetzt schwieg Lya. Sie sah mich an, als hätte ich sie beleidigt. Dann drehte sie sich um und ging wieder in ihr Zimmer. Ich fragte mich immer, was sie in ihrem Zimmer tat. Hier gab es kein WLAN, und sie weigerte sich auch, die Bücher zu lesen, die ich mitgenommen hatte. Ich würde es nie herausfinden, da sie mir verboten hatte, ihr Zimmer zu betreten. Ich wollte mich daran halten.
Ich zog meinen Anzug zurecht und wartete an der Kreuzung darauf, dass die Ampel auf Grün sprang. Noch stand sie auf Rot. Neben mir gingen zwei Männer über die Straße. Weit und breit war kein Auto zu sehen. Sie hatten recht, dachte ich. Warum sollten sie auch warten? Warum nicht die Regeln brechen und bei Rot über die Straße laufen? Ich blieb stehen. Ich blieb immer stehen, weil ich die Welt der Regeln und Gesetze vertrat. Ich sah mich um. War die Welt nicht längst über die Ufer der Regeln getreten? War ich die Einzige, die stehen blieb? Ich spürte ein Kribbeln, das mein Rückgrat hinunterlief. Ein Schwindel spannte sich in meinem Kopf. Es war immer noch rot. Ich setzte einen Fuß auf die Straße und verlor mein Bewusstsein.
Ich ging zurück ins Schlafzimmer und setzte mich auf das Bett. Wann hatte es begonnen? Wann war die Welt verschwunden? Mein Atem war das Einzige, was mir noch geblieben war. Ich konnte nichts mehr empfinden, keine Freude, keinen Schmerz, kein Leid, keine Liebe. Wann hatte es begonnen? Ich versuchte, mich zu erinnern. Wie waren die Tage vor meinem Zusammenbruch? Alles hatte doch einen Anfang! Nichts war einfach da! Oder irrte ich mich? Wann hatte es begonnen? War es an dem Tag, als die Hand des Generalstaatsanwaltes nicht mehr kalt gewesen war? War es, als ich meinem Mann gestanden hatte, dass ich ihn nicht mehr liebte, und wir trotzdem beschlossen, wegen Lya zusammenzubleiben? War es an dem Tag, als ich begonnen hatte, gegen LAM vorzugehen? Oder war es früher, als ich festgestellt hatte, dass meine Werte nach der Wende zerbrochen waren? Oder war es in der Schule, als jeder mich mied und niemand meinen Mund küssen wollte? Oder waren es meine Eltern? Haben sie mir bei der Geburt das Leben genommen?
Das Leben. Es war in mir erloschen. Ich lebte, und dennoch war ich tot. Ich schloss die Augen und wartete, dass etwas geschah. Aber es geschah nichts, also beschloss ich, zu schlafen.
TOTE SEELEN
Es war dunkel geworden. Eine Krähe suchte ihr Lied. Der Baum war im Schwarz versunken. Ich hatte Hunger. Hatte Lya bereits gegessen? Ich stand auf und ging in die Küche. Die Herdplatten waren kalt. Ich ging zu ihrer Tür und klopfte.
»Hast du Hunger, Schatz?«
»Nein. Ich möchte gerne weiterschlafen.«
Ich nickte und ging zurück in die Küche. Ich holte zwei Scheiben Brot aus dem Korb und biss ab. Es schmeckte sauer. Und nach Kümmel. Ich hatte es aus dem Dorf. Eine ausgemergelte Bäuerin hatte es dort auf dem Wochenmarkt verkauft. Als ich gleich nach unserer Ankunft am Semmering vorgeschlagen hatte, den Bauernmarkt in Mürzzuschlag zu besuchen, war ich davon überzeugt gewesen, die aufrechte Herzlichkeit der Landbevölkerung würde mich mit offenen Armen empfangen. Ich hatte mich geirrt und nach wenigen Minuten den Markt mit einem großen Laib Brot verlassen. Den Rest hatte ich im Kaufladen besorgt, wo ich schweigend Lebensmittel über das Band geschoben und in einer Plastiktüte verstaut hatte. Fertigprodukte. Für die Mikrowelle, die ich nicht hatte. Für den Backofen, den ich nicht hatte. Ich hatte in jener Zeit, in der ich versuchte, die Schwarze Familie zu stürzen, vergessen, wie man kochte.
»Wir müssen morgen wieder ins Dorf. Einkaufen. Hast du auf etwas Besonderes Lust?«, rief ich meiner Tochter zu und widersetzte mich mutig ihrer Bitte, sie schlafen zu lassen. Ich bekam keine Antwort. Ich hatte auch keine erwartet. Aber ich wollte zumindest für einen Moment eine gute Mutter sein.
Essen. Was hatte ich früher gerne gegessen? Ich konnte essen, was ich wollte. Ich hatte auch genug Geld mitgebracht, um mir kaufen zu können, was ich mochte. Aber was mochte ich? Hatte ich jemals eine Lieblingsspeise? Als Kind hatte ich Putenfleisch mit gelbem Reis und Dosenpfirsichen geliebt. Wenn das Geld gereicht hatte, dann hatte meine Mutter das Fleisch mit Mandelsplittern überbacken.
»Magst du Putenfleisch?«, rief ich wieder.
Ich würde uns Pute machen. Eine Liste. Ich würde eine Einkaufsliste schreiben. Ich hatte ja Zeit. Ich konnte kochen, was ich wollte und was ich mochte. Natürlich konnte ich immer essen, was ich wollte, aber mochte ich immer, was ich wollte? Ein verrückter Gedanke.
Ich stand auf und kramte aus der Bestecklade der Küche einen Stift, der sich zwischen den Gabeln versteckt hatte. Meine Schrift war kaum leserlich. Ich hatte verlernt, zu schreiben. Es hatte immer schnell gehen müssen. Wenn mir der General Anweisungen gegeben hatte. Für Notizen war kaum Zeit geblieben. Ich hatte sie immer schnell in meine To-do-Liste übertragen müssen, sonst hätte ich meine eigene Schrift nicht mehr entziffern können. Ich sah auf mein Gekritzel. Wenn die Schrift das Wesen eines Menschen beschrieb, dann war ich jemand Krakeliges. Ohne Wert und Substanz. Aber nun konnte ich doch in aller Ruhe schreiben. Ich musste keine Notizen entgegennehmen.
Wollten wir jeden Tag Pute essen? Sollte ich nicht einen Wochenplan anlegen? Ich lebte ja jetzt in der Provinz, hier musste es doch ein Leichtes sein, regionale und hochwertige Lebensmittel zu erstehen, aus denen sich wunderbar duftende Speisen zubereiten ließen. Aber würde ich nicht enttäuscht sein, wenn der Duft weniger intensiv war? Oder hatte ich auch verlernt, zu riechen?
Ich unterbrach meine Arbeit an der Liste und dachte an den Wochenmarkt. Ich hatte Angst vor den Menschen. Ich wusste nicht, was ich mit ihnen anfangen sollte. Sie waren schweigsam gegenüber Fremden. Gab es nicht auch Fertiggerichte, die man in der Pfanne zubereiten konnte? Ich glaubte mich an einige Packungen im Kaufladen zu erinnern. Ich war in Berlin immer in ein Restaurant gegangen und hatte in Potsdam vom Lieferservice gelebt. Ich musste ja nicht gleich mit dem Kochen beginnen. Wir waren schließlich noch eine Zeit lang hier, kein Grund, irgendwas zu überstürzen.
Und während ich auf meine eilig hingekritzelte Einkaufsliste sah, begriff ich, dass ich mir ein Gefängnis gebaut hatte, mich selbst in dessen tiefstem Kerker vor der Welt weggesperrt. Meine Sinne, die Brücken zur Welt, sie alle waren verbrannt.
Ich schnitt eine weitere Scheibe Brot ab und ging zurück ins Schlafzimmer. Ich wollte nach dem Baum sehen. Wollte sehen, ob der Nebel gekommen war.
Zur Ruhe kommen.
Das waren die Worte meiner Therapeutin. Ich sollte auf den Semmering fahren. Ein Luftkurort in den österreichischen Voralpen.
Wir waren mit dem Auto gefahren. Über Tschechien und Wien. Mich hatte der Semmering mit seinen ausladenden Villen an Potsdam erinnert. Was gefehlt hatte, waren die Menschen. Als ich die geschlungene Passstraße nach oben gefahren war und zum ersten Mal auf der rechten Seite das Südbahnhotel erblickt hatte, war mir sofort mulmig zumute gewesen.
Ich wusste an diesem Tag nicht, warum. Es war im Grunde wunderschön hier. Es war ein warmer Tag im späten Oktober mit goldenen Strahlen. Und doch hatte etwas Unbestimmtes diesen Ort ergriffen. Ich fuhr den Wagen zur Seite und stieg aus. Lya blieb sitzen, starrte auf ihr Handy und knetete mit den Eckzähnen ihre Lippe. Hinter dem Südbahnhotel, das auf einer Anhöhe in einer tief gelegenen Mulde lag, erstreckte sich das Massiv des Schneeberges. Von hier aus konnte man auch das Wiener Becken einsehen, während sich auf der linken Seite das Gebirge wölbte und die Semmeringbahn mit ihren fabelhaften Viadukten und Tunneln beherbergte.
»Guck mal, Lya! Das sieht wirklich sehr schön aus hier. Guck mal!«
Lya rührte sich nicht. Sie hatte die Idee, mit mir ein paar Wochen wegzufahren, vom ersten Moment an gehasst. Aber nachdem sie die Schule geschmissen hatte und von zu Hause fortgelaufen war, musste sie sich auf einen Deal einlassen, nachdem ich sie gefunden hatte – allein und hungrig im Foyer einer Sparkasse in Berlin. Entweder sie fuhr mit mir mit und wir überlegten in aller Ruhe, wie es mit unserem Leben weitergehen sollte, oder wir würden für immer getrennte Wege einschlagen. Ich hatte hoch gepokert. Und Lya hatte eingewilligt.
»Wann sind wir da?«
Ich war fast erschrocken, als ich Lyas Stimme hörte. Sie hatte die ganze Fahrt über nicht gesprochen, umso überraschter war ich über den rauen Klang ihrer sonst so zerbrechlichen Stimme.
»Gleich, mein Schatz. Wir müssen noch über den Pass, dann sind wir bald dort.«
Ich stieg wieder ins Auto und ließ das Gefühl der Unbestimmtheit hinter mir. Ich startete den Wagen und lenkte ihn zurück auf die Straße. Wenige Augenblicke später erreichte ich die Passhöhe. Die Verlassenheit eines ausgestorbenen Wintersportortes empfing mich. Unser Auto war das einzige weit und breit. Seit dem Bau des Tunnels verirrte sich außerhalb der Wintersaison kaum jemand auf den Semmering. Doch auch im Winter ging die Gästezahl zurück. Ein Konsortium aus der Ukraine hatte in der Gegend investiert und zeigte wenig Interesse am Betrieb der Skianlagen. Mir war das nicht unrecht, denn sollte ich mich entschließen, bis zum Winter zu bleiben, hätten mich die vielen Touristen eher abgeschreckt. Ich suchte Ruhe und weder Après-Ski noch überfüllte Pisten oder verstopfte Bergstraßen.
Ein Blick auf die Benzinuhr empfahl mir, zur nächsten Tankstelle zu fahren. Aber nach der langen Fahrt war ich müde und wollte erst einmal unser neues Zuhause sehen. Tanken kann ich immer noch, dachte ich und bog links in eine schmale Straße ein.
»Guckst du auf die Karte, ob wir hier auch wirklich richtig sind?«, bat ich Lya, die angewidert auf ihr Handy starrte und auf die Navigations-App wechselte.
»Kein Empfang«, sagte sie, ohne aufzublicken.
Fichten- und Tannenzweige griffen nach dem Auto, und die Straße verwandelte sich in einen mürrischen Weg, der nach jeder Kurve versuchte, uns abzuwerfen. Nach zehn Minuten aber tauchten wir wieder aus dem Wald auf und erreichten eine weite Wiese, an deren Ende ein Haus stand. Es wirkte wie eine kleine vergessene Villa, in der zwei Familien Platz gefunden hätten. Dahinter türmte sich der weite farbige Horizont, der in die Steiermark hineinreichte. Umfasst wurde der warme Himmel von zwei weitläufigen Bergketten, auf deren Gipfeln bereits die Vorboten der nahen Nacht lagen.
Ich kämpfte mit den Tränen, als ich die letzten Meter zu unserem neuen Zuhause fuhr. Ich hatte ganz vergessen, wie schön die Welt sein konnte, wenn man nur einmal wirklich hinsah. Das Haus war in Richtung Osten gelegen und wurde im Süden von hohen Tannen bewacht. Auf der rechten Seite öffnete sich das Semmeringmassiv und gab einen weiten Blick auf den gegenüberliegenden Hang frei, auf dem ebenfalls vereinzelt Häuser standen.
Mittlerweile war der Nebel gekommen, und ich dachte daran, wie schnell mein Herz geschlagen hatte, als ich das Haus zum ersten Mal betreten hatte. Ich hatte so viel Freude und Zuversicht mit der Zeit hier verbunden, hatte gehofft, mit Lya in den Sonnenuntergang zu blicken und erste Gespräche zu finden, die uns wieder zusammenführen würden. Aber ich fand nur Einsamkeit und Stille. Schreckliche Stille. Nur das Drücken der Nacht und das heimliche Geflüster der Vögel am Morgen. Und die schwere Luft, die von Tag zu Tag kälter wurde.
Zur Ruhe kommen.
Ich hatte verlernt, wie das funktionierte. Ich hatte eher das Gefühl, zu ertrinken, und spielte jeden Tag mit dem Gedanken, nach Berlin zurückzufahren, statt hier in der Stille zu verenden. Dabei hatte ich das Haus noch nie richtig verlassen. Ich wechselte zwischen dem viel zu großen Schlafzimmer mit Kamin und ausladendem Balkon und der niedrigen, dunklen, verwinkelten Küche hin und her. Lya hatte sich in einem Zimmer verkrochen. Natürlich waren wir im Dorf gewesen, hatten uns am Semmering umgesehen, waren auf der steirischen Seite hinunter nach Spital am Semmering gefahren, wo der Wintersport ungeduldig auf den ersten Schnee wartete. In die andere Richtung, weiter nach Niederösterreich, waren wir nicht gefahren.
Der Semmering stellte eine Art unsichtbare Barriere dar. Durchbrach man sie, wollte man nicht mehr zurück und floh umgehend weiter bis nach Wiener Neustadt oder Wien – und dann war es nicht mehr weit bis nach Prag und Berlin. Nein, wir kannten nichts von unserer neuen Heimat und fanden auch niemanden, mit dem wir hätten sprechen können. Selbst der Eigentümer der Villa, den meine Therapeutin kannte, kommunizierte mit mir nur per E-Mail und hatte den Schlüssel unter die Matte am Eingangstor gelegt.
Je tiefer die Nacht in den Nebel tauchte, desto schneller verzog er sich wieder zurück in die nördlichen Wälder. Dann erhob sich über unserem Haus ein weitläufiger Sternenhimmel.
Am nächsten Tag wollte ich beginnen, mich neu zu finden. Sollte Lya zu Hause bleiben, ich würde einkaufen gehen und später kochen und mich am wunderbaren Duft gerösteter Mandelsplitter erfreuen. Ja, das wollte ich. Die Sonne sollte mich wecken oder das Wanken der Bäume oder der Ruf der Vögel. Doch es kam anders.
Was mich weckte, war dieses seltsame Grollen aus den Wäldern. Es schien das ganze Haus zu erfassen. Ich fuhr schweißgebadet aus meinem traumlosen Schlaf hoch. Ich lief zu Lya, da ich Sorge hatte, ein Erdbeben hätte das Grollen ausgelöst. Doch Lya schien fest zu schlafen. Ich zog meinen Morgenmantel über und trat auf die Terrasse nach draußen.
DAS VOLK DER NACHT
Ich erstarrte.
Es war schrecklich.
Ich wurde zu Stein.
Konnte mich nicht bewegen.
Der am Tag so wundervolle Ausblick war wie ausgewechselt, denn es schien, als hätte das dunkle Brummen und Vibrieren alles ergriffen, was ich sehen konnte. Ich zog meinen Mantel enger zu und hatte plötzlich Angst. Was war das? Was mochte solch einen Lärm verursachen? Ich hatte nie zuvor so ein tiefes, bedrohliches Geräusch gehört, wie ein unheimlicher, vergifteter Wind.
Ich suchte mit meinen Blicken nach der Ursache. Aber ich konnte nichts entdecken. Obwohl der Mond den gegenüberliegenden Hang gut ausleuchtete, konnte ich nichts Ungewöhnliches erkennen. Erst als ich mich hinhockte, um mit der Handfläche zu fühlen, ob das Brummen tatsächlich so stark war, dass das ganze Haus vibrierte, wurde mir klar, dass ich es mit etwas sehr Großem zu tun haben musste. Denn ich spürte, wie das Grollen meinen ganzen Körper erfasste und mir eine allumfassende Gänsehaut verursachte. Eine innere Stimme befahl mir, zu fliehen. So schnell ich konnte.
Und tatsächlich. Im lichten Schatten des Mondes sah ich einige Rehe und sogar Hasen, die sich lautlos und schnell aus dem Staub machten. Sie alle schienen den Hang zu verlassen. Also musste das Grollen von dort ausgehen. Ich trat näher an die Balustrade der Terrasse und kniff die Augen zusammen. Irgendetwas musste dort vorgehen. Plötzlich erfüllte der strenge Duft verbrannten Holzes die Luft. Es war dieser modrige Gestank, den nasses Holz erzeugte, wenn es den Kampf gegen das Feuer verlor. Der Geruch von nassen Flammen. Ich wunderte mich, woher ich diesen Geruch kannte, als meine Glieder erstarrten.
Da sah ich sie zum ersten Mal.
Die Menschen.
Es waren viele.
So viele.
Sie gingen schweigend und lautlos über den Hang. Sie schienen einer dunklen Gestalt zu folgen. Es waren sicher an die vier- bis fünfhundert Menschen. Lautlos schritten sie über das Mondfeld. Ich legte meine Hand über den Mund, da ich nicht glauben konnte, was ich da sah. Je mehr sich meine Augen an das Schauspiel gewöhnten, desto deutlicher konnte ich den dunklen Zug erkennen. Die Menschen hatten alle den Kopf gesenkt und folgten der finsteren Gestalt, die aussah wie eine alte Frau. Der Prozession gehörten viele Frauen und sogar Kinder an. Ich spürte ihre Verzweiflung bis hierher. Bewacht wurde der Zug von Hunden – oder nein: Wölfen! Es waren Wölfe! Deshalb waren die Tiere geflohen. Es war ein großes Rudel von sicher dreißig Tieren. Alte und junge. Und am Ende der Prozession versuchte sogar ein kleiner Wolf, den Anschluss an den unheimlichen Marsch nicht zu verpassen.
Die Angst in mir wurde mit jedem Atemzug größer; ich ging noch zwei Schritte zurück, um von den Menschen nicht entdeckt zu werden. Aber was, wenn sie den Hang verlassen und hier heraufkommen würden? Sollte ich Lya wecken, damit wir schnell fliehen könnten? Was, wenn sie uns umzingelten? Wenn das nicht der einzige Zug war? Vor lauter Panik wurde mein Atem immer flacher.
»Was ist los?«
Ich erschrak, als Lya plötzlich hinter mir stand. Ihre Dreadlocks sahen in der Nacht aus wie der Kopfschmuck einer Kriegerin.
»Bist du auch davon aufgewacht? Dieses Grollen, was ist das? Und dort: Schau dir das an!«
Ich zeigte mit dem Finger zum gegenüberliegenden Hang und wagte mich sogar wieder ein bis zwei Schritte nach vorn.
»Was ist dort?«
Ich sah Lya fassungslos an. Wie konnte sie das Grauen dort drüben nicht erkennen? Ich wandte mich von ihr ab, hin zum Hang auf der anderen Seite, und – wie konnte das sein? – außer dem bleichen Mond, der sein Licht über die dunklen Konturen der Nacht schmiegte, war dort nichts zu erkennen. Und auch das Grollen war verschwunden und wich einer neuen Stille, die sich wieder zu uns gesellte.
»Du brauchst echt Hilfe, Mutter. Ich bin müde, ich gehe wieder in mein Zimmer«, sagte Lya und verschwand so schnell, wie sie gekommen war. Ich zitterte am ganzen Körper und konnte mich nicht mehr auf den Beinen halten. Ich ging nach hinten, bis ich mit dem Rücken an die Wand stieß, und rutschte zu Boden.
Ich durfte jetzt nicht wahnsinnig werden. Ich durfte jetzt nicht wahnsinnig werden.
Hast du etwas übersehen? Erinnere dich an jedes Detail. Wann ist er gekommen, der Frost?
ZWEI
Wasser zu Wasser. Staub zu Staub.
In den Wolken gefriert mein Schicksal.
WASSER
In dieser Nacht fand ich keinen Schlaf mehr. Nur langsam verlor die Welt ihren Schrecken, deshalb erhob ich mich, um im Liegen nicht erst recht niedergedrückt zu werden. Meine Kehle war trocken. Ich ging nach draußen und sah auf den Hang, der nun in der beginnenden Dämmerung an Konturen gewann. Erste Vögel glitten durch die feuchte Luft. Nebelwände hingen in den Wäldern. Keine Hinweise auf die Ereignisse, die mich aufgeschreckt hatten. Keine aufgeregten Menschen, die die Spuren der unheimlichen Prozession untersuchten. Keine Hunde, die den Schatten folgten, keine ängstlichen Mütter, die ihre Kinder auf den Höfen beschützten.
Ich ging in die Küche und setzte Tee auf. Lya schlief noch. Hatte Lya recht, und ich brauchte tatsächlich Hilfe? War das, was ich gesehen hatte, bloße Einbildung? Ich hatte meiner Therapeutin von meiner Angst erzählt, eines Tages wahnsinnig zu werden. Sie schob es auf die Arbeit. Seit ich denken konnte, hatte ich immer hart gearbeitet. Freizeit gab es nicht, war beinahe ein Schimpfwort gewesen für mich. Ich hatte meinen Eltern im Alltag geholfen, für die Schule gelernt und mich auf das Studium und später auf den Beruf konzentriert. Ich hatte mich ausgebeutet. Für ein Mädchen wie mich wäre sonst nicht viel übrig geblieben.
Wollte ich mehr erreichen als meine Eltern, dann musste ich arbeiten. Aber was sollte ich nun tun? Akzeptieren, dass Bilder in meinem Kopf sich zu formen begannen? Akzeptieren – wie sehr ich dieses Wort hasste! Akzeptieren, dass Menschen so waren, wie sie waren? Dass Menschen die Regeln brachen, Gesetze überschritten, weil sie nicht anders konnten, als Opfer ihrer eigenen Vergangenheit zu werden? Akzeptieren, dass die Welt so war, wie sie war? Akzeptieren, dass jede Anstrengung, die Welt ein Stückchen gerechter zu machen, am Ende sinnlos sein würde?
Nein, ich wollte nicht akzeptieren, dass ich meinen Verstand verlor. Ich klopfte an Lyas Tür.
»Komm! Lass uns frühstücken im Dorf! Das tut uns gut nach der Nacht gestern. Und dann gehen wir einkaufen und lassen uns viel Zeit.«
Ich hörte, wie sich Lya im Bett umdrehte. Sie sagte mir, dass sie keinen Bock habe. Ich ließ nicht locker und war anschließend stolz, dass sich Lya ohne großes Motzen doch entschloss, ihr Zimmer zu verlassen und mich ins Dorf zu begleiten. Machte sie es, weil sie sich seit gestern um mich sorgte? Ich startete den Wagen, wendete ihn auf der Wiese, und wir fuhren ins Dorf.
»Du hast gestern wirklich gar nichts gesehen?«
Lya hatte die Beine anzogen und unter ihre Arme geklemmt und sah auf das Baumspalier, durch das vorsichtige Sonnenstrahlen eines kalten Tages blitzten.
»Da war nichts, Mutter.«
»Hast du auch dieses Dröhnen nicht gehört?«
Lya schwieg. Ich steuerte den Wagen auf die Semmeringer Passstraße und bog links in Richtung Hochstraße ein. Vor dem Gemeindeamt hielt ich an.
»Ich dachte, wir wollten frühstücken.«
»Lass mich kurz mit dem Bürgermeister reden.«
»Mit dem Bürgermeister? Als ob der mit dir reden würde …«