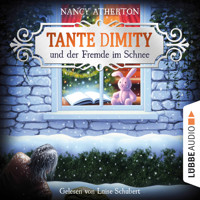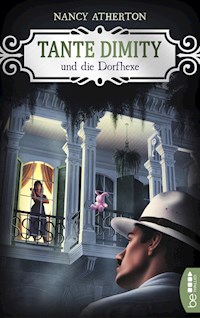5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wohlfühlkrimi mit Lori Shepherd
- Sprache: Deutsch
Lori Shepherd, von einem gefährlichen Auftrag aus Australien in ihr Heimatdorf Finch zurückgekehrt, sehnt sich nach Ruhe. Doch damit ist es vorbei, als ihr Schwiegervater William in das herrschaftliche Anwesen Fairworth House zieht. Ein Gentleman, wie er im Buche steht, der nicht nur mancher Witwe den Kopf verdreht, sondern auch Seltsames auf dem Dachboden seines neuen Hauses entdeckt. Als Möbel anfangen, sich wie von Geisterhand zu bewegen, unheimliche Stimmen ertönen und mysteriöse Besucher ihn überraschen, ist William mit seiner Geduld am Ende. Lori bittet Tante Dimity um Rat, denn wer kennt sich mit Geistern besser aus als sie?
Ein spannender Wohlfühlkrimi mit Tante Dimity. Jetzt als eBook bei beTHRILLED.
Versüßen Sie sich die Lektüre mit Tante Dimitys Geheimrezepten! In diesem Band: Tante Dimitys Gewürzkuchen.
"Geistreich und packend - gerade das Richtige, wenn Ihnen mal alles über den Kopf wächst und sie sich am liebsten in ein gutes Buch flüchten möchten." Lincoln Journal Star
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Epilog
Tante Dimitys Gewürzkuchen
Über dieses Buch
Lori Shepherd, von einem gefährlichen Auftrag aus Australien in ihr Heimatdorf Finch zurückgekehrt, sehnt sich nach Ruhe. Doch damit ist es vorbei, als ihr Schwiegervater William in das herrschaftliche Anwesen Fairworth House zieht. Ein Gentleman, wie er im Buche steht, der nicht nur mancher Witwe den Kopf verdreht, sondern auch Seltsames auf dem Dachboden seines neuen Hauses entdeckt. Als Möbel anfangen, sich wie von Geisterhand zu bewegen, unheimliche Stimmen ertönen und mysteriöse Besucher ihn überraschen, ist William mit seiner Geduld am Ende. Lori, die langsam an seinem Verstand zweifelt, bittet Tante Dimity um Rat, denn wer kennt sich mit Geistern besser aus als sie?
Über die Autorin
Nancy Atherton ist die Autorin der beliebten »Tante Dimity« Reihe, die inzwischen über 20 Bände umfasst. Geboren und aufgewachsen in Chicago, reiste sie nach der Schule lange durch Europa, wo sie ihre Liebe zu England entdeckte. Nach langjährigem Nomadendasein lebt Nancy Atherton heute mit ihrer Familie in Colorado Springs.
NANCY ATHERTON
Aus dem Amerikanischen von Monika Köpfer
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen.
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Jeannine Schmelzer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Alvaro Cabrera Jimenez | Montreeboy
Illustration: © Jerry LoFaro
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3507-1
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Aunt Dimity and the Family Tree« bei Penguin Books, New York.
Copyright © der Originalausgabe 2011 by Nancy T. Atherton
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2011
by RM Buch und Medien Vertrieb GmbH
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Wyn, die mich zum Tee eingeladen hat.
Kapitel 1
DIE GRUNDSUBSTANZ VON Fairworth House war noch recht gut. Auch wenn es während der letzten fünfzig Jahre unter einer Reihe von glücklosen Besitzern vernachlässigt worden war, verfügte es über solide Grundmauern. Ich war gelinde gesagt entsetzt gewesen, als ich erfuhr, dass mein Schwiegervater, William Willis senior, ein zweihundertfünfzig Jahre altes Anwesen kaufen wollte, das von Grund auf renoviert werden musste. Doch laut Bericht des Baugutachters war der alte Kasten nicht so marode, wie es von außen schien.
Das Schieferdach musste nicht vollständig erneuert, sondern nur ausgebessert werden, und die weichen Kalksteinmauern mussten einfach nur mühsam vom wild wuchernden Efeu befreit werden, der beinahe bis zu den Dachtraufen reichte. Zwar hatten Kinder sich einen Spaß daraus gemacht, mit ihren Steinschleudern auf das eine oder andere Fenster zu zielen, aber die meisten Glasscheiben waren noch intakt. Und die herrlichen Parkettböden waren weder der Trockenfäule noch dem Holzwurm noch einem Wasserschaden zum Opfer gefallen.
Die meisterhafte Handwerkskunst seiner Erbauer und die außerordentliche Qualität der verwendeten Materialien hatten Fairworth vor der zerstörerischen Kraft der Elemente bewahrt.
Fairworth House war natürlich gealtert, aber mit Würde.
Das alte Herrenhaus war zwar kein Palast, aber die Gefahr, mit einem Cottage verwechselt zu werden, bestand auch nicht. Es verfügte über drei Stockwerke, nicht weniger als sieben Schlafzimmer, einen Wintergarten, einen Billardraum, zwei Salons, eine Bibliothek und ein Arbeitszimmer. Jeder Immobilienmakler, der etwas von seinem Metier verstand, hätte es als »ein herrliches Landhaus für Menschen, die das Besondere lieben« angepriesen, und die ganz ehrlichen unter ihnen hätten noch hinzugefügt: »renovierungsbedürftig«.
Die Schornsteine waren rußverschmiert, und das ganze Leitungs- und Rohrsystem war hoffnungslos veraltet. Als Erstes mussten die Wasserrohre, die Heizung und die elektrischen Leitungen von Grund auf erneuert werden, ebenso die Küche, der Waschraum und die Badezimmer. Ein kleiner Aufzug wurde eingebaut, im Hinblick auf die Bequemlichkeit sowohl zukünftiger Hausangestellter als auch des Hausherrn, dessen Knie nicht mehr ganz so elastisch waren wie einst.
Doch die bedeutendste Veränderung, die an dem Haus vorgenommen wurde, war die möblierte Einliegerwohnung im Dachgeschoss. Sie war für eben jene Hausangestellten vorgesehen, die erst noch gefunden werden wollten.
Auch die Grünanlagen bedurften der Neugestaltung. Ein Landschaftsarchitekt hatte die Pläne für den weitläufigen Park angefertigt, der das Herzstück des vier Hektar großen Anwesens war. Eine angesehene Gartenbaufirma war dabei, sie in die Wirklichkeit umzusetzen. Wenn es nicht zu irgendwelchen unvorhergesehenen Katastrophen kam, würde der Gemüsegarten binnen eines Jahres Früchte und Gemüse in Hülle und Fülle hervorbringen und die Blumenbeete mehr als genug Blumen, um sämtliche Vasen in sämtlichen Räumen des Hauses zu bestücken.
Ohne mein Wissen hatte mein Schwiegervater mithilfe von zwei Freunden, die mit Antiquitäten handelten, bereits lange vor dem Erwerb von Fairworth House damit begonnen, englische Möbel aus dem 18. Jahrhundert zu sammeln. Kaum hatte sich der Staub der Renovierungsarbeiten gelegt, wanderten die ausgesuchten Stücke von ihrem provisorischen Lager in ihr neues Heim. Willis senior arbeitete eng mit einem Innenarchitekten zusammen, der ihm half, jeden einzelnen Raum entsprechend seiner eigenen Vorstellungen einzurichten. Auch beaufsichtigte mein Schwiegervater die Auswahl der jeweiligen Anstriche für Wände, Türen, Fenster und Leisten sowie der Tapeten, Polsterstoffe und der Bettwäsche. Auf mein Anraten hin mischte er unter die Antiquitäten hie und da das eine oder andere neuzeitliche Stück, was zwar einen Stilbruch bedeutete, aber für die nötige Bequemlichkeit sorgte. Schließlich sollte das Haus nicht wie ein Museum wirken, sondern ein behagliches Heim sein.
Durch glückliche Umstände fanden sich einige ursprüngliche Einrichtungsstücke von Fairworth House in einer dunklen Ecke des alten Stalls. Ein Gemälde, ein Buch und ein paar Dekorationsgegenstände, die über die Jahre hinweg den Spinnen, Mäusen und Fledermäusen Gesellschaft geleistet hatten, wurden von Spinnweben befreit und ans Tageslicht gebracht.
Das Ergebnis war spektakulär, und das ist noch untertrieben. Fairworth House war kein protziges, nachträglich mit Türmchen und kitschigen Ornamenten angereichertes Ausstellungsstück. Es war ein solides, respektables georgianisches Haus – klassisch und von vergleichsweise bescheidener Größe. Das Anwesen, das ich immer als hoffnungslose Ruine betrachtet hatte, entpuppte sich als verborgenes Juwel, das nur gründlich hatte aufpoliert werden müssen – wozu es einer beträchtlichen Summe alten Geldes bedurft hatte.
Das Haus passte wie angegossen zu seinem neuen Besitzer. William Arthur Willis senior, der Patriarch einer alt eingesessenen wohlhabenden Bostoner Familie, war der Begründer einer ehrwürdigen Anwaltskanzlei, die sich bemühte, die bisweilen recht sonderbaren Wünsche begüterter Mandanten zufriedenzustellen. In eine reiche Familie geboren, hatte mein Schwiegervater das Vermögen im Laufe seiner beruflichen Karriere noch beträchtlich vermehrt. Nun, da er sich aus der Leitung der Kanzlei zurückgezogen hatte, wusste er nicht so recht, was er mit dem Geld anfangen sollte. Auch wenn er durchaus an die Annehmlichkeiten eines begüterten Lebens gewöhnt war, verabscheute er die Zurschaustellung von Reichtum. Wie das Haus, das er kürzlich erworben hatte, war auch Willis senior solide, respektabel und von unaufdringlicher Eleganz.
Darüber hinaus war er ein treusorgender Familienmensch. Obwohl sich Willis senior ein viel größeres und weniger renovierungsbedürftiges Anwesen hätte leisten können, hatte er sich für Fairworth entschieden, weil es ihm ermöglichte, in der Nähe seines einzigen Nachkommens zu wohnen, eines Sohnes namens William Arthur Willis junior, der von allen nur Bill genannt wurde.
Wie es der Zufall wollte, war Bill Willis mein Mann. Wir lebten mit unseren siebenjährigen Zwillingssöhnen Will und Rob und unserem schwarzen Kater Stanley in einem honigfarbenen Cottage, das sich behaglich zwischen die sanften Hügel und Flickenteppichfelder der Cotswolds schmiegte, einer ländlichen Gegend in den englischen Midlands. Ursprünglich aus Amerika stammend, waren wir vor fast einem Jahrzehnt nach England umgesiedelt. Unsere Söhne kannten sich besser mit Kricket als mit Baseball aus und feierten mit derselben Begeisterung den Guy Fawkes Day wie den vierten Juli.
Da Bill und ich keinerlei Neigung verspürten, unsere kleine glückliche Familie zu entwurzeln, hatte Willis senior bei seiner Pensionierung beschlossen, in unserer Nähe neue Wurzeln zu schlagen. Fairworth House lag dreieinhalb Kilometer von unserem Cottage entfernt, eine Strecke, die Will und Rob leicht auf ihren grauen Ponys Thunder und Storm bewältigen konnten. Um sie zu häufigen Besuchen zu ermuntern, hatte Willis senior ebenso viel Sorgfalt bei der Renovierung des Stalls walten lassen wie bei der des Wohnhauses.
Das nächstgelegene zivilisatorische Zentrum war Finch, ein kleines Dorf, das mit keiner nennenswerten Attraktion aufwarten konnte. Die umliegenden Farmer hielten die örtlichen Geschäfte am Leben, und hin und wieder verewigte ein Künstler auf der Durchreise eines der Gebäude. Aber nur selten verirrten sich Touristen in die gewundenen Gässchen von Finch, während Historiker seine Existenz völlig ignorierten.
Dank seiner abgeschiedenen Lage widerstand Finch tapfer allen modernen Trends und bewahrte sich seinen dörflichen Charakter, wobei jeder Einzelne lebhaft – mancher vielleicht sogar mit übertriebenem Eifer – am Leben der übrigen Mitbewohner Anteil nahm. Mein Mann, der den europäischen Zweig der Anwaltskanzlei von seinem Hightech-Büro am Dorfanger aus leitete, hatte aus Erfahrung gelernt, dass er besser die Fenster schloss, wenn er vertrauliche Telefonate führte. Denn in Finch gab es immer jemanden, der zuhörte.
Doch was Klatsch und Tratsch anbelangte, so hatte mein Schwiegervater in den vergangenen Monaten für ausreichend Stoff gesorgt. Da die Kieszufahrt nach Fairworth am südlichen Ende von Finch lag, konnten die Einheimischen hervorragend die Parade schwerer Baufahrzeuge mitverfolgen, die zu und von der Baustelle weg fuhren. Einige der Dorfbewohner spotteten über Willis senior, er stecke gutes Geld in einen maroden alten Kasten. Andere wieder fanden es ehrenhaft, dass er ein altes Gebäude wieder in seinem ehemaligen Glanz erstrahlen lassen wolle.
Und wieder andere – eine kleine, aber mächtige Minderheit, die vorwiegend aus Witwen und unverheirateten Frauen reiferen Jahrgangs bestand – entpuppten sich als glühende Verehrerinnen meines Schwiegervaters und hielten seine Entscheidung, Fairworth zu restaurieren, für die glorreichste Idee in der Geschichte der Zivilisation. Herzen, die schon lange vor sich hin geschlummert hatten, flatterten plötzlich bei der Aussicht, in Bälde einen wohlhabenden, weißhaarigen Witwer in der Nachbarschaft begrüßen zu dürfen.
Mein Mann nannte diese wackeren Damen »Vaters emsige Mägde«. Ihnen war es zu einem nicht unbeträchtlichen Teil zu verdanken, dass Fairworth House in schier atemberaubendem Tempo bewohnbar gemacht wurde. Alter und Erfahrung verliehen den emsigen Damen die nötige Autorität, der sich zu bedienen sie keinen Augenblick zögerten. Jeden Morgen, gleich ob es stürmte oder schneite, passierten sie die Buckelbrücke am Ortsrand von Finch und marschierten entschlossen die alleeartige Auffahrt zu Willis seniors Anwesen hinauf, um die jeweiligen Bauarbeiten zu beaufsichtigen.
Jene Arbeiter, die pünktlich erschienen und auf ausgedehnte Pausen und Pubbesuche verzichteten, wurden mit frisch gebackenen Plätzchen und selbstgekochtem Mittagessen belohnt – und mit der seligen Stille, die sich breitmacht, wenn Harpyien ihr Gezänk einstellen. Faulpelze hingegen wurden mit lauwarmem Tee, eisigen Blicken und, falls nötig, einer gehörigen Standpauke abgespeist.
Nachdem sie in drei Monaten vollbracht hatten, wofür sechs Monate veranschlagt worden waren, konnten die armen Bauarbeiter es kaum mehr erwarten, in eine Welt zurückzukehren, wo sie in Frieden ein Bier genießen durften. Und so war Fairworth House Mitte August bezugsfertig. Die Bibliothek wartete noch auf den letzten Schliff, ebenso der Billardraum und der Wintergarten, aber die Wohnräume waren fertig renoviert und möbliert. Willis senior zog am Donnerstag, dem 12. August ein, und ich hatte mich bereit erklärt, für Samstag, den 14. August eine Einzugsparty zu organisieren.
Das einzige Haar in der Suppe war, dass es noch keine Hausangestellten gab. Obwohl Willis senior mit meiner Unterstützung etliche Kandidaten zu einem Vorstellungsgespräch empfangen hatte, war bislang noch niemand gefunden worden, der den Anforderungen entsprechen konnte. Meinem Schwiegervater schwebte ein älteres Paar vor, und das machte die Suche zehn Mal schwieriger, als sie ohnehin schon war.
Wie nicht anders zu erwarten, hatten sich die »emsigen Mägde« erboten, das Kochen, die Haushaltsführung und das Gärtnern zu übernehmen, aber mein Schwiegervater hatte die Hilfsangebote freundlich ausgeschlagen. Er wusste genau, wenn er ein Angebot annahm und dafür ein anderes ausschlug, würde das die erbittertsten Grabenkämpfe auslösen, deren Erschütterungen auf Jahre hin im ganzen Dorf zu spüren wären. Die andere Lösung – die Damen alle gleichzeitig im Haus zu haben, während sie hitzig, wenn nicht gar gewalttätig um seine Gunst buhlten – kam ebenso wenig in Frage. Sein Plan stand also fest: Er wünschte sich als zukünftige Hausangestellte ein zuverlässiges, älteres Paar, das keinerlei Verbindungen nach Finch hatte. Nur dass ein solches Paar weit und breit nicht in Sicht war.
Wie schon viele vor ihm musste auch mein Schwiegervater feststellen, wie schwer es ist, gutes Hauspersonal zu finden.
Immerhin wohnte ja nur wenige Kilometer entfernt eine tüchtige Schwiegertochter. Mir war klar, dass, wenn nicht bald geeignetes Personal am Horizont auftauchte, ich neben meinem eigenen Haushalt einen zweiten zu bewältigen hätte.
Das Kochen war kein Problem – ich beherrschte die Kunst, rasch ein nahrhaftes Essen auf den Tisch zu stellen. Außerdem konnte ich mich auf meine beste Freundin Emma Harris verlassen, die dafür sorgen würde, dass die frisch angelegten Gärten nicht frühzeitig dahinsiechten. Aber allein bei der Aussicht, neben meiner Aufgabe, zwei äußerst lebhafte Jungen zu bändigen, auch noch den Wollmäusen auf den weitläufigen Fluren von Fairworth House hinterherjagen zu müssen, löste in mir den Wunsch aus, mich mit einer kalten Kompresse auf der Stirn in ein dunkles Zimmer zu legen.
Insgeheim betete ich inbrünstig, dass die renommierte Londoner Personalagentur, die wir mit der Suche betraut hatten, in Kürze zwei Kandidaten finden würde, die nicht zu alt waren und nicht zu jung, nicht zu überheblich, zu flatterhaft, zu derb oder zu dumm für die gutdotierten Positionen. Doch als der 14. August bedrohlich näher rückte und noch immer keine geeigneten Kandidaten in Sicht waren, begann meine Hoffnung zu schwinden.
Am Tag der Party stand ich bei Sonnenaufgang auf, fuhr Will und Rob zum Reitunterricht im nahe gelegenen Anscombe Manor, machte einen kurzen Zwischenstopp in Fairworth House, um Willis senior mit einem Frühstück zu versorgen, und kehrte ins Cottage zurück, wo Bill einen Berg frisch getoasteter Brote verspeiste. Anstatt mich zu ihm zu setzen und mich mit dem gebutterten Toast zu stärken, den mir mein Mann hinhielt, hetzte ich sogleich zu dem alten Eichenschreibtisch im Arbeitszimmer, um nochmals meine Aufgabenliste zu überfliegen. Während der vergangenen Monate hatte ich mit unzähligen Schreibwarengeschäften, Caterern, Floristen und Musikern verhandelt, und endlich war der Tag gekommen, da sich meine Mühe auszahlen sollte.
Um acht Uhr am Abend sollten etwa zweihundert Gäste in das blumengeschmückte Fairworth House strömen, um sich an köstlichen Speisen zu erfreuen und mit Champagner auf meinen reizenden Schwiegervater anzustoßen, während ein Kammerorchester im Hintergrund diskret für die musikalische Untermalung sorgte. Ich mag zwar nicht in der Lage sein, Sanitärinstallationen vorzunehmen oder Bäume zu kunstvollen Gebilden zu trimmen, aber wenn es darum geht, eine gelungene Party zu schmeißen, kann mir keiner so leicht das Wasser reichen. Dank meiner guten Planung sollte Willis seniors Hauseinweihungsparty zu einem der glanzvollsten gesellschaftlichen Ereignisse des Sommers werden.
Ich hatte etwa die Hälfte der Punkte auf meiner Checkliste abgehakt, als Davina Trent, die Leiterin der Personalagentur, mich anrief, um mir mitzuteilen, dass ein geeignetes Paar »noch vor heute Abend« in Fairworth House eintreffen würde. Der Zeitpunkt war alles andere als optimal, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen.
»Und wie geeignet ist das Paar?«, fragte ich misstrauisch.
»Oh, sehr geeignet, würde ich sagen«, kam prompt die Antwort. »Ich werde Ihnen gleich die Bewerbungsunterlagen faxen, Ms Shepherd.«
Damit, dass Mrs Trent mich »Ms Shepherd« genannt hatte, hatte sie bei mir gepunktet. Denn Menschen, die mich nicht näher kannten, vergaßen nur allzu oft, dass ich bei meiner Heirat meinen Mädchennamen behalten hatte.
»Ich versichere Ihnen persönlich«, fuhr Mrs Trent fort, »dass Ihr Schwiegervater entzückt von den Donovans sein wird.«
»Gut, wir werden sehen.« Ich seufzte etwas bekümmert, dankte ihr und legte auf. Irgendwie würde ich auch noch ein Vorstellungsgespräch in den ohnehin mit Terminen vollgestopften Tag hineinquetschen können, obwohl ich mir nicht allzu große Hoffnung machte. Zu oft war ich schon enttäuscht worden, um zu glauben, dass die Donovans hielten, was Mrs Trent versprach.
Gerade als ich die Hand zum Faxgerät ausstreckte, klingelte erneut das Telefon. Diesmal hatte der Anrufer eine Nachricht für mich, die mir einen Schauer über den Rücken jagte. Wie vor den Kopf geschlagen starrte ich einen Moment lang auf das Telefon, dann warf ich den Kopf zurück und heulte: »Nein!«
Der Hörer entglitt meinen tauben Fingern, und während Bill erschrocken zur Tür hereinstürmte, ließ ich mich matt auf seinen Schreibtisch sinken.
»Lori?«, fragte er und eilte zu mir. »Was ist los? Ist den Jungen etwas zugestoßen? Oder meinem Vater?«
»Nein, weder den Jungen noch Vater.« Ich stöhnte. »Aber dem Caterer.«
Bill amtete erleichtert aus, legte den Hörer auf die Gabel und streichelte tröstend meinen Rücken.
»Was ist denn mit dem Caterer?«
»Lebensmittelvergiftung«, antwortete ich mit tragischer Stimme. »Das gesamte Servicepersonal ist erkrankt, und die Küche muss professionell keimfrei gemacht werden, bevor sie wieder benutzt werden darf. Und das Essen musste bis auf den letzten Bissen weggeschmissen werden.« Ich barg das Gesicht in den Händen und stöhnte jämmerlich. »Meine Kanapees, meine wunderschönen Kanapees, das ganze Fingerfood, der Kaviar, der Hummer, der geräucherte Lachs, die Petit Fours, die klitzekleinen Eclairs, ja sogar die Rohkostplatten ... alles weg-geschmissen.« Meine Stimme erstarb, und ich konnte nicht weitersprechen.
»Nun«, sagte Bill nüchtern, »wir wollen unsere Gäste ja nicht auch noch vergiften, nicht wahr?«
»Nein«, wimmerte ich.
»Kann der Caterer wenigstens den Champagner liefern?«
»Ja«, erwiderte ich matt. »Das Eis auch, aber wie ... wie sollen wir die Gäste jetzt verköstigen?«
»Ganz einfach«, sagte Bill mit einem lässigen Achselzucken. »Du schickst einen Hilferuf an Vaters emsige Mägde.«
Ich richtete mich langsam auf und spürte, wie die Farbe in mein Gesicht zurückkehrte.
»Die emsigen Mägde?« Benommen starrte ich zu den Bleiglasfenstern. »Natürlich. Warum bin ich nicht darauf gekommen?«
»Du hast unter Schock gestanden. Ich bin sicher, früher oder später wären dir die Mägde auch eingefallen.« Bill warf einen Blick auf seine Uhr. »Ich werde bis Mittag im Büro sein, Liebling. Danach stehe ich zu deiner Verfügung.«
Ich sprang auf und gab ihm einen schmatzenden Kuss, dann schob ich ihn energisch aus dem Arbeitszimmer.
»Geh jetzt«, sagte ich. »Ich muss die Truppen zusammenziehen.«
»Viel Glück, mon capitaine!«, rief er über die Schulter zurück.
Ich griff zum Telefonhörer und wählte die erste Nummer. Ich vertraute darauf, dass der Kader unverheirateter Frauen Gewehr bei Fuß stehen würde, um ein unvergiftetes Mahl für zweihundert Gäste auf die Beine zu stellen, das nicht nur rechtzeitig fertig, sondern auch noch weit unter Budget sein würde, und sei es nur, um ihren Traummann zu beeindrucken. Wahrscheinlich würde meine größte Herausforderung darin bestehen, zu verhindern, dass im Laufe des Abends ein handfester Konkurrenzkampf unter den Köchinnen ausbrach.
Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, dass ich, noch ehe der Tag zu Ende wäre, in den schlimmsten Verrat aller Zeiten verwickelt werden würde, der je an den guten Leuten von Finch verübt wurde.
Das Leben in einem englischen Dorf wird niemals langweilig.
Kapitel 2
DIE NACHRICHT VON der Catering-Krise verbreitete sich in Windeseile in Finch. Noch ehe ich wusste, wie mir geschah, strömten die Hilfsangebote nur so herein. Nicht nur die emsigen Mägde, nein, alle wollten helfen, gleich welchen Geschlechts, Alters oder ob verheiratet oder nicht. Dass ihre Reaktion so geschwind und so herzlich erfolgte, wunderte mich nicht weiter.
Die Leute aus Finch waren großzügige Menschen, stets bereit einzuspringen, wenn Not am Mann war. Doch ihr Eifer, die Einweihungsparty retten zu wollen, war einer noch größeren Macht als ihrer Gutmütigkeit geschuldet. Lilian Bunting, die Frau des Pfarrers, brachte es auf den Punkt: »Sie brennen einfach darauf zu sehen, was William aus Fairworth House gemacht hat.«
Ich teilte durchaus Lilians Ansicht, dass der Großteil der Einwohner die Party als ausgezeichnete Gelegenheit betrachtete, heimlich von Raum zu Raum zu schleichen und kritische Kommentare über Teppiche, Gardinen, Wandfarben und Möbel abzugeben und darüber zu debattieren, wie viel die Gemälde, die Bücher und das Mobiliar – jede einzelne Kleinigkeit gekostet haben mochte. Deswegen war ich auf die Flut von Anrufen der Einheimischen gefasst, die sich erboten, die Ärmel hochzukrempeln und zu tun, was immer zu tun war, um das lange herbeigesehnte Ereignis doch noch stattfinden zu lassen.
Mit Bedacht verteilte ich die verschiedenen Aufgaben, um zu verhindern, am Ende mit zu vielen Pasteten und zu wenigen Desserts dazustehen. Die freiwilligen Helfer, die gut kochen konnten, zogen sich in ihre Küche zurück. Die anderen wiederum, die, was die Zubereitung von Speisen anging, ungeeignet waren, machten sich nützlich, indem sie Einkäufe in den örtlichen Geschäften oder dem großen Supermarkt in dem nächstgelegenen Marktflecken Upper Deeping erledigten.
Die meisten eilten in den eigenen Garten, um Kräuter und Gemüse zu holen, und ein paar Farmer fuhren von Cottage zu Cottage, um die Köche mit Eiern, Geflügel, Schinken, Milch, Sahne, Butter und Käse zu beliefern. Um die Mittagszeit herum roch es in Finch so köstlich, dass mir das Wasser im Mund zusammenlief.
Nachdem der Ball ins Rollen gekommen war, rief ich in Anscombe Manor an und fragte, ob Will und Rob den ganzen Tag im Reitstall verbringen könnten – so ziemlich exakt die Vorstellung, die sich die beiden Buben vom Himmel machten. Dann verlegte ich meinen Kommandoposten vom Cottage nach Fairworth House. Nach kurzer Suche fand ich meinen Schwiegervater gemütlich in einem Ledersessel in seinem Arbeitszimmer, einem luftigen, offenen Raum, der an die Bibliothek grenzte.
Willis senior las in einem alten, staubigen Band mit dem aufregenden Titel: Notizen zur Schafzucht. Ich erkannte darin das Buch, das wir vor der Restaurierung im alten Stall ausgegraben hatten, zusammen mit einem Gemälde, das dringend gereinigt werden musste. Das Bild lehnte an der Wand neben dem Sheraton-Sideboard und wartete darauf, dass ein ortsansässiger Restaurator Hand an es legte.
Es starrte nicht nur vor Schmutz, sondern war auch noch extrem gefährlich. Beinahe hätte ich mir die Hand an einer Glasscherbe geschnitten, die am inneren Rahmenrand herausragte. Gott allein wusste, was das Bild darstellen mochte, denn kein menschliches Auge vermochte die Schmutzschichten zu durchdringen, die es bedeckten. Sein verwahrloster Zustand bildete einen disharmonischen Kontrast zu der sonst makellosen Sauberkeit des Zimmers.
Durch die offenen Verandatüren wehte eine erfrischende Brise vom Garten herein, und die hohen Fenster blitzten im Sonnenlicht. Willis senior, offensichtlich beschwingt von dem warmen Sommertag, war so lässig gekleidet, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Er trug einen weißen Flanellanzug, ein blassblaues Hemd, eine gelbe Seidenkrawatte, weiße Socken und Slipper mit kleinen Quasten. Auf dem Nussbaumschreibtisch stand ein Silbertablett mit einem Kristallglaskrug voller geeister Limonade und auf dem kleinen Satinholztisch neben seinem Sessel ein Glas Limonade. Auch wenn das Wetter zu einem Spaziergang über die Wiesen und Felder einlud, hatte mein Schwiegervater augenscheinlich vor, den Rest des Tages im Haus zu verbringen.
Er schlug das Buch zu und legte es zur Seite, als ich das Zimmer betrat.
»Ich überlege mir, ob ich mir eine kleine Schafherde zulege«, verkündete er.
»Schafe?«, fragte ich verblüfft.
»Cotswold-Schafe, um genau zu sein. Auch als Cotswold Lions bekannt, eine uralte und vom Aussterben bedrohte heimische Rasse, die sich durch ein herrliches Fell auszeichnet. Das wäre doch ein sinnvoller Beitrag, um diese Rasse vor dem Aussterben zu bewahren.«
»Hm«, stimmte ich halbherzig zu, ehe ich auf dringendere Dinge zu sprechen kam. Als ich zu einem atemlosen Bericht ansetzte über die akuten Planänderungen bezüglich des Essens, hob Willis senior seine sorgfältig manikürte Hand und gebot mir Einhalt.
»Du brauchst mir nichts zu erklären«, sagte er. »Bill war auf dem Weg zum Büro kurz hier. Er hat mich über den Vorfall mit der Lebensmittelvergiftung in Kenntnis gesetzt. In der Tat äußerst ärgerlich, aber ich bin sicher, du wirst wie Phönix aus der Asche wiederauferstehen und die unvorhergesehenen Hindernisse mit Verve aus dem Weg fegen.« Er ließ einen zufriedenen Seufzer vernehmen und den Blick durch den sonnendurchfluteten Raum schweifen. »Wie du siehst, habe ich den Rat meines Sohnes befolgt und ... ähm ... mich flach auf die Erde gelegt, bis Hurrikan Lori vorbeigezogen ist.«
»Kluger Junge, dein Sohn«, sagte ich mit einem verzagten Lächeln. »Warum hast du nicht gleich das sinkende Schiff verlassen und Zuflucht in Bills Büro gesucht?«
»Ich wollte in der Nähe sein, falls du, was äußerst unwahrscheinlich ist, meinen Rat benötigst. Aber wie ich hörte, hast du das Catering-Dilemma ja bereits gelöst.«
»Ja, das habe ich tatsächlich. Die Dorfbewohner reißen sich darum, etwas zu deinem Partybüfett beizusteuern. Allerdings weiß ich weder genau, was sie bringen werden, noch wann, und ich habe zudem noch tausend andere Dinge zu erledigen, daher mach dich bitte schon einmal auf jede Menge Chaos gefasst. Aber keine Angst, ich sorge dafür, dass man dich hier nicht stört. Auch während der Party wird dein Arbeitszimmer tabu sein. Ich will nicht, dass irgendjemand deinen Schreibtisch durchstöbert.«
Willis senior hob die Augenbrauen. »Wer sollte die Kühnheit besitzen, meinen Schreibtisch zu durchstöbern?«
»Zum Beispiel jeder, der gern wissen möchte, wie viel du für deine Miniaturensammlung bezahlt hast«, erwiderte ich unumwunden. »Die Leute aus Finch sind neugierige Geister. Es ist besser, wenn man sie nicht in Versuchung führt.«
Er schürzte nachdenklich die Lippen. »Ich werde beim Hinausgehen die Tür abschließen. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, den Fuß der Haupttreppe zu verhüllen, damit niemand auf die Idee kommt, die oberen Stockwerke zu erkunden.«
»Eine hervorragende Idee. Ich werde die Floristin bitten, sich der Sache anzunehmen.« Ich warf einen Blick auf den Kristallglaskrug und fragte mich, ob vielleicht schon eine emsige Magd hereingeschneit war, um Willis senior mit einer Erfrischung zu versorgen. »Hat Bill die Limonade gemacht?«
»Ich bin unfähig zu lügen«, sagte Willis senior augenzwinkernd. »Nein, ich habe sie selbst zubereitet. Ich habe Zitronen ausgepresst, Zucker dazugegeben, das Ganze mit Wasser aufgefüllt und ohne fremde Hilfe Eiswürfel hineingerührt. Du wirst es zwar kaum glauben, Lori, aber ich bin nicht völlig hilflos.«
»Ich habe nie gedacht, dass du hilflos bist«, protestierte ich. »Aber wenn du Hunger bekommst ...«
»Werde ich tapfer versuchen, die Küche zu finden«, unterbrach Willis senior mich, »wo ich einen Laib Brot, ein großzügig bemessenes Stück Stiltonkäse und ein paar reife Äpfel bereitgelegt habe. Vielleicht ist es ja übertrieben optimistisch von mir, Lori, aber ich bin in der Tat zuversichtlich, dass ich dem Hungertod entkommen werde.«
»Habe verstanden«, sagte ich mit einem schiefen Lächeln. »Du bist nicht hilflos. Hast du dein Handy griffbereit?«
»Das habe ich.« Er tätschelte seine Brusttasche. »Und ich verspreche, Gebrauch davon zu machen, falls ich Hilfe benötige. In der Zwischenzeit würde ich dich bitten, mich aus deinen Gedanken zu verbannen. Du hast weiß Gott an Wichtigeres zu denken.«
»Du wirst dich aber vielleicht ebenfalls um etwas Wichtiges kümmern müssen«, sagte ich. »Davina Trent hat angerufen, um mir zu sagen, dass sie ein weiteres Kandidatenpaar zu einem Vorstellungsgespräch zu uns schickt. Sie heißen Donovan, und sie meinte, dass sie noch vor heute Abend hier eintreffen werden.«
»›Vor heute Abend‹ ist ein ziemlich weit gefasster Begriff«, bemerkte Willis senior stirnrunzelnd. »Mrs Trent machte auf mich bislang einen gut organisierten Eindruck. Ich frage mich, warum sie diesmal so wenig präzise war.«
»Keine Ahnung.« Ich warf einen raschen Blick auf meine Uhr. »Vielleicht werden die Donovans es uns erklären können. Halt doch bitte Ausschau nach ihnen, ja?« Ich deutete in Richtung der Fenster. »Von hier aus kannst du die Auffahrt ja gut überblicken. Wenn du also ein fremdes Paar in einem unbekannten Wagen herauffahren siehst ...«
»... werde ich mein Handy benutzen und es dich wissen lassen.« Willis senior nickte geduldig und spähte dann durch das am nächsten gelegene Fenster. »Haben die Donovans zufälligerweise einen mit Blumenmotiven bemalten Kastenwagen?«
»Blumenmotiven?« Ich folgte seinem Blick und rief aufgeregt: »Das sind die Floristen. Sie sind aber früh dran! Außerdem habe ich ihnen gesagt, sie sollen den Hintereingang benutzen. Ich gehe rasch hinaus, bevor sie auf deinen schönen Böden Wasserflecken hinterlassen. Ich melde mich nachher wieder bei dir, William.« Ich bedachte das schmutzstarrende Gemälde mit einem grimmigen Blick und lief dann zur Eingangshalle. Ein langer Tag, an dem ich versuchen müsste, an zu vielen Orten gleichzeitig zu sein, hatte gerade erst begonnen.
Um sechs Uhr am frühen Abend war der Blumenschmuck fertig und der Champagner gekühlt, die Musiker saßen in der Bibliothek, und die Küche platzte aus allen Nähten. Höchst motivierte und fleißige Dorfbewohner hatten eine erstaunliche Auswahl an unterschiedlichsten Speisen geliefert.
Charles Bellingham und Grant Tavistock hatten ihre Kunst- und Antiquitätenhandlung an diesem Tag geschlossen, um erlesene Kanapees zu kreieren, bestückt mit Kaviar, Gänseleberpastete, Trüffel und anderen kostbaren Ingredienzien. Am anderen Ende der kulinarischen Skala rangierten die unzähligen Sausage-Rolls aus der Küche von Dick Peacock, dem örtlichen Gastwirt, während seine Frau Christine in mühevoller Kleinarbeit Käse-Obst-Häppchen mit Zahnstochern versehen hatte.
Die neunzehnjährige Bree Pym hingegen hatte Miniaturpawlovas – köstliche Baisertörtchen mit Früchten und Sahne – beigesteuert, was durchaus Sinn machte, da sie aus Neuseeland stammte, und Emma Harris hatte sich mit Miranda Morrow, der örtlichen Kräuterhexe, zusammengetan, um vegetarische, kalorienarme Hors d’oeuvres aus dem Hut zu zaubern, die, wie ich fürchtete, viele bewundern, aber nur wenige essen würden.
Lilian Bunting hatte ein Dutzend Freiwilliger zusammengetrommelt, die im alten Schulhaus, das unter normalen Umständen als Gemeindehalle fungierte, Unmengen köstlicher Sandwiches auf Platten zauberten. Ihr Mann, Theodore Bunting, der sanftmütige Pfarrer der Gemeinde von St. George in Finch, präsentierte mir die Früchte ihrer Arbeit, begleitet von einem inbrünstigen Stoßgebet gen Himmel, der Herr möge uns vor einer Lebensmittelvergiftung bewahren. Auch wenn ich in sein Gebet einstimmte, sorgte ich dafür, dass sämtliche verderblichen Speisen schnurstracks in den Kühlwagen wanderten, den ich von einem Restaurantbedarf in Upper Deeping ausgeliehen hatte. Ich war mir sicher, dass der Herr es mir nachsehen würde. Bekanntlich war sein Eifer besonders groß, wenn es darum ging, jenen zu helfen, die sich selbst zu helfen wussten.
Die emsigen Mägde hatten so viele Gebäckteilchen herangeschafft, dass Willis senior eine Konditorei hätte eröffnen können. Elspeth Binney, eine pensionierte Lehrerin, hatte Hunderte pastellfarbener Petit Fours kreiert. Millicent Scroggins, eine pensionierte Sekretärin, hatte sich auf die Produktion von Madeleines, Makronen und Meringen verlegt. Selena Buxton, eine pensionierte Hochzeitsplanerin, hatte sich auf eine Auswahl an zarten Obsttörtchen verlegt. Und Opal Taylor, die quasi außer Konkurrenz lief, da sie den Vorteil hatte, eine pensionierte Köchin zu sein, stahl allen die Show, indem sie Chargen von Blätterteigpasteten lieferte, gefüllt mit den unterschiedlichsten Delikatessen, angefangen von Räucherlachs bis zu Curry-Garnelen.
Die einzige Dorfbewohnerin, die sich nicht an der Aktion beteiligt hatte, war Sally Pyne, die energische, großmütterliche Witwe, die die örtliche Teestube betrieb. Als ich Sallys heisere Stimme und ihr bellendes Husten übers Telefon vernommen hatte, war mein Rat an sie gewesen, sich schleunigst ins Bett zu legen und vorerst dort zu bleiben. Ihre sechzehnjährige Enkelin, Rainey Dawson, war zwar bei ihr, um ihr zur Hand zu gehen, aber dennoch hätte sich Sally keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können, um krank zu werden. Sehr zu ihrem Leidwesen würden sie und Rainey nun die Party verpassen. Und zu meinem auch, denn Sally wäre ein vorbildlicher Gast gewesen, war sie doch die einzige Witwe im Dorf, die bislang kein Interesse daran gezeigt hatte, um meinen Schwiegervater herumzuscharwänzeln.
Die Küchenmannschaft und das Servicepersonal, die ich in letzter Minute und unter großen Kosten bei einem Cateringunternehmen in Oxford angeheuert hatte, trafen um halb sieben ein. Sofort machten sie sich mit den räumlichen Gegebenheiten vertraut und stellten Tische für die Speisen auf. Ein junger Mann namens Chad ernannte sich selbst zum Chefbutler und bezog in der Eingangshalle Position, während sein Freund Rupert sich freiwillig als Page zur Verfügung stellte, der die Fahrzeuge der eintreffenden Gäste in Empfang nehmen würde, eine Position, die mir gar nicht in den Sinn gekommen war. Auch wenn Fairworth House noch immer nach frischer Farbe und feuchtem Mörtel roch, es war tatsächlich alles vorbereitet, um unsere Gäste angemessen zu empfangen. Um Viertel nach sieben erschien Willis senior, der seinen legeren Flanellanzug gegen einen makellosen schwarzen Dreiteiler eingetauscht hatte, und erteilte mir meinen Marschbefehl.
Ich flitzte zum Cottage zurück, wo ich zu meinem Entzücken zwei frisch gebadete und adrett angezogene Jungen und einen nicht minder adretten Gatten vorfand. Ich hüpfte unter die Dusche, fönte in Windeseile mein dunkles, lockiges Haar und schlüpfte in das sommerliche, vergissmeinnichtblaue Seidenkleid, das ich eigens für diesen Anlass genäht hatte.
Bill zwang mich, einmal tief durchzuatmen, ehe er mir erlaubte, mich zu Rob und Will in den kanariengelben Range Rover zu setzen. Er nahm hinter dem Lenkrad Platz, hielt kurz inne, um mir mit dem Handrücken über die Wange zu streicheln, dann gab er Gas und fuhr, angefeuert von den Jungen hinten auf dem Rücksitz, in rekordverdächtiger Geschwindigkeit nach Fairworth House.
Rupert nahm von Bill den Wagenschlüssel in Empfang, Chad öffnete uns die Eingangstür, und Willis senior begrüßte uns in der hohen Eingangshalle. Als wir zum Salon schlenderten, hörte ich aus der Bibliothek die sanften Klänge eines Mozart-Konzerts, die sich mit dem schweren Duft der Tuberosen vermischten. Ich lächelte, als ich sah, wie eine junge Frau den erwachsenen Gästen Champagner reichte und eine andere den Kindern Apfelsaft. Wieder eine andere präsentierte uns ein glänzendes Silbertablett, das mit delikaten Kanapees bestückt war. Ich nahm ein Glas Champagner und drehte mich zu Willis senior um, doch ehe ich einen Toast auf ihn ausbringen konnte, kam er mir zuvor.
»Auf die Heldin des Tages«, sagte er.
»Auf Hurrikan Lori«, ergänzte Bill.
»Auf Mami!«, riefen die Jungen im Chor.
Ich errötete, nahm glücklich die Lobeshymnen entgegen und genoss zum ersten Mal an diesem Tag einen Augenblick des Friedens.
Es sollte auch der letzte sein.
Um halb neun begriff ich, warum manche Herrenhäuser über einen Ballsaal verfügen. Partys, die sich auf einen Saal beschränken, sind leichter zu überschauen als solche, die sich auf mehrere Räume verteilen.
Da Fairworth House keinen Ballsaal hatte, musste ich von Zimmer zu Zimmer laufen, um mich zu vergewissern, dass sich alle amüsierten. Glücklicherweise gingen sämtliche Räume auf den Hauptflur und waren durch bogenartige Türöffnungen miteinander verbunden, sodass mir das Patrouillieren leichtfiel. Das sanfte Stimmengewirr, vermischt mit gelegentlichem Gelächter, und Willis seniors zufriedenes Gesicht, der noch immer Freunde und Familienangehörige begrüßte, bestätigten mir, dass alles in bester Ordnung war.
Um neun Uhr trat ich meine Gastgeberinnenrolle an Emma Harris und Lilian Bunting ab – die beiden vernunftbegabtesten Frauen unter den Anwesenden – und nahm die anspruchsvolle Aufgabe in Angriff, meine beiden aufgedrehten Söhne zu überzeugen, dass es Zeit für sie war, ins Bett zu gehen. Nach längerer Diskussion erklärten sich Will und Rob bereit, mit Nell und Kit Smith ins Cottage zurückzukehren. Die beiden hatten sich als Babysitter zur Verfügung gestellt, und ich wusste, dass sie gut mit den Zwillingen zurechtkamen. Da Nell und Kit als frisch vermähltes Paar noch immer gern für sich waren statt in Gesellschaft anderer Leute, bedeutete es kein großes Opfer für sie, das Fest frühzeitig zu verlassen und den Rest des Abends ruhig im Cottage zu verbringen.
Als ich endlich meine beiden Söhne verabschiedet hatte, war die Party in vollem Gang. Ein über beide Backen strahlender Willis senior hielt, umgeben von alten und neuen Freunden, im Gesellschaftszimmer Hof. Eine fast unpassend wachsam wirkende Emma hatte sich hinter ihm postiert, während Lilian nirgends zu sehen war. Als ich Bill im Billardzimmer begegnete, fragte ich ihn, ob er wisse, wo sie abgeblieben sei.
»Lilian ist in der Küche«, erwiderte er, »und liest den emsigen Mägden die Leviten.«
Mein Magen verkrampfte sich. »Warum? Was haben sie getan?«
»Kaum warst du nach oben gegangen, sind sie in die Küche gestürzt, um Tabletts mit ihren jeweiligen Kreationen zu bestücken. Dann haben sie angefangen, Vater nachzustellen. Der Gedanke, was passiert wäre, wenn sie ihn alle gleichzeitig in Beschlag genommen hätten, lässt mich erschaudern.«
»Heiliger Himmel«, sagte ich und legte eine Hand an die Stirn. »Es hätte den totalen Krieg gegeben.«
»Den totalen Krieg, genau«, wiederholte Bill mit gewichtiger Stimme. »Zerschellte Blätterteigpasteten an den Decken, Obsttörtchen, die durch die Luft zischen, unschuldige Zuschauer, die von fliegenden Makronen zu Boden gestreckt werden ...« Seine Worte verhallten in einem glucksenden Lachen.
Ich ließ meine Hand sinken und sah ihn mit schmalen Augen an. »Hast du schon mal versucht, die Spuren von Curry-Garnelen von einem frisch restaurierten Deckenfresko zu entfernen?«
»Nein«, erwiderte Bill grinsend, »und dank Lilian werde ich das auch nicht müssen. Sie hat die Gefahr rechtzeitig erkannt und die Gefahrenträger in weiser Voraussicht in der Küche versammelt, um ihnen gute Manieren beizubringen.«
»Und es Emma überlassen, sich um William zu kümmern«, sagte ich, während es mir allmählich dämmerte.
»Du hast seine Leibwächter mit Bedacht ausgewählt«, sagte Bill. »Ich glaube nicht, dass Vaters emsige Mägde weiteren Ärger verursachen werden. Oh.« Er sah an mir vorbei und murmelte: »Wenn man vom Teufel spricht ...«
Ich drehte mich rasch um und sah, wie Peggy Taxman aus der Bibliothek kommend den Billardraum betrat. Hastig ließ sie den Blick schweifen, als suchte sie jemanden, und ging dann schnurstracks auf mich zu.
»Ich sollte wohl besser mal nach Vater sehen, glaube ich.« Bill machte auf dem Absatz kehrt und zog sich rasch in den Gesellschaftsraum zurück.
»Feigling«, murmelte ich, konnte aber ein Lächeln nicht unterdrücken.
Ich konnte es Bill nicht wirklich übel nehmen, dass er vor Peggy Taxman Reißaus nahm. Peggy war eine respekteinflößende Frau, eine handfeste Person, eine Macherin, die Finch stimmgewaltig und mit eiserner Hand regierte. Sie betrieb das Postamt, das Emporium – ein kleines Warenhaus oder größerer Gemischtwarenladen – und den Gemüseladen. Außerdem hatte sie die unangenehme Angewohnheit, »Freiwillige« für die verschiedenen Komitees zu rekrutieren, denen sie ohne Ausnahme vorstand. Ohne sie würde das Dorfleben unweigerlich zum Stillstand kommen, und doch konnte niemand leugnen, dass sie übereifrig, selbstherrlich, herrisch und, offen gesagt, angsteinflößend war. Sobald Peggy Taxmans majestätischer Busen und ihre strassbesetzte Brille in Sicht kamen, nahmen die meisten Männer – und auch zahlreiche Frauen – die Beine unter die Arme.
»Hallo, Peggy«, sagte ich strahlend und neigte mich ein wenig zur Seite, um auch den unscheinbaren Mann einzubeziehen, den sie im Schlepptau hatte. »Schön, dass du deinen Mann mitgebracht hast. Schön, dich zu sehen, Jasper. Ich freue mich, dass ihr beide kommen konntet.«
Jasper murmelte etwas Unverständliches, doch Peggy machte seine Zurückhaltung wett, indem sie losdonnerte: »Natürlich sind wir gekommen! Das hätten wir uns um nichts in der Welt entgehen lassen! Was ich von einer gewissen gemeinsamen Freundin von uns nicht sagen kann, die durch Abwesenheit glänzt.«
»Das ist mir auch aufgefallen«, sagte Millicent Scroggins, die wie aus dem Nichts neben Peggy erschienen war. »Ich habe sie jedenfalls noch nicht gesehen.«
»Ich auch nicht«, sagte Charles Bellingham, der hinter Millicent hervortrat.
Im Nu hatte sich ein Kreis Einheimischer um uns herum gebildet – Finchs spezielle Ausprägung von Magnetismus –, und schon nahm die Unterhaltung Fahrt auf.
»Wir versuchen gerade, ein faszinierendes Geheimnis zu lüften«, erklärte Charles den Neuhinzugekommenen. »Wo ist La Señora?«
Seit Sally Pyne im Juni eine Reise nach Mexiko gemacht hatte, hieß sie im Dorf nur noch La Señora. Sally hatte den zehntägigen All-inclusive-Urlaub bei einem Preisrätsel in einem Reisemagazin gewonnen. Ihre Nachbarn und Freunde hätten sich wahrscheinlich für sie gefreut, hätte sie diese nach ihrer Rückkehr nicht wochenlang mit ihren Abenteuergeschichten zu Tode gelangweilt. Wenn man ihren Erzählungen Glauben schenken wollte, war sie in einer Lagune Kajak gefahren, war in einem unterirdischen Fluss geschwommen, hatte an einer Seilrutsche ein Schluckloch überquert, beim Schnorcheln in der Nähe eines Korallenriffs einen Stachelrochen gestreichelt und die höchste Maya-Pyramide der Welt erklommen. Das Problem war, dass niemand ihr auch nur ein einziges Wort glaubte. Sally war zweifellos eine ausgezeichnete Konditorin und sie war eine Meisterin der Gerüchteküche, aber eine Athletin war sie gewiss nicht.
»Nie im Leben hätte ich gedacht, dass sich La Señora ein Fest wie dieses entgehen lässt«, sagte Charles Bellingham, der sich ein Glas Champagner von einem vorbeikommenden Tablett schnappte. »Vielleicht hättet ihr lieber Tequila ausschenken sollen, Lori.«
»Und eine Mariachi-Band anheuern«, warf Grant Tavistock ein. »Kammermusik ist ihr nach allem, was sie erlebt hat, jetzt wahrscheinlich zu harmlos.«
»Vielleicht trainiert sie ja für die Olympischen Spiele«, steuerte Christine Peacock bei, indem sie die Augen rollte.
»Oder für die Besteigung des Everest«, mutmaßte Dick Peacock.
»Oder für die Kanaldurchschwimmung.« Dieser Vorschlag kam von Elspeth Binney.
»Ich würde eher auf eine Raketenfahrt zum Mond tippen«, sagte Selena Buxton kichernd.
»Und ich vermute, sie ist krank«, sagte Mr Barlow, der freundliche Allround-Handwerker des Ortes. »Andernfalls hätte nichts sie davon abbringen können, hier zu sein.«
»Glauben Sie, es könnte etwas ... Tropisches sein?«, fragte George Wetherhead besorgt. Der schüchterne Modelleisenbahn-Liebhaber hatte bekanntermaßen eine schwache Konstitution.
»Vielleicht Malaria?«, fragte Opal Taylor hoffnungsvoll. Opal hatte Sally immer noch nicht verziehen, dass ihre Kuchen beim Sommerkuchenbasar mehr Anklang gefunden hatten als ihre eigenen. »Oder Cholera?«
»Könnte auch Dengue-Fieber sein«, meinte Grant Tavistock. »Charles und ich haben letzte Woche einen Artikel darüber gelesen. Eine grauenhafte Krankheit. Ein Stich von einem infizierten Moskito, und das war’s. Es gibt keine Behandlung«, schloss er düster.
»Keine Be-be-hand-lung?«, stammelte George Wetherhead mit Augen groß wie Untertassen.
»Wahrscheinlich ist es Montezumas Rache«, sagte Mr Barlow. »Sally hat da drüben jede Menge komisches Zeug gegessen – Tacos und Tamale und so was. Da musste es sie ja früher oder später erwischen.«
»Halt, halt!«, sagte ich und hob die Stimme, um mir in der allgemeinen Aufregung Gehör zu verschaffen. »Ich kann euch sagen, warum Sally nicht hier ist. Sie hat mich heute Nachmittag angerufen, um mir mitzuteilen, dass sie nicht zur Party kommen kann, weil sie Halsweh, Husten und Schnupfen hat. Sie hat eine Sommererkältung, mehr nicht, und ich bin ihr dankbar, dass sie so rücksichtsvoll ist und darauf verzichtet hat, Williams Gäste anzustecken.«
»Eine Erkältung?«, murmelten meine Zuhörer enttäuscht im Chor.
»Die arme alte Sally.« Christine schüttelte den Kopf.
»Nur gut, dass ihre Enkelin zu Besuch ist«, sagte Dick. »Das Mädchen ist auf Trab. Rainey wird die Teestube schon schmeißen, bis Sally wieder auf dem Damm ist.«
»Ich werde morgen bei ihr vorbeischauen und sehen, ob Rainey Hilfe braucht«, sagte Mr Barlow.
»Und ich werde einen schleimigen Tee aus Ulmenrinde für Sally aufbrühen«, verkündete Miranda. »Das lindert die Halsschmerzen.«
Meine prosaische Lösung des vermeintlich faszinierenden Geheimnisses hatte jedermann den Wind aus den Segeln genommen. Sie tauschten noch ein paar Vorschläge aus, wie man Sally am besten helfen konnte, und zerstreuten sich dann. Erneut fand ich mich mit den Taxmans allein wieder. Peggy, die während der Diskussion ungewöhnlich still gewesen war, wartete, bis die anderen außer Hörweite waren, ehe sie ein spöttisches Schnauben ausstieß.