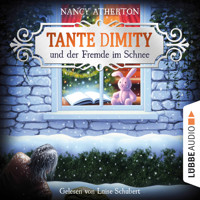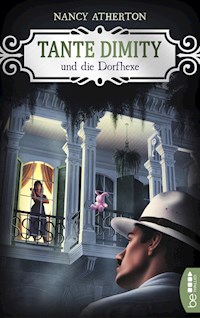5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wohlfühlkrimi mit Lori Shepherd
- Sprache: Deutsch
Lori Shepherd und ihren Zwillingen fällt die Decke auf den Kopf. Das Cottage ist eingeschneit, die Schule ist geschlossen. Ein Ausflug nach Skeaping Manor ist da genau das Richtige, um sich die Zeit zu vertreiben. In dem alten Gutshaus, das als Museum mit einer außergewöhnlichen Kuriositätensammlung dient, begegnet Lori einem kleinen Mädchen, das von einem silbernen Schlitten fasziniert ist und ihr eine seltsame Geschichte erzählt. Kurze Zeit später sind Daisy und der Schlitten spurlos verschwunden. Lori begibt sich mit Tante Dimitys Hilfe aus dem Jenseits auf die Suche und stößt dabei auf ein noch größeres Rätsel: die Geschichte des verschwundenen Prinzen ...
Ein märchenhafter Wohlfühlkrimi mit Tante Dimity. Jetzt als eBook bei beTHRILLED.
Versüßen Sie sich die Lektüre mit Tante Dimitys Geheimrezepten! In diesem Band: Mama Markovs russische Teekuchen.
"Kein anderer Krimi ist so liebenswert wie ein Tante-Dimity-Abenteuer!" (Kirkus Reviews)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Epilog
Mama Markovs russische Teekuchen
Über dieses Buch
Lori Shepherd und ihren Zwillingen fällt die Decke auf den Kopf. Das Cottage ist eingeschneit, die Schule ist geschlossen. Ein Ausflug nach Skeaping Manor ist da genau das Richtige, um sich die Zeit zu vertreiben. In dem alten Gutshaus, das als Museum mit einer außergewöhnlichen Kuriositätensammlung dient, begegnet Lori einem kleinen Mädchen, das von einem silbernen Schlitten fasziniert ist und ihr eine seltsame Geschichte erzählt. Kurze Zeit später sind Daisy und der Schlitten spurlos verschwunden. Lori begibt sich mit Tante Dimitys Hilfe aus dem Jenseits auf die Suche und stößt dabei auf ein noch größeres Rätsel: die Geschichte des verschwundenen Prinzen …
Über die Autorin
Nancy Atherton ist die Autorin der beliebten »Tante Dimity« Reihe, die inzwischen über 20 Bände umfasst. Geboren und aufgewachsen in Chicago, reiste sie nach der Schule lange durch Europa, wo sie ihre Liebe zu England entdeckte. Nach langjährigem Nomadendasein lebt Nancy Atherton heute mit ihrer Familie in Colorado Springs.
NANCY ATHERTON
Aus dem Amerikanischen von Monika Köpfer
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen.
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Jeannine Schmelzer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Alvaro Cabrera Jimenez | Montreeboy
Illustration: © Ommo Wille
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3509-5
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Aunt Dimity and the Lost Prince« bei Penguin Books, New York.
Copyright © der Originalausgabe 2013 by Nancy T. Atherton
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2013
by RM Buch und Medien Vertrieb GmbH
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Harveys Buschfeuerwehrteamvom Great Basin Nationalpark,mit einem herzlichen Dankeschön
Kapitel 1
ES HEISST, DASS der Dichter T.S. Eliot, als er sein Poem Das wüste Land schrieb, zunächst den Februar als trostlosesten Monat gewählt habe, um ihn dann in der überarbeiteten Fassung gegen den April auszutauschen. Wenn Sie mich fragen, lag er beim ersten Entwurf richtig. Für mich ist die einzige versöhnliche Eigenschaft des Februars seine Kürze. Wäre er auch nur einen Tag länger, würde ich ihn aus Protest aus meinem Kalender streichen.
Und die Schaltjahre? Verschonen Sie mich mit den Schaltjahren. Ich vermute, sie haben irgendeinen sinnvollen Zweck, aber wenn man schon in gewissen Abständen einen zusätzlichen Tag in den Kalender einfügen muss, warum nicht im Juli? Oder im August? Oder im September? Warum muss man den trübseligsten Monat des Jahres verlängern, wo doch sehr viel angenehmere Monate zur Auswahl stehen? Schaltjahre, dessen bin ich überzeugt, wurden nur erfunden, um mich zu quälen.
Der Januar ist nicht so schlimm. Im Januar können wir nach der Hektik der Feiertage zur wohltuenden Routine des Alltags zurückkehren. Der Weihnachtsbaum wurde bis dahin gemulcht oder im Garten gepflanzt oder zu einem Futterhäuschen verarbeitet. Die Lichterketten und der Baumschmuck sind auf dem Speicher verstaut. Im Wohnzimmer gibt es wieder genügend Platz, das Esszimmer ist wieder ordentlich aufgeräumt, in der Küche sieht es nicht mehr aus, als hätte der Blitz eingeschlagen. Jetzt, da man keine Weihnachtsgeschenke mehr einkaufen, Grußkarten schreiben, Plätzchen backen, Krippen bauen, keine Kirche dekorieren und kein Krippenspiel proben muss, verfügt man endlich wieder über seine Zeit. Die Erwachsenen gehen wieder zur Arbeit, die Kinder sind wieder in der Schule, und das Leben nimmt wieder seinen regelmäßigen Lauf wie das gut geölte Uhrwerk einer alten Standuhr.
Doch am ersten Februar hat sich der Neuigkeitseffekt der Alltagsroutine bereits wieder abgenutzt. Weihnachten ist nur noch eine entfernte Erinnerung, und vom Frühling ist noch nicht einmal ein Schimmer am Horizont auszumachen. Es fühlt sich an, als wäre schon immer Winter gewesen und als würde er bis in alle Ewigkeiten dauern – öder, kalter, grauer, trostloser Winter –, ohne die geringste Hoffnung, dass es je besser werden könnte. Wenn man doch nur in Neuseeland wohnte, dann würde man den zweiten Monat des Jahres als den Höhepunkt der Sommermonate betrachten, aber ich lebte nun einmal in England, und so war der Februar für mich das Stück Kohle im Weihnachtsstrumpf.
Und doch war es objektiv gesehen undankbar von mir, herumzugrummeln, nur weil ein weiterer Februar nahte, hatte ich doch eigentlich allen Grund, mit meinem Leben zufrieden zu sein. Ich war mit einem wunderbaren Mann verheiratet, hatte zwei wunderbare Kinder, und wir lebten in einem hübschen honigfarbenen Steincottage in den Cotswolds, einer ländlichen Gegend in den englischen West Midlands.
Der nächste zivilisatorische Knotenpunkt war Finch, ein winziges Dorf, umgeben von sanften Hügeln und einem Flickenteppich aus Feldern, und dann kam lange nichts mehr. Verkehrsstaus kannte man in Finch nicht, herumliegender Abfall hatte Seltenheitswert, und Kriminalität war so gut wie nicht existent. Das Leben der Dorfbewohner drehte sich um die dörflichen Ereignisse und einen unaufhörlichen Reigen aus köstlichem Klatsch und Tratsch. Eine Frau, die sich für etwas Besseres hielt, hätte dem Dorftratsch die kalte Schulter gezeigt, aber ich hielt mich nicht für etwas Besseres. Ich war der festen Überzeugung, dass neugierige Nachbarn gleichgültigen vorzuziehen seien, und verhielt mich auch nach dieser Maxime.
Mein Mann und ich waren zwar Amerikaner, lebten aber fast schon seit einem Jahrzehnt glücklich und zufrieden in England, und unsere achtjährigen Söhne hatten nie woanders gelebt. Von seinem Büro am Dorfanger leitete Bill den europäischen Zweig der altehrwürdigen Anwaltskanzlei, die sich seit jeher in Familienhand befand. Will und Rob besuchten die Morningside School in dem nahe gelegenen Marktflecken Upper Deeping, und ich tat mein Bestes, um meinen vielfältigen Rollen als Ehefrau, Mutter, Nachbarin, Freundin, freiwillige Helferin bei Gemeindeveranstaltungen, Klatschbase in Ausbildung und Leiterin des Westwood Trusts gerecht zu werden. Letzteres war eine Non-Profit-Organisation, die soziale Projekte unterstützte.
Stanley, der bei uns im Cottage wohnte, tat kaum mehr, als zu fressen, zu schlafen, herumzutollen oder elegante Posen einzunehmen, doch da er vier Pfoten und einen Schwanz hatte, wurde auch nicht mehr von ihm erwartet. Stanley war ein Kater mit glänzendem schwarzem Fell und löwenzahngelben Augen. Er hing mit hündischer Ergebenheit an Bill.
Der Rest von uns war indessen Bills Vater ergeben, William Arthur Willis senior, einem weißhaarigen Witwer mit einer Leidenschaft für Orchideen, antiquarische Bücher und ausgedehnte Wanderungen in der freien Natur. Willis senior, der Inbegriff eines altmodischen Gentlemans, war ebenso weise wie freundlich und vernarrt in seine beiden Enkel. Als er die Leitung der familieneigenen Anwaltskanzlei aufgab, um nach Fairworth House zu ziehen, in ein prächtiges georgianisches Herrenhaus unweit unseres Cottages, war unsere Familie komplett.
Kurz und gut, mein Leben war alles in allem von Glück und Zufriedenheit gesegnet, und ich hatte wahrlich keinen Grund, herumzujammern, nur weil Februar war. Doch als mein Mann dringend zu einem Mandanten nach Mallorca gerufen wurde, konnte ich nicht anders, als mein Schicksal zu beklagen.
Dabei war ich es eigentlich gewohnt, dass Bills Beruf seine häufige Abwesenheit von zu Hause erforderte. Als Anwalt war er auf Erbrecht und Vermögensverwaltung spezialisiert und betreute eine internationale Klientel, und ich konnte es ihm wohl kaum verübeln, dass er einfach seinen Job machte. Ich konnte ihm allerdings sehr wohl verübeln – und zwar bitterlich –, dass er auf einer blumenübersäten Mittelmeerinsel in der Sonne badete, während ich in einem Cottage mit zwei gelangweilten, schlecht gelaunten kleinen Jungen festsaß.
Der Fairness halber muss ich einräumen, dass Will und Rob nur selten gelangweilt und schlechter Laune waren. Als eineiige Zwillinge hatte jeder von ihnen einen angeborenen Spielkameraden, und an Fantasie – schließlich waren sie meine Sprösslinge – mangelte es ihnen auch nicht. Unter normalen Umständen waren meine Söhne fröhlich, energiegeladen und absolut imstande, sich selbst zu beschäftigen. Im Winter konnte ich mich darauf verlassen, dass sie die ihnen verbleibende Freizeit nach der Schule auf der Wiese hinter unserem Garten verbrachten, wo sie Schlitten fuhren, Schneeballschlachten veranstalteten und alle möglichen Schneebauten anfertigten; von Schneefestungen bis zu Schneedrachen.
Samstags fuhr ich sie regelmäßig zu dem nahe gelegenen Anscombe Manor, wo sie ihrer wahren Leidenschaft frönen konnten: dem Reiten. Nichts auf der Welt, einschließlich meiner Haferflockenplätzchen oder Bills naturgetreuer Nachahmung eines Tyrannosaurus Rex, konnte es mit ihrer Lieblingsbeschäftigung aufnehmen, nämlich auf ihren grauen Ponys Thunder und Storm über Stock und Stein zu galoppieren.
An den Sonntagen ging es zuerst in die Kirche, dann nach Fairworth House, wo Will und Rob nach Herzenslust Verstecken spielen, den weitläufigen Speicher erkunden und ihre Geschicklichkeit beim Stoßen von Kugeln am Billardtisch ihres Großvaters testen konnten. Hin und wieder, wenn uns der Sinn danach stand, unternahmen wir nach dem Mittagessen einen Familienausflug zu einer der örtlichen Freizeitattraktionen. Kurz und gut, meine Söhne konnten sich also nicht beklagen, dass ihr Leben öde, trostlos und beschränkt sei.
Doch jetzt hatte uns der Fluch des Februars ereilt, und ich musste hilflos zusehen, wie unsere sonst so angenehme Alltagsroutine zerbröselte. Bills Abreise fiel zeitlich mit dem Eintreffen einer Kaltfront zusammen, die von der Nordsee hereinbrach und unsere Region mit grimmigem Frost überzog, vor dem die Zentralheizung der Morningside School hilflos kapitulierte. Die Rektorin der Schule rief mich am Sonntagabend an, um mich zu informieren, dass der Unterricht für mindestens eine Woche ausfallen müsse, da die benötigten Ersatzteile, um den Heizkessel zu reparieren, irgendwo in einem im Schnee versinkenden Warenlager in Helsinki begraben waren.
Will und Rob gingen zwar gern zur Schule, fanden aber bald Gefallen an den Vorzügen ungeplanter Ferien. Da eisige Winde sie davon abhielten, draußen zu spielen, ersannen sie neue und kreative Wege, um Dampf abzulassen. Über Nacht wurden sämtliche Stühle im Cottage zu Trampolinen und sämtliche Tische zu Abschussrampen. Bald war der Boden bis auf den letzten Quadratzentimeter bedeckt mit Eisenbahnschienen, Rennautos, Bauklötzen, Dinosauriern und Stofftieren und was sie sonst noch alles aus ihren Spielzeugkisten hervorzerrten und verstreuten, sodass sich das Haus in einen einzigen Hindernisparcours verwandelte. Um sich seiner Haut zu erwehren, zog sich Stanley ins Gästezimmer zurück, wo er sich unter dem Bett versteckte, um nur des Nachts hervorzukommen, wenn die Jungen fest schliefen und die Luft rein war.
Im Gegensatz zu Stanley konnte ich mich nirgendwo verstecken. Am Mittwoch verkündete ich den Ausnahmezustand und drohte meinen Söhnen mit schwerwiegenden Folgen, sollten sie sich weiterhin wie Barbaren gebärden. Daraufhin räumten sie gehorsam das Feld, um sich zivilisierteren Spielen zuzuwenden, aber Zeichnen und Lesen, Schreiben und dergleichen stille Beschäftigungen waren ein kläglicher Ersatz für das ausgelassene Herumtoben auf der Wiese hinterm Haus.
Der Möglichkeit beraubt, ihre aufgestaute Energie loszuwerden, verfielen die Zwillinge in trübselige Stimmung und wussten nichts mehr mit sich anzufangen. Wenn sie sich nicht gerade um Bleistifte, Bücher, Spielzeug oder bei Brettspielen zankten, saßen sie griesgrämig auf der Fensterbank im Wohnzimmer und pressten ihre identischen Nasen an die eisige Fensterscheibe, sehnsüchtig darauf wartend, aus ihrer Gefangenschaft entlassen zu werden. Und meine Nerven lagen blank von diesem Wechselbad der Gefühle: Hatte ich sie gerade noch zur Ruhe ermahnt, galt es, sie im nächsten Moment wieder aufzumuntern.
Ich fuhr zu Willis senior, um seinen Beistand zu erbitten, doch er hatte sich eine grimmige Erkältung zugezogen, und seine Haushälterin, eine fürsorgliche und äußerst fähige junge Frau namens Deirdre Donovan, versperrte allen Besuchern die Tür. Als ich seine heisere Stimme hörte, sah ich ein, dass Ruhe und Frieden wohl die beste Medizin für ihn waren, und verwarf meinen Plan wieder, die Jungs in Fairworth House abzusetzen, damit sie sich austoben konnten.
Die Keime, die Willis zu schaffen machten, hatten sich offenbar in der ganzen Gegend verbreitet, denn auch sämtliche Schulfreunde der Zwillinge waren krank. Zwar boten mir ein paar Mütter, die sich offenbar ebenfalls von ihren Kindern belagert fühlten, an, ihre Sprösslinge zum Spielen bei mir abzuladen, aber ich lehnte jedes Mal höflich ab, als ich das Schniefen des Nachwuchses im Hintergrund vernahm. Man konnte es mir wohl kaum verübeln, dass ich Will und Rob vor diesem hartnäckigen Virus schützen wollte.
Während unsere Ausweichmöglichkeiten zusehends schrumpften, schien sich das Cottage um uns herum zusammenzuziehen und mit jeder zankgefüllten Stunde kleiner und enger zu werden. Einen flüchtigen Moment lang erwog ich, auf der Wiese hinter dem Haus ein Freizeitzentrum errichten zu lassen – ausgestattet mit Schwimmbad, einem Cricketfeld, Reitplatz und Klettergerüsten, so weit das Auge reichte. Der Plan erschien mir völlig einleuchtend, doch da ich ahnte, dass Bill ein Wörtchen mitreden wollte, legte ich ihn fürs Erste ad acta und kehrte ins Wohnzimmer zurück, um zwischen den Piraten, die das Sofa gestürmt hatten, Frieden zu stiften.
Am Freitagmorgen hatte mein mütterliches Waffenarsenal nur noch eine einzige Waffe übrig: das Versprechen, dass sie den ganzen Samstag im Reitstall verbringen dürften. Ich zückte meinen Trumpf beim Frühstück, indem ich meine Söhne daran erinnerte, dass wir in weniger als vierundzwanzig Stunden bereits auf dem Weg zum Anscombe Riding Center wären, wo sie einen Tag lang auf ihre Kosten kämen. Auch wenn die eisige Kälte sie davon abhalten sollte, ihre Ponys zu reiten, erklärte ich ihnen, hätten sie ausgiebig Gelegenheit, ihr Zaumzeug zu putzen, auf Heuballen herumzuklettern, mit ihren Reiterfreunden zu fachsimpeln und Thunder und Storm zu striegeln.
Meine aufmunternden Worte wirkten Wunder. Will und Rob hüpften fröhlich in den ersten Stock hinauf, um Dame zu spielen, während ich den Großteil des Morgens sang und lächelte und Plätzchen für die Jungen backte, die sie in den Reitstall mitnehmen und mit ihren Kumpels teilen konnten. Unbekümmert setzte ich mich über die Tücken des Februars hinweg, bis das Läuten des Telefons mich erstarren ließ und eine Ahnung drohenden Unheils mir einen kalten Schauder über den Rücken jagte.
»Lori?« Die Stimme am anderen Ende der Leitung gehörte Emma Harris, meiner besten Freundin und Besitzerin des Reitstalls. »Ich muss dir leider sagen ...«
Ich stöhnte innerlich und machte mich auf schlimme Nachrichten gefasst.
»... dass der Reitstall auf absehbare Zeit geschlossen sein wird«, fuhr Emma fort.
»Der Reitstall?«, wiederholte ich dumpf. »Geschlossen?« Ich warf einen gehetzten Blick auf den Wandkalender, sank auf einen Küchenstuhl und legte erschöpft die Hand an die Stirn. »Wie kannst du mir das antun, Emma? Will und Rob wissen seit einer geschlagenen Woche nicht, wohin mit ihrer Energie. Sie brauchen dringen ihre Ponys. Kannst du dir auch nur entfernt vorstellen, was passiert, wenn ich ihnen sage, sie können morgen nicht in den Reitstall?« Ich bedeckte meine Augen mit der Hand und seufzte inbrünstig. »Weißt du, was das für mich auf absehbare Zeit bedeutet?«
»Tut mir leid, wenn ich dir Unannehmlichkeiten bereite, Lori«, sagte Emma schroff, »aber wir haben es ebenfalls mit einer Reihe von Unannehmlichkeiten zu tun. Die Wasserleitungen, die zu den Stallungen führen, sind eingefroren, eine ist sogar geplatzt. Derek und seine Leute tun ihr Bestes, aber der Hof vor den Ställen ist zurzeit eine einzige Eisbahn.«
Derek Harris war Emmas Mann. Als Gebäuderestaurator war er mit den nötigen Werkzeugen, Fertigkeiten und dem Personal ausgestattet, um mit jedem erdenklichen Notfall fertigzuwerden, der in einem Haushalt auftreten konnte. Wenn Derek nicht in der Lage war, die beschädigten Wasserleitungen umgehend zu reparieren oder zu ersetzen, wäre es auch niemand anderes.
»Es ist der Fluch«, murmelte ich.
»Oh Lori«, sage Emma ungeduldig. »Stimmst du schon wieder dein Klagelied über den Februar an?«
»Welchen Monat haben wir, meine Liebe?«, erwiderte ich. »Und was ist mit euren Wasserleitungen passiert?«
»Reiner Zufall«, antwortete Emma. »Im Winter gibt es nun einmal gelegentlich einen Kälteeinbruch. Mit einem Fluch hat das nichts zu tun.«
»Und was ist mit dem kaputten Heizkessel in der Schule und der grassierenden Erkältungswelle?«
»Zufall«, sagte Emma leichthin.
»Das sagst du«, grummelte ich, doch im selben Moment kam mir der Gedanke, dass meine Reaktion vielleicht nicht ganz angemessen war angesichts der Notlage, in der sich meine beste Freundin befand. Mit heroischer Anstrengung schob ich meine eigenen Schwierigkeiten beiseite und konzentrierte mich auf die Emmas. »Du armes Ding. Kann ich dir irgendwie helfen? Wie wär’s mit einer heißen Suppe? Oder warmen Betten? Oder einer Wagenladung voll Fackeln? Sag mir, was du brauchst, und ich werde es dir bringen.«
Emma gluckste am anderen Ende der Leitung. »Danke, Lori, aber wir kommen zurecht. Aber wie gesagt, wir haben alle Hände voll zu tun, und es wird einige Zeit dauern, bis alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Die Ställe sind Gott sei Dank höher gelegen und trocken, sodass wir die Pferde nicht woanders unterbringen müssen.«
»Apropos Pferde – geht es ihnen gut?«, fragte ich.
»In dem Lärm und der Hektik sind sie natürlich ein bisschen unruhig geworden«, erwiderte Emma, »aber sie werden sich schon daran gewöhnen. Sag Will und Rob, sie brauchen sich wegen ihrer Ponys keine Sorgen zu machen. Wir kümmern uns um sie.«
»Das wissen sie genauso gut wie ich. Na gut, ich vermute mal, du bist voll und ganz mit dem Notfallmanagement beschäftigt, Emma, also will ich dich nicht länger aufhalten. Falls du etwas brauchst, du weißt ja, wen du anrufen kannst, bei Tag und bei Nacht.«
»Kein Sorge, deine Nummer steht in meinem Kurzwahlverzeichnis«, sagte Emma und beendete das Gespräch.
Ich legte den Hörer auf die Gabel zurück und suchte im Geiste fieberhaft nach einer alternativen Beschäftigung, die zwei zutiefst enttäuschte siebenjährige Jungs besänftigen könnte. Aber zum ersten Mal ließ meine Fantasie mich im Stich. Mir fiel rein gar nichts ein, was Will und Rob für einen pferdefreien Samstag hätte entschädigen können. Wie gelähmt saß ich am Küchentisch und zerbrach mir den Kopf, unfähig, mich dazu durchzuringen, meinen nichtsahnenden Söhnen die desaströse Nachricht zu überbringen. Ich verharrte noch immer in diesem Zustand geistiger und körperlicher Lähmung, als plötzlich die Türklingel ertönte.
In der Hoffnung, ein Zauberer oder Akrobat oder ein Trupp jonglierender Schimpansen stünde vor meiner Tür, sprang ich auf und hetzte den Flur entlang in Richtung Haustür. Doch was ich auf meiner Schwelle vorfand, war noch erstaunlicher als ein Wanderzirkus auf der Durchreise.
Als ich die Tür aufriss, erblickte ich lodernde Flammen.
Kapitel 2
WEDER SCHRIE ICH, noch packte ich den Feuerlöscher oder rannte nach oben, um Will und Rob zu retten, denn bei näherem Hinsehen entpuppten sich die vermeintlichen Flammen als die kurzen, feuerroten stachligen Locken der neunzehnjährigen Bree Pym, einer Dorfbewohnerin, die unweit unseres Cottages wohnte.
»Menschenskind«, sagte ich. »Was hast du mit deinem Haar gemacht?«
»Gefällt es dir?« Bree drehte den Kopf nach rechts und nach links, um ihren spektakulären neuen Look vorzuführen.
»Sieht aus, als würde dein Kopf in Flammen stehen«, sagte ich.
»Großartig«, erwiderte sie strahlend. »Genau das war meine Absicht. Ich nenne die Frisur meinen mobilen Ofen. Es gibt nichts Besseres als rotes Haar, um dieser Eiseskälte die Stirn zu bieten.«
Ich lachte. In Brees Gegenwart konnte ich nie ernst bleiben. Sie brachte frischen Wind in unser Dorf und bewahrte den Rest von uns davor, in Langeweile zu versinken.
Aubrey Aroha Pym, von allen nur Bree genannt, stammte aus Neuseeland. Sie hatte ein charmantes altes Haus und ein ansehnliches Vermögen von ihren Großtanten geerbt, den verstorbenen und allseits betrauerten Ruth und Louise Pym, die am Dorfrand von Finch gelebt hatten. Obwohl Bree inzwischen schon seit mehr als einem Jahr im Haus ihrer Großtanten wohnte, fand eine Handvoll Dorfbewohner sie noch immer ziemlich befremdlich. Sie waren es einfach nicht gewohnt, die Kirchenbank mit einer vor Energie sprühenden jungen Ausländerin zu teilen, die nicht nur zahlreiche Tatoos zur Schau trug, sondern auch einen glitzernden Ring im Nasenflügel. Wenn sie nun obendrein am kommenden Sonntag mit flammend rotem Haar in die Kirche hineinspazierte, würden sie wahrscheinlich vor Schreck in Ohnmacht fallen.
»Es ist ... atemberaubend«, sagte ich, und das war nicht gelogen. Ich zwang mich, den Blick kurz von ihrem Kopf abzuwenden, hin zu dem kleinen Koffer in ihrer Hand. »Gehst du weg?«
»Ja. Hierhin, so hoffe ich wenigstens. Falls du barmherzig mit mir bist.«
»Du willst bei uns wohnen?«, sagte ich und spürte, wie sich mein Herzschlag beschleunigte.
»Wenn du mich aufnimmst«, erwiderte sie vorsichtig.
»Ob ich dich aufnehme?« Ich trat einen Schritt vor und umarmte sie. »Natürlich nehme ich dich auf! Meine Gebete wurden erhört, du bist meine Rettung!«
Bree ließ sich von mir in den Flur ziehen und machte dabei einen reichlich verwirrten Eindruck. Sie stellte ihren Koffer auf den Boden, hängte ihre bauschige schwarze Jacke an die Garderobe und streifte sich ihre rosa gepunkteten Snowboots von den Füßen, sodass sie in ihren violetten Wollsocken dastand.
»Sehe ich es richtig, dass ich den passenden Moment gewählt habe, um bei dir hereinzuplatzen?«, fragte sie, während sie den Schnee von ihrer Jeans wischte.
»Dein Timing hätte nicht besser sein können. Komm mit in die Küche. Ich erkläre dir alles bei einer Kanne Tee und einem Teller mit frischgebackenen Plätzchen.«
Bree folgte mir durch den Flur, setzte sich an den Küchentisch und nahm sich ein Plätzchen, während wir auf das Pfeifen des Wasserkessels warteten.
»Mhm«, machte sie und leckt genüsslich die Krümel von ihren Fingern. »Was sind das für Plätzchen?«
»Sie haben mehrere Namen«, erwiderte ich, während ich das Teegeschirr auf den Tisch stellte. »Aber meine Mutter nannte sie Pekannussbällchen. Hier.« Ich warf ihr eine Serviette zu. »Du hast Puderzucker am Kinn.«
»Den Preis zahl ich gerne«, sagte Bree und wischte sich das Kinn ab, während sie nach einem zweiten Pekannussbällchen langte.
Als der Tee fertig war, stellte ich die Kanne auf den Tisch und setzte mich auf den Platz gegenüber von Bree, verschränkte die Hände und sagte feierlich: »Du kommst gerade noch rechtzeitig, um mich und die Jungs vor akutem Lagerkoller zu bewahren.«
»Lagerkoller, ach ja.« Sie sah sich in der Küche um. »Und was ist mit Bill. Ist er immun dagegen?«
»Bill ist auf Mallorca«, sagte ich in bitterem Ton. Dann erzählte ich ihr in aller Ausführlichkeit die Ereignisse der zu Ende gehenden Woche. »Und da zu allem Überfluss auch noch der Reitstall geschlossen ist«, beendete ich meinen Bericht, »war ich völlig ratlos, wie die Jungen und ich das Wochenende überstehen sollten. Aber jetzt, da du da bist, bin ich meine Sorgen los.«
»Wie das?« Bree sah nun vollends verwirrt aus.
»Das fragst du noch?«, sagte ich. »Du bist weitaus interessanter als ein Zauberer, ein Akrobat und ein Trupp jonglierender Schimpansen zusammen. Wenn Will und Rob herausfinden, dass du hier bist, werden sie völlig aus dem Häuschen sein.«
»Also, ich weiß nicht«, sagte Bree zweifelnd. »Ich bin ein ziemlich lausiger Ersatz für Thunder und Storm.«
»Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Für die Jungs kommst du an Unterhaltungswert gleich hinter Heuballen.«
»Ich finde sie ja auch süß«, sagte Bree mit einem Augenzwinkern.
Sie steckte ein drittes Pekannussbällchen in den Mund und kaute nachdenklich, ehe sie hinzufügte: »Wahrscheinlich war es ein Wink des Schicksals. Zuerst wollte ich auf Peggy Taxmans Barmherzigkeit setzen, aber da sie keine hat, habe ich beschlossen, hierherzukommen.«
»Aber warum bist du überhaupt auf irgendjemandes Barmherzigkeit angewiesen?«, fragte ich.
»Weil ich ein Volltrottel bin«, erwiderte sie in sachlichem Ton. »Ich habe heute Morgen beschlossen, mein Schlafzimmer neu zu streichen.« Sie schüttelte den Kopf. »Das war keine gute Idee. Frische Farbe braucht frische Luft, aber wenn ich das Fenster aufmache, wird es meinen Wasserleitungen ebenso ergehen wie Emmas. Also werde ich auf wärmere Temperaturen warten müssen, bevor ich mein Haus ordentlich lüften kann. Und in der Zwischenzeit ...«
»In der Zwischenzeit wohnst du hier«, beendete ich ihren Satz.
»Danke.«
»Ich habe zu danken.« Ich schob den Teller mit den Plätzchen zu ihr hin und stand auf. »Iss noch ein Pekannussbällchen. Ich gehe inzwischen die Jungs holen.«
»Aber mach ihnen den Mund nicht allzu wässrig!«, rief Bree mir nach. »Mit jonglierenden Schimpansen kann ich nicht konkurrieren.«
Will und Rob sackten sichtlich zusammen, als ich ihnen vom vorübergehend geschlossenen Reitstall erzählte, lebten aber augenblicklich wieder auf, als sie sahen, wer am unteren Treppenabsatz auf sie wartete.
»Breeeeeee!«, riefen sie im Chor und polterten die Treppe hinab, und es fehlte nicht viel und sie hätten Bree mit ihren stürmischen Umarmungen umgerissen.
»Dürfen wir auch unsere Haare färben, Mami?«, fragte Will und trat ein wenig zurück, um Brees neue Frisur in Augenschein zu nehmen.
»Ich will blaue Haare«, verkündete Rob.
»Nein, ihr dürft euch die Haare nicht färben«, sagte ich streng, »aber ihr dürft Brees Gepäck ins Gästezimmer hochbringen.«
»Gästezimmer?«, sagte Will.
»Bleibst du bei uns?«, fragte Rob und sah Bree mit großen Augen an. »Über Nacht?«
»Die nächsten paar Tage, nehme ich an«, antwortete sie. »Wenn es euch recht ist.«
»Oh ja, das ist uns recht«, verkündete Will eifrig.
»Es ist uns mehr als recht«, sagte Rob und griff schnell nach Brees Handkoffer.
Der Rest des Tages verlief turbulent, aber glücklich. Bree war, wie sich herausstellte, Zauberin, Akrobatin und Jongleurin in einer Person. Während ich das Mittagessen zubereitete, brachte sie den Jungen einen Münztrick bei, den sie schließlich wie zwei ausgefuchste Profis beherrschten. Nach dem Mittagessen lehrte sie sie den Kopfstand mit in der Luft zu einem Dreieck verschränkten Beinen, nach Art der Yogis. Und während das Abendessen auf dem Herd köchelte, begann sie mit den Jonglierlektionen; statt Bälle benutzte sie jedoch Stofftiere, um den Möbelschaden so gering wie möglich zu halten. Ich spielte die Rolle des dankbaren Publikums und registrierte erleichtert, dass mein Gast genauso viel Spaß hatte wie Will und Rob.
Während des Abendessens schlug Bree für den folgenden Tag eine Therapie gegen unsere Klaustrophobie vor.
»Lasst uns morgen einen Ausflug machen, und zwar an einen sehr interessanten Ort«, sagte sie. »Ich wollte ihn eigentlich allein besuchen, aber mit euch macht es bestimmt mehr Spaß.«
»Was ist das denn für ein Ort?«, wollte Will wissen und schaute von seinem Kartoffelbrei auf.
»Ich dachte, wir könnten zum Skeaping Manor fahren«, erklärte Bree. »Ich bin sicher, ihr wart schon hundert Mal im Skeaping Manor, Will, aber ich war noch nie dort. Und da dachte ich, dass du und Rob es mir gern zeigen würdet.«
»Du irrst«, meldete ich mich zu Wort, »wir waren auch noch nie im Skeaping Manor. Ich habe zwar schon davon gehört, aber unsere Expeditionen scheinen uns irgendwie immer zum Cotswold Farm Park zu führen oder zum Cotswold Wildlife Park oder zu der Cotswold-Falknerei oder der Bibury-Forellenfarm oder dem Prinknash-Vogel- und Wildpark oder ...« Ich zuckte die Schultern. »Du verstehst schon. Die Jungs mögen nun mal Tiere.«
»Ich mag auch Tiere«, sagte Bree, »aber wenn man an einem kalten Wintertag ein Indoor-Abenteuer erleben möchte, ist Skeaping Manor genau der richtige Ort.«
»Es befindet sich doch in der Nähe von Upper Deeping, stimmt’s?«, fragte ich.
»Es liegt am Dorfrand von Skeaping«, erwiderte Bree, »ungefähr fünf Kilometer südlich von Upper Deeping. Laut Informationsbroschüre, die ich im Tourismusbüro entdeckt habe, ist Skeaping Manor« – sie legte den Kopf in den Nacken und sagte auswendig den Text der Broschüre auf – »ein Schatzhaus aus der jakobäischen Ära mit einer Kuriositätensammlung, die Sir Waverly Jephcott zusammengestellt hat, ein bekannter edwardianischer Arzt, Naturforscher, Archäologe, Anthropologe, Historiker und Philanthrop.«
»Was ist Skeaping Manor?«, fragte Rob mit verwirrter Miene. Offenbar hatte er kein Wort von Brees Beschreibung des Herrenhauses verstanden.
»Es ist ein Museum«, erklärte Bree, und bevor seine Mundwinkel vollends nach unten glitten, schickte sie schnell hinterher: »Aber es ist kein langweiliges, altes verstaubtes Museum. Man findet dort alle möglichen coolen Sachen.«
»Gibt es dort auch Dinosaurier?«, fragte Rob hoffnungsvoll.
»Also, in der Broschüre steht nichts von Dinosauriern«, erwiderte Bree kleinlaut, »dafür soll es dort aber Schrumpfköpfe geben.«
»Schrumpfköpfe, echt?«, wiederholte Will, dessen Miene sich sogleich erhellte.
»Und Skelette«, fuhr Bree in ihrer Aufzählung fort. »Und Mumien. Und Käfer. Und eine Axt.« Sie machte eine Pause und setzte in dramatischem Flüsterton hinzu: »Eine blutverschmierte Axt.«
»Können wir zum Skeaping Manor fahren, Mami, bitte?«, riefen die Jungen wie aus einem Munde und richteten ihre dunkelbraunen Augen auf mich.
Wären meine Kinder emotional sensibel gewesen oder hätten zu Albträumen geneigt, hätte ich die Idee sofort im Keim erstickt. Doch Bree wusste, dass es kaum etwas gab, was meine Söhne einschüchterte. Im Gegensatz zu ihrer Mutter fanden sie groteske Dinge faszinierend statt beängstigend. Gut möglich, dass sie in den folgenden Wochen Zeichnungen von Skeletten und Schrumpfköpfen anfertigen würden, ohne dass sie im Schlaf davon verfolgt würden.
»Können wir, Mami?«, fragte Rob.
»Bitte?«, sagte Will.
»Im Winter ist Skeaping Manor nur an drei Tagen in der Woche geöffnet«, warf Bree ein. »Donnerstag, Freitag und Samstag. Wenn wir morgen nicht gehen, schaffen wir’s vielleicht nicht mehr, solange ich bei euch wohne.«
»Bitte!?«, flehten die Jungen im Chor.
»Gut, dann lasst uns morgen fahren«, sagte ich, weil ich wusste, dass ich ohnehin keine Chance hatte. »Unter der Bedingung, dass ...«
»Wir räumen den Tisch ab«, sagte Will.
»Und die Geschirrspülmaschine ein«, fügte Rob hinzu.
»Und spielen brav, bis wir ins Bett müssen«, sagte Will.
»Und gehen ohne zu murren ins Bett«, erklärte Rob.
»Und wir sind im Auto auch ganz brav, versprochen«, schloss Will.
»Wie schnell meine Söhne lernen«, sagte ich lachend.
Die Jungen versuchten höflich, aber hartnäckig, Bree noch weitere Informationen abzuluchsen, aber sie weigerte sich, mehr preiszugeben.
»Wenn ich euch zu viel erzähle, ist der Überraschungseffekt dahin«, sagte sie. »Und Skeaping Manor ist voller Überraschungen.«
Bree muss an den unstillbaren Durst meiner Söhne nach allen möglichen grausigen Dingen gedacht haben, als sie diese verhängnisvollen Worte sprach. Sie konnte ja nicht wissen, dass die größte Überraschung in einem kostbaren Ausstellungsstück von unbeschreiblicher Schönheit bestehen würde.
Kapitel 3
AM SAMSTAGMORGEN STIEG die Temperatur bis knapp unter den Gefrierpunkt, und der grimmige Wind verwandelte sich in eine nicht ganz so grimmige Brise. Bree, die verkündete, es herrsche milde Witterung, hatte sich für leichte Kleidung entschieden – schwarzer Rollkragenpullover, Jeans und ihre gepunkteten Snowboots. Dazu ihre bauschige schwarze Jacke, auf Mütze und Handschuhe verzichtete sie jedoch.
Sie war aus härterem Holz geschnitzt als ich. Zwar räumte ich ein, dass sich das Wetter ein wenig gebessert hatte, konnte mich jedoch nicht dazu durchringen, es als mild zu bezeichnen. Nachdem ich die Truppe mit einem gehaltvollen Frühstück versorgt hatte, mummte ich die Jungen und mich bis zu den Augen ein und vergewisserte mich, dass Fäustlinge, Mützen, Schals und Winterstiefel fest an ihrem Platz saßen, ehe wir das Cottage verließen. Dann watschelten wir wie drei prall ausgestopfte Teddybären zu meinem kanariengelben Range Rover, während Bree beschwingt vor uns herhüpfte, leichtfüßig wie ein arktischer Hase.
Es war ein wunderschöner Tag – genau richtig für einen Ausflug aufs Land. Die Sonne schien hell vom strahlend blauen Himmel, die Hecken waren von glitzernden Schneekristallen überzogen, und die schneebedeckten Felder sahen so makellos aus wie frisch gemachte Betten. Während wir an der gewundenen Auffahrt zum Anscombe Riding Center vorbeifuhren, dann an Brees hübschem roten Backsteinhaus und schließlich dem schmiedeeisernen Tor, das an der Zufahrt von Fairworth House Wache hielt, lenkte Bree Will und Rob mit Silbenrätseln ab.
Auf dem höchsten Punkt der Buckelbrücke hielt ich den Wagen kurz an, um den Anblick von Finch in seiner winterlichen Pracht auf uns wirken zu lassen. Befreit von seinem überladenen Weihnachtsschmuck, wirkte es wie ein zum Leben erwachtes Pfefferkuchendorf. Aus jedem mit einer Schneemütze bedeckten Kamin kringelte sich Rauch, und hinter jeder vereisten Fensterscheibe wurde die Gardine zur Seite gezupft.
In Upper Deeping hingegen herrschte viel Verkehr und der Schnee war schmutzig, aber dafür herrschte dort ein lebendigeres Geschäftsleben und bot sich ein abwechslungsreicheres Bild als in dem beschaulichen Finch. Ich fuhr einen kleinen Umweg, um den Jungen die Freude zu machen, Bree ihre Schule zu zeigen, ehe ich der Hauptstraße in Richtung Süden folgte, wo nach wenigen Kilometern die Landstraße zum Dorf Skeaping abzweigte.
Bree machte als Erste das Schild aus, das uns den Weg zu unserem Zielort wies, und nach weiteren zehn Minuten auf einem gewundenen schmalen Sträßchen lotste uns ein zweites Schild auf den Parkplatz von Skeaping Manor. Wie in Brees Broschüre angekündigt, handelte es sich um ein für die jakobäische Epoche charakteristisches Fachwerkgebäude – drei Stockwerke hoch und versehen mit einer Vielzahl von Veranden, Erkern, Giebeln, Dachgauben und kleineren Anbauten. Wie zufällig hingegossen erstreckte es sich auf einer kleinen Anhöhe, die das Dorf überblickte, das größer als Finch wirkte, aber nicht minder verschlafen.
Das Herrenhaus besaß zahlreiche Fenster, aber alle schienen von schweren Vorhängen verdeckt oder großen Möbeln zugestellt zu sein. Die verdunkelten Fenster erweckten nicht gerade einen einladenden Eindruck; vielmehr gewann man den Eindruck, als handelte es sich bei dem Gebäude um eine Festung im Belagerungszustand. Ein überhängender und von massiven Eichenbalken gestützter Erker wölbte sich schützend über eine eisenbeschlagene Tür, die mit dem zweckdienlichen Hinweis HAUPTEINGANG versehen war.
»Also, ein Massenansturm herrscht hier ja nicht gerade«, bemerkte Bree, während ich den Rover zwischen einem zerbeulten alten blauen Ford Fiesta und einem glänzend roten Fiat parkte. »Nur vier Autos auf dem Parkplatz, und die gehören wahrscheinlich den Angestellten.«
»Vielleicht kommen wir in den Genuss einer privaten Führung«, sagte ich.
»In der Broschüre steht nichts von Führungen«, erwiderte Bree. »Im Übrigen sind Führungen was für Einfaltspinsel. Ich ziehe es vor, diesen Ort auf eigene Faust zu erkunden.«
»Ich auch«, stimmten Will und Rob prompt ein.
Ich meinte, eine Ahnung von Heldinnenverehrung in der Luft wahrzunehmen, und stellte mich darauf ein, die nächsten Stunden ziellos von einem abscheulichen Ausstellungsstück zum nächsten zu wandern.
»Ich würde es hassen, wenn ich die Heizrechnung des Museums bezahlen müsste«, bemerkte Bree, als wir aus dem Rover kletterten und mit knirschenden Schritten über den vereisten Weg auf die Eichentür zugingen. »Und das Dach neu zu decken, muss ein Vermögen kosten.«
»Du siehst die Dinge immer von der praktischen Seite«, sagte ich. »Stell dir lieber vor, wie wunderbar es wäre, so viele Räume für dich allein zu haben.«
»Aber man hätte sie ja nicht für sich allein«, entgegnete Bree. »Man bräuchte einen ganzen Trupp Bediensteter, um alles sauber zu halten.«
»Einen Trupp Bediensteter«, murmelte ich versonnen vor mich hin und rief mir die Körbe voller schmutziger Wäsche ins Gedächtnis, die im Cottage auf mich warteten. »Das hört sich gut an.«
Bree warf mir einen amüsierten und zugleich skeptischen Blick zu. Dann öffnete sie die Eichentür und betrat das Herrenhaus. Die Jungen schossen hinter ihr her, und ich folgte ihnen auf den Fersen, doch kaum hatten wir die Türschwelle hinter uns gelassen, hielten wir unsicher inne. Nach dem blendenden Sonnenlicht draußen, das von dem glitzernden Schnee noch verstärkt wurde, schien es in der Eingangshalle des Museums so düster wie in einer Höhle. Ich hatte das Gefühl, erblindet zu sein.
Ich zog die Jungen zu mir heran, damit sie nicht gegen Bree stießen, und verstärkte meinen Griff, als die schwere Eichentür hinter uns mit einem gedämpften Geräusch ins Schloss fiel.
»Willkommen im Skeaping Manor«, sagte eine Grabesstimme.
Ich schloss kurz die Augen, um sie an die Dunkelheit zu gewöhnen. Als ich sie wieder öffnete, sah ich, dass wir uns in einer fensterlosen, niedrigen Vorhalle befanden, deren dunkle Eichenwandvertäfelung vor Alter so schwarz war, dass sie wie verkohlt wirkte. Zu meiner Linken stand ein altmodischer Schaukelstuhl hinter einem wuchtigen Holzschreibtisch, und das Wandregal dahinter war gefüllt mit farbigen Broschüren von örtlichen Sehenswürdigkeiten. Direkt vor uns gab es eine mit kunstvollen Schnitzereien versehene Eichentür, die allem Anschein nach in die Ausstellungsräume führte.
Die Eingangshalle wurde notdürftig von einer grünen Bankierslampe und einem fleckigen Kristallleuchter an der Decke beleuchtet. Dieser warf ein gespenstisches Licht auf die Gestalt, die noch bemerkenswerter als die Einrichtung des Raums war: Vor uns stand ein großer, dünner, gut rasierter Gentleman, der von Kopf bis Fuß in edwardianischem Stil gekleidet war.
»Du meine Güte!«, rief Bree aus. »Der Geist von Sir Waverly Jephcott!«
»Cool«, meinten die Jungen unisono.
»Was für drollige Jungen, Madam«, sagte der Mann, indem er seine bestickte Weste glattstrich. »Ich fürchte jedoch, dass ich euch enttäuschen muss, denn ich bin kein Geist. Meine Kostümierung dient allein der Unterhaltung und Bildung für all jene, die sich für Sir Waverlys Epoche interessieren.« Er machte eine anmutige Verbeugung. »Ich heiße Miles Craven und bin der Museumsleiter und Verwalter von Skeaping Manor und ihnen zu Diensten. Darf ich Ihre Mäntel und Jacken in die Garderobe hängen?«
»Ja, danke«, sagte ich, erleichtert, dass ich mich nicht selbst um eine Aufbewahrungsmöglichkeit für die Anoraks meiner Jungen kümmern musste.
Wir reichten dem Museumsleiter unsere Jacken, Hüte, Schals und Fäustlinge, worauf dieser mit dem Kleiderberg in einer unsichtbaren Tür in der Wandtäfelung hinter dem Schreibtisch verschwand. Als er wieder auftauchte, hatte er einen nummerierten Zettel in der Hand.
»Ihr Garderobenschein, Madam«, sagte er und reichte mir den Zettel. »Wahrscheinlich werden Sie ihn nicht benötigen, da ich heute nicht mit weiteren Besuchern rechne, aber man weiß nie. Sind Sie zum ersten Mal im Skeaping Manor?«
»Ja, so ist es«, antwortete ich.
»Wir möchten gern die blutverschmierte Axt sehen«, verkündete Rob.
»Und die Mumien«, fügte Will hinzu.
»Und die Käfer«, warf Bree ein. »Und die Skelette.«
»Ich kann Ihnen zu einem geringen Preis einen Museumsführer anbieten«, bot Mr Craven an.
»Nein, danke«, sagte Bree bestimmt, »wir sind auf Entdeckungsreise.«
»Sie werden nicht enttäuscht werden«, sagte Mr Craven. »Es gibt reichlich zu entdecken im Skeaping Manor.«
Er wandte sich in Richtung Eichentür, mein Räuspern ließ ihn jedoch innehalten.
»Wir haben noch keinen Eintritt bezahlt«, sagte ich.
»In den Wintermonaten ist der Eintritt frei«, erwiderte er. »Allerdings sind Spenden natürlich immer willkommen.«
»Geht schon mal voraus«, sagte ich zu Bree, als ich sah, dass Will und Rob ungeduldig herumzappelten. »Ich kümmere mich rasch um die Spende und komme dann nach.«
»Na, dann mal los, ihr Entdecker!«, sagte Bree.
Das ließen sich die Zwillinge nicht zweimal sagen.
»Gute Reise«, sagte Mr Craven schmunzelnd.
Er öffnete die Tür, und die drei Entdecker preschten so begierig hindurch wie Rennpferde durch die Startmaschine. Es wärmte mir das Herz, Rob und Will so aufgeregt und quicklebendig zu sehen, und während ich in meiner Schultertasche nach dem Portemonnaie suchte, dankte ich Bree innerlich dafür, diese großartige Expedition vorgeschlagen zu haben.
»Ist Skeaping Manor dem National Trust angegliedert?«, fragte ich Mr Craven. Ich bezog mich auf die gemeinnützige Treuhandorganisation, die sich der Denkmalpflege verschrieben hatte und der Hunderte historischer Gebäude in ganz England gehörte.
»Nein. Skeaping Manor ist eine private Institution, die aus den Mitteln der Jephcott-Stiftung und von den großzügigen Spenden unserer Schirmherren finanziert wird.«
Ich reichte ihm einen Betrag, von dem ich hoffte, dass er als großzügige Spende durchging, drehte mich dann zur Tür um und hielt zögernd inne.
»Trügt mich mein Eindruck, dass Sie eine gewisse Abneigung dagegen hegen, das Museum zu betreten?«, fragte Mr Craven.
»Ich fürchte, nein«, sagte ich kleinlaut. »Um ehrlich zu sein, Mr Craven, bin ich kein großer Fan von blutverschmierten Äxten und Schrumpfköpfen. Wenn Sie meine Worte allerdings vor meinen Söhnen wiederholen sollten, werde ich es glattweg leugnen, aber unter uns gesagt, bin ich eher ein zart besaitetes Gemüt.«
»Keine Angst, Madam. Ihr Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben. Und ich kann Sie beruhigen: Sie brauchen keine Angst zu haben, dass Sie sich während ihres gesamten Besuchs wünschen, an einem anderen Ort zu sein. Unsere Broschüre mag den Eindruck erwecken, bei Skeaping Manor handele es sich um ein Horrorkabinett, aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Auch wenn Sir Waverly Jephcott ein Liebhaber von Kuriositäten war, so war er auch ein leidenschaftlicher Sammler von Porzellan, Silber und Jadegegenständen, ebenso wie von Schnitzereien und Musikinstrumenten. Seien Sie versichert, Sie können allein mit diesen Exponaten einige Stunden im Museum zubringen.« Er betrachtete mich kurz interessiert, ehe er vorsichtig fragte: »Irre ich mich, oder habe ich tatsächlich einen amerikanischen Akzent bei Ihnen herausgehört?«
»Nein, Sie irren sich nicht. Warum? Ist das wichtig?«
»Möglicherweise«, sagte er. »Wenn Sie Engländerin wären, würde ich Sie in den ersten Stock schicken ...«
Ich nickte und unterbrach ihn. »Was in Amerika der zweite Stock ist. Ich lebe seit fast zehn Jahren in England, Mr Craven. Inzwischen weiß ich, dass wir uns im Erdgeschoss befinden, und der erste Stock ist ...« – ich deutete zur Decke – »direkt über uns.«
»Ausgezeichnet.« Er fischte einen goldenen Kugelschreiber aus dem Inneren seines Gehrocks und nahm eine Broschüre aus dem Wandregal. »Ich skizziere Ihnen eine Route in diesem kleinen Führer, die Sie so direkt wie möglich zu den Exponaten im ersten Stock führt, die für Sie interessant sein dürften. Ich bin sicher, sie werden Ihnen gefallen.«
»Das ist sehr freundlich.« Ich langte in meine Schultertasche. »Wie viel schulde ich Ihnen?«
»Ich schenke ihn Ihnen«, sagte er und legte das Büchlein in meine Hand. »Betrachten Sie ihn als Zeichen meiner Dankbarkeit.«
»Dankbarkeit?«, fragte ich verwirrt.
»Der Großteil unserer Besucher kommt wegen der schaurigen Aspekte der Sammlung in unser Museum«, erklärte er lächelnd. »Da tut es gut, jemandem zu begegnen, der die feineren Dinge des Lebens schätzt.«
Ich bin sicher, dass Miles Craven es gut mir gemeint hatte, aber ganz vermeiden ließen sich die »schaurigen Aspekte« von Skeaping Manor nicht. Von den dunklen, labyrinthartigen Gängen trat man ohne Vorwarnung in Räume voller schummrig erleuchteter Glasvitrinen, in denen barbarische chirurgische Instrumente ausgestellt waren oder deformierte menschliche Schädel oder die Kadaver von längst verstorbenen Tieren, deren starre Augen mir vorwurfsvoll zu folgen schienen, als ich an ihnen vorbeischlüpfte, um zu Bree und den Jungen zu stoßen.
Während ich durch die Gänge huschte, begegnete ich keiner Menschenseele, und das war auch gut so. Denn ein vereinzelter Besucher hätte sich womöglich durch das unaufhörliche Geplapper der Jungen – und auch Brees – gestört gefühlt. Mir hingegen dienten ihre Stimmen als Orientierungshilfe, und so dauerte es nicht lange, und ich fand die Entdecker um einen Kasten mit besonders scheußlichen Kreaturen herum versammelt – langbeinigen Insekten, die auf Nadeln aufgespießt waren. Ich hatte keine Ahnung, um was für Insekten es sich handelte, aber sie waren größer und ekelerregender als alle, die mir je über den Weg gelaufen waren.