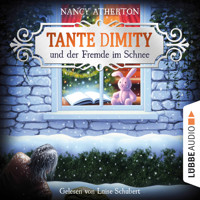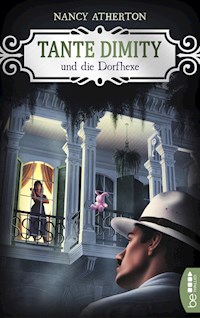7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Lori freut sich auf einen romantischen Wochenendausflug mit ihrem Ehemann Bill - aber ein fürchterlicher Sturm wirbelt ihre Pläne durcheinander, und sie strandet allein in einem kleinen Dorf in Sussex. Eine Unterkunft findet sie in dem historischen Wirtshaus "The King's Ransom". Als Lori in der ersten Nacht knarzende Türen und unheimliches Kinderlachen hört, ist ihre Neugier geweckt. Stimmen die seltsamen Geschichten, die sich um das Wirtshaus ranken? Treiben tatsächlich die Geister toter Schmuggler hier ihr Unwesen? Oder sollte sich Lori eher vor den lebenden Bewohnern des Gasthofs in Acht nehmen? Gemeinsam mit Tante Dimity geht sie den Geheimnissen auf den Grund ...
Ein zauberhafter Wohlfühlkrimi mit Tante Dimity. Als eBook bei beTHRILLED und als Taschenbuch erhältlich.
Versüßen Sie sich die Lektüre mit Tante Dimitys Geheimrezepten! In diesem Band: Steve’s Apple Crumble.
"Ein herzerwärmender Roman voller interessanter Charaktere." Kirkus Review
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Alle Titel der Reihe
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Epilog
Rezept: Steves Apple Crumble
Alle Titel der Reihe
Tante Dimity und das geheimnisvolle Erbe
Tante Dimity und der verschwiegende Verdacht
Tante Dimity und der unerhörte Skandal
Tante Dimity und das verborgene Grab
Tante Dimity und der Fremde im Schnee
Tante Dimity und der Kreis des Teufels
Tante Dimity und der unbekannte Mörder
Tante Dimity und der skrupellose Erpresser
Tante Dimity und der unheimliche Sturm
Tante Dimity und der verhängnisvolle Brief
Tante Dimity und die unheilvolle Insel
Tante Dimity und der Wilde Westen
Tante Dimity und die Jagd nach dem Vampir
Tante Dimity und der gefährliche Drache
Tante Dimity und die Geister am Ende der Welt
Tante Dimity und das verhexte Haus
Tante Dimity und die Dorfhexe
Tante Dimity und der verschwundene Prinz
Tante Dimity und der Wunschbrunnen
Tante Dimity und das Geheimnis des Sommerkönigs
Tante Dimity und der verlorene Schatz
Tante Dimity und der Fluch der Witwe
Tante Dimity und das wunderliche Wirtshaus
Tante Dimity und das Herz aus Gold
Über dieses Buch
Lori freut sich auf ein romantisches Wochenende mit ihrem Ehemann Bill – aber ein fürchterlicher Sturm bringt ihre Pläne durcheinander und, sie strandet allein in einem kleinen Dorf in Sussex. Eine Unterkunft findet sie in dem historischen Wirtshaus »The King's Ransom«, um das sich viele seltsame Geschichten ranken. Als Lori in der ersten Nacht knarzende Türen und unheimliches Kinderlachen hört, ist ihre Neugier geweckt. Treiben hier etwa die Geister toter Schmuggler ihr Unwesen? Oder sollte sich Lori eher vor den lebenden Bewohnern des Gasthofs in Acht nehmen? Gemeinsam mit Tante Dimity geht sie den Geheimnissen des Wirtshauses auf den Grund …
Über die Autorin
Nancy Atherton ist die Autorin der beliebten »Tante Dimity« Reihe, die inzwischen über 20 Bände umfasst. Geboren und aufgewachsen in Chicago, reiste sie nach der Schule lange durch Europa, wo sie ihre Liebe zu England entdeckte. Nach langjährigem Nomadendasein lebt Nancy Atherton heute mit ihrer Familie in Colorado Springs.
Nancy Atherton
Aus dem Amerikanischen von Barbara Röhl
beTHRILLED
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen.
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Thomas Krämer unter Verwendung von Motiven © Ommo Wille
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-7894-8
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Aunt Dimity and the King’s Ransom« bei Penguin Books, New York.
Copyright © der Originalausgabe 2018 by Nancy T. Atherton
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Mike und Jan Dudding,meine guten Freunde aus London.
Kapitel 1
Es war halb zwölf Uhr an einem stürmischen Dienstagabend Mitte Oktober. Meine zehnjährigen Söhne schliefen in ihrem Zimmer, meine kleine Tochter schlummerte in der Kinderstube, und der Familienkater war im Lieblingssessel meines Mannes eingeschlafen. Nach einem turbulenten Abend, bei dem eine tote Maus, ein überstürzter Windelwechsel und ein verbotenes Kricketspiel im Wohnzimmer eine Rolle gespielt hatten, zogen mein Mann und ich uns ins Elternschlafzimmer zurück.
Bill lehnte aufrecht in seinen Kissen und beschäftigte sich mit einem dicken Bündel kleingedruckter juristischer Dokumente. Nicht gerade meine Vorstellung von einer fesselnden Bettlektüre, aber als Anwalt mit wohlhabenden und anspruchsvollen Klienten musste Bill gelegentlich die Arbeit mit ins Bett nehmen.
Mir machte das heute nichts aus. Ich war so müde, dass es mir gleichgültig gewesen wäre, wenn Bill sein Fahrrad mit ins Bett genommen hätte. Ich war mir nicht sicher, warum ich mich so erschöpft fühlte. Aber eine gute Nachtruhe würde sicherlich alles, was mich plagte, heilen.
Ich knipste das Licht im Bad aus, kletterte ins Bett und ließ mich mit einem tiefen Seufzer in die Kissen sinken. Als Bill mein Stöhnen hörte, legte er seine Papiere beiseite und musterte mich eingehend. Zwölf Jahre Eheleben hatten ihn gelehrt, seine nächsten Worte sorgfältig zu wählen.
»Stimmt etwas nicht, Lori?«, fragte er vorsichtig. »Abgesehen von der Maus, der explodierenden Windel und der zerbrochenen Vase?«
»Nein«, erwiderte ich und sah an die Decke. »Nichts ist los. Überhaupt nichts.« Ich seufzte noch einmal. »Mein Leben ist perfekt.«
Das war nicht übertrieben. Abgesehen von gelegentlichen häuslichen Katastrophen war mein Leben praktisch ein Wirklichkeit gewordener Traum. Mein Mann war der beste aller Ehemänner, meine Kinder waren ebenso aufgeweckt wie gesund und unser Kater war ein exzellenter Mäusefänger. Wir lebten in einem märchenhaften Cottage in der Nähe eines idyllischen Dorfs, das sich in die wogenden Hügel und die Patchwork-Felder der Cotswolds schmiegte, einer von Englands schönsten ländlichen Regionen.
Obwohl Bill und ich Amerikaner waren, lebten wir seit über zehn Jahren in der Umgebung des kleinen englischen Dorfs Finch. Bill leitete von seinem Büro mit Aussicht auf den Dorfanger die internationale Niederlassung der altehrwürdigen Bostoner Kanzlei seiner Familie; Will und Rob besuchten die Morningside-Schule im nahegelegenen Dorf Upper Deeping, und ich jonglierte meine ständig wechselnden Rollen als Ehefrau, Mutter, Freundin, Nachbarin und ehrenamtliche Helferin. Und die neunzehn Monate alte Bess beschäftigte sich mit dem, was Kinder in diesem Alter so tun, was bedeutete, dass Stanley, unser Kater mit dem schimmernden schwarzen Fell, vor allem damit beschäftigt war, ihr aus dem Weg zu gehen.
Bills Vater, William Willis senior, hatte unser Glück komplett gemacht, als er die Leitung der Familienkanzlei aufgab und nach England zog, um in der Nähe seiner Enkel zu sein. Als attraktiver Witwer mit feinen Umgangsformen und einem beträchtlichen Bankkonto hatte Willis senior in Finch manch ein hoffnungsvolles Herz gebrochen, als er seine zweite Frau kennengelernt und geheiratet hatte, die bekannte Aquarellmalerin Amelia Bowen. Die beiden lebten in Fairworth House, einer eleganten Villa, die ein Stück entfernt an derselben Straße stand wie unser Cottage.
Finch lag nicht weiter als einen Steinwurf von Willis seniors bescheidenem Anwesen entfernt auf der anderen Seite einer Buckelbrücke, die den Little-Deeping-Fluss überspannte. Ein Fremder hätte das Dorf vielleicht fälschlich für ein verschlafenes Nest gehalten. Aber wir, die es unser Zuhause nannten, fanden hier jede Menge zu tun. In unserer Freizeit angelten wir am Little Deeping, wanderten auf den kreuz und quer durch die Landschaft verlaufenen Wegen, fuhren mit dem Fahrrad in gemessenem Tempo an den mit Hecken bepflanzten Straßen entlang oder ritten über die Saumpfade. Vogelbeobachtung, der Einsatz von Metalldetektoren und Gartenarbeit gehörten in Finch zu den beliebtesten Hobbys. Aber einige von uns nähten auch Quilts, sammelten Modelleisenbahnen oder brachten Gemälde hervor, die nie ein Mensch mit denen von Amelia Bowen verwechseln würde.
Bei den Aktivitäten der Gemeinde hatten wir die Qual der Wahl. Kunstausstellungen, Blumenwettbewerbe, Gemeindefeste und Sportfeste waren nur einige der Ereignisse, die regelmäßig im Dorfkalender standen.
Wenn wir nicht angelten, wanderten, Rad fuhren, ritten, unseren Hobbys nachgingen oder an dorfweiten Veranstaltungen teilnahmen, gingen wir zum Gottesdienst in die Kirche St. George’s, tranken Tee in Sally Cooks Teestube, kauften in Taxman’s Emporium ein – dem Gemischtwarenladen von Finch mit seinem hochtrabenden Namen – oder dösten bei Komiteesitzungen im alten Schulhaus, das uns als Gemeindehaus diente.
Und wohin wir auch gingen und was wir auch taten, es gab immer eine Menge zu erzählen. Klatsch stand in Finch an der Tagesordnung. Allerdings war dieser niemals grausam, obwohl er manchmal ein wenig gemein werden konnte. Meist war der dörfliche Buschfunk schlicht die einfachste Art, Lokalnachrichten zu verbreiten.
Ich hätte mir keinen besseren Ort zum Leben vorstellen können. Meine Nachbarn waren keineswegs Engel, aber sie waren herzensgute Menschen. Sie hatten Bill und mich mit offenen Armen in ihre eng verbundene Gemeinschaft aufgenommen, und sie hatten die Türen noch weiter geöffnet, um unsere Kinder willkommen zu heißen. Will und Rob hatten ihre Finger schon in jeder Keksdose in Finch und alle behandelten Bess wie ihre Lieblingsenkelin. Wir konnten uns darauf verlassen, dass unsere Nachbarn uns bei jedem Notfall zu Hilfe kommen würden, und sie wussten umgekehrt, dass sie immer auf uns zählen konnten.
Ich hatte sogar eine beste Freundin, die in der Nähe lebte. Emma Harris war Amerikanerin wie ich, obwohl sie im Gegensatz zu mir einen Engländer geheiratet hatte. Emma betrieb die Reitschule, an der Will und Rob Unterricht nahmen, und wo wir ihre grauen Ponys Thunder und Storm unterstellten. Emma war ausgeglichen, rational und in vielerlei Hinsicht mein direktes Gegenteil. Aber wie in vielen anderen Fällen, zogen sich bei uns Gegensätze an.
»Mein Leben ist vollkommen«, erklärte ich Bill noch einmal. »Ich habe eine Familie, die mich liebt und die ich vergöttere. Ich lebe an einem wunderschönen Ort unter wunderbaren Menschen. Zu Hause und in meiner Gemeinde weiß man mich zu schätzen, und meine beste Freundin lebt nur fünf Minuten entfernt. Ich habe keinen Grund – und ganz bestimmt kein Recht -, mich über irgendetwas zu beklagen.«
»Aber …?«, hakte Bill nach.
»Doch statt mich darauf zu freuen, für den Kuchenverkauf am Samstag vier Dutzend Butterscotch-Brownies zu backen, fühle ich mich wie eine Gefangene, die zu vier Dutzend Jahren Zuchthaus verurteilt worden ist«, erklärte ich und starrte immer noch dumpf an die Decke. »Keine Ahnung, warum. Normalerweise backe ich gern.«
Schweigend betrachtete Bill mein Profil und kauerte sich dann neben mich. »Brenn mit mir durch«, flüsterte er mir ins Ohr.
»Was?«, sagte ich, aus meiner Trägheit hochgeschreckt.
»Du brauchst eine Auszeit«, erklärte er und stützte den Kopf auf die Hand. »Selbst ein perfektes Leben wird nach einer Weile langweilig. Du warst nicht mehr weg von zu Hause, seit wir das lange Wochenende im White Hart in Old Cowerton verbracht haben, und das war im Juli. Ich würde sagen, du brauchst einen Tapetenwechsel, frische Luft und eine Gelegenheit, deine Batterien aufzuladen.«
»Leichter gesagt als getan«, murmelte ich.
»Das trifft auf die meisten Dinge zu«, gab Bill zurück. »Dieses spezielle Problem ist allerdings kinderleicht zu lösen.«
»Das bezweifle ich«, sagte ich. »Ich habe diese Woche wirklich viel zu tun. Es ist nicht nur der Kuchenverkauf. Ich muss die Palmen für das Krippenspiel neu anstreichen, mit Emma Marmelade einkochen, im Krankenhaus Bücher und Zeitschriften verteilen, im Second-Hand-Laden Spenden sortieren – und da habe ich zu Hause noch nichts erledigt.«
»In meinem Terminkalender ist auch nicht viel frei«, erklärte Bill, »aber wenn ich mir Platz für einen romantischen Ausflug freischaufeln kann, dann kannst du das auch.« Er strich mir eine zerzauste Locke aus der Stirn. »Ein Nein lasse ich nicht gelten, Lori.«
»Offenbar nicht.« Ich lächelte und drehte mich auf die Seite, so dass ich ihn ansehen konnte. »Wirst du mir gleich einen ausgefeilten Plan enthüllen?«
»Selbstverständlich.« Mit einer Kopfbewegung wies er auf den Stapel juristischer Papiere, die er auf den Nachttisch gelegt hatte. »Ich muss am Donnerstag nach East Sussex fahren, um mich mit einem Klienten zu treffen. Wir können im Mermaid Inn in Rye absteigen und erst am Sonntag wieder nach Hause fahren.«
Meine Augen weiteten sich. »Das Mermaid Inn? Dorthin wollte ich immer schon. Es soll eines von Englands großartigsten historischen Gasthäusern sein.«
»Habe ich auch gehört«, meinte Bill. »Lass es uns zusammen herausfinden. Wir könnten auch Rye erkunden. Am Rand der Stadt liegt ein Naturschutzgebiet, das sich bis hinunter zum Meer erstreckt. Wir könnten am Strand entlangspazieren und am Horizont nach Piratenschiffen Ausschau halten, oder durch die kopfsteingepflasterten Straßen von Rye schlendern und die lokale Geschichte aufsaugen.«
Ich sah ihn entzückt an. »Ein Hotel, das vor Atmosphäre überquillt, in einer Stadt, die nach Geschichte riecht, und alles mit Meerblick? Das klingt zu schön, um wahr zu sein.«
»Dabei habe ich das Essen noch gar nicht erwähnt«, fuhr Bill fort. »Das Restaurant des Mermaid Inn hat einen hervorragenden Ruf. Wir könnten uns dort den Bauch mit Spitzenküche vollschlagen oder die dortigen Fish and Chips probieren. Oder uns jede einzelne Mahlzeit ans Bett bringen lassen.«
»Bitte, verlang nicht von mir, dass ich auswähle, was wir essen sollen«, erklärte ich lachend. »Ich habe nicht die Energie dazu.«
»Die kommt schon wieder«, erklärte Bill. »Bis dahin kannst du die Entscheidungen mir überlassen. Wie wäre es mit einer Luxussuite mit Kamin und Himmelbett?«
»Einem richtigen Kamin, in dem man Feuer machen kann?«, fragte ich hoffnungsvoll.
»Natürlich. Dann ist da noch die Badewanne mit den Klauenfüßen, die weichen Handtücher, die Designer-Toilettenartikel, die Pralinen …«
»Hör auf!«, unterbrach ich ihn kichernd. »Verrat mir nicht alle Überraschungen!«
»Ich reserviere noch heute Abend online«, sagte Bill, »und morgen früh rede ich mit Vater. Amelia und er scharren ja schon lange mit den Füßen und wünschen sich, die Kinder ein paar Tage für sich zu haben.«
»Wir können von Glück reden, wenn sie sie zurückgeben«, meinte ich.
»Wegen Stanley brauchen wir uns auch keine Gedanken zu machen«, sagte Bill. »Amelia kümmert sich gern um ihn.«
»Amelia verwöhnt ihn nach Strich und Faden«, erklärte ich. »Während wir fort sind, wird er Lachs, Tunfisch und gehackte Shrimps schlemmen und trauern, wenn wir zurück sind. Aber er wird darüber hinwegkommen. Wie immer.«
»Wir nehmen meinen Mercedes statt deines Range Rovers«, schlug Bill vor. »Ist bestimmt eine nette Abwechslung für dich, mit einem Auto ohne Kindersitze zu fahren.«
»Und das nicht mit Dinosauriern, Kricketschlägern und Lerntassen übersät ist«, setzte ich hinzu. »Guter Gedanke.«
»Gut möglich, dass wir für unseren Ausflug kein optimales Wetter bekommen«, meinte Bill warnend. »In Rye könnte es ein wenig nieselig werden.«
»Wenn wir Angst vor Regen hätten, würden wir nicht in England leben«, rief ich ihm ins Gedächtnis. »Und wenn das Wetter ganz schlecht wird, machen wir Feuer im Kamin, kuscheln uns in unser Himmelbett und …«
»Hör auf«, unterbrach mich Bill und küsste mich auf den Hals. »Verdirb mir nicht alle Überraschungen.«
Daraufhin kam es zu einem kurzen Intermezzo, das meine graue Stimmung beträchtlich hob.
Als wir wieder sprechen konnten, runzelte Bill leicht die Stirn.
»Die Sache hat nur einen Haken«, erklärte er.
»Wusste ich es doch«, sagte ich, und meine düstere Laune drohte zurückzukehren. »Ich habe geahnt, dass ein Haken dabei ist.«
»Nur ein winziger«, versicherte er, »und der hat mit meinem Klienten zu tun.«
»Deinem Klienten?«, fragte ich verblüfft. »Den du am Donnerstag besuchst?«
»Genau dem«, bestätigte Bill. »Er heißt Sir Roger Blayne und lebt in einem elisabethanischen Herrenhaus namens Blayne Hall.«
»Ich sehe nicht, wo der Haken liegt«, meinte ich.
»Der Haken ist, dass er ein Einsiedler ist – ein richtiger Eigenbrötler«, erklärte Bill. »Als ich Sir Roger zum ersten Mal getroffen habe, musste Vater mitkommen, um sich für meine Identität zu verbürgen.«
»Wie reizend«, sagte ich.
»Seitdem hat sich unsere Beziehung enorm verbessert«, versicherte mir Bill. »Statt mich mit Abscheu zu betrachten, toleriert Sir Roger mich inzwischen.«
»Hört sich ja nach einer beachtlichen Verbesserung an«, bemerkte ich trocken.
»Die Sache ist die: Sir Roger lässt niemanden außer seinen Ärzten, seinen Anwälten und einigen treuen Gefolgsleuten in sein Haus«, sagte Bill. Da du unter keine dieser Kategorien fällst, bezweifle ich, dass er dich in Blayne Hall aufnimmt.«
»Dann warte ich im Auto auf dich«, schlug ich vor.
»Ich habe eine bessere Idee«, erklärte Bill. »Du kannst mich bei Sir Roger absetzen, nach Rye fahren, im Mermaid Inn einchecken und dann ein langes, gemütliches Schaumbad in der Badewanne mit den Klauenfüßen genießen. Wenn ich bei Sir Roger fertig bin, kann sein Chauffeur mich nach Rye fahren.«
»Wie weit ist es denn von Blayne Hall nach Rye?«, erkundigte ich mich. Ich hielt nicht viel davon, im Süden von England zu fahren, wo die Straßen dazu neigten, grünen Tunneln zu ähneln.
»Nicht mehr als zehn Meilen«, antwortete Bill, »und die Route ist gut ausgeschildert.«
»Zehn Meilen auf gut ausgeschilderten Straßen?«, sagte ich. »Das sollte kein Problem sein.« Ich kuschelte mich an meinen Mann. »Seit Bess‹ Geburt habe ich kein richtiges Schaumbad mehr genommen.«
»Könnte sein, dass ich mit in die Wanne steige«, warnte er mich.
»Ich halte dir das Wasser warm«, säuselte ich.
»Das hört sich verlockend an«, sagte er. »Ich muss sofort reservieren!«
Als er sich aus dem Bett wälzte und nach seinem Laptop griff, umschlang ich sein Kissen und stieß einen seligen Seufzer aus. Die Euphorie, in die mich der bloße Gedanke, von zu Hause wegzulaufen, stürzte, verriet mir, dass Bills Diagnose richtig war: Ich brauchte dringend eine Auszeit. Ich liebte Finch über alles, aber ein Tapetenwechsel würde mir guttun, vor allem, wenn in dieser Auszeit Schaumbäder, gemächliche Spaziergänge am Meer und ein Himmelbett in einem romantischen Gasthaus vorkamen.
»Wen kümmert es dann schon, ob es regnet?«, murmelte ich schläfrig.
Mich, wie sich herausstellen sollte.
Kapitel 2
Bills ausgetüftelter Plan ließ sich gut an. Wir schaufelten beide unsere Terminkalender frei, lieferten die Kinder am Mittwoch nach der Schule bei ihren entzückten Großeltern ab und machten uns am Donnerstagmorgen früh gen Süden auf. Es fiel mir erstaunlich leicht, meine diversen Pflichten zu delegieren. Meine Schwiegereltern, Freunde, Nachbarn und Ehrenamts-Kollegen hatten es so eilig, mich ziehen zu sehen, dass ich vermutete, sie hatten ebenfalls bemerkt, dass ich Urlaub brauchte.
Das wechselhafte Oktoberwetter verleitete mich, viel zu viel einzupacken. Als ich meinen Koffer schloss, war ich auf fast alles vorbereitet, was der Himmel einen an den Kopf werfen konnte.
Bill erlaubte sich ein selbstzufriedenes Grinsen, als er seine bescheidene Reisetasche mit meinem aus den Nähten platzenden Koffer verglich, doch ich beneidete ihn nicht. Während er zu seinem geschäftlichen Termin in Anzug und Krawatte antreten musste, konnte ich es mir auf der Fahrt in einem kuschligen Kaschmirpullover, lose sitzenden Wollhosen und weichen Stiefeletten bequem machen. Wir warfen unsere Regenjacken auf den Rücksitz des Mercedes, denn einige feuchte Erlebnisse hatten uns gelehrt, sie immer in Reichweite zu haben.
Da Bill sich erst am Nachmittag mit Sir Roger Blayne treffen würde, nahmen wir uns Zeit für die Fahrt nach Süden. Wir frühstückten in unserem Lieblingscafé in Moreton-in-Marsh, durchstöberten einen Second-Hand-Buchladen in Woodstock und fuhren dann auf eine belebte zweispurige Schnellstraße – in Amerika hätte man sie einen »Highway« genannt -, auf der wir die entlegeneren Vorstädte von London relativ rasch hinter uns ließen.
Sobald wir den Krallen Londons entronnen waren, fuhren wir wieder gemütlich weiter. Eine Reihe malerischer kleiner Straßen führte uns an Obst- und Weingärten vorbei, an reetgedeckten Cottages, weitläufigen Gutshöfen, ein paar Schlössern und zahlreichen Herrenhäusern. In gegenseitigem Einvernehmen unterdrückte ich den Drang, alle Viertelstunde bei Willis senior anzurufen, und Bill widerstand der Versuchung, sich bei seiner Kanzlei zu melden.
Es fühlte sich geradezu luxuriös an, in einem sauberen, aufgeräumten Wagen zu fahren - keine Beißringe, keine Naturwissenschafts-Projekte, keine lange vergessenen Trinkpäckchen. Aber je weiter wir nach Süden kamen, umso dunkler und drohender wirkte der Himmel.
Als wir geruhsam in einem malerischen Pub an einem Fluss zu Mittag aßen, öffneten sich die himmlischen Schleusen.
»Ein bisschen nieselig?«, fragte ich und sah in den Wolkenbruch hinaus. »Sogar die Schwäne flitzen, um sich irgendwo unterzustellen.«
»Wenn wir uns vor Regen fürchten würden …«, intonierte Bill, »würden wir nicht in England leben«, beendete ich den Satz an seiner Stelle. Ich lächelte und rückte näher an das Fenster neben unserem Tisch heran. »Hast du den Eindruck, dass der Fluss Hochwasser führt? Diese Weiden stehen mit den Füßen im Wasser.«
»Sieht schon aus, als könnte es noch steigen«, pflichtete Bill mir bei. »Vielleicht sollten wir sehen, dass wir loskommen, bevor sich der Parkplatz in einen See verwandelt.«
Schnell aßen wir unsere Haselnusstörtchen auf, zahlten, zogen unsere Jacken an und rannten durch dicke Pfützen zu dem Mercedes. Sobald wir unterwegs waren, drehte Bill die Heizung auf, damit unsere feuchten Hosen trockneten, und ich betrachtete die Landschaft durch die Autoscheiben, an denen der Regen herabströmte.
Das miserable Wetter begleitete uns bis nach Blayne Hall. Als Bill aus dem Wagen stieg, fuhr der Wind in seine Jacke, und mir klatschte ein Schwall Regentropfen ins Gesicht, bevor er seine Tür schließen konnte. Um trocken zu bleiben, kletterte ich über die Schaltung, um Bills Platz hinter dem Steuer einzunehmen.
Ich sah meinem Mann an, dass er Bedenken wegen meiner Fahrt nach Rye hatte. Ich selbst war inzwischen von der Idee auch nur noch mäßig begeistert, aber wir behielten unsere Vorbehalte für uns. Bill hatte meine Fahrkünste schon öfters kritisiert, und ich wollte nicht zugeben, dass der Sturm mich einschüchterte.
»Ich melde mich per Handy bei dir, sobald ich im Mermaid Inn angekommen bin«, rief ich Bill durch das geschlossene Fenster zu.
»Wir sehen uns dort«, schrie er zurück. »Halt mir das Badewasser warm!«
Ich reckte fröhlich den Daumen in die Höhe; eine Geste, die meinen Gemütszustand nicht exakt wiedergab.
Ein Butler trat aus Blayne Hall heraus. Er war mit einem riesigen schwarzen Schirm bewaffnet, der durch den starken Wind sofort umschlug. Scheinbar unbeeindruckt von dem Missgeschick verneigte er sich tief vor Bill und geleitete ihn dann ins Herrenhaus. Ich fühlte mich ein wenig verlassen, als der unerschütterliche Diener mit dem flatterhaften Schirm die Tür hinter meinem Mann schloss. Doch dann nahm ich meinen Mut zusammen, wendete das Auto und fuhr auf Sir Rogers schotterbestreuter Einfahrt zurück.
Als ich das Ende der Einfahrt erreichte, zögerte ich. Bill hatte mir erklärt, nach rechts würde ich eine größere Straße in East Sussex erreichen, während ich, wenn ich links abbog, über Landstraßen fahren würde. Um die wetterbedingten Staus zu vermeiden, die bestimmt die breitere und viel befahrene Straße verstopfen würden, wandte ich mich nach links.
Die Optimistin in mir war überzeugt davon, dass das Unwetter nicht schlimmer werden würde. Die Pessimistin in mir lachte freudlos, als das doch passierte.
Ich hatte noch keine fünf Meilen zurückgelegt, als es, nachdem der Regen zuvor stetig geströmt war, wie aus Eimern herabzuschütten begann. Die Abwassergräben auf beiden Seiten der Straße waren bald bis zum Rand gefüllt, und obwohl meine Scheibenwischer Überstunden machten, konnte ich die Straßenschilder kaum lesen.
Das Unwetter betäubte mich weder mit Donner, noch blendete es mich mit Blitzen. Aber ich machte mir Sorgen, es könnte versuchen, mich zu ersäufen. Immer, wenn ich es wagte, den Blick von der Straße zu nehmen, sah ich, wie sich in frisch abgeernteten Feldern Teiche bildeten, Schafe auf vollgesogenen Weiden höheren Grund suchten und Bäume im Wind wild um sich schlugen. Die Böen peitschten den Wagen so gnadenlos, dass ich nur noch im Schritttempo vorankam und das Steuer so fest umklammerte, dass meine Knöchel weiß wurden.
Als ich auf einer Brücke anhielt, um den Fluss zu betrachten, der am Fuß eines breiten Hügels durch ein ebenes Stück bebauten Landes floss, bekam ich es mit der Angst zu tun. Die wilden Fluten hatten den Fluss noch nicht über die Ufer treten lassen, aber er wirkte aufgewühlt genug, um die Brücke in Stücke zu schlagen. Als sechs Autos an mir vorbeikrochen und auf einen Fahrweg einbogen, der den Hügel hinaufzuführen schien, folgte ich ihren Rücklichtern. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich fuhr, doch aufwärts schien eine gute Idee zu sein.
Die kleine Straße schlängelte sich den Hügel hinauf, bis sie die Kuppe erreichte, wo sie sich in eine Hauptstraße mit Kopfsteinpflaster verwandelte, die mitten durch ein Dorf verlief. Grüppchen geschäftig umhereilender Fußgänger brachten die Fahrzeuge vor mir zum Halten, daher hielt ich auf einen Kirchturm zu, den ich nicht weit entfernt in einer Seitenstraße entdeckte. Nach meiner nervenaufreibenden Fahrt wünschte ich mir nichts mehr, als das Unwetter in einem stabilen Gebäude auszusitzen.
»Eine Zufluchtsstätte«, seufzte ich, als das Kirchengebäude in Sicht kam. Ich parkte den Mercedes auf dem grasbewachsenen Seitenstreifen, schaltete den Motor ab und stieß ein kurzes, aber tiefempfundenes Dankgebet für meine Rettung aus. Es war nicht alles rosig, aber besser, als es gewesen war, bevor ich den Hügel hinaufgefahren war.
Ich wollte gerade meinen Gurt lösen, als mein Handy klingelte. Ich zog das Telefon aus der Schultertasche, wobei ich dankbar dafür war, dass mich kein Anruf abgelenkt hatte, während ich noch mit dem Steuer kämpfte. Ich war nicht im Mindesten überrascht, auf dem winzigen Bildschirm des Telefons Bills Namen zu lesen.
»Mir geht es gut, Bill«, sagte ich und nahm seine, wie ich wusste, erste und dringendste Frage vorweg. »Ich bin vor ungefähr fünf Minuten von der Straße abgefahren. Ich bin mir nicht sicher, wo ich bin, aber ich stehe vor einer Kirche in einem Dorf auf einem Hügel und werde gleich hineingehen, also sollte ich in Sicherheit sein. Hast du eine Ahnung, was zur Hölle mit dem Wetter los ist?«
»Ja«, erklärte er, »und es ist nichts Gutes. Laut Sir Roger zieht ein außertropischer Zyklon die Südküste entlang.«
»Was ist ein außertropischer Zyklon?«
»Stelle ihn dir wie einen Hurrikan vor«, sagte Bill. »Blayne Hill liegt nur im Bereich seiner äußersten Ausläufer, aber du befindest dich näher am Zentrum. Wenn der Sturm weiterzieht, solltest du außer Gefahr sein. Wenn er stillsteht, könnte es knifflig werden.«
»Ich Glückspilz«, meinte ich. »Schätze, wir hätten vorm Losfahren die Wettervorhersage ansehen sollen …«
»Beim nächsten Mal«, erwiderte er düster. »Bist du sicher, dass es dir gut geht?«
»Es wird mir besser gehen, wenn ich erst in der Kirche bin«, erklärte ich. »Durch den Wind schwankt der Wagen ein wenig.«
»Ich komme dich holen«, sagte er.
Ich sah in den Regen und dachte schnell nach. Ich hatte nicht vor, meinem strahlenden Ritter zu erlauben, durch einen außertropischen Zyklon zu reiten, um mir zu Hilfe zu kommen.
»Wie denn?«, verlangte ich zu wissen. »Du hast keine Ahnung, wo ich bin. Selbst wenn ich dir meinen genauen Standort durchgebe könnte, bräuchtest du mich nicht zu holen, weil es mir wirklich gut geht.«
»Lori …«, begann er, doch ich unterbrach ihn.
»Mir geht es gut, Bill«, beharrte ich. »Ich treibe nicht auf einem Rettungsfloß mitten im Ozean. Ich befinde mich in einem Dorf mit Läden und Häusern und mindestens einer Kirche. Wenn ich Hilfe brauche, muss ich keine Leuchtrakete abschießen. Ich kann einfach an eine Tür klopfen.«
»Nun gut«, sagte er zögernd. »Ich bleibe einstweilen, wo ich bin. Aber ruf mich an, sobald du weißt, wo du dich befindest.«
»Wird gemacht«, versprach ich. »Aber bitte doch unterdessen Sir Roger, dir einen steifen Whisky einzuschenken. Du brauchst etwas für die Nerven.«
Bill lachte und wir beendeten den Anruf.
Ich ließ mich erleichtert auf dem Fahrersitz zurücksinken. Zwar konnte ich es Bill nicht verübeln, dass er sich Sorgen um mich machte, aber die Vorstellung, dass er sich meinetwegen in Gefahr begab, war zu grauenhaft, um darüber nachzudenken.
Ich zog die Handbremse an, löste meinen Gurt, steckte das Handy wieder in meine Umhängetasche und öffnete und schloss meine müden Finger, während ich mich für den Sprint in die Kirche wappnete. Erst da bemerkte ich ein großes, handgemaltes Schild, das fast auf Augenhöhe an der Mauer des Kirchhofs hing.
Das Schild teilte mir mit, dass ich mich vor der Gemeindekirche St. Alfege‘s befand, wo gegenwärtig eine Ausstellung sakraler Handarbeiten stattfand. Ich war froh, das Schild nicht eher gesehen zu haben. Ich hatte keine Ahnung, wer St. Alfege war, doch ich bezweifelte, dass viele Kirchen nach ihm benannt waren. Wenn meine Ehrlichkeit mich bewogen hätte, Bill den ungewöhnlichen Namen der Kirche zu nennen, hätte er herausgebracht, wo ich mich aufhielt, und wäre zu mir geeilt – genau das, was ich nicht wollte.
Lautstark pfiff der Sturm um den Wagen herum und Regentropfen prasselten gegen die Windschutzscheibe. Ich brauchte keine weitere Einladung, um den Reißverschluss meiner Jacke hochzuziehen, meine Kapuze aufzusetzen, meine Umhängetasche zu schnappen und mich auf den Weg zu machen.
Der erste Schwall nasskalter Luft raubte mir den Atem. Zusätzlich zu allem anderen war die Temperatur seit unserem geruhsamen Mittagessen am Flussufer um gut zwanzig Grad gesunken. Mir wurde mit einem Mal klar, dass ich anscheinend eine Vorahnung gehabt hatte, als ich mich in Wolle und Kaschmir gekleidet hatte. Doch die bittere Kälte ließ mich wünschen, ich hätte auch Handschuhe eingepackt.
Ich sah auf den ersten Blick, dass St. Alfege’s eine sehr alte Kirche war. Sie war niedrig und gedrungen, aus Bruchsteinmauerwerk errichtet und mit Details aus grauem Kalkstein verziert. Das Dach war mit roten Dachpfannen gedeckt, die sich gut gegen den Wind zu behaupten schienen, und der plumpe, viereckige Glockenturm erinnerte mich so stark an St. George’s, dass mich eine Welle von Heimweh überkam. Ich fand St. Alfege’s nicht so schön wie St. George’s – ich zog Coltswoldstein dunklem Bruchstein vor -, aber ich musste zugeben, dass in dem strömenden Regen keine Kirche optimal aussehen würde.
Vorsichtig, um nicht auf den nassen Steinplatten auszurutschen, überquerte ich den Vorplatz, drehte den Türknauf einer dicken Eichentür und stolperte in die Kirche. Ein Seufzer der Erleichterung stieg in mir auf, als ich die Tür hinter mir zuschob. Ich konnte den tosenden Wind und den prasselnden Regen noch hören, doch der Wind klang gedämpft, und der Regen klatschte mir nicht mehr auf den Kopf.
Ich schüttelte mich wie ein nasser Welpe, schlug meine Kapuze zurück und sah mich um, konnte jedoch nicht viel erkennen. Da die Sonne sich nicht zeigen konnte, wurde St. Alfege’s nur von der roten Altarlampe und ein paar flackernden Opferkerzen in einem schmiedeeisernen Ständer am anderen Ende des Südschiffs erhellt.
Das Kirchenschiff war mit Stühlen aus laminiertem Holz statt Bankreihen ausgestattet, was in meinen Augen ein wenig von der zeitlosen Schönheit der runden normannischen Bögen ablenkte, die es von den Seitenschiffen trennten. Ich vermutete, dass eine Tür zu meiner Linken zum Glockenturm führte. Der Rest der Kirche lag so in dunklen Schatten, dass es unheimlich hätte wirken können, wenn sie nicht so eine beruhigende Stabilität ausgestrahlt hätte.
»Es würde mehr als einen Zyklon brauchen, um dich von deinem Hügel zu fegen«, erklärte ich dem robusten alten Bauwerk laut.
»Allerdings«, sagte eine Stimme.
Und jetzt wurde es ein wenig gruselig.