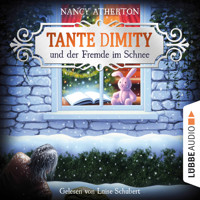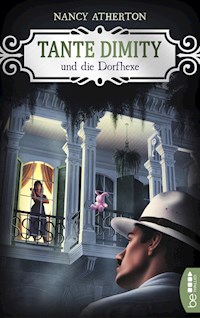7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Wohlfühlkrimi mit Lori Shepherd
- Sprache: Deutsch
Beim Herumstöbern auf dem Dachboden ihres hübschen Cottages findet Lori ein wertvoll aussehendes Armband. Als sie Tante Dimity von dem antiken Schmuckstück erzählt, ruft das bei ihr schmerzhafte Erinnerungen an das London der Nachkriegszeit hervor. Tante Dimity erzählt ihr von ihrer Freundschaft mit dem geheimnisvollen Badger und ihrer zum Scheitern verurteilten Liebesgeschichte. Um ein altes Unrecht wiedergutzumachen, bittet sie Lori, dem ursprünglichen Besitzer das Armband zurückzugeben. Obwohl inzwischen mehr als fünfzig Jahre vergangen sind, willigt Lori in das aussichtslos erscheinende Unterfangen ein. Der Auftrag führt sie nach London und in eine längst vergangene Zeit. Aber schon bald stellt sich die Frage, ob manche Schätze lieber nicht gefunden werden sollten ...
Ein neuer Wohlfühlkrimi mit Tante Dimity. Als eBook bei beTHRILLED und als Taschenbuch erhältlich.
Versüßen Sie sich die Lektüre mit Tante Dimitys Geheimrezepten! In diesem Band: Früchtebrot ohne Ei.
"Kein anderer Krimi ist so liebenswert wie ein Tante-Dimity-Abenteuer!" (Kirkus Reviews)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Epilog
Früchtebrot ohne Ei
Interview
Über dieses Buch
Beim Herumstöbern auf dem Dachboden ihres hübschen Cottages findet Lori ein wertvoll aussehendes Armband. Als sie Tante Dimity von dem antiken Schmuckstuck erzählt, ruft das bei ihr schmerzhafte Erinnerungen an das London der Nachkriegszeit hervor, und sie erzählt von einer zum Scheitern verurteilten Liebesgeschichte. Tante Dimity bittet Lori, ihrem abgewiesenen Verehrer das Armband zurückzugeben. Obwohl inzwischen mehr als fünfzig Jahre vergangen sind, willigt Lori in das aussichtslos erscheinende Unterfangen ein. Der Auftrag führt sie nach London und in eine längst vergangene Zeit – aber schon bald stellt sich die Frage, ob manche Schätze lieber nicht gefunden werden sollten …
Über die Autorin
Nancy Atherton ist die Autorin der beliebten »Tante Dimity« Reihe, die inzwischen über 20 Bände umfasst. Geboren und aufgewachsen in Chicago, reiste sie nach der Schule lange durch Europa, wo sie ihre Liebe zu England entdeckte. Nach langjährigem Nomadendasein lebt Nancy Atherton heute mit ihrer Familie in Colorado Springs.
NANCY ATHERTON
Aus dem Amerikanischen von Barbara Röhl
beTHRILLED
Digitale Originalausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen.
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Thomas Krämer unter Verwendung von Motiven © Alvaro Cabrera Jimenez | Montreeboy
Illustration: © Ommo Wille
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-5121-7
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Aunt Dimity and the Buried Treasure« bei Viking Penguin, a member of Penguin Group (USA) LLC, 2016.
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Nancy T. Atherton
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Gillian Weavers,deren Freundschaft ich über alles schätze
Kapitel 1
Es war ein warmer, sonniger Tag Ende Oktober. Mein Mann war bei der Arbeit, meine Söhne waren in der Schule und meine Tochter zahnte.
Während andere Kleinkinder bei jedem neu durchbrechenden Zahn fieberten und jammerten, schien Bess zufrieden zu sein, einfach auf jedem Gegenstand, der in ihre Reichweite kam, herumzukauen. Das betraf unter anderem Plastikdinosaurier, Kricketschläger, Gummistiefel, Tischbeine und Hundeohren. Der fragliche Hund war ein sanfter alter Basset, der sich Bess′ Aufmerksamkeiten hatte gefallen lassen, bis ich seine Not erkannte und ihn rettete.
Bess′ Zahn-Abenteuer hatte meine neunjährigen Zwillinge Will und Rob den unschätzbaren Wert von Ordnung gelehrt. Spielzeug, das man auf dem Boden liegenließ oder auf dem Couchtisch verstreute, war leichte Beute für Bess, die, obwohl ich das zu verhindern versuchte, grundsätzlich alles anknabberte.
Obwohl Bill, mein Mann, unsere Tochter »das Nagetier« getauft hatte, nachdem er sie dabei ertappt hatte, wie sie am Griff seines ledernen Aktenkoffers kaute, waren Will und Rob ihren Übergriffen gegenüber ebenso nachsichtig wie der alte Basset. Sie hatten noch nie erlebt, wie einem Kind Zähne wuchsen und fanden das äußerst interessant.
Und Bess war sehr klug. Sie hatte sich viel früher als die Zwillinge allein umgedreht, war eher gekrabbelt und hatte früher nach fester Nahrung verlangt. So unglaublich das klingen mag, ich hätte schwören können, dass sie kurz davor stand, verständlich zu sprechen. Letzteres bestritt Bill, indem er erklärte, dass Wörter wie gug, pah und wabah nicht der Standarddefinition von verständlich entsprachen, doch er konnte nicht leugnen, dass unser Mädchen nach jedem anderen Kriterium ihren Altersgenossen weit voraus war.
Wir hatten nichts Besonderes unternommen, um Bess zu fördern. Weder hatten wir ihr schon vor der Geburt Mozart vorgespielt, noch sie mit Spielzeug überhäuft, das garantierte, ihren IQ zu erhöhen. Ich schrieb ihren schnellen Fortschritt ihrem Wunsch zu, ihre Brüder einzuholen, und dem Übermaß an Liebe und Aufmerksamkeit, mit dem das eng verbundene Gemeinwesen, das wir unser Zuhause nannten, sie überhäufte.
Bill, Will, Rob, Bess und ich lebten in einem honigfarbenen Cottage nahe dem kleinen Dorf Finch, einem bildschönen Dörfchen in den wogenden Hügeln und Feldern der Cotswolds, einer ländlichen Region in den englischen West Midlands. Bill und ich waren Amerikaner, genau wie unsere Kinder, aber wir lebten schon lange genug in England – und sahen genug County Cricket –, um den Unterschied zwischen einem rechtshändigen gedrehten Wurf und einem tiefgespielten Ball zu kennen.
Unser seidig glänzender Kater Stanley war zu hundert Prozent englisch, aber er hatte kein Problem damit, sich an unseren fremdartigen Akzent und unsere eigenartigen Redewendungen zu gewöhnen. Ich war überzeugt davon, dass wir ihn auch auf Walisisch hätten ansprechen können, und es wäre ihm gleichgültig gewesen, solange wir ihm die Ohren kraulten und seinen Futternapf füllten.
Während Stanley abwechselnd fraß, schlief und versuchte, sich aus Bess′ Reichweite fernzuhalten, hatte der Rest von uns einen etwas volleren Terminkalender. Bill leitete die europäische Niederlassung der altehrwürdigen Bostoner Anwaltskanzlei seiner Familie, Will und Rob besuchten die Morningside School im nahegelegenen Marktflecken Upper Deeping, und ich jonglierte meine vielfältigen Rollen als Ehefrau, Mutter, Freundin, Nachbarin und ehrenamtliche Helferin in der Gemeinde. Dennoch war niemand von uns so beschäftigt wie Bess, deren steile Lernkurve unsere im Vergleich flach wie ein Pfannkuchen aussehen ließ.
Unser Cottage lag zwei Meilen von Finch entfernt an einer schmalen, kurvenreichen Straße mit hohen Hecken. Wir teilten unser Sträßchen mit einer Handvoll anderer Familien, doch der größte Teil unserer Nachbarn lebte im Dorf selbst. Ihre Häuser und kleinen Geschäfte standen auf beiden Seiten des Dorfangers zwischen der St. George‘s-Kirche und der alten Buckelbrücke, die sich über den Little Deeping River spannte.
Von außen gesehen war Finch ein bedeutungsloser Fliegenklecks auf der Landkarte, ein verschlafenes Nest, in dem noch nie etwas Bemerkenswertes passiert war. In Finch gab es keine dieser blauen Gedenktafeln, die den Geburtsort der Großen und Berühmten kennzeichnen, weil dort noch nie jemand Großes oder Berühmtes geboren worden war. Abgesehen von seiner ländlichen Schönheit und den mittelalterlichen Wandmalereien in St. George’s, besaß Finch wenig, um sich der Welt jenseits seiner Grenzen zu empfehlen. Es war schon immer ein gewöhnlicher Ort gewesen, in dem normale Menschen ein Durchschnittsleben führten, und doch fand ich es außerordentlich. Denn manchmal machen die kleinen Freuden des Lebens den großen Unterschied aus.
Trotz seiner schläfrigen Erscheinung, war Finch in Wahrheit ein summendes Zentrum von Geschäftigkeit. Die langen Perioden zwischen Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen waren mit Blumenausstellungen, Schäferhund-Prüfungen, Kirchenbasaren, Flohmärkten, Kunstausstellungen, Erntefesten, Sportfesten und Krippenspielen ausgefüllt. Wenn meine Nachbarn nicht gerade derartige Veranstaltungen organisierten und an ihnen teilnahmen, betrieben sie Läden, pflegten Gärten, gingen ihren Hobbys nach, zankten sich stürmisch um Lappalien und genossen die heitere Ruhe der umliegenden Landschaft.
Ihre liebste Freizeitbeschäftigung jedoch war die Kultivierung des Dorfklatsches. Die Dorfbewohner schenkten den sogenannten Prominenten keinerlei Aufmerksamkeit und den Nachrichten über das Weltgeschehen nur sehr wenig, doch übereinander besaßen sie ein enzyklopädisches Wissen. Gewichtszunahmen oder -abnahmen, neue Haarschnitte, andere Kleidung und plötzliche Stimmungsschwankungen wurden exakt registriert und endlos debattiert. Sally Cooks Teestube war ein beliebtes Gesprächsthema, aber auch der Peacocks Pub, der Gemüseladen, die Kirche, die Brücke, der Dorfanger, die Bank am Kriegerdenkmal, das alte Schulhaus, das uns als Gemeindesaal diente, und Peggy Taxmans gut bestückter Gemischtwarenladen wurden an jedem Küchentisch in jedem Cottage durchgehechelt.
Wer sich nach Anonymität sehnte, hätte die Neugier meiner Nachbarn unerträglich aufdringlich gefunden, doch mir schenkte sie ein starkes Gefühl von Sicherheit. Zwar war Privatsphäre in Finch fast unbekannt, Verbrechen aber ebenfalls. Die Dorfbewohner entdeckten einen verdächtigen Fremden schneller als ein Turmfalke eine Feldmaus, und sie machten andere rasch auf ihre Sichtung aufmerksam. Ich wusste, dass meine Kinder in Finch sicher waren, denn ich wusste, wie viele Augen über sie wachten.
Bess war in Finch die Ballkönigin; verständlich angesichts des Umstands, dass sie das einzige Baby in einem in erster Linie von Rentnern und noch arbeitenden Menschen mittleren Alters bevölkerten Dorf war. Die Dorfbewohner mochten auch Will und Rob gut leiden, doch ein Kleinkind hatte etwas, das sogar den griesgrämigsten aller Grantler in ein Babysprache plapperndes Häufchen Rührseligkeit verwandelte.
Bess′ ergebenster Fan war ihr Opa. William Arthur Willis senior war ein vornehmer, altmodischer Gentleman, der unsere Familie vervollständigt hatte, als er sich aus der Kanzlei der Familie zurückgezogen hatte und nach England übersiedelt war, um die Rolle als einziger lebender Großelternteil seiner Enkelkinder zu übernehmen. William seniors auf patrizische Art gutes Aussehen, seine tadellosen Umgangsformen und sein dickes Bankkonto hatten ihn zum begehrtesten Witwer in Finch gemacht, bis er sein eigenes Leben komplettiert hatte – und dabei manch ein Herz brach –, indem er die bekannte Aquarellmalerin Amelia Thistle ehelichte.
Willis senior war vollkommen vernarrt in Bess, und Amelia hatte mehrere Skizzenbücher mit Bleistiftzeichnungen von ihr gefüllt, die Bess′ Persönlichkeit auf eine Art einfingen, die Fotografie überholt erscheinen ließ. Zum Glück für alle Beteiligten lebten Willis senior und Amelia ein Stück weiter in derselben Straße wie wir in Fairworth House, einem eleganten georgianischen Herrenhaus, das von einem bescheidenen Anwesen umgeben war.
Das schmiedeeiserne Tor, das den Eingang zum Anwesen meines Schwiegervaters hütete, lag einen kurzen Spaziergang von der Buckelbrücke entfernt. Von unserem Cottage aus war es ein wenig weiter zum Tor, doch Bess und ich genossen den Spaziergang fast so sehr, wie wir es liebten, Zeit mit Grandpa und Grandma zu verbringen. Seit die Frischvermählten von ihrer Hochzeitsreise zurückgekehrt waren, hatten wir Fairworth House fast täglich einen Besuch abgestattet.
An diesem goldenen Tag Ende Oktober leitete aber nicht so sehr familiäre Zuneigung meine Schritte, sondern unverfrorene, unbändige Neugier. In Finch stand ein bedeutsames Ereignis bevor, und es würde praktisch auf Willis seniors Türschwelle stattfinden.
Ins Ivy Cottage, welches direkt auf der anderen Straßenseite gegenüber dem schmiedeeisernen Tor meines Schwiegervaters lag, würden neue Mieter einziehen. In einer großen Stadt hätte ein solches Ereignis unbemerkt bleiben können, aber nicht in Finch.
Meine Nachbarn hatten bereits einige grundlegende Informationen über die Neuankömmlinge herausgefunden, indem sie sie in Gespräche verwickelt hatten, als sie Finch besuchten, um sich das Haus anzusehen. Ich war nicht vor Ort gewesen, doch dank des Buschfunks im Dorf, der in einem Tempo funktionierte, welches das Internet in den Schatten stellte, hatte ich das Gefühl, sie belauscht zu haben.
Sally Cook und mehrere andere zuverlässige Quellen hatten mich bald darüber informiert, dass unsere zukünftigen Nachbarn, James und Felicity Hobson, pensionierte Lehrer waren. Sie hatten einen unverheirateten Sohn, der in Singapur im Finanzwesen arbeitete, und eine verheiratete Tochter, die mit ihrem Mann, einem Architekten, und ihren zwei kleinen Kindern – einem Jungen und einem Mädchen – in Upper Deeping lebte und eine Firma betrieb, die sich auf luxuriöse Inneneinrichtungen spezialisierte. Und über diese Tochter in Upper Deeping, die Innenarchitektin war, hatten die Hobsons von Ivy Cottage erfahren.
Jemand, der nicht vertraut mit den etwas eigenartigen Gepflogenheiten von Finch war, hätte vielleicht gedacht, dass das eine ganz schöne Menge an Informationen für eine Handvoll netter Plaudereien war, doch ich war mir des Talents meiner Nachbarn für die hohe Kunst des Kreuzverhörs bewusst. Mich erstaunte nur, dass sie ihnen nicht das Brutto-Jahreseinkommen des Sohns aus der Nase gezogen hatten, die Schulnoten der Enkelkinder und die Ansichten der Tochter zur vieldiskutierten Frage »Gardinen oder Vorhänge«.
Solche Bröckchen, die bei ein paar oberflächlichen Gesprächen abfielen, würden allerdings nicht ausreichen, um die wissbegierigsten unter den Dorfbewohnern zufriedenzustellen. Um mehr zu erfahren, würden sie fast mit Sicherheit ein Ritual zur Informationsbeschaffung durchführen, das, soweit ich wusste, nur in Finch stattfand. Bill nannte es »die Möbelwagen-Wache«.
Meine Nachbarn hielten sich viel darauf zugute, Menschen nach ihren Besitztümern beurteilen zu können. Sie verstanden sich ebenso gut darauf, Sessel und Lampen zu deuten, wie eine Wahrsagerin Handlinien liest. Da sie außerdem unheilbare Schnüffler waren, ließen sie sich nie eine Gelegenheit entgehen, beim Ausladen eines Umzugswagens zuzuschauen. Natürlich versuchten sie, diskret vorzugehen, denn kein Dorfbewohner, der etwas auf sich hielt, würde die Habseligkeiten eines anderen offen anglotzen.
Hätte Ivy Cottage am Dorfanger gelegen, wäre es für die Dörfler ein Kinderspiel gewesen, den Umzugslaster der Hobsons zu beobachten. Sie hätten ihn aus dem Pub oder der Teestube verstohlen ansehen können, oder sogar durch die Spitzengardinen ihres eigenen Heims. Doch so, wie die Dinge standen, würden sie die Buckelbrücke überqueren und ein Stück an meiner Straße entlanggehen müssen, um eine gute Aussicht zu erhaschen.
Ich konnte es kaum abwarten, mich zu ihnen zu gesellen, denn ich war genauso neugierig wie meine Nachbarn. Auch ich wollte mehr über die Hobsons erfahren; wissen, ob man sich bezüglich der Teilnahme am Dorfleben auf sie verlassen konnte oder ob sie unsere nachbarlichen Annäherungsversuche verschmähen, und Vorhänge – oder Gardinen – zuziehen und unter sich bleiben würden. Ich war nicht so geschickt wie die Dorfbewohner im Deuten von Esstischen, aber einem gut eingesessenen Sessel konnte ich für gewöhnlich ein, zwei Informationen entlocken.
Meine häufigen Besuche in Fairworth House lieferten mir einen akzeptablen Vorwand, um mich auf der Straße aufzuhalten, wenn der Umzugswagen kam. Ich hatte vor, in der Nähe des schmiedeeisernen Tors meines Schwiegervaters herumzulungern und den Laster verstohlen zu mustern, während ich an Bess′ Mützchen herumnestelte oder ihre Wickeltasche durchwühlte.
»Ich hoffe, wir haben nicht das Beste verpasst«, meinte ich zu Bess, als ich ihren Kinderwagen die schmale Straße entlangschob.
Bess stieß eine Reihe von Silben aus, die in meinen Ohren ganz ähnlich klangen wie »Sei doch realistisch, Mummy. Wir mussten Will und Rob zur Schule fahren und dann wieder nach Hause, um mich vom Autositz in den geländegängigen Kinderwagen zu setzen, den Daddy mir gekauft hat. Und vergiss den Windel-Unfall nicht, bei dem wir uns einig darüber waren, ihn vor Außenstehenden nicht zu erwähnen. Wir hätten wirklich nicht früher nach Ivy Cottage aufbrechen können«.
Bill hätte sie nicht verstanden, ich jedoch schon.
»Du hast recht«, pflichtete ich ihr bei. »Aber ich werde schneller gehen, um unseren späten Start wettzumachen. Halt deinen Hut fest, Baby!«
Wir hatten bereits die geschwungene Auffahrt von Anscombe Manor passiert, wo meine beste Freundin Emma Harris lebte, und das rote Backsteinhaus, das die junge Bree Pym von ihren Urgroßtanten geerbt hatte. Wir waren noch zehn Minuten von Willis seniors schmiedeeisernem Tor entfernt, doch als wir die letzte Kurve umrundeten, verfiel ich in einen Laufschritt, um dann abrupt und zutiefst beeindruckt stehenzubleiben.
Das Bild, das sich meinen Augen bot, war besser, als ich erwartet hatte. Der Umzugswagen war eingetroffen und parkte vor der hohen Hecke, die Ivy Cottage dem Blick entzog, und zwei stämmige Männer entluden ihn, doch ich bemerkte ihn kaum. Ich hatte zu viel damit zu tun, meine Nachbarn zu betrachten, die sich eine Vielfalt von Vorwänden — einige glaubhafter als andere — ausgedacht hatten, um sich auf der Straße herumzudrücken.
Dick Peacock, der Wirt unseres Pubs, gab vor, mit einem weißen Tuch und einer Sprühflasche mit der geheimnisvollen blauen Flüssigkeit, mit der er die Tische in seinem Lokal zu reinigen pflegte, das schmiedeeiserne Tor zu putzen. Mr. Barlow, der pensionierte Automechaniker, der sowohl Küster in unserer Kirche als auch Mann für alles im Dorf war, stand auf einer seiner Leitern, um eine schmiedeeiserne Torangel zu ölen. Charles Bellingham und Grant Tavistock, die in ihrem Haus in Finch als Kunstschätzer und -restauratoren tätig waren, führten am Straßenrand äußerst langsam ihre kleinen Hunde Goya und Matisse auf und ab.
Opal Taylor, Elspeth Binney, Millicent Scroggins und Selena Buxton – die Bill wegen ihrer Schwärmerei für Willis senior »Vaters emsige Mägde« getauft hatte –, hatten sich entschieden, als Künstlerinnen getarnt aufzutreten, was bis zu einem gewissen Grad Sinn ergab, da sie in Upper Deeping bei einem gewissen Mr. Shuttleworth Malstunden nahmen. Wie vorauszusehen war, hatten sie ihre Staffeleien in einem Winkel aufgebaut, der es ihnen erlauben würde, den Laster zu beobachten, während sie angeblich in ihre Arbeit versunken waren.
Sally Cook, die Besitzerin der Teestube, hatte in der Nähe der Mägde Stellung bezogen, als wäre sie fasziniert von ihren Gemälden, ließ sie jedoch ohne Umschweife im Stich, als sie mich entdeckte. Auch die anderen schienen durch meinen Auftritt abgelenkt zu sein, denn sie rissen die Blicke von einem ziemlich interessanten Ledersofa los, das die stattlichen Männer jetzt durch das Tor in der hohen Hecke manövrierten, und folgten Sally, die auf mich zugeschossen kam.
Bess und ich waren es gewöhnt, in Finch für einen Menschenauflauf zu sorgen, doch normalerweise verlangten die Massen eher nach Bess‘ Beachtung als nach meiner. Daher war ich vage alarmiert, als die nahende Horde meine süße Tochter ignorierte und ausschließlich mich ansprach.
»Lori!«, schrie Elspeth Binney. »Endlich!«
»Wo hast du nur gesteckt?«, verlange Opal Taylor zu wissen.
»Wir dachten schon, du würdest nie kommen!«, rief Charles Bellingham aus.
»Bess und ich mussten die Jungs zur Schule fahren …«, begann ich.
»Keine Zeit für Erklärungen«, sagte Sally Cook und brachte mich mit einer Handbewegung zum Schweigen. Sie warf dem Umzugslaster einen verstohlenen Blick zu und trat dann näher zu mir. »Wir haben ein großes Problem mit unseren neuen Nachbarn, Lori«, murmelte sie. »Und nur du kannst es lösen.«
Kapitel 2
Ich war mir nicht sicher, warum Sally Cook ihre Stimme gesenkt hatte. Unser kleines Grüppchen von Gaffern hätte nicht auffälliger sein können, hätten wir Fahnen geschwenkt und Feuerwerk abgebrannt. Die kleine Sally mit ihrer Großmutterfigur trug über einer weiten weißen Bluse eine graue Wolljacke und Alltagshosen aus schwarzem Stretch, und Mr. Barlow war in sein übliches Arbeitshemd und Drillichhosen gekleidet, doch sie waren die einzigen Dorfbewohner, deren Aufzug auf einer ländlichen Straße unbemerkt hätte bleiben können.
Die Mägde wirkten in ihren wallenden Malerkitteln wie ein pastellfarbener Regenbogen – Selena Buxton trug weiches Rosa, Elspeth Binney Babyblau, Opal Taylor Schlüsselblumengelb und Millicent Scroggins Minzgrün –, während Dick Peacock aus seiner Sammlung von Westen ein Exemplar in einem knalligen Paisleymuster gewählt hatte, als wolle er seinen außerordentlichen Bauchumfang noch betonen.
Der große, beleibte Charles Bellingham hatte sich einen ziemlich verwegenen schwarzen Filzhut, den er mit einem purpurfarbenen Band geschmückt hatte, auf das kahle Haupt gesetzt. Grant Tavistock dagegen hatte beschlossen, seinen üppigen graumelierten Haarschopf mit einem silbernen Schal um den Hals zu betonen.
Ich hatte mit Absicht abgewetzte Blue Jeans und einen marineblauen Pullover angezogen, um möglichst unauffällig zu bleiben. Die Möbelpacker schienen sich allerdings so auf ihre Arbeit zu konzentrieren, dass sie keine Notiz von mir und meinen buntgescheckten Nachbarn nahmen.
»Wie in aller Welt könnt ihr ein Problem mit den Hobsons haben?«, verlangte ich zu wissen. »Sie sind noch nicht einmal richtig eingezogen. Sind sie aus ihrem neuen Heim gestürmt und haben euch aufgefordert zu verschwinden?«
»Nein«, räumte Sally ein. »Keiner von uns hat mit ihnen gesprochen, seit sie in Finch waren, um das Cottage zu besichtigen.«
»Wir haben gesehen, wie sie heute Morgen angekommen sind«, setzte Dick Peacock hilfreich hinzu. »Sie waren noch vor den Möbelpackern hier.«
»Mr. Hobson fährt einen alten Fiat Panda«, erklärte mir Grant Tavistock.
»Und Mrs. Hobson einen blauen Kombi«, sagte Charles Bellingham.
»Sie haben ihre Autos in die Garage gestellt«, setzte Elspeth Binney hinzu, »und seitdem haben wir sie nicht mehr zu Gesicht bekommen.«
»Es ist schwer, durch die Hecke etwas zu erkennen«, meinte Millicent Scroggins mit einer enttäuschten Miene, die bewies, dass sie es versucht hatte.
Die hohe, aber ordentlich gestutzte Hecke versperrte den Blick auf Ivy Cottage sowie auf die Garage. Die Hobsons hätten wie die Hasen von ihren Autos bis zur Haustür hoppeln können, und auf der Straße hätte niemand etwas bemerkt.
»Wenn ihr nur einen Blick auf die Hobsons erhascht habt«, sagte ich geduldig, »und in letzter Zeit nicht mit ihnen gesprochen habt, wie könnt ihr dann ein Problem mit ihnen haben?«
»Wir haben die Kisten gesehen«, sagte Opal Taylor.
»Was für Kisten?«, fragte ich.
»Die Kisten, auf denen MUSEUM stand«, erklärte Sally, als wäre das offensichtlich. »Die Möbelpacker haben Dutzende davon ins Haus getragen.«
»Nein«, konterte Elspeth. »Ich habe nur zehn Kisten mit der Aufschrift MUSEUM gesehen.«
»Ich zwölf«, erklärte Opal.
»Merkwürdig«, sagte Grant. »Charles und ich haben neun gezählt.«
»Es waren fünf Museumskisten«, erklärte Mr. Barlow kategorisch, und da er so exakt zu sein pflegte, wie die anderen zur Übertreibung neigten, widersprach ihm niemand.
»Kommt es darauf an?«, fragte Sally ärgerlich. »Die Sache ist doch die: Die Kisten beweisen, dass die Hobsons vorhaben, ein Museum zu eröffnen.«
»Ein Museum?«, fragte ich verdutzt. »Was für ein Museum sollten zwei pensionierte Lehrer eröffnen?«
»Schultafeln im Wandel der Zeiten?«, meinte Charles.
»Eine Sammlung von Tintenfässern wäre interessant«, sagte Selena.
»Ich würde gern einmal alte Schulhefte ansehen«, erklärte Dick nachdenklich. »Seit wir zur Schule gegangen sind, hat die Handschrift sich sehr verändert.«
»Allerdings«, warf Mr. Barlow ein. »Sie ist viel unleserlicher geworden.«
Bis auf Sally, die sichtlich schlecht aufgelegt war, lachten alle.
»Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass das Museum unbedingt mit dem Lehrerberuf der Hobsons zu tun haben muss«, sagte Grant. »Vielleicht haben sie ja eine Sammlung von Modellflugzeugen oder exotischen Insekten.«
»Will und Rob werden überschnappen, wenn wir ein Insektenmuseum bekommen«, sagte ich. »Meine Jungs lieben Krabbelgetier.«
Bess suchte sich diesen Moment aus, um einen Schrei auszustoßen. Ich wusste, sie wollte mir in meiner Meinung über die Manie der Jungs beipflichten, doch die anderen hatten den Eindruck, sie werfe ihnen vor, sie zu ignorieren.
Augenblicklich wurde die Diskussion über Museen auf Eis gelegt, während die Dorfbewohner sich Mühe gaben, ihre Nachlässigkeit wettzumachen. Bess wurde hochgehoben, herumgereicht, geknuddelt, geküsst und überschwänglich gelobt, bis ich sie wieder in den Wagen legte, wo sie prompt einschlief. Für ein fast acht Monate altes Baby konnte so viel Verehrung ermüdend sein.
»Na schön«, sagte ich, sobald die Ordnung wiederhergestellt war. »Ihr habt gesehen, wie die Möbelpacker fünf Kisten mit der Aufschrift MUSEUM ins Ivy Cottage getragen haben. Daher nehmt ihr an, dass die Hobsons vorhaben, irgendein Museum zu eröffnen.« Ich hob die offenen Hände. »Ich sehe immer noch nicht, was das Problem ist.«
Eine ohrenbetäubende Lärmwelle brandete über die Straße, als alle zugleich losredeten. Die dicken Möbelpacker warfen einen Blick in unsere Richtung, verdrehten die Augen und widmeten sich weiter ihrer Arbeit.
»Seid doch leise!«, blaffte Sally. »Ihr weckt noch das Baby!«
Zerknirscht beäugten meine Nachbarn Bess, und der Tumult wich einem Chor von im Flüsterton vorgebrachten Entschuldigungen. Da ich ihrem Problem mit den Hobsons auf den Grund gehen wollte, verriet ich ihnen nicht, dass meine Tochter sogar bei einem Blaskapellenkonzert durchgeschlafen hätte.
»Sprechen wir doch einer nach dem anderen, ja?«, schlug Elspeth zaghaft vor.
»Ich fange an«, erklärte Sally, und das warnende Glitzern in ihren Augen gebot den anderen, sich zurückzuhalten. »Ivy Cottage liegt in einem Wohngebiet, Lori. Die Hobsons müssten sich bei der Grafschaft eine Sondergenehmigung und alle möglichen Lizenzen besorgen, um in ihrem Wohnhaus ein Geschäft zu betreiben.«
»Auch wenn sie die Genehmigung und die Lizenzen bekommen«, meinte Opal, »wo sollen die Museumsbesucher parken?« Mit einer ausholenden Handbewegung umfasste sie die schmale Straße. »Ihr seht selbst, dass hier kein Platz für Autos ist. Hört auf meine Worte: Sie werden kreuz und quer auf dem Dorfanger parken.«
»Sie werden den Rasen ruinieren«, erklärte Grant. »Wenn es regnet, wird der Dorfanger nicht mehr grün sein, sondern eine Schlammwüste.«
»Goya und Matisse haben nichts für Matsch übrig«, meinte Charles und sah gutmütig zwischen seinem goldfarbenen Zwergspitz und dem Malteser seines Partners hin und her.
»Ich halte auch nichts von Schlamm«, fiel Millicent ein.
»Ich auch nicht. Niemand kann Matsch leiden.«
»Sie werden überall im Dorf Sandwichpapier und Limonadendosen fallenlassen«, sagte Selena und zog missfällig die Nase kraus. »Keine Ahnung, wie es euch geht, aber ich habe keine Lust, in meiner Freizeit hinter einem Haufen Fremder aufzuräumen.«
»Ein Museum könnte aber gut fürs Geschäft sein«, argumentierte Dick. »Ich hätte nichts dagegen, im Pub ein paar mehr Gäste zu sehen.«
»Für mein Geschäft wäre es nicht gut«, murrte Sally, womit sie endlich den Grund für ihre schlechte Laune enthüllte.
»Warum nicht?«, fragte ich.
»Museen haben immer Cafés, Lori«, gab sie zurück. »Meine Teestube wirft ohnehin kaum Gewinn ab. Eine zweite im Dorf könnte mein Untergang sein.«
Wieder meldete sich Mr. Barlow zu Wort, die Stimme der Vernunft in Finch.
»Wenn Sie mich fragen«, erklärte er, »regen Sie sich über etwas auf, das vielleicht nie passiert. Wir wissen nicht wirklich, was diese Kisten zu bedeuten haben, oder?«
Die Dorfbewohner verstummten, während sie die Frage in ihren Köpfen wälzten. Elspeth Binney räumte als Erste ein, dass er da möglicherweise nicht unrecht hatte.
»Ganz richtig«, sagte sie. »Vielleicht haben die Hobsons die Kisten ja einem Museum abgekauft.«
»Oder sie lagern sie für ein Museum«, meinte Millicent.
»Möglich, dass sie sie in ein Museum bringen«, sagte Opal. »Nachdem sie sich in ihrem neuen Heim eingelebt haben natürlich.«
»Oder wir haben recht«, sagte Sally düster. »Vielleicht haben die Hobsons vor, ein eigenes Museum in Ivy Cottage aufzumachen, komplett mit Teestube.«
»Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden«, erklärte Mr. Barlow knapp. »Fragt sie. Geht jetzt gleich hinein und fragt sie ohne Umschweife, ob sie vorhaben, ein Museum zu eröffnen.«
»Genau mein Gedanke«, meinte Sally. Sie wandte sich an mich. »Und da kommst du ins Spiel, Lori.«
Der Rest der Dorfbewohner nickte aufmunternd.
»Wie bitte?«, fragte ich verblüfft. »Wobei komme ich ins Spiel?«
»Wir möchten gern, dass du die Hobsons fragst, ob sie vorhaben, in Ivy Cottage ein Museum einzurichten«, erklärte Elspeth. »Und wir möchten, dass du sie sobald wie möglich fragst.«
»Innerhalb der nächsten fünf Minuten wäre mir recht«, sagte Sally und wippte ungeduldig mit dem Fuß.
Ich starrte Sally und Elspeth an, als hätten sie mir eine subversive Aktion angetragen. Gewissermaßen traf das sogar zu. In Finch war es üblich, Neuankömmlingen eine Schonfrist von drei Tagen zu gewähren, um sich von dem anfänglichen Schock des Umzugs zu erholen. Früher an die Tür der Hobsons zu klopfen, hätte man als äußerst unhöflich betrachtet, da es unnötigen Druck auf sie ausgeübt hätte, sich inmitten von Chaos gastfreundlich zu zeigen. Und sich den Hobsons gleich am Tag ihres Einzugs aufzudrängen, während noch ihr Möbelwagen ausgeräumt wurde, hätte unter normalen Umständen als Abstieg in die Barbarei gegolten.
»A … aber was ist mit der Drei-Tage-Regel?«, stammelte ich.
«Wir müssen darauf verzichten«, erklärte Mr. Barlow. »Sonst werden gewisse Leute …« – er warf Sally einen Seitenblick zu –, »sich von ihrer Fantasie mitreißen lassen. Ehe wir uns versehen, sind aus diesen fünf Kisten Hunderte geworden, und Ivy Cottage ist die Zweigstelle des British Museum in Finch.«
»Machen Sie sich nicht lächerlich«, fauchte Sally, der Mr. Barlows Blick nicht entgangen war. »Niemand hat ein Wort über das British Museum gesagt. Aber sogar ein kleines Museum mit einer kleinen Teestube …«
»Sie haben Ihre Befürchtungen deutlich zum Ausdruck gebracht, Sally«, unterbrach Grant sie behutsam. »Bis Sie wissen, was die Hobsons mit Ivy Cottage vorhaben, machen Sie wahrscheinlich kein Auge zu.«
»Wir würden alle gern Bescheid wissen«, seufzte Millicent und zog die Augenbrauen hoch. »Wir wollen doch nicht, dass besorgniserregende Gerüchte an Peggy Taxmans Ohr dringen, oder?«, fügte sie unheilverkündend hinzu.
Bestürzt rissen die Dorfbewohner die Augen auf, und es fiel mir nicht schwer, den Grund nachzuvollziehen. Peggy Taxman war eine breitschultrige, herrische Frau mit mächtigem Busen, eine geborene Befehlshaberin, die das Dorf mit eiserner Hand regierte und eine Stimme besaß, die Granit pulverisieren konnte. Peggy betrieb die Poststelle, die Gemischtwarenhandlung und den Gemüseladen und führte bei jeder Komiteesitzung in Finch den Vorsitz. Ohne ihr Organisationstalent und ihre anscheinend unerschöpfliche Energie wäre das Leben im Dorf zum Stillstand gekommen, doch die meisten von uns hätten eine weniger anmaßende, weniger aufdringliche und weniger starrsinnige Herrscherin bevorzugt.
Ich warf einen Blick zur Buckelbrücke. »Warum ist Peggy eigentlich nicht hier?«, fragte ich.
»Anliefertag«, gab Millicent zurück. »Sie räumt die Regale im Emporium ein.«
Finchs Kaufladen war seit jeher als Emporium bekannt; ein angemessen hochtrabender Name, denn der Laden bot alles von Heuballen bis zu Sommersprossencreme an.
»Warum hat sie nicht Jasper an ihrer Stelle geschickt?«, erkundigte ich mich.
Jasper Taxman, Peggys schüchterner, sanftmütiger Ehemann, war der einzige Mensch auf Erden, der das überbordende Temperament seiner Frau bremsen konnte, doch sogar er überlegte genau, wann es sich lohnte, sich mit ihr anzulegen.
»Jasper steht hinter der Kasse«, erklärte mir Millicent, »aber sie werden schon noch von dem Museum hören.«
»Da sei Gott vor«, stöhnte Dick. »Wenn Peggy Wind davon bekommt, kommen wir die nächsten drei Tage nicht aus den Komiteesitzungen heraus. Sie wird eine Petition auf die Beine stellen und einen Protestmarsch abhalten. Entweder das, oder sie wird das Museum selbst leiten wollen, was bedeuten würde, dass sie uns als freiwillige Helfer dafür einspannen würde.«
»Eine Komiteesitzung pro Woche ist schon schlimm genug«, meinte Charles und wirkte entsetzt. »Wenn ich drei in ebenso vielen Tagen besuchen muss, werde ich verrückt.«
»Und taub«, setzte Grant düster hinzu.
»Wir müssen die Gerüchte im Keim ersticken«, erklärte Mr. Barlow entschieden. »Es gibt nur eine Möglichkeit, die klaren Fakten zu erfahren! Wir müssen direkt mit den Hobsons sprechen.«
Meine Nachbarn schauten mich flehentlich an.
»Ich bin ja bereit dazu«, sagte ich vorsichtig, »aber ich habe keine Ahnung, warum unbedingt ich das übernehmen soll. Wieso kann nicht einer von euch mit ihnen reden?«
»Weil du ein Baby hast und wir nicht«, gab Sally unverblümt zurück. »Bess ist deine Eintrittskarte ins Ivy Cottage.«
»Schämt ihr euch denn gar nicht?«, fragte ich und musterte sie vorwurfsvoll. »Soll ich wirklich meine kleine Tochter bei einem hinterlistigen Trick als Lockvogel einsetzen, um unschuldigen Eheleuten Geheimnisse abzuschwatzen, die sie vielleicht für sich behalten wollen?«
»Ja«, sagte Sally.
»Volltreffer«, meinte Grant.
»Sie hat es doch noch verstanden«, erklärte Dick selbstgefällig, und die anderen nickten.
»Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig«, sagte ich schmunzelnd. »Wünscht mir Glück!«
»Das wirst du nicht brauchen«, sagte Sally. »Du hast schließlich Bess.«
Kapitel 3
Die Dorfbewohner drängten mich vorwärts, als ein lautes Krachen alle zusammenzucken ließ. Die kräftigen Möbelpacker waren mit der Arbeit fertig und hatten die Türen des Umzugslasters zugeknallt. Das laute Gelächter, unter dem sie ins Führerhaus stiegen, ließ stark darauf schließen, dass sie Spaß daran hatten, uns erschreckt zu haben.
»Also wirklich«, meinte Elspeth empört. »Manche Leute haben einfach keine Manieren.«
Während die Möbelpacker davonfuhren, fiel niemand in Elspeths Schimpfkanonade ein. Vermutlich dachten die anderen genau wie ich an ein gewisses Sprichwort, in dem es um Glashäuser und das Werfen von Steinen ging. Wer Umzugslaster ausspionierte, konnte sich beim Thema Manieren nicht wirklich aufs hohe Ross setzen.
Meine schlummernde Tochter fuhr zwar vom Knallen der Türen nicht hoch, doch es weckte sie. Sie schlug die Augen auf, blinzelte langsam, gähnte gemächlich und schmatzte dann mit den Lippen, um mir zu bedeuten, dass sie bereit für ihren Vormittagssnack war, den ich in die Wickeltasche gesteckt hatte.
»Großartig«, meinte ich und strahlte sie an. »Wir werden die Hobsons fragen, ob wir deine pürierten Möhren in ihrer Küche aufwärmen dürfen.«
»Hoffentlich haben sie ihre Kochtöpfe schon ausgepackt«, sagte Sally.
»Das werden wir bald herausfinden«, gab ich fröhlich zurück und steuerte den Kinderwagen auf den hölzernen Torbogen in der hohen Hecke zu.
Ich konnte mein Glück kaum fassen. Obwohl wir zur Möbelwagen-Wache zu spät gekommen waren, hatten Bess und ich sogar mehr als Plätze in der ersten Reihe erwischt. Dank des geheimnisvollen Museums würden wir nicht wehmütig zuhören müssen, wie unsere Nachbarn die Tische, Stühle und Lampen der Hobsons beschrieben. Stattdessen waren wir die ersten – allerersten! – Einheimischen, die ihre Besitztümer von Nahem sehen würden, und zwar im Inneren von Ivy Cottage. Ich hatte das Gefühl, Weihnachten und Ostern seien auf einen Tag gefallen.
Äußerst hochgestimmt marschierte ich durch das Tor, doch dann ging ich langsamer und blieb schließlich stehen, als eine Flut von Erinnerungen in mir aufstieg. Ivy Cottage war ein hübsches, zweistöckiges Haus, dessen Wände mit dem Efeu bewachsen waren, nach dem das Cottage benannt war. Dichte Efeuranken umrahmten die zwei Erkerfenster im Erdgeschoss, hohe Kamine erhoben sich aus dem mit Schiefer gedeckten Dach, und ein schmales Vordach schützte die Haustür aus verwitterter Eiche. Zu beiden Seiten des glatten, mit Ziegeln belegten Pfads, der von dem Torbogen zur Eingangstür führte, gedieh ein gepflegter Garten.
Doch ich konnte mich an eine Zeit erinnern, als Ivy Cottage der Welt kein so hübsches Gesicht gezeigt hatte. Sein vorheriger Mieter, der verstorbene Hector Huggins, hatte zugelassen, dass der Garten sein Haus geradezu verschlang. Als ich es zum ersten Mal gesehen hatte, hatte es mich an ein Dornröschenschloss erinnert. Glücklicherweise hatte Mr. Huggins‘ Erbe, ein junger Australier namens Jack MacBride, den Wildwuchs gezähmt und das Cottage renoviert.
Jack hatte Ivy Cottage zwar während der langwierigen Renovierungsarbeiten bewohnt, war aber kürzlich zu Bree Pym gezogen, die sich nach einigen Missverständnissen ebenso heftig in ihn verliebt hatte wie er sich in sie. Die Dorfbewohner hatten sich widerwillig mit diesem Arrangement abgefunden. Nicht weil sie es moralisch missbilligten, sondern weil es sie um das Vergnügen einer weiteren Hochzeit in St. George’s brachte.
Seit ich Jack bei der Renovierung unterstützt hatte, war Ivy Cottage mir ebenso vertraut wie mein eigenes Haus. Mit einem Anflug von Stolz musterte ich die ordentlich geschnittenen Ranken, die blitzenden Fensterscheiben und den sorgfältig in Schuss gehaltenen Garten und hoffte, dass die Hobsons ihr neues Heim pfleglich behandeln würden, ob sie es nun als Museum nutzten oder nicht.
Bess beendete meine Träumerei mit der energisch formulierten Forderung nach Nahrung. Daher unterbrach ich meine Reise in die Vergangenheit und ging unverzüglich den Ziegelpfad hinauf.
Kaum hatte ich an die Haustür geklopft, wurde diese schon von einer großen, schlanken Frau geöffnet, die einen Fair-Isle-Pullover, braune Cordhosen und vernünftige braune Wildlederschuhe trug. Ihre Augen besaßen einen interessanten taubenblauen Ton, und ihr kurzes graues Haar war in einem schicken Stil geschnitten, der ihrem ovalen Gesicht schmeichelte. Hinter einem Ohr steckte ein Bleistift, und eine Lesebrille saß tief auf ihrer Nase. Sie hielt ein Stück Papier in der Hand und verzog ratlos die Stirn.
Die Frau sah mich über ihre Brille hinweg an und streckte mir dann das Stück Papier entgegen. Es schien sich um eine Checkliste zu handeln.
»Haben Sie irgendeine Ahnung, was dieses Gekritzel bedeuten könnte?«, fragte sie und zeigte auf den zweiten Posten auf der Liste. »Man sollte meinen, ich könnte meine eigene Schrift lesen, aber ich kann mir einfach keinen Reim darauf machen. Das kommt davon, wenn man seine To-Do-Listen in letzter Minute schreibt.«
»›Kühlbox … ausleeren‹?«, fragte ich vorsichtig, nachdem ich das Gekrakel studiert hatte.
«Du meine Güte, ja«, rief sie aus und schlug sich an die Stirn. »Ich hoffe, das Eis ist noch nicht geschmolzen. Wir brauchen die Butter morgen früh für unseren Toast. Nichts wirkt so deprimierend wie trockener Toast.« Mit einer Handbewegung bedeutete sie mir, ihr zu folgen, und eilte ins Cottage.
Ich nahm Bess und die Wickeltasche aus dem Kinderwagen, trat über die Schwelle, schloss die Tür hinter mir und hielt inne, um den großen, rechteckigen Raum zu betrachten, der sich über die ganze Länge des Cottages erstreckte. Der verblichene Hector Huggins hatte ihn sowohl als Esszimmer wie auch als Wohnraum genutzt, doch es sah aus, als sollte er den Hobsons ausschließlich als Wohnzimmer dienen. Ich fühlte mich versucht, die Tür zum Esszimmer zu öffnen, um festzustellen, ob sie vorhatten, es wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zuzuführen, entschied mich aber dagegen, um mein Glück nicht herauszufordern.
Was ich im Wohnzimmer sah, gefiel mir. Bei näherem Hinsehen erwies sich das Sofa, das mir vorhin aufgefallen war, weder als billig, noch sündhaft teuer. Es wirkte behaglich und abgenutzt wie ein Paar Lieblingshausschuhe, und der Rest des Mobiliars war genauso schlicht. Hier und da standen ein paar Antiquitäten herum, doch ich spürte, dass die edleren Teile sich, sobald die Möbel richtig aufgestellt waren, optisch zwischen die einfacheren einfügen würden.
Zufrieden trat ich in die Küche, wo ich die grauhaarige Frau dabei antraf, wie sie den Inhalt einer großen roten Kühlbox in den Edelstahl-Kühlschrank räumte, den Jack MacBride angeschlossen hatte. Die Küche war mit halbleeren und ungeöffneten Kisten vollgestellt, doch auf keiner davon stand MUSEUM.
»Sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen«, sagte die Frau über die Schulter hinweg. »Noch eine Stunde, und unsere Butter wäre komplett geschmolzen.« Sie kippte einen Schwall halb aufgetauter Eiswürfel in die Spüle und stellte dann die Kühlbox mit offenem Deckel beiseite, damit sie an der Luft trocknen konnte. »Ich kann Ihnen nicht genug danken«, fuhr sie fort, drehte sich um und streckte mir lächelnd eine klamme Hand entgegen. »Ich bin Felicity Hobson. Ihr Baby ist übrigens wunderschön.«
Mrs. Hobson hätte sich auf keine Art beliebter bei mir machen können. Ich sah auf die seidigen dunklen Ringellöckchen meiner Tochter hinunter, ihre samtbraunen Augen und ihre zarte Haut und musste zugestehen, dass sie wirklich schön war.
»Ich bin Lori Shepherd«, sagte ich und schüttelte Mrs. Hobson die Hand. »Und meine Tochter heißt Bess. Wir wohnen ein Stück weiter in Ihrer Straße, gleich hinter Anscombe Manor.«
»Anscombe Manor«, wiederholte Mrs. Hobson nachdenklich. »Ist das die Reitschule?«
»Richtig«, sagte ich. »Meine Söhne nehmen dort Unterricht.«
»Ich weiß«, erklärte sie. »Das hat mir die Besitzerin des Teesalons erzählt.«
»Ach ja?«, sagte ich und fragte mich, was Sally Cook unseren neuen Nachbarn noch über mich erzählt hatte.
»Aber ja«, sagte Mrs. Hobson. »Unsere Immobilienmaklerin hat uns einer ganzen Reihe von Dorfbewohnern vorgestellt, als wir damals nach Finch kamen, um Ivy Cottage zu besichtigen. Alle, die wir getroffen haben, schienen darauf zu brennen, mit uns zu reden.«
»Reden ist der beliebteste Sport in Finch«, erklärte ich ihr lachend.
»Ich plaudere selbst sehr gern«, sagte Mrs. Hobson.
Das Blitzen in ihren Augen deutete darauf hin, dass sie bei ihrem ersten Besuch in Finch ebenso viel über die Dorfbewohner erfahren hatte, wie diese über sie. Mrs. Hobson dachte sicherlich, dass sie sich in einer Gemeinde von Schnüfflern problemlos behaupten könne.
Bess wiederholte ihre Forderung nach Nahrung.
»Windel?«, vermutete Mrs. Hobson.
»Hunger«, sagte ich. »Für gewöhnlich bekommt Bess um diese Zeit einen Happen zu essen.«
»Ich fürchte, Babynahrung haben wir nicht dabei«, sagte Mrs. Hobson. »Unsere Kinder brauchen seit über dreißig Jahren keine mehr.«
»Keine Sorge«, meinte ich und klopfte auf die Wickeltasche. »Ich verlasse das Haus nie ohne ein Gläschen pürierte Karotten.«
»Soll ich sie für Bess aufwärmen?«, fragte Mrs. Hobson. »Ich habe hier irgendwo einen kleinen Topf.«
Sie begann Kisten hin- und herzuschieben, und sehr bald saß ich an dem freigeräumten Küchentisch und gab Bess mit dem Löffel ihren bevorzugten Vormittagssnack. Mrs. Hobsons Suche nach dem Topf hatte zusätzlich noch einen Wasserkocher, eine stabile braune Teekanne, ein eingedelltes Päckchen Tee und ein hübsches blauweißes Teeservice zutage gefördert. Während ich meine hungrige Tochter fütterte, kochte Mrs. Hobson eine Kanne Earl Grey und stellte drei Tassen und drei Unterteller auf den Tisch. Dann verließ sie die Küche und blieb am Fuß der Treppe, die zum oberen Stockwerk führte, stehen.
»James!«, rief sie. »Komm herunter! Wir haben Gäste!«
Sie kehrte in die Küche zurück, setzte sich auf den Stuhl, der mir gegenüberstand, legte die Lesebrille auf den Tisch und rieb sich die Augen.
»Mein Mann kommt gleich«, erklärte sie. »Außer, er lässt sich ablenken, aber dann gehe ich nach oben und zerre ihn persönlich hinunter.«
»Bitte nicht«, protestierte ich. »Er muss doch eine Menge zu tun haben – das gilt für Sie beide –, und Sie haben sich schon so viel Mühe gemacht …«
»Das war doch keine Mühe«, unterbrach sie mich und goss ihre Tasse voll. »Ich musste mich dringend setzen, und Sie haben mir die perfekte Ausrede dafür geliefert.«
Ich hörte Schritte auf der Treppe, und einen Augenblick später trat James Hobson in die Küche. Er war einen Kopf größer als seine Frau, und sein Gesicht wirkte faltiger als ihres, doch er war genauso schlank gebaut wie sie. Seine leuchtend blauen Augen sahen mich durch seine Drahtgestellbrille an, und sein eisengraues Haar stand in Büscheln ab, als wäre er sich gerade mit der Hand hindurchgefahren. Er war lässig gekleidet, trug ein kariertes Flanellhemd, eine etwas angeschmutzte Chino-Hose und Sportschuhe.
»Lori?«, sagte Mrs. Hobson. »Erlauben Sie mir bitte, Ihnen meinen Mann James vorzustellen. James, sag Hallo zu Lori Shepherd und ihrer Tochter Bess. Sie sind gerade noch rechtzeitig aufgetaucht, um unsere Butter zu retten.«
»Hallo und danke«, sagte er und lächelte zu mir herunter. »Ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber Sie scheinen im Moment alle Hände voll zu tun zu haben.«
»Freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Mr. Hobson«, sagte ich.
»Bitte nennen Sie mich nicht Mr. Hobson«, sagte er lächelnd und ließ sich auf den Stuhl neben dem seiner Frau sinken. »Felicity und ich sind so lange mit Mr. und Mrs. Hobson angesprochen worden, dass wir unsere Vornamen fast vergessen haben.«
»Der Fluch aller Lehrer«, meinte Mrs. Hobson. »Jedenfalls einer davon.«
»Unter Erwachsenen«, sagte ihr Mann, »sind wir James und Felicity.«
»Und ich bin Lori«, sagte ich. »Ich weiß über Lehrer Bescheid. Meine Mutter hat zu Hause in den Staaten in der dritten und vierten Klasse unterrichtet.«
»Dachte ich mir doch, dass ich einen amerikanischen Akzent wahrgenommen hatte«, meinte James. »Lebt Ihre Mutter noch in den Staaten?«
»Sie ist ein Jahr bevor ich nach England gezogen bin verstorben«, antwortete ich.
»Das tut mir leid«, sagte James. »Und Ihr Vater?«
»James«, sagte Felicity und warf ihm stirnrunzelnd einen Blick zu, »du bist wieder mal ganz schön neugierig.«