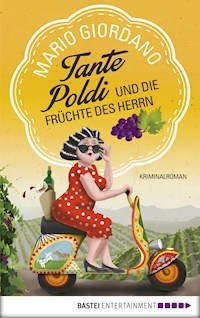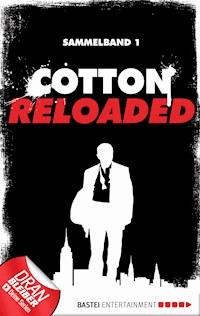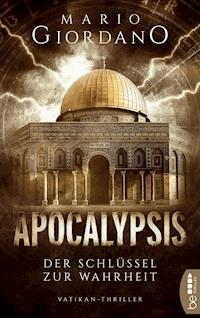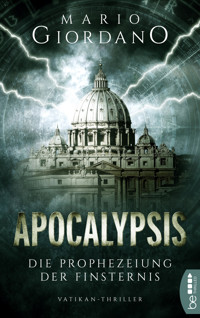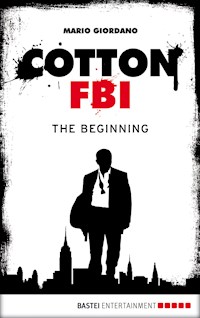Tante Poldi Sammelband: Die sizilianischen Löwen - Die Früchte des Herrn - Der schöne Antonio E-Book
Mario Giordano
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
Pfiat di München, ciao Sizilien! Tante Poldi reicht's, sie hat genug vom Leben, sie will ans Meer, um dort in Ruhe zu sterben. Auf Sizilien gibt es aber nicht nur Meer und gutes Essen, sondern auch die Familie ihres verstorbenen Mannes Peppe. Eine Kombination der Lebensfreude, die ihr das Sterben nicht gerade leicht macht. Und dann stolpert sie auch noch ständig über irgendwelche Leichen! Da ist Poldis Jagdinstinkt natürlich sofort geweckt. Und von der Mördersuche kann sie nicht einmal der attraktive Commissario Montana abhalten, dem es natürlich so gar nicht recht ist, dass so eine dahergelaufene Bayerin plötzlich ihre Nase in seine Angelegenheiten steckt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1245
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum
Vollständige Ebook-Ausgabe der 2015, 2016 und 2018 bei Bastei Lübbe erschienenen Titel Für diese Ausgabe: Copyright © 2015 (»Tante Poldi und die sizilianischen Löwen«), Copyright © 2016 (»Tante Poldi und die Früchte des Herrn«) und Copyright © 2018 (»Tante Poldi und der schöne Antonio«) by Bastei Lübbe AG, Köln Projektmanagement: Andrea Laarmann Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotive: © Martina Frank, München E-Book-Erstellung: readbox publishing GmbH, Dortmund ISBN 978-3-7517-0188-4 Bitte beachten Sie auch: lesejury.deMario Giordano
Tante Poldi Sammelband: Die sizilianischen Löwen - Die Früchte des Herrn - Der schöne Antonio
Über den Autor
Mario Giordano geboren 1963 in München, schreibt Romane (u.a. Apocalypsis-Trilogie), Jugendbücher und Drehbücher (u.a. Tatort, Schimanski, Polizeiruf 110, Das Experiment). Er lebt in Köln.
MARIO GIORDANO
Tante
PoldiUND DIE
SIZILIANISCHEN
LÖWEN
KRIMINALROMAN
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Daniela Jarzynka
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Einband-/Umschlagmotiv: © einsdreiundsechzig.com
E-Book-Produktion: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-732-50608-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
1. Kapitel
Erzählt, wie und warum die Poldi nach Sizilien kommt und was ihre Schwägerinnen davon halten. Ohne Perücke und Brandyflasche läuft gar nichts. Die Poldi lädt zum Schweinsbraten, macht ihrem Neffen ein Angebot, das er nicht ablehnen kann, und lernt ihre Nachbarn in der Via Baronessa kennen. Kurz darauf fehlt allerdings schon einer.
An ihrem sechzigsten Geburtstag zog meine Tante Poldi nach Sizilien, um sich dort gepflegt zu Tode zu saufen und dabei aufs Meer zu schauen. Das jedenfalls befürchteten wir alle, aber es kam eh immer was dazwischen. Sizilien ist kompliziert, nicht mal sterben kann man einfach so, immer kommt einem was dazwischen. Und dann geht nachher alles ganz schnell, und jemand ist ermordet worden, und niemand will irgendwas gesehen oder gewusst haben. Ganz klar, dass meine Tante Poldi, stur und bayerisch wie sie war, die Dinge selbst in die Hand nehmen und für Ordnung sorgen musste. Und damit fingen die Schwierigkeiten an.
Meine Tante Poldi. Eine glamouröse Erscheinung, immer für einen dramatischen Auftritt gut. In den letzten Jahren hatte sie etwas an Gewicht zugelegt, und, zugegeben, Alkohol und Schwermut hatten ein paar Furchen in ihre äußere Erscheinung gepflügt, aber sie war immer noch eine attraktive Frau und kopfmäßig eh voll auf der Höhe, meistens zumindest. Modisch sowieso. Als damals Music von Madonna erschien, trug die Poldi als Erste in der Westermühlstraße einen weißen Cowboyhut. In einer meiner ältesten Erinnerungen sehe ich sie noch zusammen mit meinem Onkel Peppe in einem leuchtend orangefarbenen Hosenanzug auf der Terrasse meiner Eltern in Neufahrn, in der einen Hand ein Bier, in der anderen eine Rothändle, und die ganze Welt bebte unter ihrem Lachen mit, das sie mit ihrem ganzen Körper zu bilden schien und das unerschöpflich in Schüben aus ihr herausbrach. Nur unterbrochen von den Zoten und Flüchen, deren Wiederholung mich am nächsten Tag zum Star des Schulhofs machten.
Isolde und Giuseppe hatten sich in München beim Fernsehen kennengelernt, wo die Poldi Kostümbildnerin und mein Onkel Peppe Schneider war, ein Beruf, den er aus Mangel an anderen Talenten und Visionen von seinem tyrannischen und hypochondrischen Vater übernommen hatte, meinem Großvater, dem es ansonsten ebenfalls an Talenten und Visionen gemangelt hatte, ganz im Gegensatz wiederum zu seinem Vater, also meinem Urgroßvater Barnaba, der ohne ein einziges Wort Deutsch zu sprechen in den Zwanzigerjahren nach München emigriert war, um dort einen lukrativen Südfrüchtegroßhandel aufzuziehen und reich zu werden. Aber ich komme ins Plaudern.
Es war die ganz große Liebe zwischen der Poldi und meinem Onkel Peppe. Leider sind dann ein paar Dinge gründlich schiefgelaufen. Zwei Fehlgeburten, der Alkohol, die Frauengeschichten meines Onkels, die Scheidung von meinem Onkel, die Krankheit meines Onkels, der Tod meines Onkels, die Sache mit dem Grundstück in Tansania und einige andere unerfreuliche Wendungen, Verwerfungen und Erdrutsche des Lebens haben der Tante die Schwermut beschert. Und dennoch hat sie weiterhin viel gelacht, geliebt, gesoffen und die Dinge einfach nicht auf sich beruhen lassen können, wenn ihr irgendwas gegen den Strich ging. Also im Grunde immer.
Die Poldi hatte ihren Beruf als Kostümbildnerin geliebt. Aber in den letzten Jahren hatte sie immer öfter Aufträge an jüngere Kolleginnen verloren. Es lief schlechter beim Fernsehen, die See war rauer geworden, und mit der Zeit hatte die Poldi dann auch langsam die Lust am Berufsleben verloren. Blöderweise hatte die unselige Angelegenheit in Tansania damals sie fast um ihr ganzes Sparbuch gebracht. Aber dann waren ihre Eltern kurz hintereinander verstorben und hatten ihr das kleine Häuschen am Stadtrand von Augsburg hinterlassen. Und weil meine Tante Poldi das Haus und alles was damit zusammenhing eh gehasst hatte – was also lag da näher, als sich zusammen mit ihren restlichen Ersparnissen und ihrer kleinen Rente einen Herzenswunsch zu erfüllen: Sterben mit Meerblick. Und Familie.
Wobei der Familie in Sizilien natürlich schwante, dass die Poldi ihrem Sterben mit dem einen oder anderen Gläschen nachhelfen wollte, bei ihrem Hang zur Schwermut, und dass man dagegen ansteuern müsse, mit allen Mitteln, auf allen Ebenen. Wenn ich jetzt Familie sage, dann meine ich vor allem meine drei Tanten Teresa, Caterina und Luisa und meinen Onkel Martino, Teresas Mann. Tante Teresa, denn die hat bei uns das Sagen, versuchte, die Poldi zu überzeugen, zu ihnen nach Catania zu ziehen, schon der sozialen Kontrolle wegen.
»Geh, Poldi, was willst bloß da draußen ganz alleine?«, lamentierte sie in ihrem besten Münchnerisch. »Zieh halt zu uns in die Nähe, dann hast immer jemand zum Ratschen und Kartenspielen, kannst alles zu Fuß erledigen, Theater, Kinos, Supermarkt und Krankenhaus alles praktisch um die Ecke, und ein paar schöne Polizisten hat’s da bei uns sogar auch.«
Aber keine Chance. Meerblick lautete Poldis interne Zielvereinbarung mit ihrer Schwermut, und Meerblick bekam sie, zusammen mit einem atemberaubenden Panorama von der Dachterrasse. Vorne das Meer und – bitte einmal umdrehen – hinten der Ätna. Was will man mehr? Blöd nur, dass die Poldi es mit ihrem schlimmen Knie kaum noch die Stufen zum Dach hinaufschaffte.
Torre Archirafi ist ein verschnarchtes, freundliches Nest an der Ostküste Siziliens zwischen Catania und Taormina, und wegen der kilometerlangen Uferlinie aus scharfkantigen, massiven Lavafelsen praktisch ungeeignet für jegliche Art touristischer Ausbeutung, Gentrifizierung und Verschandelung. Sollte man jedenfalls meinen. Tatsächlich hält das die Bewohner nicht davon ab, ihren Müll am Ufer zu entsorgen, sich gegenseitig nach Kräften das Leben schwerzumachen und im Sommer klotzige Holzplattformen und Imbissbuden zwischen die Uferfelsen zu rammen, wo sich dann am Wochenende Familien und junge Leute aus Catania zum Sonnenbaden, Essen, Zeitunglesen, Streiten, Essen, Radiohören, Essen und Flirten drängeln, und das alles nonstop beschallt von unidentifizierbarem Bassgewummere und betäubt von einem Dunst aus Kokosöl, Frittierfett und Fatalismus. Und mittendrin: meine Tante Poldi. Ich habe es nie verstanden, aber sie liebte es.
Dagegen der Winter in Torre: klamm, feucht, ein Meer aus Blei und Härte, das gegen die vorgelagerten Wellenbrecher anfaucht, als ob es sich den ganzen Ort holen wolle, und mit seinem Atem aus Salzdunst Schwarzschimmelblumen an jede Zimmerdecke kleckst. Die Klimaanlagen und schwachbrüstigen Heizungen haben keine Chance. Bereits im ersten April nach ihrem Einzug in der Via Baronessa musste meine Tante Poldi das ganze Haus neu weißeln lassen. Und jedes Jahr wieder aufs Neue. Die Winter in Torre sind kein Spaß, aber dafür sind sie immerhin kurz.
Zum Einkaufen fährt man ins nahegelegene Riposto oder besser gleich in den Megamercato Hipersimply, wo man eh alles kriegt. In Torre selbst gibt es nur noch den kleinen Tabacchi von Signor Bussacca für das Nötigste, die Bar-Pasticceria Cocuzza mit der traurigen Signora und ein Ristorante, um das sogar die Katzen einen Bogen machen. Immerhin hat Torre Archirafi eine Mineralwasserquelle zu bieten, und obwohl die Abfüllanlage am Hafen schon in den Siebzigerjahren stillgelegt wurde, ist meinen Tanten Acqua di Torre immer noch ein Begriff. Aus einer Seitenwand der alten Wasserfabrik ragt eine Reihe von Messinghähnen heraus, wo die Bewohner von Torre kostenlos ihr eigenes Mineralwasser zapfen können.
»Und wie schmeckt’s?«, fragte ich höflich, als mir die Poldi zum ersten Mal von der öffentlichen Mineralwasserzapfstation vorschwärmte wie von einem Schokoladenbrunnen.
»Scheußlich, natürlich, was denkst denn du? Aber der Lokalpatriotismus treibt’s rein.«
Geschlagene vier Wochen hatte mein Onkel Martino, der in seinem Berufsleben Vertreter für Tresore und Kassenanlagen für Banken gewesen war, auch sehr lukrativ, und der sich in Sizilien auskennt wie kein Zweiter, die Poldi kreuz und quer zwischen Siracusa und Taormina auf der Suche nach einem geeigneten Haus herumgefahren. Meine Tanten hatten die Poldi immerhin überreden können, sich auf einen Radius von höchstens einer Autostunde um Catania herum zu beschränken. Aber kein Haus erfüllte Poldis Wünsche, immer hatte sie etwas zu mäkeln, zu bekritteln oder zu bespotten. Dabei gab es im Grunde nur ein einziges, ziemlich esoterisches Kriterium.
»Weißt«, raunte mir die Poldi einmal zu, »es ist ganz einfach, und ich spür’s immer gleich. Es gibt gute Orte mit guten Schwingungen und schlechte Orte mit schlechten Schwingungen. Dazwischen, weißt, gibt’s nix, des ist sozusagen digital, die Binärstruktur des Glücks.«
»Die was???«
»Jetzt unterbrich mi fei nicht immer. I spür des sofort, ob ein Ort gut ist oder schlecht. Kann eine Stadt sein, ein Haus, eine Wohnung, ganz egal. I spür’s sofort. Die Energie. Des Karma. Ob des Eis trägt, verstehst? I spür des einfach.«
Bloß eben bei keinem Haus, das die Tanten für sie aussuchten. Das Eis trug nie, und das machte selbst Onkel Martino allmählich mürbe, was etwas heißen will, denn der wird sonst mit jeder Stunde hinter dem Lenkrad frischer, lehnt Klimaanlagen ab, trinkt selbst im August aus Prinzip nie einen Schluck Wasser, raucht dafür aber etwa so viel wie er atmet.
Ich erinnere mich an Ausflüge mit Onkel Martino in den Sommerferien, wenn ich wegen des ersten Sonnenbrandes eine kleine Strandpause einlegen musste. Ausflüge! Zwölfstündige Autofahrten durch Dantes Inferno, durch Luft wie geschmolzenes Glas, ohne Wasser oder Kühlung, in einem völlig verqualmten Fiat Regata. Wenn ich die Seitenscheibe herunterkurbelte, flämmte und schmirgelte mir der Schirokko das Gesicht weg, also atmete ich lieber weiter Zigarettenqualm. Die ganze Zeit über quasselte Onkel Martino ohne Unterlass auf mich ein. Über die Geschichte Siziliens, die Herkunft der besten Pistazien, Lord Nelson und die Geschwister Bronté, das Leben im Mittelalter, Friedrich II., die Vucceria von Palermo, den Zug der Thunfische und die Überfischung durch die japanischen Trawler und die Mosaiken von Monreale. Er kommentierte Live-Übertragungen von Radio Radicale aus dem italienischen Parlament. Er dozierte über Zyklopen, Griechen, Normannen, Araber, General Patton und Lucky Luciano und die gelben Seidentücher. Über die einzig denkbare Herstellung einer Granita. Über Engel, Dämonen, die Trinacria, die Wahrheit über Kafka und den Kommunismus und das Verhältnis von Körpergröße und Delinquenz innerhalb der männlichen Bevölkerung Siziliens. Faustregel: je kleiner der Mann, desto gefährlicher und umso wahrscheinlicher Mafioso. Dass ich kaum etwas verstand, störte ihn nicht. Mein Italienisch war saumiserabel. Außer einigen hilfreichen Schimpfwörtern und che schifo, allucinante, birra, con panna, boh, beh und mah – dem Reisewortschatz für Jugendliche am Strand eben – praktisch nicht vorhanden. Meinem Onkel Martino war das völlig Wurst, selbst dass ich irgendwann noch nicht einmal mehr die Kraft aufbrachte, irgendein Lebenszeichen von mir zu geben. Er fuhr einfach weiter, rauchend, quasselnd, mit jeder Stunde frischer und jünger, wie so eine Art sizilianischer Dorian Gray. Zwischendurch, in jenen seltenen Momenten, wenn er kurz schwieg, um sich eine neue MS anzuzünden, raunte er den Namen seiner Frau.
»Teresa!«
Einfach so, ganz unvermittelt, als sei sie irgendwo in der Nähe, im Kofferraum oder unter dem Rücksitz, und er müsse ihr etwas Wichtiges mitteilen.
»Teresa!«
Man musste auf diese seltsame Beschwörungsformel der Liebe nicht antworten, und meine Tante Teresa versicherte mir einmal, dass sie ihn jedes Mal rufen höre, ganz egal, wie weit er auch weg sei.
Hin und wieder hielten wir vor einer Provinzbank in irgendeinem ausgeglühten Kaff, wo ich endlich eine Cola bekam und Onkel Martino einen Caffè mit dem Bankdirektor trank, ein Geschäft abschloss oder einer verkeilten Tresortür die Hand auflegte, woraufhin die sich auf wundersame Weise wieder öffnete. Er hatte so seine Tricks im Geschäftsleben, mein Onkel Martino, zu denen auch das Pilzesuchen gehörte. Nebenbei aber zeigte er mir dann okkulte Templerfresken in achteckigen romanischen Kirchen, kühle Geheimgänge in arabisch-normannischen Burgen und anzügliche Stuckarbeiten in barocken Palästen. Was er eben so alles bei seinen Touren quer durch Sizilien entdeckt hatte.
Niemand kennt Sizilien also besser als mein Onkel Martino, aber ein geeignetes Haus für die Poldi zu finden stellte selbst seinen Erfahrungsschatz und seine Ortskenntnis, ja, seine gesamte Lebensweisheit gehörig auf den Prüfstand.
»Meine Taktik in den ersten Tagen«, gestand er mir, »war, die Poldi mürbe zu machen, weichzukochen, damit sie sich rasch entscheidet und ein Haus in der Nähe nimmt. Hitze, Autofahren, Frustration – eigentlich die perfekte Zermürbungstaktik. Aber deine Tante Poldi ist unzerstörbar, einfach unverwüstlich. Ein Panzer. Sie stöhnt und flucht, der Schweiß strömt ihr unter der Perücke ins Gesicht wie aus einem undichten Fass, aber sie gibt nicht auf. Sie ist zäh. Madonna, ich habe alles versucht.«
»Und wie habt ihr das Haus schließlich gefunden?«
»Zufall.«
Er schwieg und rauchte, rauchte und schwieg. Ich wartete. Auch eine Art Zermürbungstaktik. Wirkt beim Onkel immer, denn der will ja reden, der kann gar nicht anders, als sich ewig mitzuteilen.
»Beh! Also, hör zu. Letzter Tag, Nachmittag, fünf Häuser abgeklappert, ich am Rande der Verzweiflung, am Ende meines Lateins, brauche dringend einen Caffè. Und biege also an der nächsten Kreuzung von der Provinciale ab.«
»Nach Torre Archirafi.«
»Ich sag ja, Zufall. Wir hatten da gar kein Haus auf der Liste. Wir nehmen bloß einen Caffè in der kleinen Bar, du weißt schon, die mit der traurigen Signora an der Kasse, und ich komme mit einem Herrn ins Plaudern über dies und das. Und die Poldi? Wird schon wieder unruhig, will weiter. Ich aber lasse mich nicht hetzen, brauche eine Pause, nehme noch einen Caffè und plaudere mit dem netten Herrn weiter. Die Poldi hält es aber nicht aus, stürmt aus der Bar – und verschwindet.«
»Verschwindet? Die Poldi? Wie geht das denn?«
»Madonna, bildlich gesprochen, natürlich! Kehrt einfach nicht zurück. Nach einer Weile mache ich mir dann doch Sorgen und gehe sie suchen.«
Zigarette ausdrücken, neue aus der Packung rütteln, anzünden.
»Findest sie aber nicht«, versuchte ich, ihn zurück in die Spur zu lotsen.
»Als ob der Ort sie einfach verschluckt hätte. Also spreche ich den Priester an, der mir gerade entgegenkommt und gebe ihm eine Beschreibung der Poldi. Und Hochwürden gleich begeistert, weiß schon Bescheid. Ah, die nette Signora Poldina aus Monaco di Baviera! Meinen Namen kennt er auch schon, sämtliche Familienverhältnisse, weiß von der Haussuche und deutet auf ein ehemaliges Fischerhaus in der Mitte der Gasse, in der wir stehen. Und was sehe ich? Eine Ruine, sage ich dir, vollkommen heruntergekommen, nur Katzen, Eidechsen, Ginster und Gespenster. Aber als ich hingehe, sehe ich die Poldi schon aufgekratzt zwischen den alten Lavasteinmauern Räume abschreiten und mit den Füßen wippen und aufstampfen. Als sie mich sieht, ruft sie: ›Es trägt! Das ist es! Das ist ein guter Ort! Hast du gesehen, wie die Straße heißt? Super Schwingungen, eine ganz reine positive Energie!‹ Ihre Worte. ›Das ist mein Haus‹, hat sie immer wieder gerufen. Widerspruch zwecklos, du kennst sie ja.«
»War das Haus denn überhaupt zu verkaufen?«
»Machst du Witze? Hast du nicht zugehört?« Der Onkel faltete die Hände wie zum Gebet und schüttelte sie lebhaft vor der Brust. »Eine Ru-i-ne! Natürlich pappte da sogar noch ein uralter ›Vendesi‹-Zettel mit Telefonnummer an der Hauswand. Der Besitzer hat es kaum glauben können, als die Poldi ihn anrief. Den Rest kennst du ja. Wenn du mich fragst, hat sie zu viel bezahlt für diese Ruine, da hätte sie dir oben lieber ein vernünftigeres Bad einbauen lassen sollen.«
Ich weiß nicht, ob meine Tante Poldi zu viel für das Haus in der Via Baronessa bezahlt hat, und es ist mir auch herzlich egal. Großzügige Menschen kann man nicht übers Ohr hauen, und die Poldi ist der großzügigste Mensch, den ich kenne. Sie hat sich nie etwas schenken lassen oder noch billiger haben wollen. Sie hat jeden gut bezahlt, der ihr geholfen hat, die Handwerker, den Spazzino und Valentino, und im Restaurant immer ein ordentliches Trinkgeld gelassen. Nicht, dass sie mit dem Geld nur so um sich geworfen hätte, so dicke hatte sie es nun auch nicht, aber es war ihr eben auch nicht besonders wichtig.
Tatsache jedenfalls, dass sie mit dem Haus einen Volltreffer gelandet hatte. Das bestätigte auch mein Cousin Ciro, der Architekt ist und es wissen muss. Gemäß den Wünschen und den bescheidenen finanziellen Mitteln der Poldi restaurierte er im Laufe des nächsten Jahres das Haus in der Via Baronessa und stattete es genau so aus, wie die Poldi es wünschte. Es war wirklich ein schönes, schlankes Haus. In zweiter Reihe am Meer gelegen, nicht zu klein, nicht zu groß, dreistöckig mit einem barocken Balkon, einem kleinen Cortile und eben jener Dachterrasse mit diesem spektakulären Ausblick auf Meer und Vulkan. Eingeklemmt in eine schattige Gasse hinter der Uferpromenade, leuchtete es in Veilchenblau und Sonnengelb, mit grünen Fensterläden und einem klotzigen Messingschild, das jedem schon von Weitem verkündete, wer dort in der Via Baronessa 29 wohnte: Isolde Oberreiter. Meine Tante Poldi. Und alle paar Wochen oben unterm Dach auch ihr Neffe aus Deutschland. Irgendwie gehörte ich von Anfang an zur Einrichtung wie die afrikanischen Ebenholzgötzen und die beiden lebensgroßen Porzellanpudel.
Als das Haus dann im Jahr darauf bezugsfertig war, die Münchner Wohnung leer bis auf die Gespenster der Erinnerung, der Möbelwagen unterwegs Richtung Alpen, Apennin und Ätna – wartete Poldis alter Alfa Romeo vollgepackt und vollgetankt in der Westermühlstraße auf seine letzte große Tour. Und auf mich eben auch. Denn da meine Tante Poldi eine Heidenflugangst hatte und ihr eine so lange Autofahrt alleine und in nüchternem Zustand nicht zuzumuten war, hatten mich die Tanten gedrängt, die Poldi von München bis Torre Archirafi zu chauffieren.
»Du kannst dir deine Zeit doch einteilen und bist ungebunden«, erklärte meine Tante Caterina, die Stimme der Vernunft in unserer Familie, mir am Telefon. »Und schreiben kannst du genauso gut bei uns, vielleicht sogar besser.«
Womit sie meinte: Da du ja ohnehin arbeitslos und arbeitsscheu bist und noch nicht einmal ein Freundin hast, obwohl andere Männer in deinem Alter längst Familie haben, kannst du genauso gut auch bei uns herumgammeln, vielleicht ist es ja noch zu etwas gut.
Und das war es dann ja auch schließlich.
Zwischen München und Torre Archirafi stand mir jedoch noch eine vierunddreißigstündige Autofahrt in Isoldes übermotorisiertem Achtzigerjahre-Alfa mit den Überrollbügeln bevor, den sie ums Verrecken nicht gegen einen praktischeren Panda eintauschen wollte und den sie ohnehin nur selten bewegte, da man dazu ja amtlich nüchtern sein musste.
»Wir könnten doch bis Genua fahren und dann gemütlich die Fähre bis Palermo nehmen«, schlug ich zaghaft vor, aber die Poldi sah mich nur mitleidig an. Mein Fehler. Hätte ich wissen müssen. Wenn sie ein Wort wirklich von Herzen verachtete, dann gemütlich.
»Mei, wenn dir des jetzt zu viel ist mit mir …«
»Passt schon«, ächzte ich, und wir zuckelten los, nie über Hundert, schlichen unterm Brenner durch, perlten den ganzen Stiefel hinab, krochen an Mailand, Florenz, Rom und Neapel vorbei, immer Autostrada bis Reggio Calabria, verschlangen die ersten Arancini di riso morgens auf der Fähre zwischen Scilla und Charybdis, verfuhren uns in Messina, und ab da bestand die Poldi darauf, das letzte Stück bis Torre selbst zu fahren. Sie ließ den asthmatischen Alfa aufröhren und gab Stoff. Als wir in Torre ankamen, küsste ich den Boden und dankte der Muttergottes für meine Rettung und Wiedergeburt.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag«, ächzte ich. Denn das war genau der Tag, an dem meine Tante Poldi sechzig wurde.
Alle paar Tage kamen Onkel Martino und die Tanten in Torre vorbei, um nach der Poldi zu sehen. Meine Tanten hatten nämlich auch ein Projekt: die Poldi am Leben zu halten, so lange wie möglich, ihr zumindest zu mehr Lebensmut zu verhelfen. Und für Sizilianer ruht die Lebensfreude auf zwei Säulen: gut zu essen und über gutes Essen zu reden beziehungsweise zu streiten. Mein Onkel Martino zum Beispiel ging jeden Tag in seinen Tempel, den Fischmarkt von Catania. Nicht wirklich ein heiterer Ort, sondern mehr eine Art Börse, wo Männer angespannt und hochkonzentriert herumlungern, um die Fischstände auf die Qualität des Angebots und den Preis abzuchecken, auf das Bauchstück vom Thunfisch spekulieren oder darauf, dass ein Fischer verspätet noch mit einem Schwertfisch ankommt, wenn alle anderen sich schon eingedeckt haben, und man ihn dann günstiger und noch frischer als frisch bekommt. Das geht über Stunden so, auch kein Spaß. Oder der Onkel ging mit meiner Tante Teresa am Ätna Pilze suchen. Um Brot zu kaufen, fuhr er einmal um den Ätna herum und für Eier in eine Autowerkstatt bei Lentini, wo mutierte Hühner Eier mit zwei Dottern legten. Granita aß man nur bei Cipriani in Acireale, Cannoli alla crema di ricotta nur von Savia auf der Via Etnea in Catania. Als ich einmal die Pasticceria Russo in Santa Venerina für ihr Marzipan lobte, knurrte mein Onkel nur abfällig – und fuhr mit mir umgehend dorthin, um die Sache auf der Stelle zu überprüfen und sich anschließend anerkennend über meine Intelligenz zu äußern. Die Kirschen mussten aus S. Alfio sein, die Pistazien aus Bronte, die Kartoffeln aus Giarre, der wilde Fenchel von einem bestimmten, geheim gehaltenen alten Lavafeld, wo man mit Glück auch handtellergroße Austernpilze fand, wenn die Terranovas nicht schon vorher da gewesen waren. Arancini di riso aß man bei Urna in San Giovanni la Punta und Pizza bei Il Tocco unterhalb der Provinciale gleich hinter der Esso. Von den Mandarinen schmeckten nur die aus Siracusa und von den Feigen nur die von dem Straßenhändler in San Gregorio, von wo auch immer die herkamen. Wenn man überhaupt irgendwo außerhalb der eigenen vier Wände Fisch essen konnte, dann nur bei Don Carmelo in Santa Maria la Scala. Dort übrigens bekam man auch die beste Pasta al nero di seppia. Das Leben war kompliziert, das Land steckte fest im Würgegriff der Krise und der Korruption, Männer lebten noch immer bis Mitte vierzig oder bis zur Heirat bei ihren Eltern, weil sie keine Arbeit fanden – aber kulinarisch machte man keine Kompromisse. Was der Poldi, sinnenfroh und neugierig, wie sie war, schon immer an Sizilien gefallen hatte. Nur den Weingeschmack meines Onkels fand sie miserabel, denn weder er noch die Tanten tranken gerne. Überhaupt wird in Sizilien wenig getrunken, allerhöchstens ein Schlückchen zum Essen, das war’s. Anfänglich ein Problem für die Poldi, bis sie die Weinabteilung im Hipersimply entdeckte und später Gaetano Avola mit seinem Weinberg in Zafferana kennenlernte. Aber ich greife vor.
Poldis Tag begann immer mit einem Prosecco zum Wachwerden. Dann folgte ein Espresso mit Schuss, danach ein tüchtiger Schuss ohne Espresso. Manchmal, wenn die Gezeiten der Schwermut ihr besonders zusetzten, spazierte sie anschließend nach Praiola, einem abgelegenen kleinen Kiesstrand. Ein verwunschener Platz mit klarem Wasser wie aus flüssigem Kobalt, übersät mit Lavabrocken, von Ebbe und Flut zu schwarzen und rostbraunen Dinosauriereiern rund geschliffen. Meist war sie dort ganz allein. Erst im Hochsommer kamen später am Tag die Familien mit ihren Radios, Picknickkörben, Kühltaschen, Schwimmwürsten und Sonnenschirmen und müllten den kleinen Strand zu, bis er im Oktober einer Deponie glich und von den Winterstürmen dann wieder gereinigt wurde. Dort tauchte meine Tante Poldi manchmal ihre Füße ins klare Wasser, warf ein besonders schönes Dinosaurierei für meinen Onkel Peppe ins Meer, faltete die Hände vor der Brust und sagte: »Namaste, Leben.« Und dann noch: »Lecktsmialleamarsch.«
Um elf dann das erste Weißbier, Umberto Tozzi dabei bis zum Anschlag aufgedreht, der Gloria schmetterte, dass es selbst die Sirenen an der Meerenge von Messina in den Wahnsinn getrieben hätte.
Wenn meine Cousinen und Cousins zu Besuch waren, grölten wir den Schlager gemeinsam mit, nur statt »Gloria« immer mit »Poldi«. So eine Art Hymne wurde das, kann man sagen.
Seltsamerweise beschwerten sich die Nachbarn nie. Seltsamerweise liebten sie die Poldi vom ersten Tag an, trugen ihr die Einkäufe nach Hause, erledigten kleine Reparaturen im Haus, begleiteten sie zu Behördengängen und luden sie zum Kartenspielen ein. Was für einen Knacks auch immer es im Leben meiner Tante gegeben hatte – in ihrer Nähe fühlte sich jeder wohl. Die Nachbarn nannten sie nur »Donna Poldina«.
Die Nachbarn: links Signora Anzalone mit ihrem Mann, beide auch schon älter. Das Haus zur rechten gehörte einem Dottore Branciforti, Steuerberater aus Catania, der aber höchstens an den Wochenenden mit seiner Geliebten kam, beziehungsweise in den Sommermonaten mit der Familie. Am Ende der Straße lebte Elio Bussacca, dem der Tabacchi an der Ecke gehörte und der meiner Tante schließlich auch Valentino vermittelte.
In den ersten Wochen nach dem Umzug schien für die Poldi noch alles nach Plan zu laufen. Sie hatte sich mit ihren alten Möbeln, den Bauernschränken, der antiquarischen Waffensammlung ihres Vaters, den afrikanischen Ebenholzgötzen und dem Porzellannippes eingerichtet und prostete nun abwechselnd dem Meer und dem Vulkan zu. Wenn sie sich dem Ätna zuwandte, zündete sie sich aus Respekt vor dem großen Raucher immer eine MS an, eine Morto sicuro, wie man in Italien sagt, und trank Brandy dazu.
Die Hitze schien an ihr abzuperlen wie Tau an einem Lotusblatt, obwohl ihr der Schweiß nur so unter der Perücke herabtroff.
Überhaupt die Perücke.
Seit ich denken kann, trug sie die. Ein gewaltiges schwarzes Monstrum, das sich je nach Mode in unterschiedlichen Frisuren über ihrem Kopf zusammenballte wie eine Gewitterwolke. Was sich darunter verbarg, hatte der Familienlegende nach noch nie jemand zu sehen bekommen. Selbst mein Onkel Peppe hatte sich diesbezüglich nur vage geäußert. Allerdings vermute ich, dass es Vito Montana später vergönnt war, einen Blick unter das Allerheiligste zu werfen. Aber auch der bewahrte diesbezüglich diskretes Stillschweigen.
Gleich am ersten Sonntag nach ihrem Einzug lud die Poldi die Tanten, meine Cousinen und Cousins und mich, der sich im Gästezimmer unterm Dach immer noch von der Hinfahrt erholen musste, zu Schweinsbraten, Biersauce, Knödel und Kraut ein. Mittags. Mitte Juli. In Sizilien. Zur Begrüßung gab es einen Martini im Wasserglas, der einen finnischen Seemann ins Koma geschossen hätte. Während die Poldi drinnen noch die Sauce andickte und abwechselnd einen Schluck Bier angoss und den zweiten selber trank, drängten wir uns in dem aufgeheizten kleinen Innenhof unter der einzigen Markise zusammen wie Pinguine im Sturm. Aber riechen tat es schon mal herrlich. Als die Poldi dann mit diesem Monstrum von Schweinsbraten herauskam, schweißgebadet, den Kopf so rot wie kurz vorm Platzen, bin ich gleich panisch aufgesprungen.
»Komm man bloß in den Schatten, Poldi!«
Aber meine Tante Poldi hat mich – wie so oft – nur voller Mitleid angesehen. »Mei, glaubst du, dass i da nach Sizilien gekommen bin, um im Schatten zu sitzen? Eine Sonne will i haben, eine richtige Sonne, die eine Kraft hat! Il sole! Weil, in Italien ist die Sonne ein Kerl, genau wie des Meer und der Vulkan, und für diese drei Kerle bin i schließlich hergekommen! Also jetzt setzt euch endlich, i hol die Knödl.«
Und er war wirklich ein Gedicht, dieser Schweinsbraten, la fine del mondo, selbst bei vierzig Grad. Meine Cousins, die naturgemäß eine gewisse Skepsis gegenüber deutschem Essen an den Tag legen, haben zwar erst gezögert, aber nach den ersten höflichen Bissen auch reingehauen wie die Bierkutscher. Nur das Blaukraut rührten sie wie immer nicht an. Von der Hitze hat sich jedenfalls niemand einschüchtern lassen.
»Sag einmal, wie kommst denn du eigentlich zurück nach Deutschland?«, fragte mich meine Tante Poldi unvermittelt.
Ich zuckte mit den Schultern. »Kann mir ja demnächst mal einen Flug buchen.«
Die Poldi schüttelte den Kopf, als habe ich etwas sehr Dummes gesagt.
»G’fällt’s dir nicht da oben im Gästezimmer?«
»Äh, doch klar.«
»Schreibst?«
»Geht so.«
»Kann man vielleicht mal was lesen?«
Genau die Frage, die ich hasste.
»Weißt du, Poldi, im Augenblick eher nicht, ist alles noch mehr so im Fluss. Work in progress.«
Leichtsinnigerweise hatte ich ihr auf der Fahrt von meinem ähnlich selbstzerstörerischen Projekt erzählt – eine große, epische deutsch-sizilianische Familiensaga über drei Generationen zu schreiben. So einen richtig fetten Roman, prall, saftig, brillant erzählt, voller Wendungen, geistreichen Bildern, schrägen Typen, stoppelbärtigen Schurken, ätherischen Schönheiten, viel Haut, Verwicklungen der Liebe, Schelmenstücken, glühenden Tagen und samtigen Nächten, berstend von historischen Parallelsträngen. Der ganz große Wurf eben, mein Ticket zum Welterfolg. Blöd nur, dass ich kein Stück vorankam. Totale Blockade, der reine Krampf, Sisyphos schon auf den ersten Metern. All das hatte ich meiner Tante Poldi schon zwischen Brenner und Messina gestanden, und sie hatte nur genickt, denn vom Scheitern verstand sie was.
»Mei, i hab nur gerade ’dacht, wenn’s dir da oben g’fällt, dann kannst ja bleiben. Respektive öfter kommen, ich meine, regelmäßig. Zum Schreiben und Recherchieren. Und deinem Italienisch tät’s auch gut tun.«
Ich stöhnte. »Ja, danke, noch mehr Druck.«
Aber aus irgendeinem Grund ließ meine Tante Poldi nicht locker. »I versteh gar nicht, was du willst! Da oben hast du dein eigenes Bad und deine Ruhe. Kannst kommen und gehen, wie es dir passt, und falls sich amoremäßig was ergibt, kannst du sie jederzeit mitbringen.«
Auch das noch. Aber klar, dass meine Tanten natürlich sofort begeistert auf den Zug aufsprangen, denn damit hätten sie jemand aus der Familie vor Ort, der ein Auge auf die Poldi haben konnte. Und als mich Tante Teresa am nächsten Sonntag zum Mittagessen einbestellte, wusste ich, dass jeder Widerstand zwecklos war. Immerhin, dachte ich, kannst du beim Scheitern aufs Meer schauen, ist doch was. Und so flog ich auf Kosten der Tanten einmal im Monat aus Deutschland ein, wohnte in der Via Baronessa 29 unterm Dach, haderte tagsüber mit meiner Mittelmäßigkeit und hörte mir abends, wenn meine Tante Poldi angeschickert genug war, staunend den Stand ihrer Ermittlungen im Mordfall Valentino an.
2. Kapitel
Erzählt von Valentino, einem sehr privaten Fotoprojekt der Poldi, vom Nachmittag in Torre Archirafi und der traurigen Signora Cocuzza. Die Poldi macht sich Sorgen und wird um ein Haar von Palmen erschlagen. In Acireale lässt sie etwas mitgehen und entdeckt kurz darauf ein kleines, aber schwer bewachtes Paradies, dem ein Löwe abhanden gekommen ist.
Valentino war ein stiller, schmächtiger Junge von knapp zwanzig Jahren. Einer jener sizilianischen Typen, in denen das arabisch-normannische Erbe Siziliens durchbricht. Schwarze Locken, Oliventeint, breite Nase, breiter Mund, blaue Augen.
»Ein schöner Bursche«, fand die Poldi. »Genau so ein Spuchti wie der Peppe früher. Könnt man glatt schwach werden, nachhert.«
Denn ob man es glaubt oder nicht – trotz ihrer sechzig und der Fülle war die Poldi immer noch schwer angesagt, jedenfalls den Blicken der Männer im Ort nach zu urteilen. Die Poldi war seit jeher ein Feger gewesen, kein Kind von Traurigkeit und den Männern an sich, zumal in einer feschen Polizeiuniform, herzlich zugetan. Das wurde mir klar, als sie mir einmal die Fotoalben mit ihrer Polizistenkollektion zeigte. Die Poldi hatte nämlich ein Hobby: gut aussehende Verkehrspolizisten aus aller Welt zu fotografieren. Und da sie viel herumgekommen war, hatte sie in den vergangenen dreißig Jahren fünf dicke Alben mit uniformierter, dampfgebügelter Männlichkeit angefüllt, von Alaska bis Australien, von Belgrad bis Buenos Aires. Alle Fotos ordentlich datiert und viele mit Namen, wenn die Poldi die Ordnungshüter näher kennengelernt hatte. Da posierten tätowierte Maori in blütenweißen Shorts, schwang ein schnurbärtiger Sikh in makellosem Khaki seine Rute, fletschten berittene New Yorker Cops mit verspiegelten Brillen die Zähne. Eine stolze Parade der Zackigkeit, der Bügelfalten und Schnauzbärte. Kanadische Mounties in flammend roter Paradeuniform, schmalhüftige rotwangige Schotten in Schwarz-Weiß, kurzbeinige Bolivianer ganz in Oliv und mit feschem Barett, wehmütige sibirische Jungs mit Fellmützen – meine Tante Poldi hatte sie alle gehabt. Am liebsten aber fotografierte meine Tante Vigili urbani. Italienische Verkehrspolizisten mit ihren weißen Handschuhen und manchmal auch den weißen Tropenhelmen machten bestimmt die Hälfte der Aufnahmen aus.
»Die schönsten, musst wissen, gibt’s in Rom. Mit weitem Abstand. Kein Vergleich, absolut unerreichbar. Eine Grazie wie der Nurejew ein jeder. Da sitzt jede Handbewegung und die Uniform eh. Und musst nicht glauben, dass einer von denen jemals lächeln würde, so weit kommt’s noch. G’lächelt wird erst nach Dienstschluss, i weiß, wovon i red. Aber hier, schau, vorgestern in Taormina, da hab i auch schon ein Prachtexemplar g’sichtet.«
Immer mittwochs besuchte die Tante in Taormina nämlich die Sprachschule von Michele, einem Freund meines Cousins Ciro. Der Mittwoch war daher der einzige Tag, an dem sie nüchtern blieb. Zwar sprach die Poldi ein ganz ordentliches Italienisch für den Alltagsgebrauch, aber das reichte ihr nicht.
»Wozu der Stress?«, fragte ich sie einmal. »Wenn man sich eh totsaufen will.«
Ungeschickt, ganz ungeschickt, den Verdacht meiner Tanten so unverblümt auszusprechen.
»Ja, was ist jetzt des für eine bescheuerte Frage?«, blaffte sie mich an. »So lange du kein Passato remoto hinkriegst, Bürscherl, brauchst gar nicht so oberschlau daherreden. Hast mi?«
Jedenfalls hatte die Poldi in Taormina einen besonders feschen Vigile fotografiert, den sie bei nächster Gelegenheit näher kennenlernen wollte. Er wirkte nicht mehr ganz so taufrisch mit seinem liebevoll gestutzten grauen Vollbart und seiner kleinen Wampe, trug seine makellose Uniform jedoch mit der beneidenswerten Arroganz eines gut aussehenden Volltrottels, dem Mama immer noch die Hemden bügelte.
Aber zurück zu Valentino. Der war kein Volltrottel, obwohl er selbstverständlich auch noch bei seinen Eltern lebte. Aber nun hatte er ja auch weder einen Ausbildungsplatz noch einen geregelten Job gefunden. Dabei war Valentino wirklich kein dummer Junge, wie die Poldi rasch merkte. Wie viele junge Sizilianer schlug er sich mit Gelegenheitsjobs durch und trug sich mit dem Gedanken, nach Deutschland auszuwandern. Für Jahrzehnte zu emigrieren ist für Sizilianer ein Klacks. Koffer packen, bacio, addio – und los. Leichter jedenfalls, als ein Kurztrip mit dem Billigflieger zum deutschen Cousin. Persönliche Anmerkung meinerseits.
Valentino ging der Poldi bei kleinen Reparaturen im Haus zur Hand, die bereits kurz nach der Restaurierung des Hauses fällig wurden. Nichts gegen meinen Cousin Ciro, aber beim Dach haben seine Leute total geschlampt. Als ich oben im Bad einmal die Glühbirne wechseln wollte, schwappte mir ein Niagarafall von Regenwasser aus der Lampenschale entgegen. Ein Wunder, dass mich nicht der Schlag getroffen hat.
Valentino konnte Lampen anschließen, Bilder andübeln, die Klimaanlage auswechseln und Einkäufe im Hipersimplyerledigen. Ein Junge mit vielen Talenten. Die Poldi hatte ihn schnell in ihr Herz geschlossen, und da war ja bekanntlich viel Platz. Sie paukte sogar Deutschvokabeln mit ihm. Wobei er mit der Aussprache, die er da lernte, nördlich von Aschaffenburg bereits Probleme bekommen hätte. Aber aus Deutschland wurde ja ohnehin nichts, denn Anfang August verschwand Valentino plötzlich spurlos.
Die Poldi wartete einen ganzen Tag auf Valentino, der versprochen hatte, sich um einen verstopften Abfluss zu kümmern. Meine Tante Poldi nahm es nicht krumm, wenn man sie ein Mal versetzte. Aber als sie auch am nächsten und übernächsten Tag nichts von Valentino hörte und er auch nicht ans Handy ging, wunderte sie sich zunächst, ärgerte sich dann und machte sich schließlich Sorgen. Denn erst jetzt wurde ihr klar, wie wenig sie im Grunde über Valentino wusste.
Dass sie gerade mal seinen Nachnamen kannte. Candela.
Dass sie aber keine Ahnung hatte, wo er eigentlich wohnte.
Signora Anzalone hatte Valentinos Verschwinden nicht einmal bemerkt, und Signor Bussacca zuckte nur mit den Schultern.
»Boh! Wo soll er schon sein! Wird ein Mädchen kennengelernt haben. Der taucht schon wieder auf.«
Weder beruhigte das die Poldi, noch glaubte sie es.
»Wann haben Sie ihn denn zuletzt gesehen?«
Bussacca dachte nach. »Gestern? Nein, muss vorgestern gewesen sein. Oder am Montag. Ja, am Montag, da hat er eine Packung Lucky Strike und für fünfzig Euro Guthaben für sein Handy gekauft.«
Daran erinnerte sich die Poldi. Valentino hatte ihr am Montag den schweren Topf mit dem Zitronenbäumchen auf die Dachterrasse gewuchtet, sich danach eine neue Packung Zigaretten aufgemacht und den Guthabencode auf einer neuen Telefonkarte freigerubbelt und über sein Handy aktiviert.
»Erinnern Sie sich, für welche Telefongesellschaft die Scheda telefonica war?«
»Eine TIM. Die anderen waren aus.«
Die Poldi erinnerte sich an die blau-rote Pappkarte und wunderte sich schon wieder, denn Valentino hatte sein Handy sonst immer über eine rot-weiße Karte aufgeladen. Und ein nagelneues Klapphandy hatte er da am Montag auch gehabt. Fiel ihr nun auf.
»Warum hat er den Anbieter gewechselt?«, wunderte sie sich laut, aber darauf sagte Signor Bussacca wieder nur »Boh!«, was die italienische Kurzfassung von »Ich-habe-absolut-keinen-blassen-Schimmer« ist.
»Also gehst wo am besten hin, wenn’st was wissen willst?«, fragte die Poldi mich später ab und gab auch gleich die Antwort. »Zur Wasserstelle gehst. Weil, alle Tiere treffen sich immer an der Wasserstelle, die kleinen wie die großen. Den Räuber wie die Beute – alle zieht’s zum Wasser, da ist der Mensch nicht anders. Und was, frag ich dich, ist die Wasserstelle von Torre Archirafi?«
»Äh, die Mineralwasserquelle?«
Die Poldi seufzte. »Mei, im übertragenen Sinn!«
»Die Bar?«
»Cento punti!«, rief meine Tante Poldi aus und nahm einen Schluck.
In der Bar Gelateria Cocuzza war die Poldi natürlich längst bekannt, weil sie da jeden Nachmittag eine Maulbeergranita mit Sahne oben und unten und einem Brioche nahm. Duftend, im weißen Kaftan, mit dramatischem Lidstrich, tüchtig Rouge und goldenen Riemchensandalen legte sie in der Bar an wie ein Kreuzfahrtschiff in einer Provinzmarina. Immer um fünf, wenn sich nach dem langen glühenden Mittag die Häuser wieder öffneten und der ganze Ort zur Passeggiata aufbrach. Die ging so: Da es ohnehin keine Geschäfte zum Bummeln gab, drehte man eine kurze Runde am Lungomare, dann aber knickte die Spur der Flaneure schon zum klimatisierten Himmelreich der Bar ab, wie die Flugbahn von Kometen, die der Sonne zu nahe kommen.
Kein Wunder aber auch, denn aus der Bar wehte von morgens bis abends – außer an Dienstagen – von zwei Ventilatoren herausgeschaufelt eine wunderbare Brise aus Nordpol und dem Versprechen von Vanille, Mandelmilch, Kaffee und naturidentischen Aromastoffen, die jeden, der kein Stein war, bis ins Mark vor Wonne erschütterte. Draußen auf dem Platz flirrte der sizilianische Sommernachmittag, aber drinnen vibrierte die Arktis unter dem Surren der Ventilatoren und der Klimaanlage, die die Flecken unter den Achseln verdunsten und die Augusthitze für die Dauer eines Gelato vergessen ließen. Acht Sorten leuchteten da in cremigen, glänzenden Gebirgen in der Auslage, in unmittelbarer Nachbarschaft zu frischen Cremetörtchen voller Walderdbeeren, Mandelgebäck, Cornetti, Brioches und Marzipanfrüchten. Und ganz am Ende der Theke dufteten Blätterteigtaschen, goldene Arancini-Zipfel, Pizzette und Tramezzini. Hinter der Theke, tief unter Aluminiumdeckeln verborgen, schlummerten Granita und Flaschen voller eiskalter Mandelmilch. Kurz gesagt: die Verheißung, dass es einen gütigen Gott gibt.
Dieser Eindruck verflüchtigte sich jedoch, sobald man die Bar betrat und in das Gesicht von Signora Cocuzza blickte, die mit einem Ausdruck so voller Traurigkeit hinter ihrer Kasse saß, dass es einem das Herz brechen konnte. Wie alt war sie? Niemand wusste es genau. Fünfzig? Sechzig? Hundert? Vielleicht war sie ein Gespenst, so klapprig und dürr, umweht von diesem schwachen Geruch von Mottenkugeln und Ewigkeit. Die Poldi hatte nur in Erfahrung bringen können, dass ihr Mann vor zehn Jahren verstorben war. Ihre beiden erwachsenen Söhne hinter der Theke dagegen wirkten kerngesund in ihrer Augustlethargie, mit ihren gezupften Augenbrauen, den Oberarm-Tribals, ihren delinquenten Haarschnitten und Fußballtrikots.
Signora Cocuzza lächelte nie und sprach auch fast nie. Sie kassierte nur, reichte einem den Bon, rang sich ein dürres Lächeln ab und starrte dann wieder ins Leere, als koste sie jeder Akt des Kassierens einen letzten Lebensfunken. So etwas musste einen ja neugierig machen, und deswegen hat es die Poldi auch gar nicht so sehr wegen der leckeren Granita in die Bar gezogen. Signora Cocuzza, das sah die Poldi gleich, musste einmal eine sehr schöne Frau gewesen sein. Aber sie sah eben auch, dass in der klapprigen Gestalt ein großer Schmerz tobte, denn davon, wie gesagt, verstand die Poldi was.
»Verzeihen Sie, Signora, haben Sie Valentino in den letzten Tagen vielleicht gesehen oder was von ihm gehört?«
Die Frage schien nur langsam in das Bewusstsein von Signora Cocuzza einzusickern. Immer noch hielt sie der Poldi den Bon für die Granita entgegen.
»Valentino Candela, den kennen Sie doch«, fuhr die Poldi unbeirrt fort und nahm ihren Bon entgegen. »Seit drei Tagen ist der Bengel wie vom Erdboden verschluckt. Vielleicht ist er in der Zwischenzeit ja mal hier aufgetaucht. Ich meine, nicht, dass ich mir Sorgen mache, aber man macht sich halt Gedanken.«
Signora Cocuzza schüttelte kaum wahrnehmbar den Kopf, als koste sie das allein schon furchtbare Anstrengung.
»Tut mir leid«, flüsterte sie.
Und schwieg wieder. Um sie nicht weiter zu bedrängen, wollte Poldi schon mit ihrem Bon zur Theke gehen. Aber Signora Cocuzza war noch nicht fertig.
»Donna Poldina …«
Kaum zu verstehen, ein Hauch von Stimme nur. Überrascht von der unerwarteten persönlichen Ansprache, stand die Poldi sofort wieder vor der Kasse, sah zu, wie die traurige Signoraeinen Kuli aus ihrer Kitteltasche herauswuchtete wie ein großes Gewicht und etwas auf die Rückseite eines Zettels kritzelte. Eine Adresse in Acireale.
»Die Eltern«, hauchte Signora Cocuzza und reichte ihr den Zettel.
Die Poldi überlegte kurz. Die Frage, woher SignoraCocuzza die Adresse kannte, lag ihr auf der Zunge. Die Poldi beließ es jedoch vorläufig dabei, dankte, reichte der Signora nur den Bon zurück und änderte ihre Bestellung.
Wie gesagt, Nachmittag. Wie gesagt, August. Was erstens bedeutete: immer noch heiß, und zweitens, dass die Poldi schon nicht mehr wirklich nüchtern war. Dennoch – ein Kilo Gelato im hübsch verpackten Styroporbecher mit Blümchenpapier und Schleifchen auf dem Beifahrersitz – steuerte sie ihren Alfa tapfer nach Acireale. Alles nicht weit, praktisch um die Ecke, aber die gewundene, enge Provinciale, links und rechts von hohen alten Lavasteinmauern eingefasst, setzte der Poldi dann doch mächtig zu in ihrem Zustand. Ständig musste sie ausweichen, wenn ihr die Zitronentransporter entgegenbretterten. Kurz vor Santa Tecla schoss ein Lastwagen, beladen mit ausgewachsenen Palmen und Olivenbäumen, aus dem Tor einer Großgärtnerei heraus. Im letzten Moment konnte die Poldi noch eine Vollbremsung hinlegen. Der Lastwagenfahrer hupte sie wütend an, bog auf die Straße ein und raste davon. Die Poldi blieb für einen Moment keuchend am Straßenrand stehen und starrte auf das große Tor mit dem Leuchtschild daneben:
»PIANTE RUSSO«
Um ein Haar von Palmen erschlagen, dachte die Tante kopfschüttelnd, mei, das hätte alles durcheinandergebracht, nachert.
Obwohl sie sich in Acireale nicht auskannte, fand die Poldi die Adresse am Stadtrand auf Anhieb. Überhaupt fand sie sich an jedem Ort der Welt bestens zurecht, von Jakarta bis Lima, denn da hatte sie einen unschlagbaren Trick: Sie fragte alle Nase lang nach dem Weg. Alle hundert Meter hielt sie an, einerlei ob hinter ihr gehupt wurde, und haute den Nächstbesten nach dem Weg an. Das Verfahren war robust gegen Fehlinformationen irgendwelcher Spaßvögel, und mit der Präzision eines Navigationssystems landete die Poldi immer auf dem kürzesten Weg im Ziel.
Maria und Angelo Candela waren noch keine fünfzig und wirkten dennoch alt. Seit vier Jahren arbeitslos, lebten sie von Sozialhilfe und von dem bisschen, das Valentino mit nach Hause brachte. Eine kleine Wohnung, in der es nach Zigaretten, Zwiebeln und Verzweiflung roch, aber Poldi bemerkte auch gleich den nagelneuen Flachbildfernseher. Valentinos Eltern wirkten nicht einmal überrascht, als die Poldi so unvermittelt bei ihnen auf der Matte stand.
»Valentino hat viel von Ihnen erzählt, Donna Poldina«, sagte Maria und verteilte das mitgebrachte Gelato eilig auf drei Gläser. »Irgendwie sind Sie uns schon ganz vertraut geworden.«
»Und wo steckt er nun, der Valentino?«
Die Candelas wechselten einen beunruhigten Blick, der der Poldi nicht entging.
»Wir wissen es nicht«, sagte Angelo leise. »Seit drei Tagen haben wir nichts von ihm gehört.«
»Macht er so was öfter?«
Die Candelas schüttelten die Köpfe und löffelten ihr Eis, bevor es ganz geschmolzen war. Oder um nicht reden zu müssen, dachte die Poldi.
»Haben Sie denn gar keine Vermutung, wo er stecken könnte?«
Abermals Kopfschütteln. Die Plastiklöffel klapperten in den Gläsern. Die Poldi glaubte den beiden kein Wort. Nachdenklich schleckte sie ihren Löffel ab. Schokoladen- und Pistazieneis hatten sich vermischt und schmeckten süß und bitter und salzig. Nach Tränen und enttäuschten Hoffnungen, dachte die Poldi, und alles auf einmal, wie immer in diesem Land.
»Bitte verstehen Sie mich richtig«, klaubte die Poldi ihr bestes Italienisch zusammen. »Ich will mich nicht in Ihre Privatangelegenheiten mischen. Aber ich sehe doch, dass Sie sich Sorgen machen. Ich mache mir ja auch Sorgen. Weil … ich meine, vielleicht steckt er ja in Schwierigkeiten.«
Das Wort »Schwierigkeiten« ließ die beiden zusammenzucken. Etwas schien sich tief in Marias Innerem gelöst zu haben und blubberte als gequälter Seufzer an die Oberfläche.
»Und spätestens da«, erklärte mir meine Tante Poldi später, »bei diesem Seufzer, hab i g’wusst, dass der Valentino wirklich in irgendein Riesenschlamassel verwickelt ist. Weil, von Schlamassel und solchen Seufzern versteh i was. Alarmstufe Rot, du weißt schon. Da hab i geahnt, dass seine Eltern schon nicht mehr glaubt haben, dass er zurückkommt. Und dass sie mir auch nicht mehr erzählen würden. Omertà und so, weißt schon. Und da ist dann so ein Programm bei mir angesprungen, weißt. Dass i ihn jetzt finden muss, den Valentino. Weil es nämlich pressiert. Und nur deswegen hab i auch des kleine Mosaiksteinchen mitgehen lassen.«
Entschlossen legte die Poldi ihren Eislöffel zur Seite und sah Maria an. »Ob ich vielleicht sein Zimmer sehen könnte?«
»Vielen Dank für das Eis, Signora Poldi«, sagte Angelo förmlich, »aber Sie sollten jetzt besser gehen.«
Maria warf ihrem Mann einen scharfen Blick zu und erhob sich. »Aber vorher können Sie natürlich noch sein Zimmer sehen.«
Valentinos Zimmer sah aus wie jedes andere Zimmer eines jungen Mannes, der noch zu Hause wohnt. Ein ungemachtes Bett, nachlässig verstreute Wäsche, ein uralter Laptop mit angeschlossenem Game-Controller, Ferrariposter, Fußballhelden und Pin-ups an den Wänden. Es roch nach Mottenkugeln und Dope. Auf dem Sims draußen vor dem Fenster gedieh in einem Topf eine prächtige Cannabisstaude.
Während die Poldi sich aufmerksam umsah, blieb Maria in der Tür stehen, als fürchte sie, die Geister zu stören, die dieses Zimmer bewohnten.
»Das ist eine Cannabisart, die man nicht rauchen kann«, sagte Maria. »Die hat er nur zur Zierde, weil sie so schön ist.«
Die Poldi dachte sich ihren Teil. Auf einer Kommode entdeckte sie Lehrbücher für Deutsch, japanische Mangas und eine Reihe kleiner bunter Mosaiksteinchen, die im Sonnenlicht glitzerten. Helle Tonscherben, auf einer Seite leuchtend glasiert, keine größer als eine Fingerkuppe. Ganz außen auch ein gelber Kristall, wie man sie mit etwas Glück manchmal am Ätna findet. Etwa drei Zentimeter groß, ein rhombisches Prisma, auf einem porösen Stein gewachsen, hübsch anzusehen. Die Poldi nahm ihn in die Hand, und als sie ihn zurücklegte, rochen ihre Finger ein bisschen nach Schwefel. Die Poldi machte ein Foto mit ihrem Handy von dem kleinen Arrangement. Und schwupps, ehe sie sichs versah, hatte sie schon eine der glasierten Scherben heimlich eingesteckt. Tut man nicht, so was, aber es war auch mehr so ein Impuls, der sie da leitete. Eine Art genetisches Programm, wie sie mir erklärte. Denn was man über meine Tante Poldi auch noch wissen muss: Ihr Vater war Hauptkommissar bei der Kripo Augsburg gewesen. Mordkommission. Georg Oberreiter, der eine oder andere erinnert sich vielleicht, hat seinerzeit den Nölden-Fall aufgeklärt. Und auch wenn die Poldi ein Leben lang versucht hat, ihre Eltern, das Haus und den ganzen Augsburger Vorstadtmief abzuschütteln wie eine Katze das Wasser im Fell, muss man doch festhalten, dass der Apfel nie weit vom Stamm fällt, auch nicht im Hause Oberreiter. Da war die Poldi einfach vorgeprägt.
Maria begleitete die Poldi zur Tür. »Danke noch mal für das Eis. Wenn wir was von Valentino hören, rufe ich Sie gleich an.«
»Vielleicht besuchen Sie mich ja auch mal, und wir plaudern ein bisschen. Ich würde mich freuen.«
Maria schüttelte den Kopf und seufzte wieder, wie nur eine Mutter seufzt, die weiß, dass sie ihrem Kind nicht helfen kann.
»Er hat manchmal für Russo gearbeitet«, flüsterte sie. »Der Vivaio, wissen Sie?«
Der Poldi fiel der Laster mit den Palmen ein, der sie um Haaresbreite über den Haufen gefahren hätte. Piante Russo.
»Sie meinen die große Baumschule an der Provinciale?«
Maria nickte. »Ja. Bei Femminamorta.«
Femminamorta.
Und schon wieder löste sich so ein kleiner Erinnerungsplack bei der Poldi. Ein ganz kleiner, schon halb zersetzt vom Vergessen, wirbelte auf, trudelte matt herum und fiel dann geräuschlos wie eine Schneeflocke zu den Bildern von dem Tag, als Valentino zum letzten Mal bei ihr gewesen war. Bilder von einem nervösen Valentino, der einen halbvollen Zementsack die Treppe zum Dach hinaufwuchtete, um dort eine undichte Stelle auszubessern. Ein irgendwie bedrückter Valentino, das fiel ihr jetzt auf, der zu viel rauchte, ein nagelneues Handy mit einer TIM-Karte aktivierte und davon sprach, dass er abends noch wohin müsse. Nach Femminamorta.
»Können Sie mir sagen, wo das liegt?«
Jedenfalls nicht leicht zu finden, denn Femminamorta war weder ein Ort noch ein Restaurant, ergo auch nicht ausgeschildert, sondern nur der inoffizielle Name eines Landguts an der Provinciale, gleich neben der Großgärtnerei Russo. Da die Lavasteinmauern entlang der Straße jedoch keinen Blick auf die Grundstücke dahinter gestatteten, da es kein Schild gab und die Poldi niemanden sah, den sie fragen konnte, musste sie einige Male hin und her gurken, bis sie die kleine Zufahrt endlich bemerkte. Ein schier unpassierbarer Feldweg durchschnitt das Gelände der Großgärtnerei einige hundert Meter. Hinter den Steinmauern surrten Berieselungsanlagen und röhrten Bagger, die ausgewachsene Palmen hin und her bewegten.
Marias Beschreibung folgend, quälte Poldi den Alfa über Hunderte von Schlaglöchern bis zu einem alten, von Bougainville umwucherten Torbogen mit zwei Säulen. Auf der einen thronte ein mürrischer steinerner Löwe, in den Pranken ein Wappen mit Lilien. Der Löwe auf der anderen Säule fehlte.
Und hinter dem Torbogen dann – ein kleines Paradies.
Femminamorta.
Eine etwas heruntergekommene sizilianische Landvilla aus dem achtzehnten Jahrhundert, erbaut aus Lavatuff, rosa getüncht und übergetüncht, von Bougainville und Jasmin fast völlig umrankt, mitten in einem subtropischen Garten gelegen, mit Palmen, Oleanderbüschen, Hibiskus, Avocado-, Aprikosen- und Zitronenbäumen. Und gar nicht fern im Hintergrund, mit ausgebreiteten Schwingen wie ein dunkler Schutzengel – der Ätna.
Kein Mensch zu sehen, alle Fensterläden dicht, aber neben einer verblassten Sonnenuhr im oberen Stockwerk der Villa stand ein Fenster offen.
Die Poldi parkte den Alfa und machte sich bemerkbar.
»Permesso?«
Keine Antwort.
Also lauter. »PERMESSO? … Hallo?«
Nichts.
Auch gut, drehte die Poldi eben eine kleine Runde durch den verwunschenen Garten. Der Wind raschelte leise in den Palmen, glitzerndes Sonnenlicht fiel auf das Haus und den Garten. Sonst war nichts zu sehen oder zu hören, als ob dieser Ort erst erweckt werden müsste. Durch ein Lachen vielleicht, denn vom ersten Moment an war der Poldi klar, dass dies ein guter Ort war. Dass das Eis hier trug.
Auf der Rückseite des Hauses hing Wäsche. Die Poldi wollte gerade wieder rufen, als sie wie aus dem Nichts von einem sehr wütenden, sehr großen Gänserich attackiert wurde. Fauchend und mit aufgestellten Schwingen schoss er unter der aufgehängten Wäsche hindurch und griff die Poldi an, die den Ganter in Ermangelung eines Stocks nur mit bayerischen Schimpfwörtern auf Abstand hielt.
»Gehst weg, bleds, hundsgreislig’s Viech du. Verschwind bloß, scheißklumpverreckter Drack! Ja, fauch du nur! Wannst denkst, dass i da eine Angst vor dir hab, dann hast dich aber g’schnitten, krummhaxades Trumm du, weil i nämlich keine Angst hab vor deiner arschkramperten Machonummer. Hast mi?«
Gänsefauchen, Tantenflüche. Angriff, Rückzug, Fauchen, Flüche.
»Mon dieu! Wer ist da?«, rief jetzt eine Frauenstimme auf Italienisch mit französischem Akzent aus dem oberen Stock.
»Moi!«, rief die Poldi hinauf.
Und der Gänserich beruhigte sich augenblicklich.
Eine zarte junge Frau erschien auf der oberen Terrasse. Blasser Teint, Jeans, verschlissener Rollkragenpullover mit hochgekrempelten Ärmeln, Sonnenbrille, die kurzen dunkeln Haare zerzaust, als käme sie gerade aus dem Bett.
»Der Traum eines jeden kettenrauchenden französischen Filmregisseurs«, erklärte mir die Poldi später. »Wenn’st verstehst, was i meine. Des reine Klischee, pures Destillat der nervösen, wahnsinnig kapriziösen, unerträglich einsamen, hammererotischen und Sartre lesenden französischen Schönheit.«
»Nee, schon klar«, sagte ich. »Also nichts für mich, meinst du damit.«
»Mei, was bist du immer empfindlich!«
»Hast du wirklich ›Moi‹ gerufen?«
»Ja, freilich. Des hab i doch spontan g’schnallt mit dem Akzent, da hab i gar nicht nachdenken müssen.«
»Ah!Êtes-vous français?«, rief die junge Frau begeistert von der Terrasse.
»Nein!«, rief die Poldi auf Italienisch mit einem Blick auf den nun friedlichen Ganter zurück. »Aber sagen Sie’s nicht der Macho-Gans!«
Die Frau oben lachte hell auf und kam herunter. Der Gänserich verzog sich wieder auf seinen Wachposten.
»Mon dieu, er ist furchteinflößend, nicht wahr? Ich glaube, er kassiert sogar Schutzgeld von den Hunden.« Sie sprach fließendes Italienisch, aber mit wirklich sehr starkem französischem Akzent, betrachtete die Poldi einen Moment, lachte wieder, als sei die kurze Prüfung sehr zu ihrer Befriedigung ausgefallen und streckte ihr die Hand entgegen. »Valérie Raisi di Belfiore. Einfach Valérie.«
»Isolde Oberreiter. Einfach Poldi.«
»Was war das für eine lustige Sprache, die Sie da eben gesprochen haben?«
»Bairisch.«
»Ah, Sie sind Deutsche!«
»Etwas komplizierter ist es dann schon.«
»Hört man Ihrem Italienisch gar nicht an. Aber, mon dieu, ich bin die Letzte, die das beurteilen könnte. Seit ich zwanzig bin, lebe ich hier, aber jeder sagt mir ständig: ›Seien Sie unbesorgt, Signorina, in ein paar Monaten ist Ihr Italienisch schon viel besser.‹« Sie lachte wieder. Sie lachte überhaupt ebenso so oft wie sie »mon dieu« sagte und fasste die Poldi nun impulsiv am Arm wie eine gute Bekannte.
»Alors. Was stehen wir hier herum! Wollen Sie einen Kaffee? Und dann erzählen Sie mir, welche freundlichen Gezeiten Sie an diesen Strand gespült haben.«
Valérie führte die Poldi ins Haus, wo es kühl war und schattig und nach Staub, Büchern, Mottenkugeln und dem Jasmin roch, den Valérie in üppigen Sträußen auf zahlreiche Vasen verteilt hatte. Die Zeit schien plötzlich langsamer zu vergehen, als müsse sie sich hier drinnen durch ein duftendes Öl weiterbewegen. Irgendwo bellte ein Hund, sonst war nichts mehr zu hören von der Welt da draußen. Auch innen wirkte die rosafarbene Villa wie aus der Zeit gefallen, zwischen Jahrhunderten abgerieben, aber fast immer noch im Originalzustand erhalten. Der Boden war gefliest mit hellem Terrakotta und schwarzem Basalt. An einigen Stellen blitzten bunte Mosaiken unter den abgewetzten Teppichen hervor. An den Decken flirrten Blumenornamente, tanzten verblichene Nymphen mit faunischen Geliebten durch tropische Landschaften, schlugen Pfaue ihr Rad, zogen Kraniche über nebelverhangene Landschaften und Schimmelflecken hinweg. Große Kraken, Delphine und schillernde Rotbarben durchkreuzten einen mythischen Ozean, bevölkert von Nixen und Sirenen, und ein lüsterner Zyklop plierte hinter dem Ätna auf meine sprachlose Tante herab.
»Kreuzbirnbaumundhollerstaudn! Leckmiramarsch!«, rief die Poldi aus. Und auf Italienisch: »Dieses Haus ist ein magischer Ort!« Denn von magischen und verfluchten Orten verstand sie ja auch etwas.
Erfreut stellte Valérie die Espressokanne wieder weg und zeigte der Poldi eines der Gästezimmer, das einst die Kapelle des Hauses gewesen war. Von der gewölbten und schimmelbefallenen Decke rieselte zwar der Putz herab, aber zwischen den Placken leuchteten immer noch Fresken mit Darstellungen des Paradieses und der Vertreibung Adam und Evas.
»Ich hatte im letzten Jahr einen Rutengänger hier zu Gast, einen Deutschen, der meinte, er habe noch nie eine so starke positive Energie ausgependelt wie hier.«
Im ganzen Haus hingen düstere Ölschinken mit Porträts der ehemaligen Besitzer von Femminamorta. Schwermütige junge Männer, Greise mit tückischen Augen und gepuderte orientalische Schönheiten, eingeschnürt in Korsette und Seidenkleider.
»Voilà, meine Vorfahren väterlicherseits, die Raisi di Belfiore!«, erklärte Valérie. »Bourbonen, Feiglinge, Mütter und Hurenböcke, Visionäre, Helden und Poeten, Heilige und Gespenster – alles dabei. Bis Garibaldi sie 1861 enteignet und stichprobenartig füsiliert hat.«
Die Poldi nickte. Schließlich hatte sie den Leopard mit Claudia Cardinale und Alain Delon bestimmt so an die zwanzig Mal gesehen.
»›Alles muss sich verändern, damit alles so bleibt wie es ist‹«, zitierte sie aus dem Film.
Die Veränderung hatte für die überlebenden Belfiores allerdings darin bestanden, von Generation zu Generation zu verarmen und, um den Gravitationskräften des Ruins entgegenzuwirken, nach und nach Land zu verkaufen und – mon dieu! – bürgerliche Berufe zu ergreifen.
»Bestimmt spuken einige noch immer hier herum«, stellte die Poldi mit Blick auf das Porträt eines besonders unglücklich dreinblickenden Urahns fest.
»Mon dieu und ob!«
Da sich ihr deutsch-bayerisch-italienischer Gast offenbar für das Haus begeisterte, zeigte Valérie der Poldi gleich auch die Weinkellerei nebenan. Ein muffiges Gewölbe mit einer gewaltigen Weinpresse aus uralter Eiche, verschiedenen gemauerten Becken für den Most und alten Holzfässern, in denen ein Erwachsener hätte aufrecht stehen können.
»Hier hat der Rutengänger damals des Zentrum der positiven Energie erpendelt.«
»Aber Wein wird hier wohl schon lange nicht mehr gemacht.« Die Poldi deutete auf die verstaubten Fässer und das Gerümpel und die Matratzen, die hinter der Presse gelagert wurden. »Eine schöne Verschwendung der ganzen positiven Energie.«
»Mon dieu!«, bestätigte Valérie. »Ursprünglich war das alles hier Weinanbaugebiet. Die Raisi di Belfiore haben Femminamorta immer nur ein Mal im Jahr zur Erntezeit bewohnt. Ende des neunzehnten Jahrhunderts gab es ein Erdbeben, und die halbe Decke kam herunter. Mein Ururgroßvater hat das Haus sofort fluchtartig verlassen, aus Angst, es werde einstürzen, und es auch nie wieder betreten. Mon dieu, hundert Jahre lang hat niemand das Haus mehr betreten. Bis mein Vater es dann in den Siebzigern untersucht und festgestellt hat, dass es völlig intakt ist. Das Erdbeben hatte damals nur am Putz gerüttelt, mehr nicht.«
»Und der Wein?«
Valérie schüttelte den Kopf. »Nach dem Risorgimento haben die Belfiores nach und nach alles verscherbelt, nur, um bloß nicht arbeiten zu müssen.«
Die Poldi erfuhr, dass Valérie das kleine Anwesen von ihrem Vater geerbt hatte, der ihre Mutter kurz nach Valéries Geburt verlassen hatte.
»Sie haben sich geliebt und gehasst. Ein solches Feuer der Leidenschaft verzehrt jede Beziehung.«
»Eine Amour fou«, befand die Poldi, denn davon verstand sie ebenfalls etwas, und dachte an meinen Onkel.
»Ich habe meinen Vater kaum gekannt, aber als ich dann von dem Erbe erfuhr, dachte ich, es wird Zeit, ihn kennenzulernen. Also habe ich Italienisch gelernt und bin hierhergezogen. Aber, mon dieu, wir wollten doch einen Kaffee trinken!«
Im Salon gruppierten sich durchgesessene, mit ausgebleichten Stoffen abgedeckte Ledermöbel um einen Couchtisch herum, auf dem sich alte Folianten und zerlesene Taschenbücher türmten. Bücher überall. Auf den Tischen, in Regalen und Vitrinen und in der alten Bibliothek, die, wie Valérie erklärte, noch aus dem späten neunzehnten Jahrhundert stammte.
Valérie servierte pappige Kekse zu einem scheußlichen Espresso, den die Poldi zur Geschmacksverbesserung mit dem Inhalt ihres Flachmanns etwas streckte. Valérie nahm fünf Löffel Zucker. Die Poldi mochte sie immer mehr.
Femminamorta, so erfuhr sie weiter, war alles, was den Raisi di Belfiores von ihrem immensen Besitz geblieben war. Um das Haus zu halten und über die Runden zu kommen, vermietete Valérie die unbenutzten Zimmer an Feriengäste.
»Inzwischen gehört das meiste Land ringsum ohnehin Russo.«
Die Poldi horchte auf. »Kennen Sie ihn?«
»Mon dieu, allerdings. Schließlich versucht er seit Jahren, mir Femminamorta abzuschwatzen und mich rumzukriegen.«
»Ist er denn nicht verheiratet?«
»Geschieden. Er hat eine erwachsene Tochter, die demnächst heiratet.« Sie lachte. »Wir haben eigentlich ein ganz stabiles Verhältnis. In letzter Zeit schreckt er allerdings auch vor dramatischen Maßnahmen nicht mehr zurück. Haben Sie den Torlöwen am Eingang gesehen?«
»Ja. Aber sein Zwillingsbruder fehlt.«
»Allerdings fehlt er, mon dieu! Russo leugnet es zwar, aber natürlich ist mir klar, dass er dahintersteckt. Eine unmissverständliche Warnung, dass es mit seiner Geduld bald aus ist.« Sie sprang unvermittelt auf. »Aber was jammere ich Ihnen hier die Ohren voll. Wollen Sie noch ein anderes Zimmer sehen, bevor Sie sich entscheiden? Sie können so lange bleiben, wie Sie wollen, über den Preis werden wir uns schon einig.«
Da fiel der Poldi wieder ein, aus welchem Grund sie ursprünglich gekommen war und dass hier ein Missverständnis vorlag. »Eigentlich suche ich nach Valentino. Valentino Candela, sagt Ihnen der Name was?«
Valérie sah die Poldi einen Augenblick an, als müsse sie die Schärfe nachstellen, um sich ein neues Bild von ihrem Gast zu machen.
»Natürlich«, sagte sie vorsichtig. »Valentino. Hübscher Kerl. Der arbeitet für Russo, aber manchmal hilft er mir auch im Haus und im Garten.«
»Er ist seit drei Tagen verschwunden.«
Valérie reagierte bestürzt. »Mon dieu. Jetzt, wo Sie es sagen, ich hab ihn auch schon länger nicht mehr gesehen.«
»Mir hat er am Montag gesagt, dass er abends hier auf Femminamorta zu tun hätte.«
Valérie dachte nach, schüttelte dann aber entschieden den Kopf. »Nein, da bin ich ganz sicher.«
Die Poldi zeigte ihr das Mosaiksteinchen, das sie bei den Candelas hatte mitgehen lassen.
Valérie reichte es ihr nur schulterzuckend zurück. »Sehr hübsch. Aber was hat das mit Valentino zu tun?«
Die Poldi ließ das Steinchen in ihrer Hand hin und her kullern. »Ich weiß es nicht.« Doch belebt durch Kaffee, Brandy und die vielen positiven Energien verfiel sie auf einen Gedanken. »Aber ich würde es Signor Russo gerne persönlich fragen. Am liebsten, ohne mich lange anmelden zu müssen.«
»Ich bezweifle, dass er Sie empfängt.« Sie lächelte plötzlich wieder. »Aber ich kann Ihnen eine Abkürzung zum Verwaltungsgebäude zeigen.«