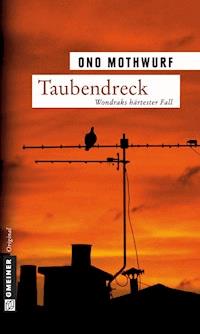
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Wondrak
- Sprache: Deutsch
Kommissar Thomas Wondrak, Mitte vierzig, ist Bayerns erfolgreichster Mordaufklärer - unter Kriminalisten eine Legende. Seit knapp zwei Jahren bereitet ihm allerdings die Mühelosigkeit, mit der sich seine Fälle wie von selbst lösen, Kopfzerbrechen. Um seine kriminalistische Kombinationsfähigkeit nicht völlig verkrüppeln zu lassen, hat sich der Chef der Kripo Fürstenfeldbruck angewöhnt, jedem noch so kleinen Detail eines Verbrechens nachzugehen. Was sich in seinem neuen Fall jedoch als kompliziert erweist: Millionen von Dollars, die den Besitzer wechseln, mysteriöse Todesfälle und eine tierische Massenvernichtungswaffe lassen ihn den Überblick verlieren ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ono Mothwurf
Taubendreck
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2009 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © sxc.hu
ISBN 978-3-8392-3002-2
1. Idylle und Schrecken
Ein erstes Ende
Das Gurren von zwei Tauben dringt mit einem Schwall nach Walnusslaub duftender Herbstluft durch das angelehnte Fenster in die Küche. Die Luft ist durch und durch warm, nicht so unentschlossen wie sonst im Herbst, sondern massiv. Im Schatten kaum kühler als in der Sonne. Schwer zu sagen, was diesen Tag so schön macht – das warme Gefühl auf der Haut, die strahlenden Farben der Herbstblätter oder das wehmütige Gurren im Ohr, das wie ein Abschied vom Sommer klingt.
Warum wird die weiße Taube als Friedenssymbol verehrt? Es liegt am Gurren. Der friedliche, leicht einschläfernde Gesang ist die offizielle Begleitmusik für Abrüstung, Gewaltverzicht und Deeskalation.
Vollkommen unbeeindruckt von dieser Erkenntnis, nimmt die Frau das japanische Küchenmesser in die Hand und sticht zu. Die handgeschmiedete Klinge schimmert bläulich. Der Stahl dringt einfach ein, fast ohne Widerstand, und schon sackt der Mann zusammen.
Die Tauben flattern auf.
Der Mann fühlt sich kurz an Venedig erinnert, an den Himmel über dem Markusplatz, das Gesicht seiner Geliebten über sich, die Luft von einer Wolke aufflackernder Tauben in ein flirrendes Blaugrau getaucht, dann fühlt er den Stahl in sich und weiß, warum. Das heißt, ganz genau weiß er es nicht, er hat nur so eine Ahnung, aber zum Nachdenken fehlt jetzt einfach die Zeit. Außerdem war er nie der Typ, der lange nachgedacht hat, er hat immer schnell und aus dem Bauch entschieden, und vielleicht stirbt er deshalb nicht durch einen Kopfschuss, sondern durch einen Bauchstich.
Die Frau fängt den Mann auf und legt ihn behutsam auf den Boden. Sie wundert sich, dass sie keinen Fluchtreflex verspürt. Verbrecher, heißt es, kehren immer wieder an den Tatort zurück. Aber sie will gar nicht erst weg. Im Gegenteil. Sie streichelt die Hand des Mannes und redet mit zärtlicher Stimme auf ihn ein. Sie hat schon ihre Mutter auf dem Sterbebett begleitet und auch eine Tante. Aber sie hat noch nie einem Ermordeten hinübergeholfen. Ihrem Ermordeten. Sie hat ja auch noch nie gemordet. Oder soll man es als Totschlag bezeichnen? Als Sterbehilfe?
Das eindeutig Schönste daran: die vollkommene Vorhersehbarkeit. Während sich das Sterben ihrer Mutter drei Tage lang hingezogen hatte, was für beide Seiten ungeheure Qualen bedeutet hatte, war es hier nur eine Sache von Sekunden. Nicht viel Zeit, um sich zu verabschieden. Sie beugt sich über ihn, flüstert ihm etwas ins Ohr, dann verändert sich sein Gesicht.
Jeder Tod ist anders. Dieser hier ist warm, duftet nach Walnüssen, schimmert bläulich und kommt mit einem Gurren. Fast ein schöner Tod, könnte man sagen. Verglichen mit den anderen, die noch kommen werden.
Nachdem das Lächeln auf dem Gesicht des Mannes verrutscht und ausdruckslos geworden ist, tippt die Frau eine Nummer in ihr Mobiltelefon.
»Ist dort die Polizei? Ich habe einen Mann getötet.«
Und dann ist das Gurren weg und es wird still.
Aufwachen, Kommissar
Kommissar Wondraks Mobiltelefon klingelte. Es war ein alter, abgenudelter Nokia-Ton, den jeder in seiner Umgebung schon so satt hatte wie die Fanfare der Tagesschau. Nur Wondrak nicht. Das Teil, aus dem er ertönte, war ein riesiges, unverwüstliches, vier Jahre altes Handtelefon mit den Abmessungen eines Kohlebriketts. Ein neues war technisch unnötig. Er wollte nicht fotografieren, keine Briefe schreiben, keine Musik hören, er wollte nur telefonieren. Dass modisch ein Wechsel längst überfällig war, daran konnte kein Zweifel bestehen. Aber Wondrak konnte dem Reiz einfach nicht nachgeben, sich ein Handy zuzulegen, das den Namen seines Vaters trug. Wondrak hatte, genau genommen, einen Doppelnamen: Ericsson-Wondrak. Aber er verwendete ihn nicht mehr. Lieber ein zu großes Handy als ein zu langer Name, sagte er sich. Also hielt er seinem alten, schwarzen finnischen Ziegel die Treue.
»Wondrak«, meldete er sich, nachdem er die grüne, abgegriffene Taste gedrückt hatte.
»Kommissar Nokia! Wo sind Sie?« ›Kommissar Nokia‹ durfte ihn nur einer nennen. Der alte Büroleiter der Kripo Fürstenfeldbruck, Egon Schneiderweiß. »Stellen Sie sich vor! Ein Mord ist geschehen!« Wondraks Gesicht hellte sich schlagartig auf. Das änderte sich aber gleich wieder, als er erfuhr, dass die Täterin bis zu ihrer Ergreifung bei ihrem Opfer geblieben ist, die Tatwaffe gefunden und das Motiv Eifersucht oder verschmähte Liebe war oder eine Mischung aus beidem. Er musste nur noch seine Unterschrift unter den Bericht setzen und der Fall war abgeschlossen.
»Gehts nicht einmal wenigstens ein bisschen anspruchsvoller? Machen die das alle absichtlich?«
Wondrak atmete tief durch. Seit er 45 geworden war, also seit letztem Jahr, hatte sich das Niveau der Kriminalfälle, an denen er arbeitete, auf eine erschreckende Art verflacht.
Wondrak war immer stolz darauf gewesen, dass er kein klassisches Beamtenleben führte, gefüllt mit langweiligen Routinearbeiten und unendlichen Bürostunden. Er war viel an der frischen Luft, kam mit einer Menge außergewöhnlicher Leute in Kontakt und hatte das befriedigende Gefühl in der Brust, bei der wichtigsten Schlacht der Menschheit in der ersten Reihe zu kämpfen: dem Kampf zwischen Gut und Böse. 15 Jahre war er im Dienst und seit neun Jahren Kommissar. Er hatte berühmte Diebeszüge aufgeklärt, wie den Überfall auf die Sparkasse Starnberg, bei der 164.000 Mark von zwei pensionierten Tennisprofis gestohlen wurden, die Entführungsgeschichte der zwei Kinder und der zwei Ponys eines Verlegers von Tiermagazinen, die eben dieser inszeniert hatte, um Publicity zu bekommen und um durch die Lösegeldzahlung Steuern zu sparen. Und nicht zu vergessen, den legendärsten Kriminalfall der 90er-Jahre, den Mord an einer Millionärswitwe am Ammersee, die vom silberhaarigen Dampferkapitän der ›Herrsching‹ versenkt worden war.
Wondrak hatte alle seine Fälle mit Offenheit, Nachdenklichkeit und Zähigkeit gelöst, seinen wichtigsten Charaktereigenschaften. Das Temperament hatte er von seiner österreichischen Mutter, einer Wiener Kaffeehaustochter, die Zähigkeit von seinem Vater, dem Spross einer norwegischen Bergsteigerdynastie aus Hurrungane, das in West-Jotunheimen liegt. Mit dieser bemerkenswerten Talentekombination knackte er jedes Alibi und klärte auch das scheinbar perfekteste Verbrechen auf.
Aber heutzutage hatte niemand mehr Interesse an einem perfekten Verbrechen. Anscheinend nicht einmal die Verbrecher selbst. Wollte denn gar keiner mehr seiner gerechten Strafe entgehen? War denn der moderne Strafvollzug so attraktiv, dass es sich lohnte, einen 25-Jahres-Aufenthalt mit Vollpension zu buchen?
Oder lag es an Bayern? Der süddeutsche Hochsicherheitsstaat wirkte auf Kriminelle offenbar so abschreckend, dass es nur noch sonntagabends richtig gefährlich wurde. Im Fernsehen, beim ›Tatort‹. In den Ranglisten der sichersten Gegenden führte der Landkreis Fürstenfeldbruck alle Statistiken an, und die wenigen Straftaten, die hier noch passierten, wurden zu allem Überfluss auch noch mit höchster Wahrscheinlichkeit aufgeklärt.
»In Saarbrücken müsste man sein«, seufzte Wondrak in sich hinein. »Hier hat das Böse noch Zukunft. Aber wer will schon nach Saarbrücken?«
Tatsächlich hatte sich das beschauliche Städtchen im Südwesten der Republik langsam, aber stetig an die Spitze der Kriminalstatistik vorgearbeitet.
Aber Wondrak arbeitete leider nicht im Kriminalparadies. Er lebte im Hochsicherheitstrakt Deutschlands, und das Verbrechen, so graute ihm, hatte hier keine große Zukunft mehr. Überwältigt von so viel Unterforderung, hätte sich Wondrak in eine Art ›Frühpensionierten-Stand-by-Dämmerschlaf‹ zurückfallen lassen können, aus den ihn nur ab und zu sein Telefon herausklingelte. Für banale, wenn auch traurige Todesfälle, für die er in seinem kriminalistischen Denkzentrum nicht mehr als drei Synapsen miteinander verbinden musste. Der Selbstmörder, der scheinbar die Bankenordner mit den Schulden als Aufstiegshilfe genommen hatte, um sich von ihnen in den Strick zu stürzen. (In Wirklichkeit wollte die Witwe die Lebensversicherung einstreichen.) Der Mörder, der das Pflanzengift im Gartencenter zwar bar bezahlt hatte, aber geizig genug war, seine Payback-Karte vorzulegen. Der Schlauchbootunfall auf der Amper, bei dem ein Vater von drei Töchtern auf grausame Art ertrunken war. Er war aus dem Boot ins Wasser gefallen, aber mit dem Fuß in einem Seil hängen geblieben. Das Seil hatte sich um einen Felsen geschlungen, am anderen Ende hing das Schlauchboot mit den Töchtern. Die Strömung zog nun das Schlauchboot so lange stromabwärts, bis der Mann unter einem Felsen im Wasser festgeklemmt war.
Wondrak war nur durch Zufall an dem Polizeibus vorbeigekommen, der am Rande der kleinen Flussbiegung nahe dem Kiesbett geparkt war.
»Servus, Günther, kann ich helfen?« Günther Bergmann winkte ihn heran, während Kollegin Veronika Veigl Decken um die zitternden, tropfnassen Schwestern legte. Wondrak mochte Günthers unkomplizierte Art. Er ließ sich gern helfen, er half gern und hatte überhaupt kein Problem, fünf Jahre älter und trotzdem zwei Hierarchiestufen unter ihm zu arbeiten. »Zu helfen gibts eigentlich nichts mehr. Den Mädchen ist nicht zu helfen. Dem Vater ist nicht mehr zu helfen. Und mir kannst du den Schreibkram auch nicht abnehmen. Aber trotzdem schön, dass du da bist. Bleib ruhig ein bisschen.« Wondrak stellte sich kurz bei den Mädchen vor und erfuhr, dass Anna 17 war, Eva 23 und Swantje 24. »Wir haben Vater die Rafting-Tour zum Geburtstag geschenkt. Und hier an der Kiesbank wollten wir anlegen, um ein Picknick zu machen.«
Als ihm die Schwestern genau erklärt hatten, wie und wo das Unglück passiert war, riss Wondrak die Augen auf und schlug sich mit der flachen Hand auf die Stirn. Die jungen Frauen erschraken.
»Mensch, ich könnte Ihnen doch einen Tee machen!« Wondrak öffnete seinen Kofferraum und holte aus einer Reisetasche einen Topf, füllte eine halbe Flasche Wasser ein und schob den Stecker des Tauchsieders in den Zigarettenanzünder. Das Tee-Set hatte er zu einer Zeit geschenkt bekommen, als er sich noch jede dritte Nacht mit Observationen um die Ohren schlagen musste. Seitdem wusste er, wie ungeheuer vielseitig warmes Wasser einzusetzen war. Als Suppe. Als Kaffee. Als Kakao. Als Tee. Heute brauchte er es als Wahrheitsdroge. Während sich das Wasser langsam erwärmte, trottete er gemächlich an den Fluss, um sich die Leiche anzusehen und das Schlauchboot. Für die wenigen Autos, die auf der Straße vorbeikamen, sah Wondrak aus wie ein Spaziergänger, der ab und zu einen Ast aufhob und ihn ins Wasser warf. Die Strömung erfasste ihn, trug ihn fort, zog ihn am Felsen vorbei, führte ihn an die ruhige Stelle hinter dem Wasserwirbel und hielt ihn dort fest. Genau so, wie es Anna erzählt hatte.
Wondrak fühlte sich beobachtet.
Er vermied es, sich zu schnell umzudrehen, und als wäre nichts gewesen, ging er zum Bus zurück und fragte: »Kräuter, Hagebutte, Pfefferminz oder schwarz?« Die Plastikbecher stammten aus dem Bestand des Polizeibusses, die Teebeutel kamen von Wondrak. Er beobachtete, wie sich sechs schlotternde Hände vorsichtig um die Becher schlossen. Wie sich drei Lippenpaare an den Becherrand setzten und leise schlürften und wie sich ein friedlicher Ausdruck auf den Gesichtern breitmachte. Sie wurden jünger, immer jünger, und schließlich saßen drei kleine Schwestern auf einer Ofenbank, die Beine angezogen, und schlürften Kakao mit Schlagsahne, und danach wollten sie nur noch warme Pyjamas, einen Gutenachtkuss, dann ins Bett und alles vergessen. Wondrak hasste sich für das, was nun kommen sollte. Er wollte jetzt lieber die gute Mutter sein und die drei beschützen. Sicher hatten sie einen Grund gehabt, den Vater zu ertränken. Vielleicht war es sogar ein guter Grund.
Warum musste Wondrak ihr frisch gewonnenes Vertrauen so missbrauchen? Warum konnte er nicht nachgeben und einfach den Mund halten? Keiner würde etwas merken. Die Guten haben die Bösen besiegt, die Schwachen die Starken. Können Mordgeschichten nicht auch mal gut ausgehen?
»Warum liegen im Schlauchboot vier Paddel?« Wondrak fragte es mit einem Höchstmaß an Beiläufigkeit, aber die Wirkung war, als hätte jemand mit einem Paddel aufs Blechdach des Busses getrommelt. Mit dem Paddel, das eigentlich im Fluss liegen müsste. Weit flussabwärts, irgendwo am Ufer angetrieben. Bergmann drehte den Kopf, um zu sehen, was los war.
Es sind nicht die Worte, die alles verraten. Es sind die Blicke. Diese Blicke, die eigentlich ganz unschuldig sagen sollten: ›Wieso, sind halt vier Paddel?‹, die aber flehten: ›Verdammt, wir haben das Paddel vergessen, jetzt weiß er alles!‹ Wondrak wusste natürlich nichts, er ahnte nur. Aber selbst Bergmann merkte in diesem Moment, dass irgendetwas nicht stimmte.
Dann war der Moment des Skrupels auch schon verflogen und in Wondraks wundersamem kriminalistischen Apparat rastete leise ein Mechanismus ein. Ein Mittelding zwischen dem Auslösehebel in einem mechanischen Wecker, der den Klick kurz vor dem Klingeln verursacht, und einer vollelektronischen Zielautomatik, die einen unbemannten Flugkörper ins Ziel steuert. Jedenfalls folgte der weitere Ablauf einem professionellen Schema, das mit dem Menschen Wondrak recht wenig zu tun hatte. Wondrak, die unbemannte Verhörmaschine. Die drei Schwestern wurden voneinander getrennt und einzeln befragt, die Spurensicherung wurde geholt, an den Ort, der vom Unfallort zum Tatort geworden war, und am Ende des Automatismus stand ein Geständnis. Das wusste Wondrak schon, bevor er die erste Frage gestellt hatte. Die einzige Variable war, wie oft der Stundenzeiger bis dahin die Zwölf passiert haben mochte.
Es war Anna. Sie war begeisterte Kanutin. Im Urlaub oft einen ganzen Tag lang auf dem offenen Meer in den Wellen unterwegs. Linkshänderin. Bestens mit Strömungsverhältnissen vertraut. Und mit den Tücken, die so ein einsam im schnellen Fluss stehender Felsen zu bieten hatte. An der ungewöhnlichen Art, wie der Zugknoten geknüpft war, in dem sich der Fuß des Vaters wie zufällig verheddert hatte, konnte die Spurensicherung ablesen, dass er von einem Linkshänder stammte.
Die drei jungen Frauen hatten ihren Vater gemeinsam umgebracht. Nach dem Plan der jüngsten Schwester.
Es war ein ganz kurzer Moment des Zögerns gewesen. Nicht einmal 24 Stunden später waren alle Zweifel beseitigt. Und das anfängliche Mitleid einem Staunen über die kaltblütige Entschlossenheit der drei Frauen gewichen, die ihren Vater noch über seinen Tod hinaus hassten. Warum? Wondrak hatte von Anfang an, als er die verstohlenen Blicke der drei durchnässten jungen Frauen im Polizeibus bemerkt hatte, einen Missbrauch vermutet. »Sie täuschen sich, Herr Kommissar. Mein Vater hat uns nicht angerührt. Aber er hat unsere Mutter in den Tod getrieben.« So klar, wie es Anna formulierte, sahen es Swantje und Eva nicht. Sie waren wohl vom Hass ihrer kleinen Schwester mitgerissen worden, die den Vater für den Selbstmord der Mutter verantwortlich machte. Und jetzt waren sie durch ihre eigene Hand von Halb- zu Vollwaisen geworden. Wondrak klappte den Deckel der Kartonmappe zu, zog die zwei Gummibänder über die Ecken und legte sie auf den Tisch vor sich.
Er hatte sich längst daran gewöhnt, dass sich die Fälle in seinen Händen lösten wie Luftmaschen. Man musste nur am richtigen Ende ziehen, dann zog sich der Knoten auf und zurück blieb eine gerade Schnur.
Das war vor knapp drei Jahren gewesen und seitdem hatte sich in Wondrak etwas verändert. Es ging alles zu leicht. Es war alles zu einfach. Die Routine würgte ihn. Und der Spaß, der ihn früher so oft erfüllt hatte, blieb aus.
Es schien so, als hätten es alle darauf angelegt, Wondrak zu Tode zu langweilen. Eine raffinierte Art, ihren Bezwinger zu töten, musste er zugeben.
Die richtig schönen, verzwickten Fälle, die hatten immer die anderen. Die Frankfurter. Die Hamburger. Die Saarländer. Und natürlich die ›Tatort‹-Kommissare.
Jeden Sonntag bekam Wondrak angesichts der raffinierten Mordfälle seiner Fernsehkollegen vor Augen geführt, wie banal sein Tagewerk geworden war. Manchmal dachte er daran, selbst ein perfektes Verbrechen zu inszenieren, so wie die Feuerwehrmänner, die in langen, feuerlosen Wintern zu Brandstiftern werden. Aber dann regten sich doch Bedenken. Wer sollte ihm auf die Spur kommen? Sich selbst zu überführen und zu verhaften, so weit ging seine beginnende Persönlichkeitsspaltung nun doch nicht.
Also fing er an, sich darauf zu spezialisieren, seine Fälle so lange zu durchleuchten, bis er jede Einzelheit verstand. Bis er nicht nur das Motiv kannte, sondern auch alle Geschichten, die dorthin geführt hatten.
Alle Geschichten. In all ihren Einzelheiten. Nicht, um einen Fall zu lösen, der längst gelöst war. Sondern, um nicht verrückt zu werden.
Sein Chef in Fürstenfeldbruck, einer mittelgroßen Kleinstadt vor den großen Toren der kleinen Großstadt München, hieß Kriminaldirektor Norbert Stürmer. Er hatte die postkriminalistische Fleißarbeit zunächst monatelang als unnötigen Quatsch blockiert, aber die Staatsanwälte liebten Wondraks Recherchen, und vor zwei Jahren war auch der Chef der Kripo München auf seine psychologischen Talente aufmerksam gemacht worden. Er ließ durchblicken, dass sogar der bayerische Innenminister von seinen Berichten angetan sei. Ob er nicht als Erster Kriminalhauptkommissar zur Kripo München wechseln wolle? Hier sei er jetzt schon eine Berühmtheit. Sein Bericht über den ›Interregio-Mörder‹ wurde den Nachwuchs-Kriminalisten als Lehrstoff verabreicht.
Wondrak dankte, dachte an die Mietpreise in München, an den morgendlichen Stau auf der B2, an seine Mannschaft, mit der er sich einigermaßen wohlfühlte, und stellte seinen Chef vor die Wahl. Er bot ihm an, zu bleiben und Fürstenfeldbruck weiterhin die bundesweit höchste Aufklärungsquote bei Gewaltdelikten zu sichern. Aktuell waren es genau 88,3%.
Und er wollte an der Polizeihochschule Fürstenfeldbruck den Nachwuchs schleifen. Im Gegenzug dafür wollte er aber die Freiheit haben, jeden Fall so lange zu bearbeiten, bis er persönlich ihn für abgeschlossen hielt. Und nicht, bis der Täter überführt war.
Zähneknirschend stimmte Stürmer zu. »Aber Gnade Ihnen Gott, wir verlieren unseren ersten Platz!«
Seitdem hatte Wondrak Narrenfreiheit. Und seine Fälle wurden Geschichte.
Als er Marion sah, fühlte er, dass es eine sehr ergiebige Geschichte werden könnte.
»KHK Thomas Wondrak«, stellte sich Wondrak vor.
»Marion Brucker«, sagte die Dame vollkommen ruhig. »Was heißt KHK?«
»Kriminalhauptkommissar. Ich bin der Leiter der Mordkommission bei der Kripo Fürstenfeldbruck.«
Marion wies mit dieser Handbewegung, mit der man sich gegenseitig bekannt macht, auf den Toten: »Das ist Igor Oborowitsch, Konzertpianist im Ruhestand.«
Bei Lebenden sagte Wondrak normalerweise: ›Angenehm‹, das war in diesem Fall weniger passend, also sagte er nur: »Aha.«
Während die Spurensicherung in der Küche arbeitete, gingen die beiden ins Wohnzimmer und setzten sich auf das Sofa.
»Wollen Sie mir erzählen, warum?«
»Sie haben ein bisschen Zeit mitgebracht?«, fragte Marion.
Die Kunst, Schwester zu werden
Es war ein merkwürdiger Brief. Glattes, schweres Papier. Der Umschlag sorgfältig mit einer großzügigen Handschrift versehen. Und doch wirkte er auf eine eigenartige Weise vernachlässigt. Vergilbt, mit abgestoßenen Kanten, wie ein Brief, der mit halb richtiger Anschrift von Postamt zu Postamt weitergereicht worden war, bis er endlich sein Ziel erreicht hatte.
Doch auf dem Brief stand ›Isabel Knopp‹, und die Straße stimmte auch. Vielleicht war er wochenlang in einer Tasche herumgetragen worden, bevor man ihn abgeschickt hatte, dachte Isabel. Sie drehte den Brief um und las noch einmal die Adresse des Absenders. ›Carl Elsmann aus Hamburg‹. Mit der Hand war hinter Hamburg ein Schrägstrich gesetzt und ein Ortsname ergänzt worden. ›Hamburg/Hermannsburg‹. Isabel kannte Hamburg zu wenig, um zu wissen, ob es einen Stadtteil dieses Namens gab. Sie kannte nur das Hermannsburg ihrer Großmutter, die dort seit bald 74 Jahren lebte. Isabel hatte oft ihre Sommerferien in dem kleinen Kaff am Rand der Lüneburger Heide verbracht und bei unzähligen Heidefesten das halbe Dorf kennengelernt (na gut, es waren deutlich weniger als 4.200 Leute gewesen, aber ein Carl Elsmann war nicht dabei, glaubte sie).
Isabel legte den Brief so behutsam auf den Küchentisch wie ein Findelkind in die Wiege und beschloss, ihn noch eine Weile ungeöffnet liegen zu lassen. Eilig schien es ja nicht zu sein.
Stattdessen griff sie zum Telefon und rief ihre Großmutter an. Wenn irgendetwas mit ihr sein sollte, dann wollte sie es von ihr persönlich erfahren und nicht aus einem Brief von einem Wildfremden. »Hallo Oma, wie gehts Theo?« Das war die Begrüßungsformel, um herauszufinden, wie es der Großmutter ging. Nie würde Oma sagen: ›Mein Bein schmerzt.‹ In diesem Fall sagte sie dann: ›Theo humpelt, sein Bein tut wieder weh.‹ Theo war ein wirklich unverwüstlicher Kater, um den man sich keine Sorgen machen musste. Im Gegensatz zu seiner Besitzerin.
Die Großmutter litt unter einer Mischung aus Geselligkeits-Mangelerscheinung und Privatfernseh-Überversorgung. Seit ihr Neffe ihr eine Satellitenschüssel zu Weihnachten geschenkt hatte, stand sie unter der geistigen Knechtschaft des privaten Fernseh-Unterhaltungskartells und hatte ihr Abonnement des ›Celler Kurier‹ gekündigt. Die medizinischen Ratgeber-Sendungen taten das Übrige, um aus Großmutter eine raunzige, hypochondrische Vogelscheuche zu machen, die sich nur noch für sich selbst und die Fernbedienung interessierte. Isabel seufzte, während Großmutter eine Liste all ihrer Wehwehchen herunterbetete. Nichts Ernstes. Wobei Isabel gar nicht auf die Fragen einging, wie man Katzen eigentlich den Blutdruck misst und ob sie wirklich Arteriosklerose haben können. Schade um Oma, dachte Isabel, versprach, bald wieder anzurufen, dachte, dass sie das bestimmt lange Zeit nicht tun würde und fühlte, dass sie von der schlechten Laune, mit der sie sich gerade angesteckt hatte, so schnell nicht wieder geheilt würde.
Doch damit hatte sie sich gründlich geirrt.
Denn die erste Zeile des Briefes, den sie nach dem Auflegen kurz entschlossen aufriss, bestand aus zwei unglaublichen Worten:
›Liebe Schwester!‹
Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass jemand sie so nannte.
Nachdem sie 29 Jahre lang jeden Morgen als Einzelkind aufgewacht war, schlug Isabel die Augen auf und hatte keine Ahnung, wie sie sich jetzt fühlen sollte. Irgendetwas sagte ihr, dass der Brief von Carl Elsmann kein schlechter Scherz war. Sie hatte einen großen Bruder. Immer schon gehabt. Und jetzt kam die Zeit, ihre Familie kennenzulernen. Oder das, was von ihr übrig war. Ihr Vater war seit mehr als 20 Jahren abgetaucht, erst in Rotwein, dann in Kanada, und ihre Mutter hatte seitdem all ihre Energie daran gesetzt, eine vollkommen zerrüttete Mutter-Tochter-Beziehung aufzubauen. Insofern konnte Isabel ihrer Mutter gar nicht richtig böse sein, dass sie ihr den Bruder verschwiegen hatte: denn um jemandem böse zu sein, muss man ja eine gewisse Nähe zu ihm haben, und die war zwischen Mutter und Isabel vergleichbar mit der Entfernung des Weltraum-Teleskops Hubble zu seiner Bodenstation. Ab und zu wurde ein Lebenszeichen rübergefunkt, das war aber meist so unscharf, dass man sich kein Bild machen konnte, was dort eigentlich los war.
Seit drei Jahren rief ihre Mutter sie nicht mal mehr zum Geburtstag an. Isabel schickte ihr trotzdem einmal im Jahr eine Karte.
Der Schmerz beim Schreiben war beträchtlich.
›Selbst vergessen zu werden wird umso deutlicher, wenn ich mich an die erinnere, die sich nicht mehr an mich erinnern.‹
Sie hatte beschlossen, sich nicht auf das Niveau ihrer Erzeugerin zu begeben, und lebte nach ihren eigenen Regeln, die drei Hauptkapitel umfassten:
1.) Disziplin
2.) Lebenslust
3.) Ausschweifung
Wer sie nur tagsüber und aus der Ferne kannte, hätte die Krankenschwester für ein Mauerblümchen halten können. Hundertprozentig zuverlässig, klug, aber spröde im Umgang mit Menschen. Doch die Männer, die ihr näherkamen, spürten, dass hinter der disziplinierten Fassade mehr steckte. Alle ahnten es. Ein paar wussten es. Junge Assistenzärzte mit unverfälschtem, erotischem Wahrnehmungssinn bekamen rote Flecken im Gesicht, wenn sie mit ihr arbeiteten.
Auf männliche Patienten hatte sie eine verblüffend heilsame Wirkung, die der von homöopathischen Mitteln bei Weitem überlegen war. Erst, wenn die Patienten entlassen werden sollten, verschlechterte sich ihr Zustand wieder schlagartig. Die Oberärzte ihrer Abteilung hatten für die mit Isabel verbundenen Blutdruck-Schwankungen den Fachausdruck ›Isatonie‹ entwickelt. Dabei versuchte Isabel ganz bewusst, nicht den geringsten Anlass dafür zu bieten. Während des Dienstes gab sie nicht den kleinsten ihrer Reize preis. Sie trug auch in der größten Sommerhitze weiße Leinenhosen, und mehr als einen Blick auf den Ansatz einer Halskette gab der Ausschnitt ihrer weißen Blusen nie frei.
Es war die Art, wie sie sich bewegte, die das Männerblut in Wallung brachte. Der Eindruck einer ungeheuren, lauernden, gebändigten Kraft. In einer Mischung aus Lust und Angst begaben sich Männer in ihr Magnetfeld, Lust, diese Kraft zu entfesseln, und Angst, sie nicht beherrschen zu können. Es war die Kraft einer Frau, die gelernt hatte, alleine auf der Welt zu sein, und ihre Stärke genau daraus gewann.
Sie war nur eine Stationsschwester in der Kreisklinik Fürstenfeldbruck. Aber auf geheimnisvolle Art hatte sie sich die natürliche Autorität eines Chefarztes in der dritten Generation angeeignet.
Einige Männer hatten diese Kraft bereits am eigenen Leib erleben dürfen. Die jungen Ärzte, die mit ihr durch die Clubs zogen und sich von ihrer ausgelassenen Art, Party zu machen, mitreißen ließen. Die älteren Ärzte, die mit ihr in die besten Restaurants essen gingen und sich daran berauschten, wie sinnlich Nahrungsaufnahme sein konnte.
Und die wenigen Auserwählten, die mit ihr ins Bett durften.
Betäubt von Isabels Intensität, prallten sie alle zurück, gingen danach ein paar Tage auf Distanz, um dann immer wieder ihre Nähe zu suchen. Wie junge Stiere am elektrischen Weidezaun. Keiner hielt es mit ihr aus. Und keiner ohne sie.
Es ging ihr also ganz gut ohne ihre Mutter. Und doch gab es manchmal Fragen, die nur eine Mutter beantworten konnte. Der Brief von Carl zum Beispiel eröffnete einen ganzen Katalog solcher Fragen.
Wondrak räusperte sich. Er war mehr als verwirrt. Noch machte nichts von dem, was Marion gerade erzählt hatte, Sinn. Der Tote hieß nicht Carl, und die Frau vor ihm hieß nicht Isabel. »Marion, haben Sie zwischenzeitlich den Namen gewechselt? Sind Sie die Isabel?«
Marion sah ihn ruhig an. »Nein. Sie wollten doch, dass ich ausführlich erzähle. Oder soll ich abkürzen?«
»Nein, nein!«
»Also: Isabel ist so etwas wie meine Tochter. Sie würde natürlich vehement bestreiten, dass ich ihre beste Freundin bin. Dafür bin ich zu alt und zu anders. Isabel würde nie mit mir shoppen, nicht mit mir abends ins Kino gehen und schon gar nicht mit mir auf einen Drink in die Stadt, sie will überhaupt nicht mit mir gesehen werden. Aber dann und wann kommt sie zu mir und will sich von mir bekochen lassen und die nächsten Schritte besprechen.«
»Sie sind Isabels Ersatzmutter?«
»Genau das. Und Mütter kann man sich nicht aussuchen, nicht wahr? Mütter hat man.«
Isabel fuhr hinaus in die graue Zwischenhölle, wo Stadt und Vorstadt aneinandergeraten. Ein gemischtes Gewerbegebiet an der Hubertusstraße, ein Baumarkt, ein Reifenmarkt und gleich ums Eck ein Haus mit 80er-Jahre-pistazienfarbenen Eingangstüren. Genau hier lag ›Nails perfect‹, Marions kleines Schönheitsimperium.
Marion hatte gerade keine Zeit, sie war in einer Behandlungskabine.
Zwei Permanent Make-ups und eine Damenbartentfernung später hielt sie den Brief in der Hand. »Wenigstens ein Foto hätte er mitschicken können. Jetzt weißt du nicht einmal, ob es sich lohnt.«
Isabel bereute bereits, dass sie gekommen war. »Guck dir nur mal das Papier und die Handschrift an. Der hat Stil.« Isabel lächelte mit schmalen Lippen. Sie saßen in Marions Küche in der großzügigen Etage, die sie sich über dem Nagelstudio eingerichtet hatte. Auch Marion lebte allein. Über ihr Liebesleben wusste Isabel wenig bis nichts. Und die paar Geschichten, die Marion freiwillig rausgerückt hatte, klangen alle so tragisch, dass Isabel aufgehört hatte, sie danach zu fragen. Eines Tages würde sie es freiwillig erzählen. Vielleicht wäre der Brief so ein Anlass?
Was Marion mit Isabel gemeinsam hatte, war unterschwellige, unaufdringliche Energie. Auch Marion war auf geheimnisvolle Art aufgeladen. Doch Isabel wusste nicht, wie und wann Marion diese Energie freiließ. Oder behielt sie sie etwa ganz für sich? Manchmal konnte Isabel sehen, wie Marions Schultern nach vorne klappten und plötzlich alle Straffheit aus ihr wich. Isabels Gefühle für sie schwankten zwischen Mitleid und Genervtsein. Und doch wusste sie immer, wenn sie von ihr wegfuhr, was sie an ihr hatte. Wenn sie allerdings zu ihr hinfuhr, fragte sie sich immer erst mal eine Stunde lang, was sie hier wollte.
Im Moment ging ihr der Tanz ums Geld und das dazugehörige Geprotze gehörig auf den Geist. Jeder wurde von Marion zu allererst auf sein Vermögen taxiert.
»Ich sehe so etwas sofort. Der ist Millionär und Junggeselle. Vielleicht ist er ja was für mich?«
»Quatsch, wahrscheinlich ist er Lehrer oder Bibliothekar. Daher die schöne Handschrift. Und er wohnt in einer Zweizimmermaisonnette, die ihm eine alte Tante untervermietet«, seufzte Isabel. An der Tür klingelte es und der Pizzabote brachte Salat und Pizzabrot. »Mit diesen Nägeln kann man einfach nicht kochen.« Marion fuhr ihre Krallen aus und polierte sie an ihren Seidenleggings. Sie waren doch tatsächlich elfenbeinmetallic lackiert, wie das Golf-Cabrio, das mit dem Format füllenden Heckscheibenaufkleber ›Der See ruft!‹ einen Monat lang in Marions Straße gestanden hatte, um sich dann Ende Mai in die Golf-Scirocco-Polo-Kolonne Richtung Wörthersee einzureihen. Es kam nie wieder zurück. Wahrscheinlich wurde es an Ort und Stelle in einem Akt heidnischer Verehrung angezündet und im See versenkt. Das sollte man auch mit diesen Nägeln machen, dachte Isabel, während sie im Salat herumstocherte. »Wir fahren am Wochenende hoch und gucken uns den Knaben an!«
»Nein, nein, ich fahre allein. Ich brauche kein Kindermädchen.«
»Aber du brauchst ein Auto. Wie willst du denn sonst in die Heide kommen? Da bist du doch tagelang unterwegs.«
Mit einem Mal war Isabel klar, was sie tun wollte. Sie antwortete ganz ruhig: »Mit dem Zug. Bis Hannover mit dem ICE, dann nach Celle und dann mit dem Bus weiter. So, wie ich immer zu Oma gefahren bin.«
»Gut, aber bring mir wenigstens ein Foto von ihm mit«, brummelte Marion beleidigt.
Bruderliebe
Isabel saß im Zug und ließ die Landschaft an sich vorbeifliegen. Draußen verdorrte in Zeitlupe das Land. Sie war in einem satten, fetten Grün gestartet, und je länger sie aus dem Fenster sah, umso brauner wurde alles. Dabei sah es gar nicht so heiß aus. Das Blau des Himmels war nicht zu sehen, die Sonne leuchtete kalkweiß durch eine dünne, milchige Schleierwolkenschicht, und hätte man nicht gewusst, dass die Klimaanlage so viel Kälte lieferte, wie die 15.000 Volt-Oberleitung nur hergab, man hätte glauben können, draußen hätte es 19 Grad, wie drinnen.
Als sie in Hannover umstieg, dachte sie, Flammen schlügen ihr entgegen. 20 Minuten später im Regionalzug nach Celle hatte es wieder 16 Grad Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen. Nur in umgekehrter Reihenfolge. In einer Minute war sie in Schweiß gebadet. Das war wohl die ausgleichende Gerechtigkeit für das leichte Frösteln im ICE. Sie öffnete das Fenster, stellte sich in die Zugluft und ärgerte sich, ihre Wasservorräte nicht wieder aufgefüllt zu haben. Sollte sie es bereuen, nicht auf Marions Angebot eingegangen zu sein, im klimatisierten Mercedes mitzufahren?
Niemals!
Mit klebrigem Gaumen und trotzigem Blick kam sie in Celle an und kaufte am Bahnhofskiosk zwei Flaschen Vittel. Der Himmel hatte mittlerweile eine ockergelbe Farbe angenommen, und in diesem Licht verwandelte sich die niedersächsische Residenzstadt in ein Beduinendorf.
Es sah so aus, als würde gleich ein Sandsturm losbrechen. Sybille hatte trotzdem Lust auf einen Eiskaffee. Ihr Bus sollte erst in einer Stunde gehen, also setzte sie sich vor die Eisdiele und sah amüsiert zu, wie um sie herum alles weggeräumt wurde.
Die ersten Windböen trieben Staubwolken über den Platz und so beeilte sie sich, einen trockenen Platz für sich und ihren Koffer zu finden. An der Busstation stand ein kleines Wartehäuschen, das einigermaßen wind- und wetterfest aussah, und hierhin zog sie sich zurück, als der Eiskaffee geschmolzen, getrunken und bezahlt war.
Da stand plötzlich ein Mann in einem hellen Sommeranzug vor ihr und lächelte sie an: »Entschuldigen Sie, mein Name ist Carl Elsmann, bist du Isabel?«
Die Verblüffung ließ sie sich nicht anmerken: »Allerdings, Bruderherz. Wo warst du so lange?«
Er strahlte sie offen an und schüttelte ihre Hand. »Eigentlich wollte ich dich schon in Hannover abholen, aber die Züge waren alle viel zu pünktlich für mich. Ich habe deine Bahn nur noch von hinten gesehen.«
»Warum hast du mich nicht angerufen und mir gesagt, dass du mich abholst? Dann hätte ich gewartet.«
»Mit mir kann man keinen Termin ausmachen. Besser, du lässt dich überraschen. Überraschung gelungen?«
Isabel musterte ihn von oben bis unten und sagte: »Ja.«
Die ersten Regentropfen schlugen schwer auf dem Pflaster auf und verdampften sofort. Sie rannten über den Bahnhofsvorplatz zu Carls Wagen.
Die Art, wie Carl die Reisetasche auf die schmale Rückbank hievte und den Rest vorne unter der Haube verstaute, verriet den geübten Porsche-Fahrer. Isabel hatte kurz überlegt, ob er sich den Wagen nur ausgeliehen hatte, um sie zu beeindrucken, doch als er patschnass – sein heller Sommeranzug war mittlerweile dunkelbraun gesprenkelt – ins Auto schlüpfte, merkte sie, dass er solche Spielchen nicht nötig hatte.
»Willst du ins Hotel oder bei Oma?«
»Das heißt: zu Oma. Und wieso kennst du Oma?«
»Natürlich kenne ich sie, wir haben dieselbe Mutter, also auch dieselbe Oma.« Isabel war wie vom Donner gerührt. Nun kannte sie diesen Kerl gerade mal fünf Minuten und schon musste sie die Großmutter mit ihm teilen.
»Seit wann kennst du sie?«
»Seit vier Wochen. Seit ich aus Brüssel zurück bin. Und du?« Erst jetzt fiel ihr der leichte Akzent auf, der seinem akkuraten Deutsch eine weiche Note gab. Was war das? Es klang eher Amerikanisch als Französisch.
Draußen strömte der Regen und setzte das Land unter Wasser. Die Straße wurde kilometerweit von verdorrtem Heidegestrüpp gesäumt. Flächen, die sonst grün-violett schillerten, hatten den Farbton von sizilianischen Schafweiden im August angenommen.
»Ich kenne Oma auch erst, seit ich fünf bin. Mama hat nie viel von dem klassischen Großfamilienmodell gehalten. Sie hat uns von ihrer ganzen Sippe abgeschirmt. Bis eines Tages eine ältere Frau vor der Tür stand, die sagte: ›Hallo, ich bin Oma.‹ Und seitdem haben wir uns regelmäßig gesehen. Meistens in den Sommerferien, da war ich zwei Wochen bei ihr. Als Mutter entdeckt hat, wie praktisch das im Sommer ist, hatte sie plötzlich nichts mehr dagegen. Komische Frau. Ich weiß ja nicht, was ihr Metier war, aber Kinder großzuziehen, war jedenfalls nicht ihr Ding.«
»Ich schätze, sie hat einfach die Abtreibungstermine verpennt«, meinte Carl trocken. »Und mich dann gleich nach der Geburt weggegeben. Eigentlich hätte ich gute Lust, sie auch mal zu treffen.«
»Lohnt sich nicht wirklich«, meinte Isabel mit einer abfälligen Kopfbewegung. Der Scheibenwischer leistete Schwerstarbeit, um die Flüsse, Bäche und Seen von der Scheibe zu schaufeln. Carl fuhr langsam durch die anbrechende Dunkelheit.
»Und dann, wo bist du dann gelandet?«
»Ich hatte Glück. Da war ein Paar aus Hamburg, das schon einen Adoptivsohn hatte und nun ein zweites Kind wollte. Er ist Amerikaner, sie Hamburgerin, und so waren wir ziemlich viel über dem Atlantik unterwegs. Ich war 18, als sie es uns beiden sagten und ich beschloss, es nicht zu glauben. Für mich waren sie Mama und Papa, und damit basta. Meinen Eltern war das natürlich recht. Tim hat da ganz anders reagiert. Den haben wir verloren.«
»Was ist passiert?«
»Von einem Tag auf den anderen hat er uns misstraut. Er hat sich von allen hintergangen gefühlt. Von Vater, von Mutter, sogar von mir. Er vermutete ein Komplott, dachte, ich wäre der echte Sohn und würde nur so tun, als wäre ich adoptiert, um ihn zu beruhigen. Mit 20 Jahren! Und dann hat er sich bei der Suche nach seiner wirklichen Herkunft verlaufen.«
»Und das Gleiche hast du jetzt vor?«
»Im Moment«, und er sah ihr dabei ruhig und ein wenig zu lange in die Augen, »habe ich das Gefühl, genau auf dem richtigen Weg zu sein.«
»Haben wir die gleichen Väter?«, fragte sie, und in diesem Moment fiel ihr auf, wie vertraut sie schon waren und gleichzeitig nichts voneinander wussten.
Er sah sie an mit einem merkwürdigen Flackern in den Augen. »Das kann wohl nur unsere Mutter beantworten. Aber ich glaube, dass nicht einmal sie imstande gewesen wäre, im Abstand von zehn Jahren den gleichen Fehler zweimal zu machen.«





























