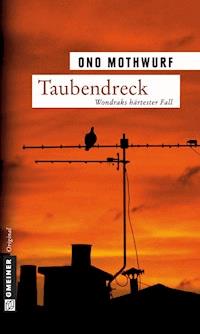Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Wondrak
- Sprache: Deutsch
Statistisch gesehen müsste Kriminalhauptkommissar Wondrak jährlich 15 Morde aufklären. Doch es wird gerade mal ein Drittel davon aktenkundig, und die fünf Morde löst er wie immer im Vorbeigehen. Sein Chef achtet peinlich darauf, dass seine Statistik makellos bleibt. Denn schon seit Jahren führt Fürstenfeldbruck den Titel „Höchste Aufklärungsrate der Republik“ und das soll bitte schön auch so bleiben. Doch dann steht plötzlich Timo vor Wondrak, ein junger Grafik-Praktikant aus einer Starnberger Werbeagentur. Der behauptet, seine Freundin Selena wäre ermordet worden. Als Beweis zeigt er dem Kommissar zwei Armbanduhren, seine und ihre, die zur gleichen Zeit stehen geblieben sind. Und den Täter kennt er auch schon: „Mein Art-Director hat sie umgebracht! Mit einer Pappe. Er hat die Präsentationspappe zerrissen. Die Arbeit von drei Tagen. Das hat Selena das Herz gebrochen.“ Kein leichter Fall und eine ernsthafte Gefahr für Wondraks tadellose Ermittlerkarriere!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Ono Mothwurf
Werbevoodoo
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2010 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 07575/2095-0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2010
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Korrekturen: Sven Lang, Katja Ernst, Doreen Fröhlich
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von boing / photocase.com
und tomogul / photocase.com
ISBN 978-3-8392-3438-9
1. Praktikantenlos
Den ganzen Morgen über waren ihm Frauen aufgefallen, die Tränen in den Augen hatten. In der S-Bahn hatte ihn eine junge Frau angesehen, als wäre ihr die Katze entlaufen. Eine andere, als wäre sie am Frühstückstisch, nachdem der Tee getrunken und das Croissant verspeist war, verlassen worden. Einfach so, ohne Vorwarnung.
Stumme, ratlose Mienen, die ihn noch verfolgten, als er längst die Morgensonne im Gesicht hatte. Oder bildete er sich das nur ein? Waren die Frauen gar nicht traurig? Sondern einfach nur müde? Und die Tränen? Vielleicht hatte ihnen der Schnellzug nach Garmisch Staub ins Auge geweht, als sie am Bahnsteig warteten?
Den Weg vom Bahnhof bis zum Büro legte er neuerdings zu Fuß zurück, zweimal war ihm sein Fahrrad gestohlen worden, das war der Preis für das antizyklische Arbeiten. Denn während sich halb Starnberg jeden Morgen auf den Weg Richtung München begab, machte Timo es andersrum. Er arbeitete auf dem Land. Starnberger würden ihr pralles, vor Wohlstand glühendes Millionärsdorf, niemals als Land bezeichnen. Aber ein Münchener durfte das.
Sogar hier, an den Schmutzrändern, im Gewerbegebiet, wo man sonst gern ein wenig schwarz unter den Fingernägeln trägt, war Starnberg herausgeputzt. Jede Firma, die etwas auf sich hielt, hatte einen gepflegten Vorgarten, selbst der Schrottplatz sah aus wie ein Künstlerhof. Neue Besen überall, glatter Asphalt ohne sichtbare Ausbesserungslöcher und wenn die Arbeiter des Gartenamtes morgens in ihre Arbeitshandschuhe schlüpften, stellte sich der oberflächliche Beobachter unwillkürlich die Frage, ob diese Handschuhe wohl von Hermès gefertigt würden. Dort gibt’s bekanntlich eine vortreffliche Gartenkollektion.
Sein Fahrrad hatte in der Nacht immer am S-Bahnhof Starnberg Nord gestanden, und war für die Nachtschwärmer, die um Viertel vor sechs mit dem ersten Morgenzug aus München kamen, eine unwiderstehliche Beute gewesen. Zuerst wurde das eine geknackt, dann war auch sein zweites Rad verschwunden. Timo war nicht wirklich böse darüber. Fast war er froh über die Möglichkeit, ein bisschen mehr Zeit zwischen S-Bahn und Arbeitsplatz zu haben. Doch auf dem Kilometer in der Morgensonne wollten diese trauernden Gesichter auch nicht verschwinden. Was war das für ein Tag? Ein prachtvoller Sommertag. Keine Anzeichen einer Katastrophe. Warum hatten die Frauen ihn so flehend angesehen? Was sahen sie in ihm? Einen Schuldigen? Einen Beschützer? Einen Beteiligten? Einen ebenso Verzweifelten? Einen Retter? Er fühlte sich immer irgendwie beteiligt.
Für einen 24-Jährigen machte sich Timo verdammt viele Gedanken über die Befindlichkeiten anderer Leute.
Aber vielleicht lag es ja an Selena. Sie war die Erste gewesen, die ihn heute so traurig angesehen hatte. Sie wollte ihm nicht sagen, wieso. Na ja, wie Frauen manchmal sind.
Er hatte die 29 Minuten Zugfahrt gut genutzt, Timo war zufrieden mit den drei Tränenporträts. Er wusste noch nicht genau, in welche Geschichte er sie einbauen wollte, und welche Rollen sie darin spielen sollten, eines war jedoch klar: Dass die schwarzhaarige Frau, die den Blick fest zu Boden auf eine Wasserpfütze gerichtet hatte, als wäre diese Pfütze ein Fenster in tiefer liegende Räume und als würde sie durch den Spiegel hindurch einem dunklen Wesen direkt ins Auge blicken, eine eigene Story bekommen würde.
Was heißt Story. Einen kleinen Comic. Der fotokopiert an ein paar Kunststudenten und Professoren verteilt, von Comic-Zeitschriften regelmäßig abgelehnt und vom Rest der Welt nicht mal ignoriert wurde. So sah’s aus.
Dann war er angekommen und öffnete die Tür zu SCP, einer Villa am See.
S für Schneidervater, C für Creative und P für Partner.
Das war ein wenig einfallsreicher Euphemismus für ein Beteiligungsmodell, das die leitenden Mitarbeiter davon abhielt, ihre eigene Werbeagentur zu gründen und trotzdem das ganze Kapital beim alten Schneidervater konzentrierte. So hatte es ihm zumindest sein Kumpel Flo erklärt, der täglich das Handelsblatt komplett durchlas und wöchentlich Timo klar zu machen versuchte, warum man mit Werbung kein Geld mehr verdienen könne. Timo fand nichts langweiliger als Wirtschaftsteile von Zeitungen, deshalb war ihm das Partnermodell der Agentur vollkommen gleichgültig.
Timo war der vermutlich beste Gestalter der Welt. Grafik-Designer, Comic-Zeichner, Illustrator, Foto-Künstler, Photoshop-Artist, in allen diesen Disziplinen war er herausragend.
Das hatte ihm der alte Schneidervater erklärt, nachdem er seine Bewerbungsmappe durchgeblättert und ihn direkt eingestellt hatte, über den Kopf von Arnold O. Langer hinweg, dem wichtigsten Art-Director des Hauses.
Eingestellt war leider nicht gleichbedeutend mit angestellt.
Timo war Praktikant. Und trotz seiner 60 Stunden-Woche bekam er gerade mal 630 Euro im Monat. »Überstunden? In keiner Agentur der Welt werden Überstunden bezahlt! Na gut, vielleicht in der Agentur für Arbeit. Aber nicht in Werbeagenturen.« Hatte ihm der Kreativdirektor Tom Thamm erklärt.
Timo war nicht wirklich verwundert, er wusste das bereits aus den beiden Jobs, die er davor gemacht hatte.
Bei ›Burn‹ (der Agenturslogan versprach: ›Zeit ist das Feuer, in dem wir brennen‹) hatte alles angefangen. Einem kreativen Hotshop, mit einer ganzen Wand voller Auszeichnungen und Kampagnen, die in aller Munde waren. Dort hatte er fast Tag und Nacht gearbeitet, denn die Arbeit fühlte sich gar nicht wie Arbeit an. Sie war reines Vergnügen. Und dieses Vergnügen sprang auf wunderbare Weise von Timos Werken auf ihre Betrachter über. Timo spürte nicht, dass die Zeit verging. Er spürte nur das Feuer, Ideen zu erzeugen, die Millionen von Kunden sehen würden. Und die sie vielleicht dazu bringen würden, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Zu kaufen oder nicht zu kaufen. Wach zu werden oder weiter zu schlafen.
»Und, was meinst du?«, fragte er immer leicht unsicher, wenn er einen Entwurf fertig hatte. Die Antworten variierten, wenngleich die Richtung immer dieselbe war. Seine Kreativ-Kollegen sagten: »Geil!«, die Berater: »Super!«, die englischstämmige Strategin: »Brillant!«, und die Kunden: »Ist gekauft.«
Timo fühlte sich, als wäre er nicht nur der Mittelpunkt der Agentur, sondern auch der wichtigste Botschafter der Welt. Schnell waren die neun Monate bei ›Burn‹ um. Am letzten Tag des Praktikums stand er bei Robert, seinem AD, also Art-Director, der gerade mal drei Jahre älter war als er, im Büro. »Äh, was mache ich eigentlich morgen?«
Robert hob nicht einmal den Blick vom Laptop, als er antwortete: »Weiß ich doch nicht.«
»Ja, ich dachte, ich mache bei euch weiter.«
Langsam hob Robert die Augen und sah Timo an: »Du weißt doch, wir übernehmen grundsätzlich keine Anfänger.«
»Ich bin doch kein Anfänger mehr.«
»Sagst du.«
»Heh – ich habe neun Monate Erfahrung.«
»Klar. Du kriegst ein gutes Zeugnis von mir. Mach’s gut!«
Als Timo am nächsten Tag aufwachte, war er genau dort, wo er schon einmal angefangen hatte. Direkt nach dem Abschluss als diplomierter Grafik-Designer. Aber es fühlte sich weniger euphorisch an. Er wusste nun, dass die Welt nicht auf ihn gewartet hatte. Auf ihn wartete nur eine schmucklose Kette von Bewerbungsgesprächen, vagen Versprechungen und der Erkenntnis, dass in zehn bis zwölf Monaten ein anderer Praktikant auf diesem Sessel sitzen würde.
Bei Suttner & Suttner lief es deutlich besser. »Ah, du liebst den Job, das sieht man«, meinte Bernd Suttner beim Durchblättern von Timos Mappe. »Bei uns wirst du ihn noch mehr lieben. Du darfst auf unserem wichtigsten Etat arbeiten. Kannst du Auto?«
»Als Junior-AD?«
Suttner lächelte gönnerhaft. »Darüber können wir in neun Monaten gern reden, ich könnte mir gut vorstellen, dass du zu uns passt. Aber vorher müssen wir uns beschnuppern, und das läuft bei uns nur über ein Praktikum. Abgemacht?«
Nach neun Monaten war Suttner immerhin bereit, das Praktikum um drei Monate zu verlängern, danach bekam Timo einen freundlichen Brief:
Lieber Timo,
leider erlaubt es die Profit-Situation der Agentur im Moment nicht, Dich als Junior-AD zu übernehmen. Um Deiner weiteren kreativen Entwicklung nicht im Wege zu stehen, müssen wir das Arbeitsverhältnis zum 31. Juli 2008 leider auflösen. Alles Gute, wir hoffen, dass wir Dich eines Tages wieder zurückbekommen.
Dein Bernd
›Praktikanten, die vor Begeisterung brennen, sind die wichtigsten Energieträger der Werbeagenturen‹ hatte ein Werbe-Fachblatt vor einiger Zeit geschrieben.
Zyniker, von denen die Werbebranche bekanntlich voll ist, haben noch hinzufügt: ›Diese Energieträger sind auch von ihrer CO2-Bilanz her besser. Mit ihren Hungerlöhnen können sie sich nämlich kein Fleisch leisten.‹
›Die weitere kreative Entwicklung‹ bestand nun also darin, dass Timo nicht mehr im Glockenbachviertel in München arbeiten durfte, sondern in Starnberg. Und auch nicht bei einer kreativen Top-Adresse, sondern in einem Laden, dessen Kreativität sich auf die Ausrichtung des jährlichen Sommerfestes konzentrierte.
Dieses Fest hatte es allerdings wirklich in sich: eine berühmte Jazz-Band, ein berühmter Koch, vier berühmte DJs, ein Dutzend berühmter Gesichter aus Film und Fernsehen, ein paar berühmte Musiker, ein paar Klatschreporter und dazwischen verzückte Anzugträger, die sich einen Abend lang als Stars fühlen durften und nicht als Werbeleiter. Der alte Schneidervater führte sie alle zusammen. An Leinen, die er ein Jahr lang ausgelegt hatte. »Dieses Fest, mein Junge«, sagte er eines Abends zu Timo, »ist das erfolgreichste Akquise-Instrument, das sich jemals eine Werbeagentur ausgedacht hat. Freu dich drauf, in zwei Wochen erlebst du dein erstes!«
2. Selena
Selena blickte zur Decke. Lichter wie helle, leuchtende Wasserpflanzen kletterten flink die Wand hoch und sprangen von der Wand hinauf zur Decke. Von dort aus drehten sie sich träge einmal im Kreis und huschten dann wieder die Wand hinab. Selena konnte ihren Blick nicht von dieser Erscheinung abwenden.
Eine kleine Spieluhr wiederholte zum dritten Mal die Melodie eines Wiegenlieds von Mozart.
Selena ging auf das Babybett zu und streckte die Hand aus. »Sch-schschsch-sch!«, sang sie leise und strich zart über den Hinterkopf des kleinen Konstantin. Der wollte eigentlich gerade mit dem Schreien beginnen und auf diese Weise ›ich bin (gähn!) überhaupt nicht müde (gähngähn!!) und überhaupt, mach’ die blöde Spieluhr aus (gähngähngähn!)‹ zum Ausdruck bringen. Selena war ihm, wie so oft, zuvorgekommen, sodass sich das angedeutete Schreien in einem zufriedenen Seufzer auflösen konnte.
»Wie machen Sie das nur, Selena?«, fragte Marianne sie immer wieder, »bei uns schreit Konstantin die Nächte durch.« Selena zuckte dann immer nur mit der Schulter und lächelte Marianne, die Mutter von Konstantin, an. Sie hätte mit ihrem harten kroatischen Akzent natürlich auch ›weiss auk nickt‹ sagen können, aber sie fühlte sich in ihren Liedern und Zeichen und Blicken und Gesten viel wohler als in der deutschen Sprache, die ihr unmelodiös und unsicher erschien.
Vielleicht war das auch der Grund, warum Konstantin ihr so vertraute. Schließlich bewegte er sich mit seinen eineinhalb Jahren und seinen drei Worten, die man mit viel Wohlwollen aus dem Gebrabbel heraushören konnte, auch nicht besonders souverän inmitten von Menschen, die ihn mit einem aktiven Wortschatz von 9.900 (bei Mama) und 900 Worten (bei Papa) umgaben. Da war ihm die Art, wie sein Kindermädchen mit ihm über Blicke, Berührungen, Gesten und lustige Quietschlaute kommunizierte, um einiges sympathischer.
Selena sah drei tiefe Atemzüge und wusste, dass sie das Licht der Drehlampe ausmachen konnte. Ihre Hand fand das Kabel, glitt unhörbar nach oben, nahm den Schalter zwischen die Finger, und die hellen Wasserpflanzen an der Decke lösten sich in der freundlichen Dunkelheit des Zimmers auf. Ohne ein weiteres Geräusch zu machen, huschte sie aus dem Raum. Dicht an ihre Beine geschmiegt glitt eine Katze mit hinaus, die sie keine Sekunde aus den Augen gelassen hatte. Vor ein paar Tagen war sie bei den Thamms eingezogen, sie hatte noch keinen Namen, Selena hatte festgestellt, dass sie auf Charlie reagierte, also war das der vorübergehende Name des Findelkinds, bis der Familienrat sich geeinigt hatte. Aber vielleicht blieb es auch dabei, »Hmh, Charlie? Charlie, Charlie, Charlie?« Sie beugte sich hinunter und kraulte die Katze hinterm Ohr.
Selena war nicht sicher, was sie vom anbrechenden Abend halten sollte. Eigentlich freute sie sich seit Wochen darauf. Sie wollte nun nach Hause fahren, 100 Kerzen anzünden, eine Flasche von Vaters Wein öffnen, ein bisschen Brot, Käse und Speck dazu servieren und Timo fest an sich drücken. Und dann würde sie ihm den wunderschönen, dicken weißen Schal schenken. Sie hatte ihn den Winter über aus feinster Merinowolle selbst gestrickt. Aus fünffädigem, dickem Garn. Oma Amalia hatte ihr alles über Merino beigebracht, sie hatte selbst auf ihrem Hof in der Nähe der Plitvice-Seen im damaligen Jugoslawien ein paar 100 Merinobergschafe gehabt und wusste, wie man das Fell zu feinster Wolle verarbeitete. Sie wusste, wie schön Merino die Temperatur ausgleichen konnte, sodass es im Winter nicht zu kalt und im Sommer nur selten zu heiß wurde. Sie wusste auch, dass der Händler, dem sie die unbearbeitete Wolle verkaufte, sie als Himalaja-Merino weiterverkaufte, das war alles noch lange bevor sie über Nacht ihren Hof verlassen mussten, um Richtung Norden zu fliehen, um dem Bruderkrieg, der ihr Land danach verwüsten sollte, zu entkommen. Im Februar 1991, drei Tage, bevor der Krieg begann.
Großmutter hatte gesagt: ›Wir müssen gehen.‹ Keiner hatte ihr widersprochen. Der 25-köpfige Clan vertraute sich ganz dem Gefühl von Amalia an. Und so zogen sie nach Fürstenfeldbruck, wo ein Teil der Verwandtschaft als Maurer und Fliesenleger eine neue Existenz gefunden hatte. Anfangs hatten sie sich mithilfe von Pfarrer Weißenbacher in den damals noch unrenovierten Klosterstallungen von Fürstenfeld einquartiert, den feuchten, kalten Katakomben, die im Winter nicht warm und im Sommer nicht trocken wurden. Es war hart gewesen. Das Asylrecht konnten sie nicht in Anspruch nehmen, dafür waren sie einfach zu früh geflüchtet, also waren sie Wirtschaftsflüchtlinge, und damit täglich von der Ausweisung bedroht. Aber es gelang ihnen, sich unentbehrlich zu machen. Amalia pachtete ein Grundstück und nahm die Merino-Zucht wieder auf (sie verstand, wie man die empfindlichen Bergschafe gesund durch die heißen Sommer brachte). Und sie fand einen Händler, der dringend nach Himalaja-Wolle suchte und auch bereit war, Himalaja-Preise zu bezahlen. Die anderen Familienmitglieder fanden genauso Arbeit. Abends saßen sie fassungslos vor den Fernsehern und betrachteten die Bilder aus ihrer brennenden Heimat. Die alte Amalia saß nie dabei. Sie musste es nicht noch einmal durchmachen. Sie hatte alles bereits vorhergesehen.
Selena war als Einzige weggezogen aus Fürstenfeldbruck, nach München, zu Timo, in eine kleine Wohnung. Eigentlich war das unmöglich für eine traditionelle kroatische Familie, aber Oma Amalia sah, dass es gut war, sie mochte Timo, und so fand das Paar den Segen der ganzen Sippe. Ab und zu, an den Wochenenden, rückten sie alle in Amalias kleiner Küche zusammen, da war auch Timo dabei, und die Familie merkte, dass er ein guter Kerl war. Sie waren auch ein bisschen stolz auf Selena, darauf, dass sie einen echten Bayern zum Freund hatte. Auch wenn Timo mit Lederhosen nichts am Hut hatte und kaum Dialekt sprach, es war, als wäre die Familie erst durch die Verbindung zu Timo richtig in Bayern angekommen.
Heute Abend wollten Timo und Selena ihren zweiten Jahrestag feiern. Seit vier Tagen hatten sie sich nicht gesehen. Timo musste die letzten Nächte bis elf in der Agentur schuften, und Selena hatte als Konstantins Babysitterin bei den Thamms übernachtet.
Selenas Telefon läutete. Sie sah, dass es Timos Agenturanschluss war.
»Lena, wie geht’s dir?«
Selena ahnte, dass sich ihr Gefühl bewahrheiten sollte. »Gut. Hungrig. Lustig.« Lustig bedeutete, dass sie Lust hatte auf Timo.
Ein müder Timo antwortete ihr: »Ich bin auch hungrig und lustig. Aber ich kann noch nicht losfahren.«
»Was soll das heißen? Du kannst nicht. Bist du Sklave oder was?« Telefonieren mit Selena war manchmal eine etwas unangenehme Sache. Es klang viel härter, als es gemeint war. Man konnte ihre Direktheit leicht falsch verstehen, was Timo aber nicht mehr passierte. Er hatte ihr Gesicht vor Augen und wusste, wie sie es meinte.
»Lenalenalena, du hast ja recht. Ich bin ein Sklave«, entgegnete er schwach.
»Sogar Sklave hat Feierabend.« Sie ließ nicht locker. »Du nicht. Aber wenigstens verdienst du viel Geld. 630 Euro. Jeder Azubi verdient mehr«, spottete Selena verächtlich ins Telefon.
»Lena, jetzt tust du mir auch noch weh. Ich muss heute noch fünf Anzeigen fertig machen. Und dieser Idiot von Arnold will mich fertigmachen.«
»Was ist fertigmachen?«
»Arnold kann mich nicht leiden. Er weiß, dass ich besser bin als er. Aber er zerstört jede Idee. Ich muss alles einfach nur so umsetzen, wie er es will. Es kotzt mich an.«
»Dann kotz doch und komm nach Hause.«
»Dann habe ich morgen keinen Job mehr.«
»Aber Chef, alter Vaterschneider, sagt doch immer, du bist die Zukunft der Firma!«
»Ja, aber wenn Arnold mich raushaut, wird niemand etwas dagegen unternehmen. Auch der alte Schneidervater nicht. Und wenn es hier wieder nicht klappt, dann kann ich mir einen neuen Beruf suchen.«
»Gut. Machst du in Merino. Ist schöner Beruf!«
»Das glaube ich schon. Ich will aber keinen anderen Beruf machen.«
»Dann du wirst immer Sklave bleiben. Timo, ich will keine Sklaven als Mann.«
»Nein, ich werde ein großer und berühmter …«
Selena unterbrach ihn. »Du wirst ein großer, berühmter Idiot werden.«
»Nein, Selena!« Nur wenn er streng mit ihr sprach, nannte er sie bei ihrem vollen Namen. »Ich werde nicht als Sklave enden, ich werde groß und berühmt. Und ich fange heute damit an.« Dann legte er auf. Vier Stunden später war Timos beste Arbeit, die er jemals gemacht hatte, fertig. Und Selena tot.
3. Phantomstreicheln
Als Kriminalhauptkommissar Thomas Wondrak die Gewissheit erreichte, dass Charlotte weg war, fror er im Gehen ein. Er war gerade auf dem Weg zum Sofa gewesen, einer modernen, aber doch gemütlichen Über-Eck-Sitzgruppe, die er vor einem halben Jahr bei einer selbstmörderischen 35-Prozent-Aktion des lokalen Möbelgiganten erstanden hatte. Vom ersten Abend an war dieses Sofa zum Lieblingsplatz Wondraks und Charlottes geworden. Obwohl es Wondrak ganz allein gekauft hatte. Ohne Charlotte zu fragen. Und nun blickte er auf die zusammengefaltete braune Kamelhaardecke und vermisste die Kuhle, die ihre Besitzerin verriet. Vier Tage. Das war doppelt so lang wie der längste Solotripp, den sie jemals unternommen hatte. Gedankenverloren setzte er sich hin und ließ seine Hand über die Decke wandern. Er konnte sie beinahe neben sich spüren. Als könnte er sie herbeistreicheln, begann er die braune Decke zu kraulen. Doch die tat ihm nicht den Gefallen, zu schnurren. Sie reckte ihm auch nicht ihr rechtes Ohr entgegen, damit er es am Ansatz liebkosen konnte. Und sie streckte auch keine Vorderpfoten aus, um sich zu recken und die Nägel in der Decke zu vergraben. Und doch hatte er das Gefühl, dass sie da war. Es war wie bei einer Amputation. Der ganze Arm fehlt und doch melden die Nerven ans Gehirn immer noch rätselhafte Signale wie: Nagelhaut am linken Zeigefinger ist eingerissen, müsste abgeschnitten werden. Phantomschmerzen eben. Da war nichts mehr zu fühlen, und doch spürte man jedes Detail.
Vier Tage lang hatte er jeden Morgen den Fressnapf neu gefüllt und jeden Abend war er unangetastet geblieben. War Charlotte in die Amper gefallen, den breiten, warmen, ruhigen und doch schnellen Fluss, der direkt an seinem Garten vorbeirauschte? Hatte sie sich vom verführerischen Zwilipp der Bachstelzen in den Weiden so lange auf immer dünnere Äste locken lassen, bis die Schwerkraft schließlich über das Jagdfieber siegte? Zweimal täglich war Wondrak durch den Garten gepirscht und hatte sie gerufen. Sein ›Dschungel am Amazonas‹, wie er ihn gelegentlich nannte, war nicht besonders groß, aber so dicht verwildert, dass sich darin ein Dutzend Verstecke finden ließen.
Er hatte bei den Nachbarn nachgefragt, die gelegentlich die Fütterung übernahmen, wenn Wondrak mal länger auswärts unterwegs war, doch auch hier nichts.
Er brauchte dringend Charlottes Beistand. Denn seit er heute Morgen aufgestanden war, hatte er dieses Kribbeln in der Lebenslinie seiner rechten Hand. Und das waren keine Phantomschmerzen. Wenn es ihn in der rechten juckte, war das meist ein Zeichen, dass es Arbeit gab. Die Rechte war die Hand, mit der Wondrak nachdachte, kritzelte, schrieb, zielte und schoss. In Wondraks Revier war ein Mord geschehen.
4. Das Schweigen der Lammwolle
Sie hatte eine Stimme wie ein Lambswoolpullover. Weich, aber auch eine Spur kratzig. Wer Clara zum ersten Mal reden hörte, fragte sich: Welche Signale wurden hier gesendet? Dieses heisere, kehlige, kullernde Lachen erzählte 1001 Geschichte von tobenden Nächten. Von exzessiven Gelagen. Vom Fehlen irgendwelcher Einschränkungen. Von unendlichen Möglichkeiten. Es waren Versprechungen, die kein lebendes Wesen erfüllen konnte. Und so wurde Clara zu einer Fantasie. Jeder konnte sich selbst ausmalen, was unter dem Lambswoolpulli steckte. Jeder konnte mit ihr machen, was er wollte. Ihr machte alles Spaß. Für 1,72 Euro pro Minute.
Hubert öffnete die Haustüre. »Wenn Sie bitte hier unterschreiben wollen«, sagte die brünette Frau zu ihm in einem Ton, der irgendwie künstlich klang. Gepresst. Sie war schlank, nicht groß, nicht klein, weder schön noch hässlich, Ende 30 und trug einen Parka, der ihre Figur verhüllte. Hubert nahm das Paket entgegen und schloss die Tür wieder.
»So, da bin ich wieder, na, was sagst du? Ich hab’ mir ein bisschen was …«, und hier machte die weibliche Stimme eine kleine Kunstpause, »… Leichteres angezogen, gefällt’s dir?«
Hubert sah aus dem Fenster, wie die Kurierfahrerin ins Auto einstieg.
»Hmm … beschreib mal, was du anhast, du kleines Biest!«
Der Lambswoolpulli nahm seine weiche, kratzige Melodie wieder auf, doch Hubert merkte, wie sich in den sonst so selbstsicheren Klang ein wenig Hilflosigkeit gemischt hatte. Dann legte er auf.
5. Alles wie immer. Also nichts
Wondrak hatte wieder einmal keinen Mord auf dem Tisch, als er beschloss, den Kollegen vom KDD einen kleinen Besuch abzustatten. Der Kriminaldauerdienst, den er davor nur aus dem Fernsehen kannte, war in Fürstenfeldbruck angekommen. Die Polizeireform von Altlandesvater Stoiber (oder sollte man in der Ära Seehofer besser Altlandesurgroßvater sagen?) war eigentlich gar keine schlechte Idee gewesen. Sie hatte die bisherigen Polizeidirektionen aufgelöst und große Zentralen gebildet.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!