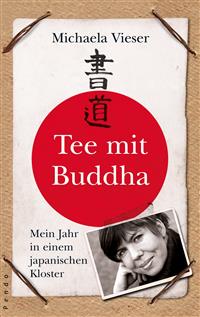
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Michaela Vieser
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Als Michaela Vieser in einem japanischen Kloster landet, ist Buddhismus für sie kaum mehr als ein Modewort. Ein Jahr bleibt sie an dem abgelegenen Ort, zu dem sie als erste Frau aus dem Westen Zutritt erhält. Sie singt und betet mit den Mönchen, wird in die Geheimnisse der Teezeremonie, des Schwertkampfes und der Kalligrafie eingeweiht. Sei es der Bergasket oder der Karaoke singende Zen-Mönch - die Begegnung mit faszinierenden Menschen offenbart ihr das Land hinter dem Lächeln. Eine besondere Begegnung mit der gelebten Spiritualität Japans, realistisch, mit Sinn für Details und einer gehörigen Portion Selbstironie erzählt. Spiegel Bestseller
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Für die Bewohner des „Klosters des rechten Weges“, und für Baldur, Elisabeth und Charlotte, die auf ihrem Weg so munter drauflos tapsen.
Inhalt
Inhalt
Einleitung
1 Runterkommen, Reinkommen – und die Realität
2 Der Meister, das Dharma und Zickenalarm
Goingesama, der Oberabt
3 Göttliche Worte, menschliche Taten und die Familie eines Kriegsverbrechers
Herr Sato, Rentner
4 Tusche, Papier und die Leere
Frau Uchida, die Kalligrafie-Lehrerin
5 Teezeremonie, Blumenstecken und Mozart im Kaffehaus
Emyo, der Teemeister
6Nazi-Lieder, Pflaumenbäume und ein Vögelchen
Kokan, der strenge Mönch, und Megumi, seine Frau
7 Schwerter, Schweigen und ein Schrei
Hirano, mein Schwertkampf-Lehrer
8 Ein Berg, eine dumme Idee und die Tengus
Mari und Kawa,die zwei Alten vom Berg
9 Mondgeflüster, Schattendasein und ein Versprechen
Joshin und Roshin, die Brüder
10Eine Witwe, ein Garten und viel Moos
Kyoko, die Witwe
11Zen, Whisky und ein langer Weg
Oshō-san, der Zen-Meister
12Abschied, Neustart und ein Beatnik
Glossar
Literatur
Dank
Deai
Einleitung
Einleitung
„Im Westen die Sonne, im Osten der Mond“,so lautet der Titel eines norwegischen Märchens und eine Zeile in einem Gedicht von J. R. R. Tolkien. In beiden Zeugnissen geht es um die Suche nach einem Land jenseits der vertrauten Welt, wo alles, was das Glück ausmacht, zusammenkommen soll. Dieses Land liegt in der Ferne, dort, wo im Westen die Sonne und im Osten der Mond am Himmel stehen.
Ähnlich suchte ich, als ich nach Japan aufbrach, um dort ein Jahr lang in einem buddhistischen Kloster zu leben. Ich hoffte, auf der anderen Seite der Erdkugel, in einem Land, dessen Kultur sich so radikal von meiner unterschied, einen Platz zu finden. Mein Dasein sollte erleuchtet werden von einer Sonne im Westen und einem Mond im Osten.
Und das kam so: Während meiner vier Jahre in London, in denen ich Japanologie und Orientalische Kunstgeschichte studierte, wurde uns geraten, ein Jahr an einer Universität in Japan zu absolvieren. Normalerweise schrieb man sich dort in einem für Ausländer konzipierten Sprachkurs ein, lebte in einem Wohnheim für ausländische Studenten und lernte dadurch Land und Leute kennen. Mir sagte das wenig zu, auch aus dem Grund, weil ich als Deutsche in England diese Erfahrung schon bis zu einem gewissen Grad durchgemacht hatte und ich mir davon nichts Neues versprach. In mir wuchs der Wunsch, Japan anders kennenzulernen. Ich wollte tiefer eintauchen in diese fremde Kultur, wollte die alten Traditionen an einem Ort erfahren, an dem sie noch lebendig waren. Besonders sehnte ich mich nach dieser tiefen Stille, die für mich von allen japanischen Kunstwerken ausging, ich wollte sie am eigenen Leib spüren. Je mehr ich darüber nachdachte, umso mehr kam ich zu der Überzeugung, dass ich all das nur in einem buddhistischen Kloster finden würde. Sicherlich ein etwas ungewöhnliches Anliegen.
Aber es war nicht nur schwer, ein solches zu finden, es schien schlichtweg unmöglich zu sein. Zuerst versuchte ich einen Kontakt zu einem solchen herzustellen, indem ich verschiedene Zen-Zentren in London aufsuchte. Was ich dort an Informationen bekam, setzte ich sofort in Briefe und Telefonate um. Doch wochenlange Recherchearbeiten brachten keinen Erfolg: In ganz Japan schien es nicht ein einziges Kloster zu geben, das sich zutraute, eine junge Frau aus dem Westen bei sich aufzunehmen. Bis ein japanischer Mönch, der an meiner Universität Buddhismus lehrte, mich ansprach. Er hatte schon von mir gehört und unterbreitete mir folgendes Angebot: ein ganzes Jahr in seinem Mutterkloster zu wohnen. Einfach so.
Ich sagte sofort zu und reiste wenige Monate später dorthin. Ich wusste, dass es kein Zen-Kloster sein würde, sondern ein Jōdo-Shinshū – ein Wahre-Schule-des-Reinen-Landes-Kloster, das Mitte des 16. Jahrhunderts gegründet worden war. Mir wäre ein Zen-Kloster zwar lieber gewesen, da der eher reduziert-konzentrierte Ansatz dieser Religion meiner Suche nach etwas anderem gedanklich vertrauter erschien, doch dachte ich mir, dass auch der Jōdo-Shinshū-Weg mir den Buddhismus näherbringen würde. Noch wusste ich wenig über diese Strömung, die seit dem japanischen Mittelalter eine der beliebtesten Glaubensrichtungen in Japan ist.
Mit dieser Entscheidung ging ich etwas ein, eine kleine Herausforderung: Wie würde ich als Frau in diesem für Männer bestimmten religiösen Ort leben? Doch da es neben dem Abt eine Bomorisan geben sollte, eine Ehefrau, war ich etwas beruhigt. Mein Abenteuer konnte beginnen, und ich hoffte auf neue Einsichten und tief greifende Erlebnisse.
Derer gab es viele. Rund hundert Bewohner hatte das Kloster. Aber in ihm lebten nicht nur Mönche, sondern auch Mütter und Väter mit ihren Kindern, Großeltern, Salariman, also die typischen japanischen Angestellten, wie auch Studenten – mithin ein Spiegelbild der japanischen Gesellschaft. Erstaunt war ich über meine anfänglichen Schwierigkeiten, mit ihnen zu kommunizieren. Ich hatte drei Jahre lang Sprache und Schrift des Landes gelernt – aus diesem Grund erwartete ich, mich mit allen gut zu verstehen. Als ich aber radebrechend vor den ersten Klostermitgliedern stand, merkte ich, dass ich mich selbst überschätzt hatte, was meine Verständigungsfähigkeiten betraf. Deutsch sprach in diesem Umfeld keiner, und Englisch nur die wenigsten. Es blieb mir nichts anderes übrig, als viel zu fragen und schnell zu lernen. Weiterhin hatte ich, zugegebenermaßen, eine etwas verklärt-romantische Vorstellung von meinem zukünftigen Ort gehabt, an dem ich ein Jahr leben wollte: Ich war davon ausgegangen, dass sich ein Kloster auf einem Berg befand, weit weg vom profanen Leben. Stattdessen musste ich feststellen, dass es mitten in einer kleinen Stadt auf der südlichsten Hauptinsel Japans lag, umringt von einer belebten Marktstraße. Das urbane Leben ging weiter, während ich auf wenigen Quadratmetern zu einer Gemeinschaft gehörte, die sich als Ziel gesetzt hatte, die buddhistischen Werte von Harmonie, Respekt und Mitgefühl im spirituellen wie weltlichen Alltag umzusetzen.
Je länger ich im Kloster lebte, desto mehr ehemalige Kommunisten lernte ich kennen, die hier ihr neues Zuhause gefunden hatten. Anscheinend waren ihre höheren Ziele den buddhistischen nicht unähnlich: die Schaffung einer Gesellschaft auf Basis von Gleichheit, Demokratie und Frieden. Das Thema tauchte in vielen Erzählungen auf – eine Facette der Nachkriegsgeschichte dieses Landes, in dem eine Aufarbeitung der traumatischen Erlebnisse während des Zweiten Weltkriegs nicht stattgefunden hat. Es gab Klosterbewohner, die den Abwurf der Atombombe über Nagasaki gesehen hatten.
Überraschend waren die exzellenten Lehrer in diesem Kloster, die mir viele der alten traditionellen Künste Japans näherbrachten. Einige waren in ihren jeweiligen Fertigkeiten anerkannte Meister und kehrten sogar im Kaiserhaus ein und aus. Dass sie sich meiner annahmen, bedeutete wirklich eine Reise in eine andere Welt. Aber nicht nur sie berührten mein Innerstes, auch die „normalen“ Klosterbewohner und ihre Geschichten beschäftigen mich bei meiner Entdeckungstour. Tee mit Buddha handelt von all diesen Menschen.
Im Japanischen gibt es das Wort deai. Es setzte sich zusammen aus den Schriftzeichen für „aus sich herausgehen“ und „treffen“. Ein deai ist daher eine Begegnung, die mehr ist als das physikalische Aufeinandertreffen zweier Personen. Bei einem deai passiert etwas.Vielleicht macht es „bäng“ oder „kawumm“. Vielleicht auch nicht.Ein Knistern liegt in der Luft, plötzlich scheint die Welt für kurze Zeit aus den Fugen zu geraten, nur um sich danach wieder neu zusammenzusetzen. Ein deai bringt positive Veränderungen mit sich, ein deai kann schicksalsbestimmend sein. Durch das deai versteht man möglicherweise etwas, das man lange nicht verstanden hat. Im Zweifelsfall ist ein deai einfach nur schön und nah.
Fast jedes Kapitel in diesem Buch ist einer anderen Person gewidmet. Die meisten von ihnen traf ich nicht in einer zeitlichen Abfolge, wie man vielleicht durch die Struktur des Buches annehmen könnte, sondern parallel. Sie alle begleiteten mich damals durch die Jahreszeiten und noch heute im täglichen Leben.
Gern sagt man nach einer solchen Erfahrung, wie ich sie im Kloster gemacht habe: Ich bin dort ein anderer Mensch geworden. Das stimmt auch. Ich sah zwar noch genauso aus wie vorher, mir war weder Bart noch Heiligenschein gewachsen, ich interessierte mich weiterhin für dieselben Dinge, habe nach wie vor Spaß an Musik und Partys. Aber etwas hat in diesem Jahr meine Weltanschauung verändert. Das Leben ist mir näher gekommen.
Namanda.
1
Runterkommen, Reinkommen – und die Realität
… er wollte an das andere Ufer und sehen, dass er weiterkam. Weiterkommen wollte er im Dharma.
Jack Kerouac, Gammler, Zen und hohe Berge
„See you later, Mrs. Snyder“ – das rief mir noch ein Freund zu, als ich in den Bus sprang, um London zu verlassen, mit einem Visum in der Tasche für kulturelle Erfahrungen bei japanischen buddhistischen Mönchen.
Mrs. Snyder? So heiße ich doch gar nicht. Komisch.
Erst später kam mir in den Sinn, was er damit meinte. Es war eine Anspielung auf Gary Snyder, den Beatnik-Poeten, den ich so verehrte und der ein wenig Schuld daran war, dass meine Reise gen Osten ging, bis nach Japan. Japan, das war das Land der Morgenröte, das Land des Lächelns, das Land der Kirschblüten, das Land von Madame Butterfly, das Land der ... – ach, wahrscheinlich alles unerfüllte Sehnsüchte. Es gibt so viele Bezeichnungen für diese Inseln, die sich hinter dem asiatischen Festland im Pazifik ausbreiten und für viele eine Projektionsfläche sind für etwas, was sie in der eigenen Kultur oder im eigenen Leben nicht finden, dort aber zu entdecken hoffen.
Ich war also die weibliche Snyder, weil ich, wie Gary vor Jahrzehnten, nach Japan aufbrach, um das Land hinter dem Lächeln kennenzulernen. Der Dichter war Ende der fünfziger Jahre von San Francisco nach Kyōto gereist, um dort in einem Zen-Kloster zu leben. Er war auf der Suche nach nichts Banalerem als „der Wahrheit“ – und hoffte, diese durch die strenge Disziplin des Zen-Buddhismus zu finden. Ob er sie tatsächlich fand oder nicht, das will ich nicht beurteilen, jedenfalls bildete ich mir ein, dass er seither mit Kraft und Demut, mit Klarheit und Begeisterung schrieb und lebte. Und das wollte ich auch. Wie er hatte ich die Möglichkeit, ein Jahr lang in einem buddhistischen Kloster zu wohnen und einzutauchen in diese fremde Kultur. Wenigstens ein Fünkchen Erleuchtung wollte ich in mein – westliches – Leben zurückbringen können.
Als ich mich in Deutschland von meiner Familie und von den Freunden verabschiedete, musste ich mir mehr als einmal den Witz anhören: „Du kannst dir dein Rückflugticket sparen, denn wenn dein Jahr im Kloster vorbei ist, kannst du auf einer Wolke zurückschweben.“
Vorerst aber war das Transportmittel meiner Wahl das Flugzeug. Endlich saß ich in einer Maschine und war mittendrin auf einer Reise, die mein Leben verändern sollte.
An der Universität hatte ich den japanischen Begriff ochitsuki aufgeschnappt,was so viel bedeutet wie „Geistesgegenwart“, „innere Ruhe“, „Frieden“. Sagt jemand „ochitsuita“, so benutzt er eine Verbform und will damit zum Ausdruck bringen, dass er endlich angekommen sei, er sich ruhig fühle, relaxed. Wörtlich übersetzt meint es auch: „Ich bin runtergekommen.“
Als der Landeanflug auf die kleine Stadt im Süden Japans begann, war es auch ein Runterkommen. Und ein ziemlich ernüchterndes dazu. Was da unten an mir vorbeizog, war einer jener Orte, von denen man sich sofort wieder wegwünscht. Fetzen einer grauen, hässlichen Betonstadt breiteten sich unter mir aus. Konzeptlos standen da Zementblöcke als Häuser kaschiert herum, mit quadratischen Löchern, die wohl Fenster sein sollten, vor denen Air-Conditioning-Boxen angebracht waren. Ein Kabelsalat an elektrischen Drähten verband die Quader miteinander, alle paar Meter waren sie an zum Teil schief stehenden Masten zusammengebunden.
Da war kein Berg Fuji, der mir durch Wolken entgegenglitzerte. Auch kein Bambuswäldchen, das sich im Wind bewegte. Oder ein Tempel mit geschwungenem Dach, das Drachen einlud, sich darauf niederzusetzen. Bambus und Tempel tauchten noch nicht einmal auf einer der Riesenwerbeflächen auf, an denen ich im Flughafengebäude vorbeilief, um zur Immigrationsbehörde zu gelangen. Der Berg Fuji schon, für eine Bankanzeige. Ansonsten waren auf den Reklametafeln niedliche Japanerinnen, noch niedlichere Kätzchen oder Cyber-Roboter zu sehen. Ein einziger Bildersalat!
Ich musste mich zusammenreißen. Es konnte nur besser werden, oder?
Der Flughafen lag auf einer der südlichen Inseln Japans, und nachdem ich in Osaka in eine kleinere Maschine umgestiegen war, befand sich außer mir kein anderer Mensch aus dem Westen mit an Bord. Aus diesem Grund hatte der Japaner, der hinter der Absperrung auf und ab hüpfte und mir immer wieder zuwinkte, auch die Gewissheit, dass ich diejenige sein musste, auf die er wartete. Aber woher hatte ich wiederum den Beweis, dass er der war, der mich in Empfang nehmen sollte? Den kryptischen Faxen des Klosters hatte ich entnommen, dass mich der Mönch Wado vom Flughafen abholen wollte. Ich sah aber keinen Mönch. Ich sah nur diesen für einen Japaner viel zu groß geratenen Mann, etwas untersetzt, mit dichtem schwarzen Haar, der zwar ein freundliches Gesicht hatte, aber so gar nichts Mönchisches ausstrahlte. Er war normal gekleidet, mit einer Stoffhose, darüber eine Windjacke. Vielleicht hatten sie auch einfach nur den Hausmeister zum Abholen geschickt?
„Konnichi wa, yokōso – Willkommen!“, rief mir der „Hausmeister“ entgegen, dabei war ich noch nicht einmal in seiner Nähe. Und als ich vor ihm stand, fügte er hinzu: „Jetzt musst du mir erklären, wie man deinen Namen ausspricht.“
„Michaela“, sagte ich langsam. Ich wunderte mich über mich selbst, dass ich ohne weitere Nachfrage das tat, worum man mich gebeten hatte.
„Huh? Mischa-e-ra?“, wiederholte jener Mann, dessen Namen ich ja noch nicht kannte.
„Ja, äh, Mi-cha-e-l-a.“
„Wie Michael Schuhmacher?“ Seine Worte kamen wie aus der Pistole herausgeschossen, und das große Fragezeichen, das ihm vorher auf der Stirn gestanden hatte, wich und wurde zu einem Ausrufezeichen.
„Na ja, fast, aber ich habe da noch dieses a.“
„Michael Schuhmacher. Haha!“ Der Mann zog dabei seine Schultern ein und tat so, als ob er hinter einem Lenkrad sitzen würde. „Brumm Brummmmmmm.“
„Ja, brumm brummm. Sie kennen ihn?“
„Ich bin ein großer Fan von ihm!“
„Ah“, sagte ich nur, damit wollte ich das Thema beenden. „Der Mönch Wado konnte wohl nicht kommen, oder? Wer sind dann Sie?“ Während der „Hausmeister“ mich geduzt hatte, zog ich doch die Sie-Anrede vor.
„Hmm ...? Ach so, ja doch. Ich bin Wado.“ Und er nickte dabei heftig mit dem Kopf, seine Augen strahlten. „Herzlich willkommen in Japan!“
„Danke fürs Abholen“, sagte ich schnell, um meinen Fauxpas möglichst wenig Raum zu geben. Ich war noch verwirrter, als man es nach einem langen Flug sowieso gewöhnlich ist. Ochitsuki, das Ankommen, musste wohl ein wenig warten.
Wado, der Mönch, der in keinster Weise aussah wie ein Mönch, schulterte mein Gepäck und führte mich zu einem schicken schwarzen Auto, das vor dem Flughafengebäude parkte. Wir stiegen ein, und sofort fing er zu reden an, eigentlich ratterte er in einem fort irgendwelche Sätze, die ich kaum verstand, nur einige Wortbrocken. Zuerst hatte ich angenommen, dass er einen Monolog hielt, aber irgendwann schien er etwas zu wiederholen. In diesem Augenblick begriff ich, dass er eine Frage an mich gerichtet hatte. Ich war zu müde, um genau hinzuhören. Ich hatte sein wasserfallartiges Sprechen zum Anlass genommen, zum Fenster hinauszuschauen. Wobei ich innerlich ein kleines Stoßgebet ausstieß: Möge die Landschaft da draußen doch allmählich schöner werden. Schließlich befand ich mich jetzt auf der Zielgeraden zu einem Kloster, in dem ich das nächste Jahr über wohnen würde. Ich erinnerte mich in diesem Augenblick daran, mit meinen Eltern einmal eine Ostseereise gebucht zu haben, bei der im Prospekt versprochen worden war, dass wir von der Ferienwohnung aus einen Blick aufs Meer und den Strand hätten. Das stimmte auch, nur war das Gelände, auf dem sich unsere Ferienwohnung befand, ein Klein-Marzahn an der Ostsee gewesen. Den Blick aufs Meer hatten wir, den Blick auf den Supermarkt aber auch.
Ich hoffte inbrünstig, dass es hier nicht so sein würde.
Aber was wollte Wado jetzt schon wieder?
„Michael Schuhmacher. Haha!“ Wado lachte erneut.
„Ja“, sagte ich, „der Rennfahrer.“
„Deutschland – das Land der schnellen Autos. Und der Autobahnen!“ Der Mönch ließ mich an seinem Halbwissen Anteil nehmen.
„Ja, so ist das.“ Ich war plötzlich müde, schrecklich müde.
„Gleich sind wir da“, versprach Wado. Ich schaute erschreckt auf. Das, was ich da draußen sah, wirkte nicht vielversprechender als das, was ich vom Flugzeug aus registriert hatte. Auch das Wetter half nicht, dem Ganzen etwas Schönes abzugewinnen. Obwohl es Sommer war, bedeckten graue Wolken den Himmel. Die Gegend war etwas ländlicher geworden, aber auch nur etwas. Wir hatten eine Stadt verlassen, vor uns tauchte aber schon die nächste auf. Lange Reihen von Häusern flossen einfach ineinander über.
Im nächsten Moment bogen wir ab von der Schnellstraße, auf der wir uns bislang fortbewegt hatten, kamen in kleinere Gässchen und Sträßchen. Von Stadtplanung keine Spur. Es war ein wilder Mix aus mehrstöckigen Betonklötzen, alten Holzhäusern und Lücken, in denen ich die typischen roten Holzbalken von kleinen Nachbarschaftsschreinen ausmachen konnte. Zwischen den Hochhäusern war eine Pagode zu erkennen. Das sah ganz hübsch aus, und als ich die Augen zusammenkniff und mir das Hochhaus wegdachte, gefiel es mir noch besser. Das musste wohl das Kloster sein.
„Der Goingesama wird leider nicht da sein, Bomorisan auch nicht. Aber all die anderen, die erwarten dich.“
Goingesama, das wusste ich, war der Oberabt des Klosters. „Bomorisan“ heißt übersetzt: „die Hüterin des Tempels“, sie war Goingesamas Frau.
Und wie viele mich erwarteten! An die fünfzig Personen waren auf dem Parkplatz vor dem Kloster zusammengelaufen und winkten mir zu. Alle sahen fröhlich aus. Meist waren es ältere Männer und Frauen, darunter auch ein paar Kinder. Ein Mann saß im Rollstuhl und trug ein Sauerstoffgerät bei sich, das über zwei Plastikröhren an seine Nase geschlossen war. Doch auch er schaute mich mit erwartungsvollen Augen an.
Als ich aus dem Auto ausgestiegen war, kümmerten sich sofort ein paar Männer um mein Gepäck. Eine alte Frau mit grauen Haaren nahm meine Hand und drückte sie. Sie flüsterte mir ins Ohr: „Wir haben auf dich gewartet. Schon vor fünfzehn Jahren sagte die Ekaisama dein Kommen voraus.“
Ekaisama? Keine Ahnung. Ich würde jemanden danach fragen. Später. Wenn sich dieser Wahnsinn hier gelegt hatte.
Die alte Frau hing jetzt regelrecht an meinem Arm und führte mich weg vom Parkplatz zum Klostergelände, das von einer Mauer umgeben war. Bevor wir durch das Tor traten, zog sie an meinem Ellenbogen und bedeutete mir, auf ein Schild zu schauen, das neben dem Tor aufgebaut war. Darauf waren japanische Schriftzeichen gemalt. Ich konnte sie nicht lesen, nur den Namen des Klosters, der übersetzt so viel hieß wie „Kloster des rechten Weges“. Ich nickte nur.
Die Frau zog mich weiter durchs Tempeltor. Doch kaum wollte ich weitergehen, da ruckte sie erneut an meinem Arm und machte eine Verbeugung. Mit einem freundlichen Blick wies sie mich an, dasselbe zu tun. Natürlich wollte ich ihr folgen, und so verbeugte ich mich ebenfalls. Die Frau schien meine Geste glücklich zu machen.
Kurz blieb ich stehen, um den Anblick zu genießen. Ah, hier sah alles schon ganz anders aus. Vor mir breitete sich die Klosteranlage aus. Vom Tempeltor führte ein breiter mit grauen Steinen ausgelegter Pfad direkt zu einem großen Gebäude mit geschwungenem Dach. Das musste das Tempelgebäude sein, unsere Verbeugung hatte ihm gegolten. Links und rechts des Weges waren fein säuberlich geharkte Kieselsteine und kleine mit Moos bewachsene angelegte Hügel. Unmittelbar neben mir plätscherte sogar Wasser aus einem Bambusrohr in einen ausgehöhlten Fels, ganz leise, aber es war ein angenehmes, beruhigendes Geräusch. Vor dem Tempelgebäude zweigte der Pfad nach links ab, vorbei an einem stattlichen Gingkobaum, geradewegs auf die Pagode zu, die ich bei der Anfahrt schon erblickt hatte. Rechts des Pfades lag ein kleines Gebäude mit einem länglichen Anbau. Hierhin brachte mich die alte Frau.
Sie schob die Eingangstür einfach zur Seite. Geschickt schlüpfte sie beim Eintreten aus ihren Schuhen und reichte mir ein paar Pantoffel. Das Ausziehen meiner Turnschuhe dauerte etwas länger. Ich war ungeduldig, es ging mir nicht schnell genug – natürlich brauchte ich daher mehr Zeit als sonst. Die Frau ließ mich bei meinem Tun nicht aus den Augen und beobachtete meinen stillen Kampf mit den Schnürsenkeln – sicher dachte sie sich dabei ihren Teil. Schließlich schubste sie mich in einen kleinen Raum, der mit Tatami-Matten ausgelegt war. Sie wurde erkennbar aufgeregter. Eine andere Frau, etwas jünger, kam herein und bot uns Tee an. Während die Alte und ich uns an einen kleinen Tisch hinknieten, schaute eine dritte Frau durch den Türspalt zu uns herein, kicherte und ging wieder. Nach einer Weile kehrte sie zurück, setzte sich neben mich und fasste mir, ohne zu fragen, ins Haar. Ich schaute sie etwas verwundert an, doch sie strahlte und sagte zu dem Großmütterchen, das mich hierher gebracht hatte: „Schau nur dieses Haar! Es ist so weich. So schön! Wie das Fell meines Hundes.“
Ich wusste nicht, ob ich das als Kompliment oder als Anmaßung verstehen sollte. Da aber beide Frauen mich daraufhin herzlich und bewundernd anblickten und einige „ah,so desu ne“ – die japanische Version von „ach ja, so ist das“ – austauschten, nahm ich an, dass sie nicht so oft hellbraunes Haar zu sehen und zu fühlen bekamen.
Endlich tauchte ein bekanntes Gesicht auf: Wado. Ich war seit knapp eineinhalb Stunden auf japanischem Boden, die Eindrücke stürzten nur so auf mich ein, und Wado wiederzusehen, das war, wie einen alten Bekannten zu treffen. Er hatte sich umgezogen und trug nun ein Mönchsgewand. Ja, jetzt sah man es, er war wirklich ein Mönch. Er wirkte plötzlich auch viel ernster, weiser. Und er fragte mich auch nicht mehr nach dem berühmten deutschen Rennfahrer. Vorerst zumindest.
Zusammen mit Wado hatte ein anderer Mann den Raum betreten, der sich mir als Soshin vorstellte und wie Wado in eine schwarze Robe gekleidet war. Soshin entsprach so ganz meiner Vorstellung eines Mönches: Er wirkte ehrwürdig und weise, und er hatte einen geschorenen Kopf, auch wenn das in seinem Fall auf sein Alter zurückzuführen war und nicht auf die Tonsur. Das Gesicht dieses alten Mannes zeigte nichts als Freundlichkeit, es sah so aus, als würde es den ganzen Tag nichts anderes tun als zu strahlen. Soshin lächelte mich auch sofort an, als hätte er meine Gedanken gelesen, und begrüßte mich im Namen des Goingesamas und seiner Frau. Er gab mir zu verstehen, dass die beiden leider gerade nicht hier seien, aber in ein paar Tagen kämen und sich sehr auf mich freuen würden.
„Der Goingesama hat einen Brief für dich dagelassen, er hat ihn sogar auf Englisch geschrieben“, sagte Soshin und überreichte mir einen Umschlag.
Ich war mir nicht sicher, ob ich ihn jetzt und hier aufmachen sollte, da mich aber alle erwartungsvoll anstarrten, öffnete ich ihn:
Liebe Michaela,
herzlich willkommen in unserem Kloster, du, die von so weit her über das Meer gekommen bist.
Das Wichtigste für uns Menschen ist nicht die eigene spirituelle Entwicklung, die ohnehin stattfindet und sich immer weiter vertieft, sondern das Wachstum und die Ausweitung des Mitgefühls gegenüberanderen und das sympathische, verbindendeBewusstsein mit anderen.
Es ist mein eigenes besonderes Gebet, dass du dies verstehen mögest, du, die du dich auf die Suche in dieser dir unbekannten Welt begibst. Ich bin mir sicher, dass es auch dein Gebet werden wird. Der Toyotaya, das Haus, in dem du wohnen wirst, wurde gebaut, um dieses Bitte zu erfüllen.
Es wäre mein großer Wunsch, dass du hier im Tempel dein neues Zuhause finden wirst und wir „kreativ“ zusammenleben werden.
Ich freue mich schon darauf, dich persönlich kennenzulernen,
Goingesama
Das war kein Brief, den ein Oberabt, der viel um die Ohren hat, dahingekritzelt hatte. Er war in diesem Schreiben auf mich eingegangen, und ich fühlte mich tief in meinem Innern berührt. Ich bedankte mich bei allen und fühlte etwas Ruhe in mich einkehren. Jetzt war ich angekommen. Ochitsuita.
2
Der Meister, das Dharma und Zickenalarm
Eins sein mit allem.
Goingesama, der Oberabt
In seinem Brief hatte der Goingesama den Toyotaya erwähnt, den „Turm der Ergiebigkeit“, der zum Klosterkomplex gehörte. In ihm sollte ich mein neues Zuhause finden. Er hatte vom „kreativen“ Zusammenleben geschrieben, was auch immer das bedeuten sollte. Als ich den Toyotaya sah, dachte ich nur: Was für ein Missverständnis!
Ich hatte mir eine kleine, spartanische Klosterzelle vorgestellt, nur in einer japanischen Version: Tatami-Matten von Wand zu Wand, dazu ein Futon, auf dem ich schlafen würde. Vielleicht noch ein Bücherregal, mehr nicht. Der Toyotaya aber, mein Domizil für meine spirituelle Reise, mein Kokon für mein Erwachen, war ein vor Kurzem fertiggestelltes Hochhaus mit vierzehn Stockwerken, bestehend aus lauter kleinen modernen Apartments, deren Balkone sich aus dem Gebäude herausdrückten, inklusiveWäsche, die zum Trocknen im Wind hätte flattern sollen, in Anbetracht der schweren Sommerschwüle aber nur träge von den Wäscheleinen hing.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























