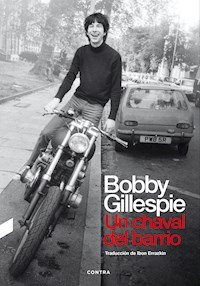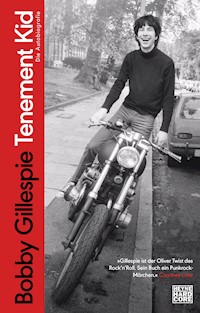
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Aus einfachen Verhältnissen in Glasgow stammend („Tenement“ ist der Ausdruck für die dortigen Mietskasernen), wird Bobby von seinem Vater früh mit Beat-Literatur, revolutionärem Gedankengut und Popmusik in Kontakt gebracht. In den 70er-Jahren entdeckt er die Welt der Rock- und Punkmusik, in die er tief eintaucht. Als Mitglied von stilprägenden Bands wie The Jesus and Mary Chain und vor allem Primal Scream prägt er den Zeitgeist. Hits wie »Movin on Up« oder »Loaded« füllen bis heute jeden Tanzboden, das Album Screamadelica gilt als einer der Klassiker der Popmusik. Sein Buch ist eine einzige farbenprächtige Liebeserklärung an die Popkultur in all ihren Facetten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 720
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
DASBUCH
Bobby Gillespie wird im Sommer 1961 in eine Glasgower Arbeiterfamilie hineingeboren. Mit sechzehn Jahren verlässt er die Schule und wird bei seinem ersten Konzerterlebnis im Apollo in Glasgow vom Rock›n›Roll-Blitz getroffen, als Phil Lynotts verspiegeltes Bass-Schlagbrett aufleuchtet. Erfüllt vom »heiligen Geist des Rock›n›Roll« ist sein Schicksal spätestens mit der Ankunft der Sex Pistols und des Punkrock besiegelt, der für Bobby eine ikonoklastische Vision der Klassenrebellion darstellt und schließlich dazu führt, dass er selbst als Mitglied in stilprägenden Bands wie The Jesus and Mary Chain und dann bei Primal Scream zum Künstler wird.
TENEMENTKID baut sich schrittweise wie ein Breakbeat-Crescendo auf bis zum Summer of Love, wilden Acid-House-Partys und einem schicksalhaften Treffen mit dem DJ und Produzenten Andrew Weatherall auf einem Feld in East Sussex. Als die 1980er-Jahre in die 90er übergehen und eine neue Art von elektronischer Soulmusik das Bewusstsein der Nation zu durchdringen beginnt, werden Primal Scream zur innovativsten britischen Band des neuen Jahrzehnts und begründen eine psychedelische Avantgarde, die bei Creation Records Gestalt annimmt.
Mit der Veröffentlichung des Klassikers Screamadelica und der anschließenden Tournee im Herbst 1991 endet diese Autobiografie, die Lebensgeschichte eines Rock›n›Roll-Apostels, der sich wie kein Zweiter die Freude und das Staunen über die Popkultur erhalten hat und höchstselbst den zukünftigen Sound des britischen Fin-de-Siècle-Pop radikal mitgestaltet hat.
DERAUTOR
Robert »Bobby« Gillespie, geboren 1962, ist ein schottischer Musiker, Singer-Songwriter und Multi-Instrumentalist. Er ist vor allem als Leadsänger, Gründungsmitglied und Haupttexter der Indierock-Band Primal Scream bekannt, die bis heute 11 Alben veröffentlicht haben, unter denen sich Hite wie »Loaded«, »Rocks«, »Movin› On Up« oder »Country Girl« befinden. Mitte der 1980er Jahre war er auch Schlagzeuger für The Jesus and Mary Chain, zuvor verdingte er sich als Roadie für Altered Images und Bassist bei The Wake. Mit Jenny Beth (Savages) veröffentlichte er 2021 ein Duett-Album.
Kristof Hahn wuchs in Saarbrücken auf und lebt seit 1980 in Berlin, wo er ein Politologiestudium abschloss und in diverse musikalische Projekte involviert ist. Am bekanntesten dürfte er für sein Mitwirken bei der New Yorker Experimental-Formation Swans sein. Daneben übersetzt er Bücher aus dem Englischen - darunter Autoren wie Hubert Selby Jr., John Peel, Russell Brand und Jim Thompson.
Bobby Gillespie
Tenement Kid
Die Autobiografie
Aus dem schottischen Englisch
von Kristof Hahn
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel
TENEMENTKID bei White Rabbit,
an imprint of The Orion Publishing Group Ltd, London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Bobby Gillespie
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Markus Naegele
Redaktion: David Numberger
Covergestaltung: Nele Schütz Design, Memmingen
Coverfotografie: Richard Bellia (vorne), Karen Parker (hinten)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-29058-0V002
Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.
Weitere News unter www.heyne.hardcore.de/facebook
@heyne.hardcore
Für A. W. und R. Y.
Danke für den Trip
»Mann, sobald wir auf die Bühne gehen, herrscht Krieg zwischen uns und dem Publikum.«
– ROBERTYOUNG
»Ich will nicht, dass die Welt sich ändert. Ich will dagegen sein.«
– JEANGENET
Inhalt
Teil 1
(1961–1977)
Ein Junge aus Springburn – und stolz darauf
Die Schulplage
Psychic Jailbreak und das Bild von Johnny
Teil 2
(1977–1981)
Lehrjahre als Punk
Die neue Religion
Kulturrevolution
Altered Images, Altered States
Factory – ein Geschenk der Götter
Teil 3
(1982–1985)
Working-Class-Industrial-Blues aus Glasgow
Der Schrei der himmelblauen Vox Phantom
Der Kittel meiner Großmutter in der Acid-Factory
Jesus wandelt auf Erden
Kreuzritter
Lederjungs auf Amphetaminen
Psychocandy
Ein Club namens Splash
Electric Ballroom Blitz
Teil 4
(1986–1991)
Sonic Flowers und Strawberry Switchblades
Brighton Rock
Gelobt sei Acid House
Das Evangelium nach Audrey Witherspoon
Loaded in Walthamstow (Remix/Remodel)
Die Boy’s-Own-Gang
Das Paradies in Hackney
Die Kinder von Marx und McLaren
Der Underground wird oberirdisch
Let It Scream(adelica)
Bildnachweise
Danksagung
Bildteil 1
Bildteil 2
Teil 1
(1961–1977)
1
Ein Junge aus Springburn – und stolz darauf
Ich bin aufgewachsen an Orten, wo die Geister der Vergangenheit herumspukten. Meine Spielplätze waren ein verlassenes Lokomotivenwerk, ein riesiger Friedhof und gespenstische Straßen mit geräumten Mietshäusern. Springburn wurde im Zuge des »Slum-Sanierungs«-Programms der konservativen Regierung von Edward Heath in den späten Sechzigerjahren abgerissen; Straße für Straße wurden die Häuser geräumt, bis die Gegend große Ähnlichkeit hatte mit den im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten zerbombten deutschen Städten, die ich auf Fotos in dem Geschichtsbuch meines Vaters gesehen hatte. Es war gruselig und aufregend zugleich. Ein älterer Junge half uns, in die mit Brettern vernagelten Wohnungen und Häuser in der Vulcan Street einzubrechen. Wo einst die Familien der verhassten »Vulcies« (die Straßenbande, mit der unsere verfeindet war) gewohnt hatten, herrschte nun Leere. Anwohner hatten Tische, Stühle und Betten zurückgelassen, in den verdreckten Waschbecken stand Geschirr, und in den Vorhängen, die man hatte hängen lassen, sammelten sich Staub und Schmutz, der dort bleiben würde bis in alle Ewigkeit. Es herrschte eine Atmosphäre von Flucht und Verlassenheit, als wären die ehemaligen Bewohner vor einer feindlichen Armee geflohen. In gewisser Weise waren sie das auch. Eine einst lebendige Arbeitersiedlung wurde zerstört und durch eine Autobahn ersetzt.
Was ist mit diesen Menschen geschehen? Was wurde aus ihnen? Wohin gingen sie? Folgendes ist mit mir passiert.
Ich kam am 22. Juni 1961 im Rottenrow Maternity Hospital in Cowcaddens, im Herzen des mittelalterlichen Stadtkerns von Glasgow, zur Welt. Es liegt ein paar Straßen von Provand’s Lordship entfernt, dem ältesten noch erhaltenen Wohngebäude der Stadt, das 1471 erbaut wurde und überragt wird von der Kathedrale – im zwölften Jahrhundert an der Stelle erbaut, wo St. Mungo, der Schutzheilige der Stadt, einst seine erste Kirche errichtet hatte. Ganz in der Nähe befindet sich der Necropolis-Friedhof – der Père Lachaise von Glasgow –, auf dem die Industriellen und Kaufleute der viktorianischen Ära, die Zuckerimporteure und Tabakbarone der Stadt, begraben sind, von denen einige ihren Reichtum der Sklaverei verdankten. Auf dem Gipfel des höchsten Hügels der Nekropole steht die Statue von John Knox, dem Begründer des schottischen Presbyterianismus. Seine kalten, frommen Augen sind wachsam und streng auf das sündige Treiben zu seinen Füßen gerichtet. Dort steht auch die Statue von König Wilhelm von Oranien auf dem Cathedral Square. Meine Oma erzählte mir, dass jeden Sommer am Jahrestag der Schlacht am Boyne betrunkene Katholiken vorbeizogen, um König Billy mit Flaschen zu bewerfen. Religion, Gewalt und Alkohol sind in Glasgow untrennbar miteinander verbunden.
Das gälische Wort »Rottenrow« bedeutet übersetzt »Straße der Könige«. Es ist außerdem ein althergebrachter englischer und schottischer Name für eine Straße, die gesäumt ist von Reihen rattenverseuchter Hütten. Man könnte also sagen, dass ich in einer rattenverseuchten Straße der Könige zur Welt kam.
Ich wurde ein Jahr vor der Kubakrise geboren, in dem Jahr, als die Berliner Mauer hochgezogen wurde. Meine Mutter, Wilma Getty Gemmell Gillespie, war noch ziemlich jung, als sie mich zur Welt brachte. Sie erzählte mir, dass sie damals fürchtete, Russland und Amerika würden den gesamten Planeten in einem apokalyptischen Atomkrieg auslöschen. Ich war ein Kind des Kalten Krieges. Die Paranoia angesichts einer drohenden nuklearen Vernichtung war damals allgegenwärtig. Meine Mutter war einundzwanzig, und mein Vater, Robert Pollock Gillespie, war dreiundzwanzig. Sie lernten sich bei der Arbeit kennen. Beide waren bei Collins, dem Buchverlag, angestellt. Mein Vater war Druckereiarbeiter und Mitglied der Drucker- und Buchbindergewerkschaft National Union of Printing, Bookbinding and Paper Workers. Sie waren beide Mitglieder der Jungsozialisten von Springburn. Mein Vater beteiligte sich in den späten Fünfzigern an einem Streik zur Verkürzung der Arbeitszeit von fünfundvierzig auf vierzig Stunden pro Woche, der letzten Endes zur Einführung der Fünftagewoche führte. Bis die Gewerkschaften diese Auseinandersetzung für sich entschieden hatten, war es Usus, dass von den Arbeitnehmern erwartet wurde, auch samstagmorgens zu arbeiten. Die Erfahrung, welche Macht eine solidarische Klasse ausüben und welche Veränderungen sie bewirken konnte, politisierte meinen Vater. Er war mit siebzehn Jahren in die Armee eingetreten – die übliche Geschichte eines weitgehend ungebildeten Arbeiterkindes ohne echte Perspektiven, das durch das Versprechen von Reisen und Abenteuern in der weiten Welt zum Militär gelockt wurde. Er war Unteroffizier in der Royal Artillery und während des Kalten Krieges in Hongkong stationiert, wo er an Aufklärungsmissionen teilnahm und hoch oben auf einem Berggipfel darauf wartete, dass Mao Tse-tungs Rote Armee über den Dragon’s Back gestürmt kam. Er erzählte mir, die Armee habe einen Mann aus ihm gemacht. Sie verschaffte ihm außerdem einen Einblick in die Funktionsweise des britischen Klassensystems. Um uns zu unterhalten, erzählte er meinem Bruder Graham und mir Geschichten aus seiner Armeezeit: Massenschlägereien in Kneipen und Bars mit amerikanischen GIs, die in den Augen der britischen Jungs nichts weiter waren als verwöhnte Weicheier, die keinen Krieg führen konnten, ohne dass an der Front nicht mindestens ein Coca-Cola-Automat stand. Dad hat die Worte »HONGKONG« auf seinen Knöcheln tätowiert. Außerdem hat er einen schwarzen Panther auf dem rechten Oberarm (stellt euch vor, wie überrascht ich war, als ich im Jahr 2000 im Hudson Hotel in New York denselben Panther auf dem linken Oberarm meiner zukünftigen Frau Katy tätowiert sah), dazu eine chinesische Prostituierte, die schüchtern hinter einem Fächer hervorschaut, und auf dem linken Unterarm den Namen »Jim Surrey«. Jim Surrey war sein bester Kumpel in der Armee, der wiederum die Worte »Bob Gillespie« auf seinem linken Unterarm eintätowiert hatte. In den Fünfzigerjahren, lange bevor Tattoos in Mode kamen, ließen sich nur Soldaten, Matrosen, Gangster, Kriminelle, Knastbrüder und fahrendes Volk die Haut mit einer Tätowiernadel bearbeiten. Tätowierungen waren etwas für Gesetzlose und Außenseiter, nicht für anständige Leute. Tätowierungen waren tabu.
Wir wohnten im dritten Stock einer Mietskaserne in einer Einzimmerwohnung in der Palermo Street 35 im Stadtteil Springburn, die meine Eltern für 100 Pfund gekauft hatten. Diese Wohnungen wurden in Glasgow als »Single-End« bezeichnet. Unsere bestand aus einem Zimmer mit einem Waschbecken und einer Kochstelle. Die Toilette lag auf dem Treppenabsatz, und wir teilten sie mit zwei anderen Familien. Die einzige konkrete Erinnerung, die ich an das Single-End habe, ist, dass ich als Kleinkind eine volle Dose Heinz Baked Beans aus dem Fenster warf. Meine Mutter reagierte völlig panisch und rannte zum Fenster, um zu sehen, ob jemand von der Dose getroffen worden war, aber zum Glück war es gerade mitten am Tag, und alle waren bei der Arbeit oder in der Schule. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hatte – es war ein plötzliches, überwältigendes Verlangen danach, es zu tun. Ich glaube, ich genoss das Gefühl, ein böser Junge zu sein. Ich merkte auch, welche Wirkung die Tat auf meine Mutter hatte. Meine allererste grenzüberschreitende Handlung.
Mein Bruder Graham wurde 1964 geboren, kurz nachdem wir in ein etwas größeres Apartment umgezogen waren, für das meine Eltern 150 Pfund gezahlt hatten und das direkt unterhalb unserer alten Wohnung lag: ein »Zimmer mit Küche«, die beide von einem kleinen Flur abgingen. Die ersten zehn Jahre meines Lebens schliefen meine Mutter, mein Vater, mein Bruder und ich in einem Zimmer. Das Bett unserer Eltern stand in einer Nische, während Graham und ich jeweils ein Einzelbett hatten. Es gab einen Kleiderschrank, eine Kommode und eine Holzkiste, in der wir unser Spielzeug und unsere Cowboy- und Feuerwehrkostüme aufbewahrten. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie sehr dieses Arrangement ihre Ehe belastet haben mag. Es muss hart gewesen sein.
In der Wohnküche hingen zwei abstrakte Aquarelle von John Taylor, einem Künstler, mit dem meine Eltern befreundet waren. Es gab außerdem ein riesiges Schwarz-Weiß-Poster des kubanischen Revolutionshelden Che Guevara, das auf dem großartigen Foto von Alberto Korda basierte – Che in seiner hochgeschlossenen Fliegerjacke, mit Bart und der schwarzen Baskenmütze mit dem Stern darauf. Es sah total heroisch und hip aus. Er schaute mit einem christusähnlichen Blick in die Zukunft. Che war unser Jesus, ein Rockstar-Revolutionär. Dennis Hoppers Image in den Sechzigerjahren war angelehnt an Che, Fidel und die bärtigen kubanischen Revolutionäre, die erfolgreich den von der US-Regierung und der Mafia unterstützten Diktator Batista vertrieben hatten. Es heißt, die Beatles hätten die Sechzigerjahre eingeläutet, aber Fidel, Che und ihre Jungs sind ihnen um drei Jahre zuvorgekommen. Wir hatten auch ein Schwarz-Weiß-Foto von den US-amerikanischen Olympiasiegern Tommie Smith und John Carlos, die auf dem Siegerpodest der Olympischen Spiele 1968 in Mexiko die geballte Faust zum Black-Panther-Gruß in die Luft reckten. Ich erinnere mich, dass ich meinen Vater fragte, was die beiden Typen da machten. Warum hatten sie schwarze Handschuhe an, und warum hoben sie ihre Fäuste in die Höhe? Er erklärte seinem siebenjährigen Sohn, dass diese Männer in den Vereinigten Staaten nicht dieselben Schulen besuchen durften wie die Weißen, nicht in denselben Restaurants essen, nicht einmal aus demselben Wasserspender trinken oder auf derselben Parkbank sitzen durften. Mein Vater erzählte mir auch die Geschichte von Cassius Clay, dem späteren Muhammad Ali, der sich geweigert hatte, in Vietnam zu kämpfen, mit der Begründung: »Kein Vietcong hat mich jemals Nigger genannt.« Meine ersten Sporthelden waren Schwarze: Muhammad Ali und Pelé. Sport ist ein unglaublich wirksames Mittel, um Rassenvorurteile abzubauen.
Das Zimmer war spärlich möbliert, es gab nur eine kleine Couch und einen weiteren Sessel zum Sitzen sowie einen Schreibtisch, auf dem die Schreibmaschine meiner Mutter stand. Sie war Stenotypistin, und in der rechten oberen Ecke lagen immer weiße A4-Blätter mit dem Logo des Race Relations Board – eine Raute mit einem schwarz-weißen Karomuster. Dabei handelte es sich um eine Organisation mit dem Ziel, Menschen aus der asiatischen Community Glasgows für linke Politik zu interessieren und ihnen so Wege zu eröffnen, ihre Interessen geltend zu machen und Macht und Einfluss zu gewinnen. Vater war die treibende Kraft bei der Gründung dieser Organisation – und gleichzeitig der einzige Mensch in Schottland, der sich damals für diese Belange engagierte. Wir hatten kein Bad, also badete uns meine Mutter im Waschbecken. Wie in dem Single-End teilten wir uns auch hier eine Außentoilette mit zwei anderen Familien. Es gab eine Vorrichtung, genannt »Flaschenzug«, die aus vier langen Holzlatten bestand, die an den Enden von einem Metallrahmen zusammengehalten wurden und mit Seilen an einem Mechanismus an der Zimmerdecke befestigt waren. Daran hängte meine Mutter die nasse, frisch gewaschene Wäsche auf. An der Wand stand ein Bücherregal, das vollgestopft war mit den Büchern meines Vaters. Ich erinnere mich außerdem an eine nordvietnamesische Flagge, die irgendwo drapiert war. Wir hatten auch einen zwitschernden grün-gelben Wellensittich namens Jackie.
In unserem Haus lief immer Musik. Dad leitete einen Folk-Club namens The Midden, in dem Musiker wie Matt McGinn und Hamish Imlach ihre ersten Auftritte hatten. Ich glaube, Billy Connolly hat meinen Vater sogar dafür bezahlt, dort auftreten zu dürfen; oder genauer gesagt, er kam als Zuschauer und fragte, ob er vor dem Hauptprogramm auf die Bühne gehen und singen dürfe. Jedes Mal, wenn mein Vater und Billy sich bei der Beerdigung eines alten Freundes treffen, sagt Billy: »Hey, Geggie, weißt du noch, dass ich in deinem Folk-Club gesungen habe?« Und mein Vater antwortet: »Nein, Billy, du hast dafür bezahlt, singen zu dürfen.«
Politischer Radikalismus und Folkmusik waren damals eng miteinander verwoben, da die jahrhundertealten Lieder oft vom Daseinskampf der arbeitenden Klasse erzählten. Wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, stellt man fest, dass sich seit dem achtzehnten Jahrhundert nicht viel verändert hat in Bezug auf Ungleichheit und die Machtverhältnisse zwischen den Klassen. Mein Vater war ein Autodidakt aus der Arbeiterklasse. Bedingt durch die familiären Verhältnisse war er kaum zur Schule gegangen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde er aufs Land nach Ayrshire evakuiert; seine Mutter arbeitete in der Nähe in einer Uranfabrik, die Teil der britischen Anstrengungen war, im Rennen um die Entwicklung einer Atomwaffe schneller zu sein als die Nazis. Sein eigener Vater war an der Front – als Infanterist in der britischen Expeditionstruppe, die am Strand von Dünkirchen von Görings Luftwaffe bombardiert und von Rommels Panzern mit Dauerfeuer belegt wurde.
Aufgezogen wurde mein Vater mehr oder weniger von seiner älteren Schwester Rosemary, während ihre Mutter arbeitete. Sie hatten nie eine eigene Wohnung, sondern mieteten sich immer bei anderen Familien in die Wohnung mit ein. Mein Vater wurde in echte Armut hineingeboren, die ihn seine gesamte Kindheit und Jugend über begleitete. Einmal litt er an akuter Mangelernährung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo man ihn mit vernünftigem Essen wieder auf die Beine brachte. Er erzählte mir, dass er niemals zulassen wollte, dass ein anderes Kind den Hunger, die Schmerzen und die demütigenden Entbehrungen durchleben musste, die er als kleiner Junge durchgemacht hatte. Deshalb hat er den größten Teil seines Erwachsenenlebens der Veränderung der Gesellschaft gewidmet – er glaubt wirklich an den Sozialismus.
Meine erste Erinnerung an Klangaufnahmen geht auf ein Philips-Tonbandgerät zurück, das meinen Eltern gehörte. Mein Vater nahm damit Auftritte von Bands im Midden auf, und er lieh sich Platten von Freunden aus, die er dann auf Band überspielte. Muddy Waters’ »Got My Mojo Working« war einer seiner Lieblingssongs, den er lauthals mitsang. Irgendwo gibt es eine Tonbandaufnahme von mir, wie ich im Alter von vier Jahren »She Loves You« von den Beatles singe. Meine allererste Aufnahmesession. Die meistgespielte Platte in unserer Wohnung in den Sechzigern war das Greatest-Hits-Album von Diana Ross and the Supremes auf Motown. Es hatte ein lila Cover mit einem gemalten Bild von Diana, Flo und Mary. Außerdem gab es Ray Charles’ Greatest Hits Volume 2 auf dem Stateside-Label mit einem coolen Foto von Ray. Dad hat diese Platte oft gespielt. Darauf waren Songs wie »Take These Chains From My Heart«, »Busted«, »The Cincinatti Kid« (aus dem Film mit Steve McQueen), »In the Heat Of The Night« (aus einem Sidney-Poitier-Film) und das traurig-schöne »Crying Time«. Der Blues durchdrang mich schon früh und hinterließ einen tiefen Eindruck bei mir. Außerdem lief bei uns viel Bob Dylan. Wir hatten die Greatest Hits und The Times They Are A-Changin’ mit den ganzen Protestsongs, eine der Lieblingsplatten meines Vaters. Außerdem gab es Platten von Joan Baez, June Tabor und irische Rebellensongs von den Dubliners. Meine Mutter spielte oft ihre Hank-Williams-10-Inch-EP mit blauem Cover und dem Titel Moanin’ The Blues. Hanks Stimme war absolut einzigartig. Sie war durchdringend, ernst und schmerzerfüllt. Und auch wenn ich zu jung war, um zu verstehen, wovon er sang, horchte ich immer aufmerksam zu, wenn er gespielt wurde. Meine Mutter liebte auch Doris Day. Und sie hatte eine Elvis-Single mit einem Fotocover, das ich mir endlos anschaute und dabei staunte, wie schön er aussah. Später fand ich heraus, dass es »Suspicious Minds« war. Ich las jedes Wort, das auf den Plattenhüllen gedruckt stand. Ich erinnere mich an ein Smokey-Robinson-Livealbum mit einem Zitat von Bob Dylan auf dem Cover, der Smokey als den »größten lebenden Dichter Amerikas« bezeichnete.
Beatles-Platten gab es keine in unserem Haushalt. Meine Mutter sagte mir später, dass sie ihnen nie etwas abgewinnen konnte; sie bevorzugte die Stones.
Mein Vater hatte wie gesagt ein Bücherregal, das sich über die gesamte Länge des Flurs erstreckte und in dem sich die Bücher stapelten. Da er bei Collins arbeitete, konnte er sich leicht mit Literatur eindecken. Er besaß Werke von Charles Dickens, Jane Austen, Daniel Defoe, Robert Louis Stevenson und andere Klassiker in einem einheitlichen grünen Einband im Taschenbuchformat. Sie standen auf dem obersten Regalbrett. Es gab auch Klassiker des Radikalismus wie Robert Noonnans The Ragged-Trousered Philanthropists (dt. Die Menschenfreunde in zerlumpten Hosen – veröffentlicht unter dem Pseudonym Robert Tressell) und Rights Of Man (dt. Die Rechte des Menschen) von Thomas Paine, dem englischen Radikalen des 18. Jahrhunderts, dessen Ideen sowohl von den französischen als auch von den amerikanischen Revolutionären aufgegriffen wurden und der auch an der Ausarbeitung der französischen Verfassung beteiligt gewesen war. Vater liebte diese beiden Bücher, und als ich ein Teenager war, legte er mir immer wieder ans Herz, sie zu lesen, was ich allerdings nie tat. Ich interessierte mich damals viel zu sehr für Sounds und NME.
Er besaß auch einige Abenteuerromane des mittlerweile umstrittenen Autors George Alfred Henty, die in Afghanistan, Afrika und Indien zur Zeit des britischen Empire spielen. Sie wurden von Blackie & Son verlegt und hatten diese coolen goldgeprägten Einbände, die mit Stammeskriegern illustriert waren. Eines hieß With Clive In India (dt. Mit Clive in Indien). Ich glaube, mein Vater dachte, dass seine beiden Jungs auf diese Sorte Bücher anspringen würden. Es gab auch Fotobände über Militärgeschichte sowie marxistische Literatur. Er hatte Henry Millers Wendekreis des Krebses und Wendekreis des Steinbocks, Bücher von Mark Twain, Jack London, eine Biografie von Guru Nanak Dev, dem Gründer des Sikhismus, und andere politische Bücher. Was mich besonders faszinierte, war The Book Of American Folk Songs. Hier fand ich »The Ballad Of Jesse James« und »Joe Hill«. Platten und Bücher bildeten für mich schon früh so etwas wie kulturelle Bezugspunkte. Meine Neugierde war geweckt.
Wir waren von Straßen mit Mietshäusern umgeben. Sie hatten einen rechteckigen Grundriss wie die uneinnehmbaren Festungen des Mittelalters. Unser Block bestand aus vier Straßen: Springburn Road am oberen Ende, Palermo Street und Vulcan Street seitlich einander gegenüber und Ayr Street am unteren Ende.
Jedes Mietshaus war drei Stockwerke hoch. Außerhalb der Apartments lag der sogenannte »Hinterhof« mit einem Schuppen, in dem die Mülleimer ausgeleert wurden. Die kleinen gemauerten Waschhäuser, in denen die Frauen Wäsche wuschen, waren zu dem Zeitpunkt, als ich zur Welt kam, schon zugemauert. Wenn man in diese Backsteingebäude hineinging, fand man uralte verrostete Mangeln mit riesigen, gewundenen Griffen aus Metall zum Auswringen der nassen Wäsche. Dann gab es Waschbecken, die gesprungen waren und vor Dreck starrten. Es waren unheimliche, verbotene Orte, die wir kaum zu betreten wagten. Tote Räume mit einer seltsamen Energie, in denen die Geister der Vergangenheit gefangen waren. Als Kind konnte ich an diesen verlassenen Orten unsichtbare Kräfte spüren.
Es gab eine Backsteinmauer, die entlang der Straße verlief und eine Trennlinie zwischen den Häusern auf der Vulcan Street und denen an unserer Straße darstellte. Dahinter lag eine Gasse, die man von der Ayr Street aus erreichen konnte. Der Boden bestand aus schwarzem Dreck und zersplitterten Pflastersteinen, die bei Kämpfen mit rivalisierenden Banden aus der Umgebung zum Einsatz kamen. Nirgendwo gab es in diesen Hinterhöfen auch nur einen Grashalm, stattdessen standen überall große hölzerne Pfähle herum, zwischen denen Leinen aufgespannt waren, die vollgepackt waren mit Wäsche. An sonnigen Tagen hängten die Frauen aus den oberen Wohnungen ihre Wäsche an v-förmigen Stangen aus ihren Fenstern. Die Kinder riefen nach ihren Müttern, dass sie ihnen ein Stück Zucker herunterwerfen sollten oder zwei mit Butter oder Margarine bestrichene und mit Zucker bestreute Scheiben Weißbrot. Das hielt einen an den langen Sommertagen in den Sechzigern bei Laune.
Der Zugang zu den Wohnungen erfolgte über die »Toreinfahrt«, die durch das Gebäude auf den Hinterhof führte. Davon ging links und rechts ein Flur ab, an dem die Türen zu den einzelnen Wohnungen lagen sowie die Treppe zu den oberen Stockwerken mit dem einen kleinen Treppenabsatz, auf dem die Außentoilette lag.
In Springburn herrschte reges Leben. Ich erinnere mich an die Männer, die zum Feierabend von der Arbeit zurückkamen, und an die Kinder, die vor dem Pub am oberen Ende der Straße auf die Väter warteten. Dort nahmen die Männer, erschöpft von der Arbeit, noch ein schnelles Bier zu sich und hielten einen Plausch mit ihren Kumpels, bevor sie nach Hause gingen, wo ihre Frauen frisch gebrühten Tee für sie bereithielten. Es gab Zeitungsverkäufer, die an Wochentagen die Abendausgabe der Times verkauften oder samstags die Sportzeitungen mit den Fußballergebnissen. Ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie ich mit meiner Mutter und Graham von einem Besuch bei meinen Großeltern in der London Road in Bridgton nach Hause kam und den Zeitungsverkäufer in der Springburn Road vor dem Pub am oberen Ende unserer Straße sah, der die Sportzeitung mit der Schlagzeile KATASTROPHEIMIBROX – 66 RANGERS-FANSZUTODEGEQUETSCHT verkaufte. Celtic lag im Old-Firm-Derby mit einem Tor in Führung, als viele Rangers-Fans kurz vor Spielende die Hoffnung aufgaben und in Scharen das Stadion verließen. Dann erzielte Colin Stein, der Mittelstürmer der Rangers, in der allerletzten Spielminute den Ausgleich. Die Fans, die auf dem Weg nach draußen waren, hörten den Torjubel und versuchten, wieder hineinzukommen. Die mickrigen Metallbarrieren waren dem Ansturm nicht gewachsen. Sechsundsechzig Menschen wurden so auf tragische Weise zu Tode gequetscht. Das hatte eine Wirkung auf mich, ein Gefühl der Entfremdung (obwohl ich in diesem Alter nicht wusste, wie ich dieses Gefühl beschreiben sollte). Es gab Jungs aus meiner Schule, die mit ihren Vätern bei dem Spiel gewesen waren. Der Tod war mit einem Mal etwas Reales, das in der unmittelbaren Umgebung passierte, und nicht nur den Bösewichtern in den Filmen.
Das Grubenunglück von Aberfan lag nur ein paar Jahre zurück. Damals war eine ganze Schule voller Kinder in meinem Alter unter einem Berg von Abraum aus dem nahe gelegenen Kohlenbergwerk zermalmt worden. Die Nachrichten und die Titelseiten waren voll davon. Diese Tragödie hat meine kindliche Vorstellungskraft stark beeinflusst. Manchmal, wenn ich aus dem Fenster des Klassenzimmers meiner Schule schaute, die von einem großen Hügel am Hyde Park überragt wurde, fragte ich mich, ob uns etwas Ähnliches zustoßen würde.
In der Springburn Road gab es viele Geschäfte, und es war immer eine Menge los. Es gab ein großes Kaufhaus namens Hoey’s und ein Kino mit dem Namen Princes in der Gourlay Street. Jeden Samstagmorgen brachte mich meine Mutter dorthin und ließ mich Filme anschauen. Es gab Frühvorstellungen – Batman, Die glorreichen Sieben, Eine Million Jahre vor unserer Zeit mit Raquel Welch (mein erster Schwarm, zusammen mit Catwoman). Es war ein magischer Ort, immer voll mit hysterischen, schreienden Kindern, vollgestopft mit Süßigkeiten, und Mädchen im Teenageralter, die mit Eis am Stiel durch die Reihen liefen. Wir feuerten alle Batman an: »GIB’S IHNEN, BATMAN! Pass auf, hinter dir!« Es war wie bei einem Fußballspiel, und jedes Mal, wenn er oder Robin, der Wunderknabe, den Joker oder den Riddler verdroschen, brach der ganze Saal in eine Art Torjubel aus. 1936 war der weltberühmte Entfesselungskünstler Harry Houdini im Princes Cinema aufgetreten – was für das von der Wirtschaftskrise gebeutelte, kulturell ausgehungerte Proletariat von Springburn ein überwältigendes Erlebnis gewesen sein muss.
Zu meinem sechsten Geburtstag bekam ich von meinen Großeltern ein Rangers-Trikot geschenkt. Ich wusste nicht einmal, was Fußball ist. Ich hatte eine Cowboymontur oder eine Kavallerieuniform haben wollen. Ich ging zu ihrer Wohnung in der London Road (ironischerweise ganz in der Nähe des Celtic Park), und sie zogen mir dieses Rangers-Trikot an, von dem ich keine Ahnung hatte, was es bedeutete. Es war das klassische Sechzigerjahre-Trikot aus der Jim-Baxter-Ära – blauer Jersey mit weißem V-Ausschnitt, weiße Shorts, schwarze Socken mit roten Stulpen.
Später bekam ich dann doch einige Ahnung von Fußball.
Ich war mit den Jungs in meiner Straße befreundet – mit denen von meiner Seite der Straße. Sogar bei der Frage, auf welcher Straßenseite man wohnte, gab es territoriale Abgrenzungen. Ich habe nie mit den Jungs auf der anderen Seite rumgehangen. Nebenan wohnte ein Junge namens Alex Donnelly, und drei Häuser weiter wohnten zwei Brüder, David und Charles Breslin. Alex und David waren im gleichen Alter wie ich, Charles ein oder zwei Jahre jünger. Sie waren allesamt Celtic-Fans, und so wurde auch ich Celtic-Fan, weil sie meine Kumpels waren. Alex Donnelly und die Breslins trugen Celtic-Trikots: die grün-weißen Querstreifen aus den Sechzigerjahren, weiße Shorts mit grünen Nummern (ein klassisches Modedetail) und weiße Socken. Ich fand, das war das absolut coolste Trikot aller Zeiten, so frisch, clean und schön. Celtic war die beste Mannschaft der Welt. Es war die Ära der legendären Lissaboner Löwen; die Mannschaft hatte 1967 im Finale in Lissabon Inter Mailand mit zwei zu eins besiegt und den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Jock Stein war der Trainer, und unser Kapitän war Billy McNeil. Die Fans hatten einen Spitznamen für (King) Billy: Caesar. Wenn man sich Fotos von ihm in jener glorreichen Nacht im Mai 1967 ansieht, wie er auf der Siegertribüne im Estádio Nacional den Europapokal in die Höhe hält, dann sieht er tatsächlich so majestätisch aus wie ein römischer Imperator. Ave Cäsar!
Dieses Celtic-Team beflügelte die Fantasie von Straßenkindern wie uns. Es war eine schlichtweg legendäre Mannschaft, umweht von einem grandiosen Mythos. Sämtliche Spieler kamen aus einem Umkreis von zehn Meilen um Glasgow, mit Ausnahme von Bobby Lennox, der aus dem dreißig Meilen entfernten Saltcoats stammte. In der heutigen Zeit des globalisierten Fußballs wäre so etwas undenkbar. Jock Stein war Verfechter eines modernen, schnellen Offensivfußballs, der, wenn er richtig gespielt wurde, den Zuschauern Momente wahrer Schönheit, Verzückung und Spiritualität bereiten konnte. In den Sechzigern war Fußball ein Spiel der Arbeiterklasse und oft die einzige Unterhaltung oder Kultur im Leben der (vorwiegend) Männer und Jungen, die jede Woche zu den Spielen pilgerten. Jock kam aus einem Dorf in Ayrshire – seine Ahnen waren über Generationen hinweg Bergarbeiter gewesen –, und wie sein guter Freund, der schamanische Trainerkollege Bill Shankly aus Liverpool, vertrat auch er die Philosophie von Fußball als einer Form von Sozialismus. Ein Beispiel dafür, wie elf Individuen zusammenkommen und als Team etwas Größeres, Schöneres und Kraftvolleres erreichen können – ein Ganzes, das größer ist als die Summe der einzelnen Teile, ganz wie bei einer Rock’n’Roll-Band. Der Kapitalismus basiert auf der potenziellen Aussicht auf Reichtum und Wohlstand, die dem »souveränen« Individuum winken (wenn es großes Glück hat). Im Sozialismus geht es um die Macht des Kollektivs.
Jenes Endspiel in Lissabon war ein Kampf Licht gegen Finsternis. Der Trainer von Inter Mailand war Helenio Herrera, ein Vertreter des in Italien entwickelten defensiven Fußballstils: des Catenaccio, bei dem man den Gegner im Laufe des Spiels langsam zermürbt und zur Verzweiflung treibt, indem man jeden Spielzug unterbindet und ins Stocken bringt, immer mit zehn Mann hinter dem Ball. Eine destruktive, fast nihilistische Vision des Sports als Zermürbungskrieg, allerdings gerechtfertigt durch die Erfolge, die die italienischen Vereine dank dieser Taktik feierten.
Später bei Primal Scream spielte Jock Steins Spielphilosophie eine große Rolle bei der Entwicklung unserer Haltung in Bezug aufs Musikmachen und auf die Art und Weise, wie wir uns live präsentierten. Wir glauben, dass eine Rock’n’Roll-Live-Show ein Frontalangriff auf die Sinne sein sollte, eine Attacke auf die Seele, eine Breitseite. Man muss mit voller Wucht loslegen. Die Bühne wackeln lassen. Die Leute zum Schweben bringen und mit sich reißen. Es muss von grandioser Schönheit sein – unterhaltsam und tödlich zugleich. Man muss bei jedem Auftritt hundert Prozent Einsatz zeigen. Die Fans jubeln einem zu, und man muss ihnen alles geben. Wie Robert Young einmal zu mir sagte: »Sobald wir auf die Bühne gehen, herrscht Krieg zwischen uns und dem Publikum.«
Wir spielten Fußball auf der Straße, mit zwei Blechdosen von der Müllkippe als Torpfosten. Wir wollten alle Jimmy Johnstone sein oder Stevie Chalmers oder Bobby Lennox. Das erste Celtic-Spiel, das ich je gesehen habe, war das Europapokalfinale 1970 gegen Feyenoord – auf unserem Schwarz-Weiß-Fernseher in der Küche. Das Bild war verschwommen und undeutlich. Damals wurden weltweite Sportereignisse wie Muhammad Alis Boxkämpfe und Fußballendspiele in anderen Ländern per Satellit in die britischen Haushalte übertragen; die Qualität war immer schlecht, das Bild flimmerte und wurde oft unscharf wie in einer Gespensterwelt. Jeder hatte einen Schwarz-Weiß-Fernseher. In unserer Straße gab es keine Farbfernseher. Wir hatten zwei Sender: BBC und STV. Mein Freund in der Nachbarschaft hatte BBC2, auf dem die Westernsendung High Chaparral lief, von der ich begeistert war. Ich flehte meine Mutter an, dass ich auch BBC2 haben wollte, aber das kostete extra Fernsehgebühren.
Eines Tages in den Sommerferien spielte ich auf der Straße mit meinen Freunden David und Charlie Breslin. Alles war cool, doch dann gingen die beiden auf mich los und verprügelten mich. Ich war schockiert und völlig fertig, denn diese Jungs waren meine Freunde, und ich vertraute ihnen total. So etwas war mir noch nie passiert. Weinend ging ich nach Hause. Meine Mutter fragte mich, was passiert war, und als ich es ihr erzählte, packte sie mich und zerrte mich die Straße entlang. Sie sagte: »Also gut, dann wirst du gegen beide kämpfen.« Ich habe den ganzen Weg lang geschrien vor Angst. Sie zerrte mich weiter bis zu ihrer Toreinfahrt, wo die beiden auf ihrer Türschwelle saßen. Ich stand heulend da, und sie sagte: »Also los, nimm dir erst den da vor. Verdrisch ihn! Verdrisch ihn! Sonst versohl ich dir den Arsch.«
Ich machte mir vor Angst fast in die Hosen. Aus Angst vor ihm und meiner Mutter. Ich wollte mir nicht noch eine weitere Abreibung einfangen. Ich heulte vor Angst und Wut und Scham über die Erniedrigung, die ich zuvor erfahren hatte, aber ich hatte keine Wahl. Die Alternative war, mich entweder zu prügeln oder mir den Zorn meiner Mutter zuzuziehen, und so stürmte ich auf David, den älteren der beiden Brüder, los und drosch mit schwächlichen Schwingern auf seinen Kopf ein, bis er damit gegen die Tür schlug. Er leistete keine große Gegenwehr, sondern stand nur da und steckte meine Schläge ein, ohne zurückzuschlagen. Sein kleiner Bruder Charles stand schweigend daneben und schaute sich das Geschehen voller Entsetzen mit an – die Augen weit aufgerissen und das Gesicht erstarrt aus Furcht vor dem bevorstehenden Gewaltausbruch, während meine Mutter auf der Treppe zu ihrer Wohnung Wache hielt. Es gab für keinen von uns ein Entrinnen.
Es war alles andere als ein fairer Kampf. Die Anwesenheit meiner Mutter hatte zur Folge, dass David sich kaum wehrte. Dann war Charles an der Reihe, sich ein paar Backpfeifen einzuhandeln, damit die verletzte Familienehre wiederhergestellt war. Als beide nur noch ein heulendes Häufchen Elend waren, war meine Mutter zufrieden und schleifte mich die Straße entlang zurück zu unserer Wohnung. Es war eine traumatisierende Erfahrung für mich, und vermutlich auch für die beiden. Aber sie haben mir nie wieder Ärger gemacht.
Ich war allerdings nie ein großer Kämpfer, im physischen Sinne. Wenn es um körperliche Auseinandersetzungen geht, bin ich ein Feigling und renne lieber weg, als mich zu prügeln … das ist eher was für Trottel und Schwachköpfe. Ich bin eine halbe Portion, Muskeln Fehlanzeige. Und ich bin, wie es so schön heißt, ein »Lover und kein Fighter«. Stattdessen habe ich gelernt, mich mit Worten zu wehren, mit Ideen und Humor, nicht mit Fäusten und Stiefeln. Und doch habe ich von meiner Mutter an diesem Tag etwas sehr Wichtiges gelernt: für mich selbst einzutreten und keine Angst vor Konfrontation zu haben. Eine überaus nützliche Lektion, wie ich in den nächsten Jahren immer wieder feststellen konnte. Danke, Mama.
Ich erinnere mich, wie meine Mutter mich an meinem ersten Schultag in der Grundschule zurückließ. Mit einem Mal war ich auf einem Spielplatz und in einem Klassenzimmer, und um mich herum waren lauter Fremde. Ich war ganz konfus, und was mich am meisten verwirrte, war, dass keiner meiner Freunde aus der Palermo Street dabei war. Als ich an diesem Tag nach Hause kam, fragte ich meinen Vater, warum Alex, David und Charles nicht auch in der Schule waren. Mein Vater erklärte mir, dass sie auf eine andere Schule gingen; ich ging auf eine protestantische Schule (an der aber auch Sikhs, Muslime und Juden zugelassen waren), während die Brüder Breslin und Donnelly auf eine katholische Schule gingen. Das war meine erste Erfahrung mit dem Gift des schottischen Sektierertums. Es war bitter. Ich fragte ihn: »Warum ist das so?« Ich spürte instinktiv, dass etwas daran falsch war. Und er sagte: »Ja, es ist falsch.« Und weil er merkte, dass mich die Angelegenheit ziemlich aufwühlte, erklärte er mir mit einfachen Worten, die selbst ich als fünfjähriges Kind verstehen konnte, warum die Situation in der Tat bescheuert und ungerecht war.
Bis zu diesem Tag hatte ich keine Ahnung, was Religion überhaupt war. Meine Eltern waren beide Sozialisten, und auch wenn ich später herausfand, dass alle meine Großeltern, Onkel und Tanten mütterlicherseits in den Dreißigerjahren Mitglieder der Grand Orange Lodge of Scotland – einer Organisation zur Förderung des Protestantismus, des Unionismus und der Loyalität zur britischen Krone – gewesen waren, spielte Religion bei uns zu Hause keine Rolle. Meine Mutter hatte in jüngeren Jahren zwar ebenfalls der Grand Orange Lodge angehört, war aber ausgetreten, als sie meinen Vater kennenlernte.
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, finde ich das Ganze schon komisch: Im Wohnzimmer von Alex Donnelly hing ein gerahmtes Bild von Papst Paul VI. an der Wand über dem Kamin. Wenn ich andere Kinder besuchte, hingen dort meistens Bilder von Queen Elizabeth II. Bei uns zu Hause gab es Che Guevara und die Black Panthers. Dem heiligen Strohsack sei Dank.
Nach diesem ersten Schultag bin ich allein zur Schule gegangen. Ich ging zu Fuß hin und zurück, sogar im Winter, wenn es auf dem Hinweg noch dunkel war und auf dem Nachhauseweg schon wieder. Wenn es schneite, war der Kontrast zwischen dem Teppich aus reinem, weißem, unberührtem Neuschnee und den satten, dunklen Samttönen des blauschwarzen, tief hängenden schottischen Himmels einfach wunderschön. Ich erinnere mich daran, wie aufgeregt ich immer war. Die Schule lag nur ein paar Straßen entfernt, und der Fußmarsch dauerte gerade eine Viertelstunde, aber für einen Fünfjährigen war es ein aufregendes Abenteuer im Schnee.
Am Ende unserer Straße lag eine riesige verlassene Fabrik, die Cowlairs Works. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts wurde ein Viertel aller Dampflokomotiven der Welt in Springburn hergestellt. Während der Zeit des Empire boomte die Eisenbahnindustrie, und die Fabriken und Werkstätten boten den Menschen der Umgebung wertvolle Arbeitsplätze. Bei meinem Eintreffen befand sich die Gegend bereits in der ersten Phase des postindustriellen Niedergangs. Die Fabrikmauern verliefen entlang der Gleise, die vom Bahnhof Springburn abzweigten und auf denen wir unsere kindlichen Mutproben veranstalteten: Wir stellten uns auf eine Schwelle zwischen den Schienen und warteten darauf, dass der Zug kam. Der Erste, der absprang, verlor, wer zuletzt sprang, gewann. Ich habe immer gewonnen. Ich fand es toll.
Das Springburn Engineering College befand sich in der Flemington Street, neben einer Whisky-Abfüllfabrik und einem Industriegebäude, das kurz zuvor abgerissen worden war. Es sah aus wie nach einem Bombenangriff, genau wie die Fotos, die man jetzt von den Gebäuden in Aleppo in Syrien sieht, nachdem die Jungs von Assad und Putin ihr mörderisches Höllenfeuer abgeworfen haben. Riesige Betonplatten, die in seltsamen Winkeln aus dem Boden ragten, fast so als wäre eine Autobahnüberführung zur Hauptverkehrszeit zusammengebrochen. Aus den Platten ragten verrostete rote Metallstangen heraus, die als Verstärkung in die Fußböden und Decken der Fabriketagen, in denen die Menschen einst gearbeitet hatten, eingezogen waren. Wie Speere steckten sie in verdrehter Agonie in den eingestürzten Betonplatten, als wären es die Reste einer Armee von Kriegern, die vor Urzeiten in einer Schlacht vergeblich versucht hatte, die Stellung zu halten.
Das waren die Orte, an denen wir früher gespielt haben. Es war gefährlich und aufregend zugleich, und nie waren Erwachsene dabei, nur man selbst und seine Fantasie. Es erinnerte an den Charlton-Heston-Film Der Omega-Mann, eine Science-Fiction-Geschichte, die in einer Zukunft spielt, in der Charlton einer der wenigen Überlebenden in einer vom Atomkrieg zerstörten Stadt ist. Er verbringt den gesamten Film damit, sein Leben gegen Legionen von tollwütigen, zombieartigen, bombengeschädigten Überlebenden auf den Straßen zu verteidigen. Ein dystopischer Klassiker, der einem kleinen Kind richtig Spaß macht.
Einmal spielte ich an einem Sommertag allein in der zerstörten Fabrik. Mein Vater hatte Nachtschicht, also schlief er, meine Mutter war auf der Arbeit. Ich stellte mir vor, ich sei Clint Eastwood in Agenten sterben einsam oder so etwas. Und dann rutschte ich aus und blieb mit meinem rechten Bein in einem Spalt zwischen zwei riesigen, geborstenen Betonplatten stecken. Als ich versuchte, mein Bein herauszuziehen, schnitt ich mir an einem der rostigen Metallspieße, die aus dem Beton kamen, den Oberschenkel auf, und eine tiefe Wunde klaffte in meinem Bein. Ich dachte, ich sterbe. Ich hatte noch nie in echt so viel Blut gesehen (nur in Kriegsfilmen) oder solche brennenden Schmerzen gespürt. Die Unversehrtheit meines Körpers war zum ersten Mal verletzt worden, und ich hatte keinen Schimmer, wie ich mit dem Schock umgehen sollte.
Ich schaffte es, mein Bein herauszuziehen und den ganzen Weg nach Hause zu humpeln, obwohl mein Bein stark blutete. Die ganze Zeit dachte ich, ich sterbe. Ich schaffte es, meinen Vater zu wecken, indem ich an die Tür hämmerte. Er brachte mich ins Krankenhaus, wo ich mit dreizehn Stichen genäht wurde. Der Arzt war ein ruhiger und gut aussehender Mann, er schaute aus wie Sidney Poitier. Er konnte sehen, dass ich unter Schock stand, also beruhigte er mich und nähte mich gut zu, und das war’s. Dreizehn Stiche sind in diesem Alter eine große Sache. Deine Beine sind winzig, sodass die Stiche enorm aussehen. Es gibt eine psychische Narbe von dem Trauma und eine Narbe auf der Haut. Beide sind für die Ewigkeit. Ein paar Wochen später gingen wir wieder hin, um die Fäden ziehen zu lassen, doch diesmal war ein anderer Arzt da. Ich weiß noch, wie ich sagte: »Ich will den schwarzen Arzt! Ich will den schwarzen Arzt! Den mag ich!«
Kurze Zeit später hatte ich einen weiteren Unfall. Ich fiel in der Whisky-Abfüllanlage von einem Stapel Paletten herunter. Ich war über den Zaun geklettert, der das Gelände umschloss, und dann auf diese ausgedienten Paletten, die etwa sieben Meter hoch gestapelt waren. Ich sprang zwischen den Stapeln hin und her und dachte, ich wäre Steve McQueen in Gesprengte Ketten. Ich stürzte und musste an der linken Seite meines Kopfes mit fünf Stichen genäht werden.
Als ich acht oder neun war, wurde ich in der Flemington Street von einem Auto angefahren. Ein Mädchen aus meiner Klasse hat mich wegen irgendetwas gehänselt. Ich wurde wütend, und sie fing an, mich auszulachen, also jagte ich ihr hinterher, vorbei an dem Schülerlotsen, der den Verkehr auf der belebten Straße regelte, und als sie den Bürgersteig auf der anderen Seite erreichte, wurde ich von einem weißen Mini Cooper angefahren, durch die Luft geschleudert und verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, kam ich mir vor wie in einem Film. Ich war umringt von Sanitätern und einer Gruppe neugieriger Schulkinder (und dem Schülerlotsen) sowie dem besorgten Studenten der technischen Hochschule, der den Mini gefahren hatte. Ein Krankenwagen brachte mich zum Stobhill Hospital. Ich hatte einen großen Bluterguss am Bein und eine Gehirnerschütterung von dem Aufprall auf der Straße. Es hätte schlimmer sein können. Ich hatte großes Glück. Gleichzeitig war es ein Vorzeichen. Ich sollte herausfinden, dass Mädchen hinterherzujagen eine gefährliche und lebensverändernde Angelegenheit sein kann.
Eine eintönige Umgebung birgt die Gefahr der Langeweile, und dort, wo ich aufwuchs, gab es nicht viel Abwechslung. Wir hatten keine Fußballplätze, und die einzigen Spielplätze mit Schaukeln und Karussells befanden sich oben im Springburn Park, der zu weit entfernt war, um allein dorthin zu gehen. Meistens spielten wir nach der Schule auf der Straße oder im Hyde Park und benutzten Mäntel als Pfosten. Ich brach in die abbruchreife Lokomotivenfabrik in der Ayr Street ein, kletterte an den Rohren an der Wand hinauf und kroch an den Trägern hoch oben unter dem Glasdach entlang. Die Träger verliefen etwa zehn bis fünfzehn Meter über dem Betonboden. Wenn ich gestürzt wäre, hätte mir niemand helfen können, weil ich immer allein unterwegs war und nie jemandem sagte, wohin ich ging. Meine Mutter hat nie gefragt, und ich wusste es selbst nicht. Ich ging am Nachmittag einfach los und streunte ziellos durch die Gegend. Man wusste nie, wen man auf der Straße treffen würde. Jeder Tag war anders. Als Kinder haben wir kein wirkliches Zeitgefühl; wir leben ständig im Augenblick. Diese Kraft des Jetzt war etwas, das ich später im Leben suchen sollte. In meiner Fantasiewelt fühlte ich mich wohl. Ich stellte mir vor, dass ich die Hauptrolle in einem Abenteuerfilm spielte. Wenn ich in diese Fabrik einbrach, war ich ein Spähtrupp auf einer gefährlichen Mission in feindlichem Gebiet. Es gab mir ein Gefühl von Freiheit.
Das Leben war wunderbar. Die Straßen von Springburn waren golden. Sie gehörten uns. Ich sah nie die Risse im Betonpflaster. Sie waren die offene Prärie, auf der Cowboys und Indianer und die US-Kavallerie ritten und kämpften, oder die Rennstrecke von Le Mans. Ich hatte im Kino den Trailer zum gleichnamigen Steve-McQueen-Film gesehen, und wenn ich mit meinem Chopper-Fahrrad herumfuhr, stellte ich mir vor, ich wäre Steve. (Mein Chopper war nicht von Raleigh, sondern eine billige Kopie mit einem metallicblauen, glitzernden Plastiksitz, so wie die wunderschönen Teddy-Boy-Jacken aus Lurex, die der Kings-Road-Designer Kenny McDonald Jahre später für PiL entwerfen sollte.) Ich fuhr mit vollem Tempo bis zum Anfang der Palermo Street, bog um die Ecke in die Springburn Road, dann die Vulcan Street hinunter und über die Ayr Street zurück zur Palermo Street, wobei ich mir vorstellte, ich wäre Steve McQueen in Monaco in seinem Rennwagen.
Gegen Ende der Sechzigerjahre verschwanden allmählich alle meine Freunde aus der Gegend. Es war der Beginn des berüchtigten Slum-Sanierungsprogramms in Springburn. Ich war viel zu jung, um das zu begreifen. Alles, was ich wusste, war, dass man eines Tages auf der Straße stand und seine Freunde waren weg – spurlos verschwunden. Da es auf der Straße keine Kinder mehr gab, mit denen man sich unterhalten oder spielen konnte, zog ich mich in meinen Kopf zurück und blieb dort. Es war eine wohlige Umgebung, in der ich mich sicher fühlte. Ich stellte mir allerhand Mutproben, wie beispielsweise von den Mauern im Hinterhof auf andere angrenzende Mauern oder Wälle zu springen. Diese waren ungefähr dreieinhalb Meter hoch. Einmal kletterte ich auf das Gerüst der Technischen Universität und versuchte, wie Tarzan zwischen den Metallstangen hin und her zu schwingen, die sich etwa zwei Meter über dem Boden befanden und einen Abstand von nicht ganz zwei Metern hatten. Ich stürzte und schlug ein paar Mal mit dem Kopf auf den Betonboden, aber ich war fest entschlossen, mir selbst zu beweisen, dass ich es schaffen konnte, und so machte ich weiter, vollgepumpt mit Adrenalin, bis ich die gegenüberliegende Stange erfolgreich erwischte.
Häufig spielten wir das Spiel »Heldentod«, bei dem ein Kind oben auf der Mauer eines Mülltonnenschuppens stand und unten ein anderes, das fragte: »Wie willst du sterben?« Der Junge auf der Mauer antwortete, mit einer Handgranate, einer Bombe, einem Messer oder einem Maschinengewehr, der andere tat dann so, als würde er ein Messer werfen oder ein Gewehr abfeuern, und der Junge musste so tun, als wäre er von einer Kugel getroffen oder in die Luft gesprengt worden, und dann von der Mauer oder dem Schuppen auf eine alte Matratze fallen, die wir auf dem Hof oder auf der Straße gefunden hatten, oder auf ein paar Pappkartons, die wir aus den Mülltonnen gezerrt hatten. Manchmal wurde die Matratze oder die Pappe unter einem weggezogen, wenn man fiel, und man schlug auf dem kalten, harten Boden auf.
Wir spielten auch ein Spiel, das »Erziehungsheim« hieß. Zehn Kinder bekamen jeweils einen Buchstaben, die zusammen ein geheimes Wort ergaben. Sie verteilten sich alle in den umliegenden Straßen, und einer (der »Anstaltsleiter« oder »Kinderfänger«) machte Jagd auf die »entkommenen« Kinder. Jedes Kind, das erwischt wurde, wurde so lange verdroschen, bis es seinen Buchstaben verriet. Danach musste es dem Anstaltsleiter helfen, die anderen zu jagen, bis er genug Buchstaben hatte, um das Geheimwort zu erraten. Ich habe meinen Buchstaben immer sofort verraten. Es hat keinen Sinn, für ein dummes Spiel Prügel einzustecken, dachte ich mir.
Die meisten von uns waren Schlüsselkinder, deren Eltern beide arbeiteten. Ich lernte, wie man an Regenrinnen hochklettert, und schaffte es, in die Fenster von Wohnungen im ersten Stock zu klettern und die Tür zu öffnen. Ein grandioses Gefühl. Ich mochte die Vorstellung, ein Einbrecher zu sein wie Illya Kuryakin, David McCallums Figur in der Fernsehserie Solo für O.N.C.E.L., der in seinem schwarzen Rollkragen wie eine Katze über die Dächer schleicht und irre cool dabei aussieht.
Ich habe mich oft in Gefahr begeben. Ich fühlte mich immer zur Grenzüberschreitung hingezogen. Als Kind kennt man das Wort Grenzüberschreitung nicht, aber man fühlt den Drang, gefährliche Dinge zu tun. Auf der Suche nach Kicks. Oder billigem Nervenkitzel. Manchmal träumte ich davon, ein Stuntman zu sein. Gab es etwas Cooleres? Man kann mit schnellen Autos über Klippen und Brücken fahren, in Kämpfe verwickelt werden und immer gewinnen! Ich erinnere mich, dass ich mit zwölf Jahren in den Sommerferien von einer Mauer flog und mit dem Kopf voran auf den Betonboden an der Rückseite des Mietshauses aufschlug. Ich brach mir beide Handgelenke. Ich musste am Kopf genäht werden. Ich konnte mir nicht einmal den Arsch abwischen. Der Sommer hatte gerade angefangen, und ich musste die gesamten Ferien mit beiden Handgelenken in Gips verbringen.
Ich weiß auch noch, dass ich Astronaut werden wollte. Ich wurde 1961 geboren, im selben Jahr, als der russische Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch ins All flog. Diese Tatsache fand ich großartig: Juri und ich, verbunden durch die Geschichte. Meine Mutter schenkte mir ein Album mit vielen Briefmarken, die tatsächlich aus der Sowjetunion stammten und auf denen Juris Porträt mit einer Rakete im Hintergrund in verschiedenen Farben abgebildet war, wie bei Andy Warhol. Später im Leben sollte ich, mithilfe von psychoaktiven Drogen, ein Kosmonaut des inneren Weltraums werden.
Mein Vater nahm mich an den meisten Samstagnachmittagen mit ins Kino – entweder ins Odeon in der Renfield Street oder ins Eglinton Toll in den Gorbals, das die größte Kinoleinwand in Europa hatte. Jahre später spielten wir mit Primal Scream ein Stück weit die Straße hinunter im Bedford Cinema, das heutzutage Carling Academy heißt, und Shane MacGowan sang mit uns »Born To Lose« von Johnny Thunders & The Heartbreakers. Ich weiß noch, wie mein Vater und Shane sich nach der Show in der Garderobe gegenseitig Witze erzählten.
Neben Filmen wie Gesprengte Ketten und Agenten sterben einsam nahm mich mein Vater mit in historische Dramen wie Waterloo mit Christopher Plummer, Young Winston mit Simon Ward und Cromwell, einen Film über den englischen Bürgerkrieg mit Richard Harris und Alec Guinness als Charles I. Ich liebte Die glorreichen Sieben. Wir alle wollten wie Yul Brynner sein, der Anführer der sieben, ein cooler, eiskalter Revolverheld, der immer einen kühlen Kopf bewahrte und von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet war. Ich erinnere mich, dass mein Vater mit mir 2001: Odyssee im Weltraum und Man nennt mich Shalako, einen Western mit Sean Connery, Honor Blackman und Brigitte Bardot in den Hauptrollen, anschaute. Eine Szene aus diesem Film hat sich in mein vorpubertäres Gedächtnis eingebrannt: Die Postkutsche, in der Bardot und die anderen reichen weißen Kolonisten sitzen, wird von den Apachen überfallen, die Blackman ersticken, indem sie sie zwingen, eine Handvoll Sand und die Perlenkette, die sie trägt, zu schlucken. Das Bild von Blackman, wie sie rücklings im Wüstensand liegt, ihre Haare, die sie zuvor mit so viel Stolz zu einer Turmfrisur hochgesteckt hatte, sich in ein wirres Knäuel verwandeln und ihre Brüste aus ihrem weißen Bustier hervorquellen, hat sich mir nachhaltig ins Gedächtnis eingebrannt.
In der Gourlay Street, wo sich das Kino befand, gab es einen Laden, der Comics und Spielzeug verkaufte. Ich kaufte dort DC- und Marvel-Comics, mein erster Lesestoff, den ich leidenschaftlich verschlang. Spider-Man, Superman, Batman, der Unglaubliche Hulk, das Ding, die Fantastischen Vier, Thor. Stan Lee war ein Gott. Dieser Mann brachte Glückseligkeit in das Leben unzähliger Kinder wie mir und half uns, uns aus unserem eintönigen Arbeiterklassedasein in andere Welten zu versetzen. Außerdem kaufte ich mir Comics über Lord Carnarvon, den viktorianischen Entdecker, der zu den Pyramiden aufbrach und die Gräber der altägyptischen Könige und Königinnen, die Mumien und andere Schätze des alten Ägypten plünderte und Kostbarkeiten aus unterworfenen, nicht-weißen, heidnischen, sogenannten primitiven Zivilisationen zurückbrachte. Die britische Oberschicht und ihr Fußvolk aus der Unterschicht vergewaltigten, plünderten und brandschatzten sich durch jeden Ort auf der Weltkarte, den sie eroberten. Papa sagte, er erinnere sich daran, wie sein Lehrer auf einer Weltkarte auf alle rosa gefärbten Länder zeigte und stolz verkündete: »Seht ihr die kleine Insel hier? (Wobei er mit seinem Stab auf das Vereinigte Königreich zeigte.) Wir herrschen über all diese Länder.«
Das erste Mal, dass mein Vater mich auf der Bühne sah, war in der Calvary-Pfingstkirche am oberen Ende unserer Straße. Meine Mutter brachte mich manchmal dorthin, weil sie in ihrer Jugend die Sonntagsschule besucht hatte und der Ansicht war, dass es nichts schaden konnte. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, erscheint es mir seltsam, denn sie waren beide Atheisten und Sozialisten, aber in der Kirche gab es eine Einrichtung für Kinder namens Band of Hope, eine christliche Wohltätigkeitsorganisation, die in Viktorianischer Zeit gegründet worden war, um Arbeiterkinder über Drogen- und Alkoholmissbrauch aufzuklären. Ich schätze, es war eine Art kostenlose Kinderbetreuung. Papa sagte, dass er eines Tages auf der Straße nach mir suchte – es muss später Nachmittag gewesen sein –, und als er herumfragte, sagten ihm die Kinder, dass ich bei der Band of Hope sei. Als Papa hereinkam, sah er mich als Erstes auf der Bühne, wo ich das Kirchenlied »My Cup Runneth Over« sang. Das war mein erster Auftritt. Ich war fünf Jahre alt. In einer Kirche. Bei einem Abstinenzlertreffen. Ich verkündete singend die frohe Botschaft. Oh, welch Ironie! Der Blues hatte mich schon damals am Wickel. Scheiß drauf.
Die Betreuer der Band of Hope waren nett. Sie gaben einem eine Tasse Tee und einen Keks. Es war ein Ort, an dem wir Kinder abhängen konnten, wenn auf der Straße sonst nichts los war. Und dann war da noch die Springburn Library in der Ayr Street. Als Kind ging ich oft dorthin, weil mein Vater mich zum Lesen ermutigt hatte. Er wollte, dass auch ich die Erfahrung machte, wie sehr Literatur die Fantasie anregen kann. Es gab eine Abteilung für Erwachsene, in der es superordentlich war und die Leute still an Tischen saßen und lasen. Mit den Bibliothekaren war nicht zu spaßen. Ich glaube, ich habe mir dort nur Kinderbücher angesehen. Es war ein weiterer Ort, an den man flüchten konnte, wenn man von der Straße genug hatte.
Gleich um die Ecke der Bibliothek in der Vulcan Street gab es eine Kirche in einem Laden im Erdgeschoss. Ich weiß nicht mehr, zu welcher Konfession sie gehörte. Nebenan befand sich ein Buchmacher, ein kleines Kabuff ohne Beschriftung – ein Buchmacher der Arbeiterklasse, kein helles, modernes Wettbüro mit bunten Leuchtreklamen wie Ladbrokes oder so. Wir sahen immer müde und abgekämpfte alte Männer in der Nähe des dunklen Eingangs, die ihren Lohn oder ihr Arbeitslosengeld auf den verblassenden Traum vom großen Gewinn beim Pferderennen verwetteten. Es war ein abgekartetes Spiel, das wussten sie alle, aber das hielt sie nicht davon ab, jeden zweiten Tag wiederzukommen und es erneut zu versuchen. Sucht. Zwang. Langeweile. Die Kirche nebenan hatte eine Hammondorgel, mit massig Registern und allem, was man braucht, um den Klang zu verändern. Eine nette Dame mittleren Alters spielte sie. Ich liebte den Klang, den sie aus der Orgel herausholte. Er hatte etwas Beruhigendes an sich. Manchmal gingen wir in den Schulferien hinein und hörten den Leuten zu, wie sie ihre Kirchenlieder sangen. Das hat mir immer gefallen, und ich hatte immer Respekt vor dem Glauben anderer Menschen. Ich erinnere mich, dass ich es faszinierend fand – all diese Menschen, die sich nicht kannten und doch gemeinsam Kirchenlieder sangen. Sie standen zusammen in einem gemeinsamen Glauben an etwas, das größer und mächtiger war als sie selbst, einem Glauben an einen Gott. Meine Familie ging nie in die Kirche, aber in nicht allzu ferner Zukunft würde auch ich Gesänge anstimmen, wenn auch nicht als Gläubiger.
Als ich neun oder zehn Jahre alt war, musste ich schließlich wirklich in die Kirche gehen, weil meine Schule keine Fußballmannschaft hatte und ich unbedingt spielen wollte. Ich trat in die Gemeindejugend ein, nur um in der dortigen Mannschaft mitzuspielen. So musste ich jeden Sonntag in die Kirche gehen, zum Bibelunterricht. Ich musste das Neue Testament lernen – eine Kinderversion des Neuen Testaments – und einen Test bestehen. Darin war ich wirklich gut. Aber alles nur, um in die Fußballmannschaft zu kommen. Mein Vater war damit einverstanden, obwohl er Marxist war.
Meine Eltern waren Mitglieder der Sozialistischen Internationale, auch SI genannt. Sie trafen sich in einem Saal nicht weit von unserer Wohnung in Springburn. Ich selbst war schon, kaum dass ich geboren war, auf Demonstrationen mit dabei. Es gibt ein Foto von mir als Baby in Papas Armen auf einer Demo zum Tag der Arbeit im Queens Park 1962. Meine Mutter machte das Banner für die Springburn Young Socialists (YS), das sie auf die Demonstrationen mitnahmen. Es war rot mit einem weißen Schriftzug. Meine Mutter und eine Freundin fertigten das Transparent auf ihrer Nähmaschine in unserer Einzimmerwohnung in der Palermo Street.
Ebenfalls auf dem Foto von meinem Vater mit mir als Baby bei der Demo war ein Teenager namens Stuart Christie, auch er ein Mitglied der Jungsozialisten in Springburn. Er hatte meinen Vater gehört, wie er an einer Straßenecke eine Rede hielt. Mein Vater hatte ihm von den wöchentlichen Treffen der Jungsozialisten erzählt und ihn eingeladen mitzumachen. Stuart verließ die YS nach einer Weile, weil sie ihm nicht revolutionär genug waren. Er glaubte, dass eine wirkliche revolutionäre Veränderung der Gesellschaft nur durch direkte Aktionen und nicht durch parlamentarische Politik herbeigeführt werden konnte. Im Juli 1964 wurde Stuart in Madrid verhaftet, weil er im Besitz von Sprengstoff war und die Absicht hatte, den faschistischen Diktator General Franco in die Luft zu jagen. Stuart drohte die Todesstrafe, aber er wurde schließlich zu zwanzig Jahren Gefängnis verurteilt. Mein Vater und andere YS-Freunde protestierten vor dem spanischen Konsulat in Glasgow für die Freilassung Stuarts. Er wurde nach drei Jahren in Francos Gefängnissen entlassen, wo er in der Zwischenzeit Kontakt zu spanischen Anarchisten aufgenommen hatte. Meine Eltern blieben mit ihm in Kontakt, bis er 2019 starb.
Mein Vater hat immer gesagt: »Du musst lesen, du musst lesen.« Wie schon erwähnt, war er aufgrund seiner Lebensumstände nie wirklich zur Schule gegangen. Er war ein verwildertes Straßenkind und lebte im Stadtteil Kingston, gleich neben den Gorbals, in der Nähe der Werften, die während des Krieges von den Deutschen bombardiert worden waren. Glasgow und Clydebank wurden von der Luftwaffe schwer beschossen.
Wann immer mein Vater zur Schule ging, war es eine unangenehme Erfahrung. Schikanen und Demütigungen seitens der Lehrer waren an der Tagesordnung, denn er kam in Lumpen zur Schule, ohne Unterhose, mit Löchern im Hosenboden. Der Lehrer ließ ihn aufstehen und führte ihn vor der ganzen Klasse vor, zeigte auf die Löcher in seiner Hose, ließ ihn dann in der Ecke mit dem Gesicht zur Wand stehen und ermunterte die Klasse, ihn auszulachen. Ein Kind aus armen Verhältnissen dem Spott preisgeben – könnt ihr euch vorstellen, wie er sich dabei fühlte? Seine ältere Schwester Rosemary kümmerte sich um ihn und zog ihn auf. Sie hatten keine eigene Unterkunft, sondern wohnten bei anderen Leuten zur Untermiete, wo sie dann auf dem Fußboden von deren Schlafzimmer übernachteten. Als sie sechzehn wurde – sie war ein ganzes Stück älter als er –, bekam sie einen Job in einer anderen Stadt, und von da an war er auf sich allein gestellt und lebte eine Zeit lang auf der Straße und ging selten zur Schule. Er erzählte mir, dass er, als er aufs Land evakuiert wurde, häufig am Fluss im Wald saß, Beeren pflückte und sich wie Tom Sawyer fühlte. Er liebte Huckleberry Finn. Es half ihm, sich aus seiner beschissenen Situation herauszuträumen. Das ist die Macht der Kunst.
Mein Vater hatte nicht viel Bildung genossen, also musste er sich selbst darum kümmern. Er liebte Die Schatzinsel und Robinson Crusoe. Ich weiß noch, wie ich etwa acht oder neun Jahre alt war und er zu mir sagte: »Was auch immer du vorhast – auf eine Kunstschule gehen, Kunst studieren oder Musiker werden, ich werde dir den Unterricht bezahlen.« Aber in dem Alter hatte ich nicht wirklich eine Ahnung, wovon er sprach. Ich erinnere mich, dass er mich zu einem lokalen Kunstkurs mitnahm, und der war ein bisschen trocken. Ich wollte lieber draußen sein und mit meinen Kumpels spielen, klettern, kämpfen, Fußball spielen.
Mein Vater erzählte mir, dass er als Kind oft ins Kino gegangen ist. Damals liefen immer zwei oder drei Filme – ein oder zwei Vorfilme und dann der Hauptfilm. Diese Filme, die er sich ansah – die Marx Brothers oder Buster Keaton, heutige Hollywood-Klassiker wie Casablanca oder Der Malteser Falke