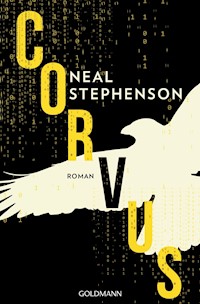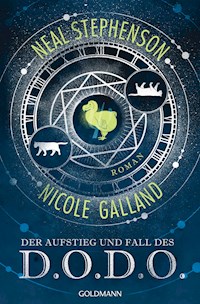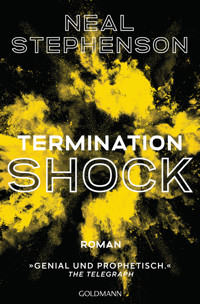
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Welt in Gefahr: ein brandaktueller Thriller um den Klimawandel – und unsere mögliche Rettung.
In einer Welt der nahen Zukunft hat der Treibhauseffekt zu einer wirbelnden Troposphäre mit Superstürmen, Überschwemmungen und gnadenloser Hitze geführt. Der globale Kollaps scheint unausweichlich, der Anstieg des Meeresspiegels ist nicht mehr aufzuhalten. Doch dann stellt ein texanischer Milliardär die Mittel für ein spektakuläres Projekt bereit, das die globale Erwärmung stoppen könnte. Aber wird es funktionieren? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der über das Schicksal der gesamten Menschheit entscheiden wird. Ein mitreißender, apokalyptischer Roman, erzählt von einem der visionärsten Autoren unserer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1215
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
In einer Welt der nahen Zukunft hat der Treibhauseffekt zu einer wirbelnden Troposphäre mit Superstürmen, Überschwemmungen und gnadenloser Hitze geführt. Der globale Kollaps scheint unausweichlich, der Anstieg des Meeresspiegels ist nicht mehr aufzuhalten. Doch dann stellt ein texanischer Milliardär die Mittel für ein spektakuläres Projekt bereit, das die globale Erwärmung stoppen könnte. Aber wird es funktionieren? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der über das Schicksal der gesamten Menschheit entscheiden wird.
Neil Stephenson
Termination Shock
Roman
Aus dem Amerikanischen von Juliane Gräbener-Müller und Tobias Schnettler
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Termination Shock« bei William Morrow, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung November 2023
Copyright © der Originalausgabe 2021 by Neal Stephenson
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Nikolaus Stingl
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © FinePic®, München
KN · Herstellung: ast
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-30085-2
www.goldmann-verlag.de
Für A. L.
If it keeps on rainin’, levee’s going to break
If it keeps on rainin’, levee’s going to break
And the water come in, have no place to stay …
I works on the levee, mama both night and day
I works on the levee, mama both night and day
I works so hard, to keep the water away
Kansas Joe McCoy and Memphis Minnie
Texas
Die Luft von Houston war zu heiß, um Flugzeuge zu tragen. Zwar hätte die Maschine der Königin durchaus dort landen können, bedenkt man, dass sie während des Flugs von Schiphol zehntausend Kilo Treibstoff in Kohlendioxid umgewandelt und in die Atmosphäre geblasen hatte. Wieder aufgetankt, konnte sie jedoch nicht sicher abheben, solange die Hitzewelle nicht gebrochen war. Und was sie brechen würde, war ein Hurrikan.
Unter Anweisung von Fluglotsen begannen Frederika Mathilde Louisa Saskia – so lautete nämlich der Vorname der Königin – und ihr Co-Pilot, ein Hauptmann der Königlich Niederländischen Luftwaffe namens Johan, den Düsenjet durch eine Reihe von Manövern zu führen, die ihren Höhepunkt in Waco finden würden.
Nun war Waco für sie vielleicht nicht die allerbeste Wahl, sich deswegen herumzustreiten jedoch zwecklos. Der Privatjet, mit sieben Personen gut besetzt, flog höher und schneller als Linienflugzeuge. Mit über fünfhundertzwanzig Knoten war er durch die untere Stratosphäre gesaust und schon fast im Begriff gewesen, in den Sinkflug Richtung Houston zu gehen, als sie die Nachricht von der Unzulänglichkeit der dortigen Luft erhalten hatten. Eine Entscheidung musste getroffen werden, die nicht unbedingt die bestmögliche zu sein brauchte.
Nach Aussage von texanischen Stimmen über Funk und von Willem, der mit dem, was er über die Datenverbindung des Jets herausgefunden hatte, nach vorne ins Cockpit kam, war in den letzten paar Stunden ein Unwetter über Waco hinweggefegt und hatte die Temperatur auf nur noch 45 Grad Celsius sinken lassen. Oder 113, nach der US-Temperaturskala. So niedrig jedenfalls, dass man sie wenigstens in der Tabelle wichtiger Zahlen nachschauen konnte, die der Hersteller drei Jahrzehnte zuvor bei der amtlichen Abnahme dieses Flugzeugtyps berechnet hatte. Nie wäre es diesen Leuten in den Sinn gekommen, dass es einmal so heiß werden könnte wie an diesem Tag in Houston, und deshalb verzeichnete die Tabelle so hohe Temperaturen gar nicht.
Wacos Flughafen würde ihnen alles bieten, was sie wirklich brauchten. Er hatte zwei v-förmig angeordnete Landebahnen. Die aktuell vorherrschenden Winde schrieben eine Landung auf der westlicheren der beiden in Richtung Süden vor. Die Fluglotsen sagten ihnen, was sie tun sollten. Und das taten sie.
Diese Männer waren vollauf damit beschäftigt, mit einer großen Zahl von Flugzeugen – zumeist Passagiermaschinen – zu jonglieren, deren Hoffnung auf eine Landung in Houston ebenfalls geplatzt war. Die meisten von ihnen brauchten größere Flughäfen, und deshalb erschien es nicht angebracht, mit ihnen darüber zu streiten, ob Waco perfekt war. Der Funkverkehr konnte von jedem, der ein Funkgerät hatte, mitgehört werden. Er wurde aufgezeichnet. Es war ziemlich wichtig, dass Saskia und ihre Crew keinen Staub aufwirbelten, nicht die Aufmerksamkeit auf sich zogen. Die Königin war von Kindheit an dazu erzogen worden, nie den Anschein zu erwecken, als würde sie königliche Vorrechte beanspruchen. Das zu tun wäre nämlich unholländisch gewesen, Wasser auf die Mühlen der Anti-Royalisten. Lennert, ihr Sicherheitschef, freundete sich gerade mit dem Gedanken an, dass Waco in Ordnung sein würde. Es gab einen Hangar, der für Maschinen wie diese geeignet war. Willem hatte bereits Hotelzimmer gebucht und sich nach einer Autovermietung erkundigt.
Sie brauchte nichts anderes zu tun, als das Flugzeug auf den Boden zu bringen. Darin war sie gut. Und selbst wenn nicht, Johan schaffte das auch ganz ohne ihre Hilfe.
Neben Königswürde und Reichtum hatte sie von ihrem Vater das merkwürdige Hobby des Fliegens von Düsenmaschinen geerbt. Obwohl er König war, hatte er nebenher als Pilot für die KLM – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij –, die Königliche Luftfahrtgesellschaft, gearbeitet, deren Logo tatsächlich eine Krone war. Wie Papa ihr vor langer Zeit erklärt hatte, gab es einen Grund, warum er Pilot geworden war: Wenn er am Steuer saß, hatte er nicht nur die Gelegenheit, sondern die heilige Pflicht, sich voll und ganz auf die Maschine zu konzentrieren, die ihn und seine Passagiere am Leben hielt.
Zwei Dinge hatte die kleine Prinzessin Frederika Mathilde Louisa Saskia an dieser Aussage damals nicht verstanden.
Das Erste (offensichtlichere): Da Mama und Papa versucht hatten, sie zu so etwas Ähnlichem wie einem normalen Menschen zu erziehen, hatte sie erst viel später verstanden, und wie viele Anforderungen die Krone an einen stellte. Jetzt wusste sie das sehr gut.
Das Zweite (das ihr erst vor Kurzem aufgegangen war): »Die Maschine, die ihn und seine Passagiere am Leben hielt«, war eine Metapher für die Niederlande: ein hochentwickeltes Gerät, das, wenn nicht permanent die richtigen Knöpfe betätigt wurden, eine Menge Niederländerinnen und Niederländer töten würde.
Während des Sinkflugs und der Vorbereitungen zur Landung verspürte sie am Steuer eines Flugzeuges ein Gefühl von Freiheit und geistiger Klarheit. Es ging ausschließlich darum, die Steuerungselemente so zu bedienen, dass bestimmte Zahlen innerhalb bestimmter Bereiche blieben. Unmittelbar vor dem Aufsetzen auf der Landebahn in Waco musste der Jet seine Geschwindigkeit auf eine VREF (Referenzgeschwindigkeit) genannte Zahl reduziert haben. Diese variierte je nach Temperatur, Flugzeuggewicht und Landebahnbeschaffenheit; berechnen konnte man sie in jedem Fall anhand dieser dreißig Jahre alten Tabellen, und es gab bekannte Verfahren, um die Geschwindigkeit der Maschine auf diese Zahl hinunterzubringen.
Gleichzeitig mussten sie die ganze Troposphäre – die Lufthülle um die Erde, in der das Wetter sich ereignete – senkrecht nach unten durchdringen, bis die Zahl auf dem Höhenmeter mit der Höhe von Waco übereinstimmte. Auch dafür gab es bekannte Verfahren, die alle in Abstimmung mit den Wendemanövern erfolgen mussten, die von den gestressten texanischen Fluglotsen diktiert wurden. Die Bedienung der Steuerelemente zur systematischen Erreichung dieser Ziele, die knappen, prägnanten, aber äußerst ruhigen Dialoge mit Johan und den Stimmen über Funk, all das zusammen versetzte sie in einen Zustand, den die Holländer als norMal mit Betonung auf der zweiten Silbe bezeichneten. Etwas völlig anderes als das englische »NORmal«.
»NorMAL« erklären zu wollen, würde ein ganzes Buch füllen, aber das Wichtigste daran war, dass »NorMAL«, wenn man zufällig zur holländischen Königsfamilie gehörte, genau das bezeichnete, was nicht zu sein die Königsfamilie ständig verdächtigt wurde, und so war alles wünschenswert, was einen norMAL machen konnte; da man das aber auch mühelos vortäuschen konnte, funktionierte es am besten mit einer Tätigkeit, die einen umbringen würde, wenn man Fehler machte.
Wenn man, wie sie es als kleines Mädchen bekanntlich getan hatte, mit dem Fahrrad zur Schule fuhr, konnte man davon ausgehen, dass Hasser das als reine Publicity bezeichnen und jeden verspotten würden, der so naiv war, darauf hereinzufallen. Doch selbst die erbittertsten Gegner der Monarchie konnten nicht leugnen, dass der König oder die Königin dieses Flugzeug tatsächlich gelandet hatte und dass sie, wenn es nur ein vorgetäuschtes Manöver gewesen wäre, jetzt tot wären. Überdies war das nichts, was auch ein Affe fertiggebracht hätte. Selbst ein Mitglied des Königshauses konnte keine Pilotenlizenz bekommen, ohne sich zuvor eine ganze Menge Mathematik, Physik, Ingenieurwissenschaft und Meteorologie anzueignen. In grauer Vorzeit hatten Könige der Welt gezeigt, dass sie es ernst meinten, indem sie sich ein Schwert umschnallten und in den Krieg ritten, wo sie ihr Leben riskierten. Sich hinters Steuer eines Flugzeuges zu setzen und dessen Nase auf die Startbahn auszurichten, kam diesem öffentlichen Blutschwur so nah, wie es in der modernen Welt nur möglich war.
Ihr Stab dachte an Einzelheiten, an die sie nicht gedacht hatte – und angesichts ihrer derzeitigen Verpflichtungen nicht hatte denken müssen. Es war ein begreiflicher Irrtum, sich Waco als kühl vorzustellen, nur weil es nicht so heiß wie Houston war. In Wahrheit würde sich das Flugzeug jedoch in einen Ofen verwandeln, kaum dass es auf dem Boden aufsetzte. Es zu verlassen würde die Sache nicht viel besser machen; ob drinnen oder draußen, es war nur eine Frage der Zeit, bis sie alle einen Hitzschlag erlitten. Sie brauchten also einen Plan, um die Maschine und ihre Insassen innerhalb von Minuten nach dem Aufsetzen zumindest in den Schatten und vorzugsweise in eine klimatisierte Umgebung zu bringen. Natürlich hatten sie aufgeladene und einsatzbereite Earthsuits im Frachtraum, aber der Gedanke, sie schon so früh herauszuholen, erschien ihnen überängstlich und amateurhaft.
Sie musste dieses Ding einfach nur auf den Boden bringen, und es gab keinen ersichtlichen Grund, warum das schwierig sein sollte. Der Hurrikan, der Houston bedrohte, war Hunderte Kilometer entfernt über dem Golf. Als Folge des vorangegangenen Unwetters war die Luft böig, aber nichts, was sie am holländischen Himmel nicht schon viele Male gemeistert hatte. Es war ein heller Tag, ungefähr sechzehn Uhr. Der von den Fluglotsen diktierte spiralförmige, lang gezogene Sinkflug bot ihr einen guten Blick über den Großraum Waco. Flach und grün lag er da. Nicht so flach wie zu Hause. Das hier war aber eine Landschaft, die, soweit das Auge reichte, durch nichts Hügelartiges verkompliziert wurde. Das Grün war dunkler als das der holländischen Weiden und Felder – viel Wald und Gestrüpp.
Allmählich konnte sie mehr erkennen. Sie bekamen eine Position für die Landebahn zugewiesen, die immer noch zu weit entfernt war, als dass man sie deutlich hätte sehen können. Jenseits des Flughafens lag die Stadt selbst, von der nur ein paar Gebäude und Türme aus etwas herausragten, was wie ein gut gepflegter Baldachin aus Schattenbäumen aussah. Es gab viele Parks. An den Rändern der Stadt wurde es grauer – vielleicht Neubaugebiete mit noch jüngeren Bäumen? Gleich rechts von ihrem Kurs lag ein großer, von der offenen Rasenfläche des Flughafens durch einen genoppten Vegetationsteppich abgeschirmter See, dessen Dunkelgrün schon fast schwarz wirkte. An der Form des Sees konnte sie erkennen, dass er künstlich angelegt war. Als Holländerin folgte sie mit dem Blick unwillkürlich der Uferlinie, bis sie den langen, geraden Abschnitt entdeckte, bei dem es sich um den Damm handeln musste. Es war ein niedriges Bauwerk aus Erde, durchbohrt von einem Überlauf, nicht weit vom Ende der Landebahn entfernt.
Diese Eindrücke ergaben sich während der rund zehn Minuten, die es brauchte, um den Jet zu landen, auf eine fast unterbewusste Weise. Zu tun gab es in dieser Zeit erstaunlich wenig. Sie und Johan hatten die Maschine so getrimmt, dass ihr Gewicht größer war als der von ihren Tragflächen erzeugte Auftrieb; dadurch verlor sie, den Gesetzen der Physik folgend, auf stetige und vorhersehbare Weise an Höhe. Die Fluggeschwindigkeit sank langsam an zweihundert Knoten vorbei in Richtung VREF, die heute bei einhundertsiebenunddreißig Knoten lag. Bald würden sie die Landeklappen ausfahren. Saskias Blick huschte im Kreis über einige wichtige Kennzahlen. Es war eine alte Maschine. Viele der Steuerelemente waren mechanische Schalter, eingelassen in Bedienfelder aus schwarzem Bakelit mit erhabenen weißen Buchstaben, ganz alte Schule. Die wichtigen Sachen in der Mitte befanden sich jedoch im »Glascockpit«, wie Piloten es nannten: herrliche, farbenprächtige Bildschirme mit virtuellen, nachträglich in das alte Armaturenbrett eingebauten Instrumenten. Ihre Augen wussten, wo die wirklich wichtigen Zahlen zu finden waren – Fluggeschwindigkeit, Flughöhe, Querneigung, Längsneigung, Gierung.
Wichtig war aber auch der Blick durch die Windschutzscheibe auf die reale Welt. Eine kleine einmotorige Maschine landete weit vor ihnen und rollte aus dem Weg. Hier und da blitzte das Land unversehens auf. Das sahen sie zu Hause ständig. Es gab lokale Überschwemmungen. Nicht genug, um große Gebiete zu überfluten, aber ausreichend, um stellenweise für stehendes Wasser zu sorgen, das die flache Landschaft dort, wo es nur langsam abfloss und der Boden gesättigt war, wie glasiert aussehen ließ. Als in eine dieser Lachen Sonnenstrahlen fielen, wurde sie kurz von deren Licht geblendet. Der Flughafen schien jedoch gut entwässert zu sein – vor Pfützen auf den Start- und Landebahnen hätte der Tower sie gewarnt. Die Landebahn war jetzt gut sichtbar, direkt vor ihnen, genau da, wo sie sein sollte, mit feuchten Flecken, aber nicht nass. Der Endanflug führte sie tief über eine Wohnsiedlung. Der größte Teil des Flughafens erstreckte sich links der Landebahn. Rechts davon befand sich zwischen ihr und einem Sicherheitszaun nur ein schmaler Grasstreifen. Unmittelbar außerhalb von und parallel zum Zaun verlief eine zweispurige Straße. Sie bildete die Grenze eines dunklen, bewaldeten Gebiets, das sich ein oder zwei Kilometer weit zum gewundenen Ufer des Sees hin erstreckte. An manchen Stellen war der Wald mit kleinen Eruptionen dunkelroter Erde und an anderen mit blauen Rechtecken gesprenkelt – über provisorische Camps geworfene Planen.
Faszinierend fand sie immer dieses langsame, unausweichliche Heranzoomen. Zwanzig Minuten zuvor wäre es ihr noch schwergefallen, unter dem blauschwarzen Gewölbe der Stratosphäre den Großraum Waco auszumachen, doch jetzt, während sie hundert Meter an Höhe verloren, konnte sie in den Gärten hinter den Häusern blaue Swimmingpools erkennen – ein hellerer Blauton als der der Planen im Wald. Kinder – vermutlich besser dran als die unter den Planen – kühlten sich nach der Schule mit einem Sprung ins Wasser ab. Für einen Moment schweifte sie innerlich zu ihrer eigenen Tochter ab, doch dann schob sie den Gedanken an Lotte erst einmal beiseite und kontrollierte stattdessen zum hundertsten Mal die Instrumente. Bewegung rechts der Landebahn sorgte für einen kurzen Moment der Angst, bis sie sah, dass es nur ein Pick-up war, der die aufgebrochene und mit Pfützen bedeckte zweispurige Straße jenseits der Flughafenumzäunung entlangfuhr. Aus irgendeinem Grund leuchteten seine Bremslichter auf. Das ging sie nichts an.
Am näher gelegenen Ende der Landebahn ließen sie den Zaun hinter sich. Jegliche Besorgnis über die Korrektheit von Geschwindigkeit, Höhe, Anstellwinkel, die sie in den letzten Sekunden des Flugs verspürt haben mochte, wurde dadurch zerstreut, dass Johan vollkommen entspannt war. Sie verstanden sich blind. Jetzt brauchten sie nur zu warten, bis jeden Moment die Reifen das Rollfeld berührten und das Flugzeug zu einem ausgesprochen teuren und schwerfälligen Auto wurde. Die hohe Position der Windschutzscheibe machte es zusammen mit der leichten Hochnäsigkeit der Maschine unmöglich, die Landebahn direkt vor ihnen zu sehen. Dieser Jet war jedoch mit einer Videokamera im Flugzeugboden ausgestattet, mit deren Hilfe sie das, was unter ihnen war, auf einem kleinen Bildschirm in der Instrumententafel zwischen den Sitzen des Piloten und des Co-Piloten sehen konnten. Normalerweise ignorierte sie ihn während der Landung, denn er zeigte nie etwas anderes als sauberen, hindernisfreien Asphalt. Nun hörte sie jedoch entsetzte Schreie von Leuten, die hinten in der Kabine auf der rechten Seite saßen und offenbar gerade etwas Unglaubliches erblickt hatten. Unglaublich und nicht gut. Sie ließ die Tür zum Cockpit gerne offen, damit neugierige Passagiere durch den Gang nach vorne und dort hinausblicken konnten; jetzt klang es aber so, als sähen sie etwas, das sieselbst nicht sehen konnte.
Sie begann, sich gerade zu fragen, ob sie den Landevorgang abbrechen sollten, als sie eine ungewöhnliche Bewegung auf dem Bildschirm bemerkte.
Sie blickte gerade lange genug darauf, um eine Art dunkle aufgewühlte Masse aus vierbeinigen Kreaturen unmittelbar unter dem Flugzeug zu sehen, die von rechts nach links ihren Weg kreuzten.
Die Maschine ruckte heftig nach rechts. Das rechte Fahrwerk unter der Tragfläche war gegen etwas gestoßen, das dort nicht hätte sein dürfen. Sie hatten noch nicht aufgesetzt, und die Räder hatten folglich noch keinen Halt auf dem Boden. Die Nase schwenkte heftig nach rechts und senkte sich gleichzeitig, wodurch das vordere Fahrwerk in einem ungünstigen Winkel auf dem Asphalt aufkam – und gleich darauf weitere Hindernisse auf der Landebahn rammte.
Sie fuhren mit VREF, die in der in Texas gebräuchlichen Maßeinheit bei etwa hundertsechzig Meilen pro Stunde lag. Der Asphalt hob sich ihnen entgegen. Das Flugzeug bewegte sich mindestens ebenso sehr seitwärts wie vorwärts – und rutschte dabei so heftig, dass sie den Blick nicht auf die Instrumente fokussieren konnte. Der Kamerabildschirm war weitgehend rot geworden, das Kameraobjektiv also entweder mit Blut oder mit Hydraulikflüssigkeit bespritzt. Wo der Bildschirm nicht rot war, war er von einem verschwommenen rasenden Grün. Nein, es war die Farbe des Himmels. Nein, wieder Grün. Sie wurde in ihren Sicherheitsgurt geworfen. Im Inneren der Maschine herrschte ein polterndes Durcheinander aus herumfliegendem Gepäck. Irgendein Flugzeugteil – die Spitze einer Tragfläche? – musste sich in den aufgeweichten Boden gebohrt haben. Jetzt blieb der Maschine nichts anderes übrig, als von diesen hundertsechzig Meilen pro Stunde herunterzukommen, indem sie die Landschaft zerstörte.
Schweine! Ihr Verstand hatte eine Weile gebraucht, um die vierbeinigen Tiere zu identifizieren, die bei ihrer wilden Jagd über die Landebahn für einen Moment auf dem Kamerabildschirm erschienen waren. Es waren Schweine. Eher Schwarzwild als landwirtschaftliche Nutztiere. Das war eine im Moment völlig nutzlose Tatsache, die ihr Gehirn da lieferte, während sie diagonal über das Gras schlingerten und rutschten und eine komplizierte Beziehung mit dem Maschendrahtzaun eingingen.
Und dann war das Flugzeug glücklicherweise zum Stehen gekommen. Heiße Luft legte sich auf ihr Gesicht; der Flugzeugrumpf war beschädigt. Es roch nach Kerosin, weshalb sie den starken Impuls verspürte, sich abzuschnallen. Prompt ließ die Schwerkraft sie auf Johan landen, der nicht so schnell in Bewegung kam. Ihm rann Blut übers Gesicht und tropfte von seinem Ohr. Es stammte aus einer unter seiner rotblonden Augenbraue deutlich sichtbaren Platzwunde. Dieses Auge war geschlossen, das andere jedoch offen, und die Pupille bewegte sich, wenn auch wie bei einem Betrunkenen. Seine Arme und Beine rührten sich. Höchstwahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Saskia löste seinen Sicherheitsgurt.
Das Cockpit zu verlassen, war unglaublich schwierig, denn die Schwerkraft ging in die falsche Richtung. Da galt es, wie ein Bergsteiger zu denken und sich Halt für Füße und Hände zu suchen. Eine starke Hand umfasste ihr Handgelenk und zog sie aus einer engen Stelle heraus: Lennert, der sich vergewissern wollte, dass seine Königin noch lebte. Nachdem er sich davon überzeugt hatte, richtete er sein Augenmerk auf die Tür, die sich mehr oder minder über ihnen befand. Obwohl er auch hier die Schwerkraft gegen sich hatte, gelang es ihm, gestützt von seiner Königin auf der einen und seiner Stellvertreterin Amelia auf der anderen Seite, den Griff zum Öffnen der Tür zu erreichen. Saskia hatte Angst, dass sie vielleicht nicht aufgehen würde, aber die Tür, die das Flugzeug von seiner Struktur her in zwei Hälften teilte, musste absurd fest und steif sein. Lennert gelang es, den Hebel zu betätigen und die Tür mit einem kräftigen Fußtritt in Bewegung zu versetzen. Sie klappte auf und offenbarte einen leicht bewölkten blauen Himmel. Er legte beide Hände an den Türrahmen, zog und schob sich hinauf und hinaus, hockte sich auf den Rumpf neben der Türöffnung und blickte sich um. Er hatte die Sonne im Gesicht, das plötzlich feucht war. So schnell konnte der menschliche Körper schwitzen – das war Feuchtigkeit aus der Luft, die auf seiner relativ kühlen Haut kondensierte.
Saskia kämpfte bereits gegen den Impuls, mit einem Satz durch diese Türöffnung zu springen. Dabei musste sie doch die Letzte sein, die das Flugzeug verließ. Johan würde eine Weile zum Aussteigen brauchen, und andere im hinteren Teil hatten möglicherweise noch schlimmere Verletzungen.
Doch Lennert machte seinen nächsten Schritt mit einer für ihn untypischen Zögerlichkeit. Was er da sah, gefiel ihm nicht; er war sich keineswegs sicher, dass es besser war, aus dem havarierten Flugzeug auszusteigen, als drinzubleiben. Seine rechte Hand glitt an seinem Gürtel nach hinten, hielt dann inne. Wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegten, trug er, bedeckt von einem über der Hose getragenen Hemd, in einem Holster im Kreuz eine Pistole. Irgendein Instinkt hatte ihn dazu veranlasst, nach ihr zu greifen. Sie war jedoch nicht da. »Hol meine Tasche«, sagte er zu Amelia. Damit meinte er die kleine Schultertasche, die seine Waffe und anderes Handwerkszeug seiner Branche enthielt. »Ich werde mich mal ein wenig umsehen, mevrouw«, erklärte er. »Es gibt zwar keine Anzeichen für Feuer, aber Sie sollten sich darauf vorbereiten, rasch auszusteigen.« Dann verschwand er aus ihrem Blickfeld, während er nach einer Möglichkeit suchte, sich an der gewölbten Seite des Flugzeugrumpfs hinunterzulassen.
Amelia durchwühlte herumliegendes Gepäck nach Lennerts Tasche. Das war ein zeitraubendes Unterfangen, denn die Tür im hinteren Teil, die zum Frachtraum führte, war irgendwann aufgebrochen, und das Gepäck hatte sich überall verteilt. So lag der Königin zum Beispiel ein blaues Bündel von etwa der Größe eines typischen Flugzeugtrolleys im Weg. Das war einer der Earthsuits. Sie hievte ihn hoch über den Kopf und schob ihn zur Tür hinaus auf den Rumpf. Genauso verfuhr sie anschließend mit irgendjemandes Rolltasche. Irgendjemandes Rucksack. Einem zweiten Earthsuit. Lennerts Schultertasche fand sie jedoch nicht, ebenso wenig wie Amelia.
Es gab noch drei weitere Personen. Willem versuchte, Fenna zu beruhigen, deren Job es war, dafür zu sorgen, dass die Königin sich nie Gedanken über ihre Frisur, ihr Make-up oder ihre Kleidung zu machen brauchte und dennoch gut genug aussah, um sich nicht der Lächerlichkeit preiszugeben. Fenna zeichnete persönlich für die Tatsache verantwortlich, dass die fünfundvierzigjährige Frederika Mathilda Louisa Saskia in der Regenbogenpresse gelegentlich als attraktiver beschrieben wurde, als sie tatsächlich war. Und (angesichts der Tatsache, dass sie Witwe war) als »gute Partie«, was immer das heißen sollte. Fenna beherrschte also ihren Job. Flugzeugabstürze dagegen waren definitiv nicht ihr Ding.
Und schließlich Alastair, der einzige Nicht-Holländer hier. Schotte mit Wohnsitz in London, wo er eine Art mathematikbasierte Risikoanalyse betrieb. Er saß, immer noch angeschnallt, schief in Richtung hinterer Kabinenteil und blickte geistesabwesend aus einem Fenster. Für einen Risikoanalysten befand er sich in einer ausgesprochen interessanten Position.
Alastair drehte den Kopf, um irgendeine Entwicklung draußen zu verfolgen, und sah sich dann nach den anderen um. Die Einzige, die seinen Blick erwiderte, war die Königin, und so räusperte er sich und sagte nüchtern zu ihr: »Draußen …«
»… sind Schweine«, ergänzte sie. »Ich weiß.«
»Ich wollte sagen: ... ist ein Alligator.«
»Oh!«
»Oder vielleicht ein Krokodil? Ich kann nicht …«
Sie wurden dadurch unterbrochen, dass Lennert ein Geräusch irgendwo zwischen Gebrüll und Aufschrei, tendenziell aber eher Letzteres, von sich gab. Falls es überhaupt Wörter enthielt, dann wohl so etwas wie »Geh weg!« oder »Geh zurück!«, ungefähr so wie Menschen zu Tieren sprachen. Doch dann heulte er in einer Mischung aus Erstaunen und wachsendem Entsetzen und Schmerz auf.
Amelia hatte endlich seine Tasche gefunden und die Pistole herausgeholt. Sie wankte den schiefen, mit Gepäckstücken übersäten Gang hinauf. Doch als sie gerade an der Tür ankam, ertönten von draußen Schüsse.
Die Königin hatte als Teil ihrer königlichen Pflichten genug Zeit im Zusammenhang mit Waffen verbracht, um zu wissen, dass das keine Pistole war. Es klang nach der erschreckend eindrucksvollen Feuerkraft eines Gewehrs, und da die Schüsse so schnell hintereinander kamen, handelte es sich vermutlich um eine halbautomatische Waffe. Ein Sturmgewehr.
Amelias Familie war aus Surinam gekommen. Zu ihren Vorfahren zählten Afrikaner, Holländer, Westinder und Ostinder. Sie war Teil der holländischen Olympiamannschaft im Judo gewesen, und ihr Körperbau wurde oft mit dem der amerikanischen Tennisspielerin Serena Williams verglichen. In der Flugzeugkabine schien sie eine Menge Platz einzunehmen. Und dennoch schnellte sie jetzt wie eine zwölfjährige Turnerin nach oben durch die Tür und fand eine Position auf dem Rumpf, von der aus sie sehen konnte, was vor sich ging. Die Pistole lag in ihrer Hand, und sie visierte über Kimme und Korn, während sie die Waffe hierhin und dorthin schwenkte. Nachdem sie jedoch für eine Weile die Situation um sich herum in Augenschein genommen hatte, ließ sie die Pistole sinken und sah genauso verblüfft aus wie zuvor Lennert.
Aus kurzer Entfernung sprach eine Männerstimme Amelia an. »Habt ihr einen Verbandskasten da drin? Er braucht einen.« Dann, nach kurzer Pause: »Moment mal. Warten Sie mal kurz.«
Zwei weitere Gewehrschüsse ertönten.
»Verdammte Alligatoren«, sagte der Mann. »Verdammtes Flugzeug. Entschuldigen Sie meine Sprache. Mit dem alten Schnauz da drüben hab ich noch ein Hühnchen zu rupfen. An Ihrer Stelle würde ich Ausschau nach weiteren Schweinen halten, das Blut wird sie anlocken.«
Während dieser kuriosen Rede hatte Frederika Mathilde Louisa Saskia ein weiteres Earthsuit-Bündel in den freien Raum unterhalb der offenen Tür gezerrt und benutzte es jetzt als Trittstufe, sodass sie wenigstens mit Kopf und Schultern in die Türöffnung ragte.
Dort gab es viel zu sehen. Sie versuchte, sich auf das ihr am nächsten Liegende zu konzentrieren. Direkt unter ihr lehnte Lennert, lebendig und bei Bewusstsein, aber vermutlich unter Schock, am Rumpf des Flugzeuges. Neben ihm lag ein totes Schwein – ein echtes Wildschwein, wahrscheinlich genauso schwer wie Lennert, mit blutigen Hauern, die seitlich aus seinem Kiefer ragten. In schwachen Stößen sickerte Blut aus einem Loch – vermutlich ein Einschussloch – in seinem Brustkorb. Eine Menge Blut hatte auch Lennert verloren, der sich am inneren Oberschenkel eine schwere Wunde zugezogen hatte. Oberhalb davon, praktisch in seiner Leiste, legte ihm der Mann, der zuvor gesprochen und geschossen hatte, gerade eine Aderpresse an. Ausgehend von seinem gedehnten, näselnden Englisch hatte sie erwartet, einen Weißen zu sehen, aber er hatte braune Haut mit dunklen Haaren und dunklen Augen. An den Seiten schimmerte sein Kopf von Stoppeln, aber aus einem breiten Streifen, der über die Mitte seines Schädels verlief, sprossen grau melierte Dreadlocks. Er hatte einen Dreitagebart und machte einen erhitzten und müden Eindruck. Über seiner Schulter hing eine AK-47. Vor Kurzem hatte er noch ein Bowiemesser mitsamt Scheide am Gürtel hängen gehabt; den Gürtel hatte er jedoch gelöst, um damit die Aderpresse anzulegen, die er jetzt mithilfe des Messers mitsamt der Scheide anstelle eines Stocks festzog. Er erwiderte Saskias Blick und nickte. »Das Messer hol ich mir später wieder, Ma’am«, sagte er, während er sich von ihnen abwandte, um die ganze Umgebung zu überblicken.
Ein weiteres – nicht so großes und nicht mit solchen Hauern versehenes – Schwein kam, wie der Mann prophezeit hatte, offenbar vom Blut angezogen, grunzend und schnüffelnd von der anderen Seite des Flugzeuges herüber. Der Mann war noch dabei, seine Kalaschnikow abzunehmen, da ertönte ein Knall, der die Königin auf einem Ohr fast taub machte. Sie blickte gerade rechtzeitig zu Amelia auf, um zu sehen, wie sie einen zweiten Schuss auf das Schwein abfeuerte. Das Tier kippte um und rührte sich bis auf einige ruckartige, vom durcheinandergeratenen Nervensystem verursachte Beinbewegungen nicht mehr. Der Mann drehte sich halb um und bedachte Amelia mit einem Kopfnicken. »Der Doppelschuss war genau die richtige Aktion, Sister«, bemerkte er in einem weltmüden, aber angenehmen Ton und kehrte ihnen wieder den Rücken zu. Als er dann aber links von ihnen etwas bemerkte, wandte er sich noch einmal kurz an sie und merkte an: »Das Triebwerk dahinten brennt.« Die Lässigkeit, mit der er diese Beobachtung äußerte, und seine spezielle Aussprache ließen sie irgendwie weniger beunruhigend erscheinen.
Saskia folgte seinem Blick und sah ein vom Rumpf abgetrenntes Düsentriebwerk, aus dessen einer Seite so etwas wie ein Metall-Origami ragte. Und tatsächlich schlugen Flammen daraus hervor. Was der bemerkenswerteste Anblick hätte sein können, der sich ihr an diesem Tag bot, wenn nicht ganz in dessen Nähe ein toter Alligator gelegen hätte, der doppelt so groß war.
»Feuerwehr? Die kommt nicht«, sagte der Mann. Mitten durch die breite Furche aus aufgewühlter Erde, Luftfahrttechnik und zerstückelten Schweinen, die die Maschine hinter sich zurückgelassen hatte, trottete er langsam davon. »Die haben nämlich das hier gesehen.« Er zeigte auf die Kalaschnikow. »Krankenwagen? Kommt auch nicht. Irgendwelche Cops, vielleicht. Aber die ganz normalen? Eher nicht. Ich muss mein Ding mit dem alten Schnauz zu Ende bringen, ehe die harten Burschen in ihren gepanzerten Mannschaftstransportwagen aufkreuzen und das ganze Zeug. Nehmt euch vor den Plünderern in Acht! Die sind viel schneller hier als das Spezialeinsatzkommando!« Er warf einen Blick zurück, um sich zu vergewissern, dass sie ihm zuhörten, und zeigte dann in Richtung des Waldes jenseits der Straße, aus dem Leute mit langen Messern hervorkamen.
Schnauz war ein niedlicher Name für ein Monster, aber Adele war auch ein mädchenhaftes Mädchen gewesen, mit niedlichen Namen für alles und jedes. Als sie angefangen hatte, ihn so zu nennen, hatte sie natürlich nicht gewusst, dass Schnauz sie eines Tages fressen würde.
In diesen Tagen vor ungefähr fünf Jahren war Schnauz lediglich ein Ferkel in einer Wildschweinrotte gewesen, die in dem Gebiet in Mitteltexas auftauchte, wo Rufus und seine Frau Mariel versuchten, sich auf fünfzig Morgen eine Existenz aufzubauen. Für Klein Adele war Schnauz an dem charakteristischen Fleckenmuster auf dem Rüssel leicht zu erkennen gewesen und später daran, dass er größer war als die anderen.
Der Grund dafür, dass Schnauz größer war, bestand – wie Rufus und Mariel zu spät herausfanden – darin, dass Adele sich angewöhnt hatte, ihn zu füttern. Und dass Schnauz, nicht dumm, sich angewöhnt hatte, herzukommen und sich füttern zu lassen.
Die Schuld daran gab Rufus Wilbur und Charlotte, einem Kinderbuch, das Mariel – wie immer mit den allerbesten Absichten – Adele ans Herz gelegt hatte, bevor sie reif genug dafür war. Allerdings gab es, um ehrlich zu sein, eine Menge ähnliches Material auf YouTube, durch das die gefährliche und falsche Vorstellung genährt wurde, Schweine seien niedliche Tiere, die keine Menschen fraßen und denen man trauen konnte. In Bezug auf die Online-Inhalte, denen arglose Kinder per Algorithmus ausgesetzt waren, kam immer wieder mal moralische Entrüstung auf, aber dabei ging es immer um Sex, Gewalt oder Politik. Alles auf seine Weise wichtig, aber zumeist ein Anliegen von Städtern.
Es hätte alles anders ausgehen können, wäre Rufus imstande gewesen, Adele in diesem prägenden Jahr, in dem sie lesen gelernt und Schnauz sich von einem neugeborenen Ferkel – im Grunde genommen einem ungeschützten Fötus – zu einem monströsen Keiler entwickelt hatte, der doppelt so viel wog wie er, der ehemalige Linebacker, vor jugendlichen Inhalten mit Schweinebezug zu schützen. Manchmal klagte Adele beim Frühstück, sie sei mitten in der Nacht von Gewehrschüssen in der Nachbarschaft geweckt worden. Dann blickten sich Rufus und Mariel über den Tisch hinweg an, und Mariel sagte: »Das müssen Jäger gewesen sein«, was streng genommen keine Lüge war. Es war Rufus gewesen, der um drei Uhr morgens mithilfe eines Infrarotzielfernrohrs draußen Wildschweine erlegte. Und wenn nicht Rufus, dann einer der Nachbarn, der dasselbe aus genau demselben Grund getan hatte.
Diese Schweine waren eine nicht aufzuhaltende Plage; das ging so weit, dass sie sich Texas regelrecht von der menschlichen Rasse zurückeroberten. Es war ohnehin ein dünn besiedeltes Gebiet; aus einem Morgen texanischen Ackerlands konnte man, egal wie hart man schuftete, nur soundso viele Dollars herausholen. Alles, was das Einkommen schmälerte, machte das ganze Vorhaben umso fragwürdiger. Ein zweites Kind hatten Rufus und Mariel aus finanziellen Gründen aufgeschoben, was in gewisser Weise auf ihren fünfzig Morgen bereits eine Reduzierung der menschlichen Bevölkerung um eins bedeutete.
Die Entscheidung, dort ihr Glück zu versuchen, hatten sie getroffen, nachdem Rufus im Fort Sill, oben im Norden jenseits der Grenze zu Oklahoma, aus der Army ausgeschieden war und beschlossen hatte, sein Glück anderswo zu suchen. Aufgewachsen war er in Lawton, einer Stadt, die an Fort Sill und das sie umgebende Mosaik aus hundertsechzig Morgen großen Landzuteilungen angrenzte, die sich weitgehend im Besitz von Comanchen befanden. Obwohl unter seinen Vorfahren Schwarze, Weiße, Mexikaner, Osage, Koreaner und Comanchen gewesen waren, wiesen seine Papiere ihn als offizielles Mitglied des Stammes der Comanchen aus. Indianer im Allgemeinen und Comanchen im Besonderen waren nämlich weit weniger an Chromosomen und dergleichen interessiert als die Masse der US-Amerikaner mit ihren DNA-Tests.
Rufus hatte Mariel kennengelernt, als er für eine Weile in Fort Sam Houston stationiert gewesen war, wo sie als Zivilistin gearbeitet hatte. Wie sich herausstellte, gab es diesen Flecken Land in ihrer Familie, diese Fünfzig-Morgen-Parzelle ein paar Autostunden nördlich von San Antonio, mit der niemand irgendetwas anfing. Das sprichwörtliche »grünere Gras«, nahmen sie jedenfalls an. Ihr Onkel ließ sie unter der Bedingung darauf leben, dass sie das Gelände in Schuss hielten und ihm eine Pacht zahlten, die Steuern etc. deckte. Sie zogen einen Wohnwagen auf das Grundstück und ließen sich dort nieder. Es gab ein altes marodes Haus, das Rufus abriss, um Bauholz zu gewinnen, aus dem er dann Außengebäude zusammenzimmerte: einen Geräteschuppen, einen Hühnerstall, später einen Unterstand für Ziegen.
Bis dahin hatte Rufus’ Leben einen in diesem Teil der Welt ganz normalen Verlauf genommen: aufgewachsen in einer zerrütteten Familie, in der Highschool ein bisschen Football gespielt, aber auf einem Niveau, das ihm weder ein Universitätsstipendium noch ein zermatschtes Gehirn eingebracht hatte. In die Army eingetreten. Mechaniker geworden. In einigen der weniger guten Gegenden der Welt komplizierte Waffen hatte er repariert. Schließlich war er unweit von zu Hause im Fort Sill gelandet und hatte erstaunt festgestellt, dass zwanzig Jahre vergangen waren. Ehrenhaft entlassen. Hatte den vagen Plan, auf der Grundlage der GI Bill einen Hochschulabschluss zu machen, was für Leute wie ihn der normale Weg war, es zu etwas zu bringen. Legte ihn auf Eis, um mit Mariel dieses Ranchprojekt in Texas in Angriff zu nehmen. Ihre Familie kam von weiter südlich, die klassische texanische Mischung aus deutsch und mexikanisch. Hin und wieder kamen diverse Onkel, Cousins oder Ähnliches von ihr zu Besuch, um ihnen beim Durchstarten zu helfen und sich, wie Rufus vermutete, ein Bild von seiner Tauglichkeit als Mann zu machen. Was er ihnen überhaupt nicht übel nahm. Es hätte ja sein können, dass er seine Frau schlug. Sie mussten sich davon überzeugen, dass das nicht der Fall war. Für ihre Gewissenhaftigkeit in diesem Punkt respektierte er sie.
An den äußersten Rändern von Kultur und Politik kam es zu einer merkwürdigen Berührung zweier Extreme, dort nämlich, wo die Zurück-aufs-Land-Hippies und die radikalen Prepper sich am Ende in nichts unterschieden, denn sie verbrachten neunundneunzig Prozent ihres Lebens mit denselben Dingen. Man brauchte eine Geschichte, die einem selbst gegenüber als Begründung dafür herhalten konnte, warum es mehr Sinn ergab, auf diese Weise zu leben, als in die Vororte von Dallas zu ziehen und einen Job bei Walmart anzunehmen. Hippies und Prepper hatten unterschiedliche Geschichten, die aber in der Praxis nicht oft zur Sprache kamen. Mariel tendierte eher zum Hippie, während Rufus sich nie für eine Seite entschied.
Bei dem Versuch, die Ranch zu einem finanziell vernünftigen Unterfangen zu machen, erlebte er immer und immer wieder Situationen, in denen ein unmenschliches Maß an schierer körperlicher Arbeit mit etwas Glück eine winzige Steigerung der Produktivität des Landes bewirken konnte. Und doch fragte er sich im Laufe der Jahre unwillkürlich, ob es das alles wert war. Selbst wenn man die ganze Option mit der GI Bill einmal beiseiteließ, konnte er sich überall sonst einen Job als Automechaniker besorgen. Die Lebenshaltungskosten würden zwar steigen, aber er könnte zumindest ausschlafen und müsste nicht seinen Wecker auf 2:30 Uhr stellen, um aufzustehen und Wildschweine zu schießen.
Er ließ sie liegen, wo sie hinfielen, und andere Wildschweine fraßen sie auf. Das war nur einer der vielen Aspekte, die das Ganze allmählich sinnlos erscheinen ließen. Wildschweine fraßen alles, auch andere Wildschweine. Weidetiere fraßen Gras, ließen aber die Wurzeln im Boden; Wildschweine durchwühlten die Erde und fraßen die Wurzeln. Das führte zu Erosion. Nur Ameisen vermochten in dem, was die Wildschweine hinterließen, zu leben. Rufus konnte die Viecher nicht schnell genug töten, und die von ihm getöteten wurden zu Futter für diejenigen, die er nicht getötet hatte. Als sie Adele verboten, Schnauz oder irgendein anderes Wildschwein zu füttern, hatte Schnauz bereits den Startvorteil, den er brauchte; inzwischen assoziierte er Menschen mit Futter, und Rufus beschlich der Verdacht, dass der Keiler von den nächtlichen Gewehrschüssen angelockt wurde, nachdem er herausgefunden hatte, dass anschließend in der Regel ein zum Verzehr freigegebener toter Cousin auf dem Boden lag. Rufus’ nächtliche Jagd führte also nur dazu, dass Schnauz immer größer wurde.
Vieles davon war späte Einsicht, nachdem das, was passiert war, passiert war. Rufus, der sich quälte. Er hätte Schnauz als besondere Bedrohung einstufen müssen. Hätte ein Wildschwein als Köder erschießen und sich dann auf die Lauer legen und auf Schnauz warten müssen. Noch Jahre später verfolgte ihn fast jede Nacht der Gedanke, dass er damals, als er noch eine Tochter gehabt hatte, womöglich Schnauz als weiße Silhouette unter vielen vor seinem Nachtvisier gehabt und es nicht geschafft hatte abzudrücken, nur weil Adele eine Schwäche für das Tier hatte und er fürchtete, ihr beim Frühstück nicht in die Augen blicken zu können.
In letzter Zeit hatte er sich den Trick angeeignet, die Zunge herauszustrecken, wenn die schlimmen, selbstquälerischen Gedanken ihm langsam in den Kopf krochen. Er machte den Mund weit auf und streckte sie, so weit es ging, heraus, fast so, als würgte er den schlechten Gedanken aus oder weigerte sich, ihn hereinzulassen, und irgendwie funktionierte das und brachte seinen Verstand wieder ins rechte Gleis. Zwar schauten ihn die Leute seltsam an, wenn er das tat, aber die Zeit, die er mit anderen Leuten verbrachte, war ohnehin begrenzt.
Sein einziger, allerdings magerer Trost war, dass es sich bei dem Vorfall – der sich ereignete, während er in der Stadt eine Ladung Abflussrohre abholte – um eine plötzliche Invasion von mindestens zwei Dutzend Wildschweinen auf ihr Grundstück gehandelt hatte. Schnauz war zwar der Anführer, hatte aber so viele Komplizen, dass Rufus, selbst wenn er mit geladenem Gewehr vor Ort gewesen wäre, es womöglich nicht geschafft hätte, Adele zu retten.
Er und Mariel trennten sich, und sie ging wieder in Richtung Süden zu ihrer Familie. Rufus machte das Töten von Wildschweinen zu seiner Lebensaufgabe, ja buchstäblich zu seinem Geschäft.
Geschäft, das war etwas, was er zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben – damals war er vierundvierzig – endlich in den Griff bekam. Bei der Army hatte er nie über Gewinn und Verlust nachzudenken brauchen. Auf der Farm hatte er diese Aufgabe übernommen, weil Mariel damit hoffnungslos überfordert war. Im Laufe dieser Jahre hatte er, während er spätnachts in seine Buchhaltungssoftware starrte, zugesehen, wie die Zahlen immer schlechter wurden und immer mehr von seiner Militärpension für die Deckung der Defizite draufging. Er musste sich eingestehen, dass die Farm zu einer Art Hobby geworden war. Aber das alles spielte nicht die entscheidende Rolle, denn die finanziellen Warnsignale wurden vom emotionalen Aspekt des Ganzen übertönt: der Geschichte, die er und Mariel sich selbst und zunehmend auch Adele erzählten, um zu begründen, warum sie überhaupt hier lebten.
Als Adele dann tot und Mariel gegangen war, war die Geschichte zu Ende. Die Dinge wurden sehr klar, und Entscheidungen waren leicht zu treffen. Rufus verkaufte, was er konnte, und schickte Mariel die Hälfte des Geldes. Er fuhr rauf nach Fort Sill, wo er als Pensionär immer noch Zugang zur Autowerkstatt hatte, und brachte seinen Truck auf Vordermann, einen Dually, wie die Leute hier Pick-ups mit doppelten Reifen an jedem Ende der Hinterachse nannten. Seine Großmutter und einige seiner Cousins waren ins Wohnwagengeschäft eingestiegen. Von ihnen bekam er einen gebrauchten Wohnwagen, den er an seinen Dually anhängen konnte. Da hinein räumte er sein ganzes Werkzeug, alle seine Waffen und sein sonstiges Hab und Gut. Er entwarf Schilder und Visitenkarten mit dem Schriftzug WILDSCHWEIN-ABSCHUSS-SERVICE und begann, einfach umherzufahren und dieses Gespann mit den Schildern drauf bei Viehauktionen, Jahrmärkten und Ähnlichem zu parken.
Ohne die Pension von der Army hätte er die ersten sechs Monate vielleicht nicht durchgestanden, aber allmählich ging es mit dem Geschäft bergauf, und Rufus fuhr mit seinem Gespann kreuz und quer durch das scheinbar unendliche Netz aus kleinen Straßen, die wie Blutkapillaren jeden Teil des Staates Texas durchzogen – eines Staates, in dem Rufus als Einwohner Oklahomas sich immer noch wie ein Fremder in einem fremden Land fühlte. Für eine Weile arbeitete er auf dieser oder jener Ranch, wo die Besitzer fanden, dass sie in dieser einen Hinsicht noch etwas zusätzliche Feuerkraft gebrauchen konnten. Er war nicht der Einzige, der das machte. Bei Weitem nicht. Aber preislich konnte er mit größeren Firmen mithalten. Die Konkurrenz hatte hungrige Mäuler zu stopfen und Gerätschaften zu unterhalten. Manche nutzten Hubschrauber. Andere erschossen Wildschweine von Geländewagen aus. Auffällig, aber teuer. Rufus arbeitete für sich allein. Er musste weder Löhne noch Beiträge zur Zahnbehandlungs- und Krankenversicherung zahlen. Seine Methode bestand darin, allein mit Gewehr, Dreibein und Infrarotzielfernrohr hinauszugehen und einfach darauf zu warten, dass die weißen Silhouetten vor dem dunklen Hintergrund auftauchten, um sie dann eine nach der anderen abzuschießen, angefangen bei den größten bis hin zu den Jungtieren, die in Panik umherwuselten.
Die ersten sechs Monate mit wenig bis gar keiner Arbeit hatten ihn ziemlich fertiggemacht, aber später wurde ihm bewusst, dass er die Zeit sehr gut genutzt hatte. Er saß an dem kleinen Tisch in seinem Wohnwagen, ließ über den Generator die Klimaanlage laufen, las Webseiten und später Bücher über Wildschweine. Das war faszinierend. So erfuhr er zunächst einmal, dass Schweine ebenso wie hellhäutige Menschen Neozoen aus Europa waren. Im sechzehnten Jahrhundert, dem Zeitalter der Eroberungen, hatten die Spanier sie über den Rio Grande mitgebracht. Vermutlich waren sie schon ausgebüxt, ehe das Wasser des Flusses auf ihrem borstigen Fell verdunstet war. Im Laufe des darauffolgenden halben Jahrtausends hatten viele solche »Einschleppungen« (so hieß das in der Fachliteratur) stattgefunden. Keine konnte jedoch, für sich genommen, einen Schnauz erklären. Dafür musste man die Wildschweineinschleppungen neueren Datums mitberücksichtigen. Manche Leute fanden Spaß daran, diese Tiere zu jagen. Besonders die Deutschen schienen wie besessen davon zu sein. In Texas lebten viele von ihnen, und sie verfügten sowohl über Geld als auch über große Flächen Grundbesitz, die sie mit Wildtieren bestücken konnten. In Deutschland gab es anscheinend eine Gegend namens Schwarzwald, und die Geschichten, die darüber kursierten, waren nicht weniger verrückt als die aus den Kreisen der Hippies und Prepper. Diese Deutsch-Texaner waren der festen Überzeugung, dass ihre Vorfahren lange vor und auch noch lange nach den Römern edel und frei dieses Waldgebiet durchstreift und mit Lanzen Wildschweine erlegt hatten und dass sie selbst beim Jagen an ihrem alten Erbe teilhatten, so wie die Indianer beim Trommeln und Tanzen. Also fingen sie die größten und gefährlichsten Wildschweine, die in Europa aufzutreiben waren, wozu sie auf der Suche nach unverdorbenen Beständen sogar Jagdgesellschaften ins russische Hinterland schickten, und brachten diese Tiere nach Texas. Normalerweise wurde das Land mit einem gewissen Aufwand eingezäunt, aber Wildschweine konnten sich unter Zäunen hindurchwühlen, Flüsse durchqueren und Wattgebiete durchwaten, und so waren die Wildschweine in freier Wildbahn fast genauso leicht freigekommen wie ihre domestizierten Cousins Hunderte von Jahren zuvor und hatten sich eifrig darangemacht, sich mit diesen zu paaren.
Rufus hatte nicht die beste Schulbildung, aber lesen konnte er, und in der Army war er vor allem deswegen ein sehr guter Mechaniker gewesen, weil er in einem viel höheren Maß als seine Kameraden die Fähigkeit besessen hatte, sich in abstruse Wartungsanleitungen zu vertiefen. Er verstand es, sich auf die wichtige Tatsache oder Zahl zu fokussieren, die aus einem Absatz herausstach wie ein Baumstumpf aus dem trüben Wasser eines Bayous. Das kam ihm zugute, als er sich mit eher akademischer Schweineliteratur beschäftigte. So verfolgten etwa Züchter von Hausschweinen das Ziel, diese so groß wie möglich zu machen. Die Angabe »über 700 kg« sprang ihm in die Augen. Das konnte nicht stimmen. Er rechnete: Das waren über tausendfünfhundert Pfund! Wildschweine waren wesentlich kleiner; das größte je registrierte war »nur« halb so schwer. Doch was würde passieren, wenn sich ein sorgfältig nach Wildheit und Schläue ausgesuchtes Wildschwein in freier Wildbahn mit einem Monster-Hausschwein paarte?
In der Literatur tauchten immer wieder dieselben Namen auf. Einer davon war Dr. I. Lane Rutledge von der Texas A&M University. Kurzes Googeln ergab, dass es sich dabei um eine Frau mit dem Vornamen Iona handelte. Sie hatte viel erreicht, indem sie mithilfe der genetischen Sequenzierung die Situation entwirrte, die sich über die letzten fünfhundert Jahre aus dem Paarungsverhalten all dieser verschiedenen Schweinearten in Texas entwickelt hatte. Wie sich herausstellte, war sie über das Internet erstaunlich leicht zu kontaktieren. Sie beantwortete seine E-Mails. Knapp zwar, aber immerhin.
Rufus hatte die Erfahrung gemacht, dass Menschen ganz allgemein zugänglicher waren, wenn man ihnen etwas anzubieten hatte, und so begann er, ihr Daten zu schicken: Proben, an denen sie DNA-Sequenzierungen vornehmen konnte, und dazu geokodierte Fotos der toten Tiere, von denen diese Körperflüssigkeiten stammten. Damit gewann Rufus ihre Aufmerksamkeit und fühlte sich eher berechtigt, sie um ein persönliches Treffen zu bitten.
Seinen Wohnwagen ließ er auf dem Gelände eines Kunden rund dreißig Kilometer von College Station entfernt stehen, fuhr in die Stadt und fand den Weg zum Campus. Die von Google Maps vorgeschlagene Route war jedoch völlig falsch, denn wegen eines großen Demonstrationszugs waren viele Straßen abgeriegelt worden. Rufus musste es aus mehreren Richtungen versuchen, dann so nah wie möglich parken und zu Fuß weitergehen. Anfangs warfen die Demonstrierenden ihm böse Blicke zu, weil er einen riesigen spritfressenden Dually fuhr; als sie aber durch die Scheibe sahen, dass er eine Person of Color war, wussten sie nicht mehr, worauf sie ihre moralische Empörung richten sollten.
Selbst mitten im November war es verdammt heiß in College Station. Rufus brach sofort der Schweiß aus, und er hoffte, dass Dr. Rutledge sich in dieser Hinsicht nicht als überempfindlich erwies. Er fragte sich, ob er mit zunehmendem Alter langsam an Wärmetoleranz einbüßte. Tagsüber wagte er sich nur noch selten vor die Tür. Eine der sehr wenigen genetischen Schwächen von Schweinen bestand darin, dass sie nicht schwitzen konnten, weshalb sie sich tagsüber suhlten und nachts der schweren Arbeit des Aufstöberns von Futter nachgingen. Dementsprechend war Rufus ein Nachtmensch geworden.
Während er sich auf dem Weg zu Dr. Rutledges Büro gegen die Laufrichtung durch die Menge kämpfte, hatte er einen guten Blick auf die Transparente, die die Demonstrierenden hochhielten. Viele davon thematisierten die Vorstellung vom Menschen als invasive Art, ein Thema, das für Rufus ausgesprochen relevant war.
Es wäre einfach und in gewisser Weise befriedigend gewesen, das, was Rufus jetzt mit den Schweinen zu machen versuchte, auf eine Ebene mit dem zu stellen, was die Comanchen zweihundert Jahre zuvor mit den Weißen versucht hatten. Aber man musste vorsichtig sein. Die Comanchen waren selbst Eindringlinge aus dem Norden gewesen und hatten die Indianer, die vor ihnen in Texas gelebt hatten, »vertrieben« – ein Euphemismus, wie er im Buche steht. Und dazu waren sie imstande gewesen, weil sie frühzeitige und begeisterte Nutzer der als Pferd bekannten invasiven Art waren.
Auf anderen Transparenten ging es, kaum zu übersehen, um das Thema Aussterben: ein Schicksal, dem alle Menschen entgegensahen, wenn sie den Klimawandel nicht in den Griff bekamen. So war Rufus, als er schließlich die Eingangstür des Gebäudes erreichte, in dem Dr. Rutledge arbeitete, vollkommen verwirrt. Hassten diese jungen Leute die Menschen, weil sie eine invasive Art waren, die es auszurotten galt? Oder liebten sie die Menschen und wollten nicht, dass sie ausgelöscht wurden? Unergründbare Fragen, über die sich vielleicht jüngere Studierende im zweiten Jahr bei Pizza und Bier nächtelang die Köpfe heiß redeten, während Rufus mit Dreibein und Gewehr allein draußen war und einen Dämon jagte.
Ihm fiel auf, dass einige der Demonstranten merkwürdige Vorrichtungen mitschleppten oder vielmehr am Leib trugen, die sich im Nachhinein als die frühen Prototypen von Earthsuits entpuppten: Kleidungsstücke, die für einen so heißen Tag viel zu schwer aussahen, denn untendrunter bestanden sie aus einem System von Kühlrohren auf der Haut. Diese waren mit Rucksackeinheiten verbunden, deren Lithiumakkusätze ein Kühlsystem betrieben. Da die Hitze am Ende aus dem System entweichen musste, besaßen die Rucksackeinheiten einen Schornstein, der direkt über dem Kopf des Trägers/der Trägerin aufragte und heiße Luft ausstieß, was man an dem Hitzeflimmern darüber erkennen konnte. Die sie trugen, waren überwiegend korpulente Nerds.
»Vor ungefähr zehntausend Jahren bemerkten Leute, die immer kurz vor dem Verhungern waren, dass Schweine Sachen fressen konnten, die für sie selbst nicht essbar waren«, sagte Dr. Rutledge.
»Sie sind Allesfresser«, sagte Rufus, nahm sich aber aus Sorge, zu vorlaut gewesen zu sein, gleich wieder etwas zurück.
Sie war jedoch ein cooler Typ. »Stimmt, und ich will darauf hinaus, dass Menschen sie essen können. Und wir sind nur ein kleines bisschen schlauer als sie.«
»Aber nicht viel«, sagte Rufus verächtlich und blickte unwillkürlich zu ihrem Bürofenster hinüber, durch das gedämpft Protestgesänge zu hören waren. Wenngleich er zugeben musste, dass diese persönlichen Kühlsysteme ganz schön raffiniert waren.
»Sie sind sehr intelligent«, stimmte sie zu und warf ebenfalls einen Blick in Richtung Fenster, was ihrer Bemerkung eine gewisse Mehrdeutigkeit verlieh. »Jedenfalls wurden sie – die Schweine – auf diese Weise domestiziert. Natürlich haben wir genetisches Material von vielen domestizierten Rassen. Daten über das eurasische Wildschwein zu erhalten, ist schwieriger, aber auch davon haben wir jede Menge. Das ist das Ausgangsmaterial. Spaßig wird’s, wenn wir all die Kombinationen sehen, die unter den mehreren Millionen Wildschweinen entstehen, die in Texas herumlaufen.«
Ihr Gebrauch des Wortes »spaßig« ließ ihn zögern, und die nächsten paar Minuten verwandte er darauf, sich innerlich einen Überblick zu verschaffen. Noch nie hatte er einen Fuß auf einen Universitätscampus gesetzt. Manches entsprach seinen Erwartungen. Viele junge und überraschend attraktive Leute mit Protestplakaten: Check. Ihr Büro war jedoch im Gegensatz zu dem von Professoren in Filmen weder holzgetäfelt, noch bedeckten vollgefüllte Bücherregale die Wände. Diese bestanden vielmehr aus Stahlbeton, und es war klein, mit Kabeln und Computern überall.
Das passte ganz gut zu Dr. Rutledge, die eine Art Stahlbetonmädchen ohne die fragwürdigen Verzierungen war, die Rufus normalerweise an Weibchen der Spezies Homo sapiens wahrnahm. Fotografien ließen auf die Existenz eines Ehemanns und mindestens zweier Kinder schließen. Mittellanges Haar, das ihr durch eine hochgeschobene Laborbrille aus dem Gesicht gehalten wurde. Tonfall des Mittleren Westens – sie war entweder aus dem Norden hierher verpflanzt worden oder gehörte zu jenen Texanern, die irgendwie erwachsen wurden, ohne einen texanischen Akzent anzunehmen. Ihm gegenüber leicht bissig und kurz angebunden, bis er ihr seine Anerkennung zeigte. Erinnerte ihn insofern an manche Offizierinnen bei der Army.
»Apropos spaßig«, sagte er schließlich, »die Einschleppungen des eurasischen Wildschweins erfolgten …«
»… nur zum Vergnügen.« Sie nickte. Er hatte das Gefühl, mit der Verwendung des Begriffs »Einschleppung« bei ihr gepunktet zu haben.
»Es macht mehr Spaß, sie zu jagen, wenn sie schwerer zu töten sind«, sagte Rufus.
»Ich bin keine Jägerin, aber das scheint mir eine logische Vermutung zu sein.«
»Schlau, schnell, gefährlich.«
Sie zog die Augenbrauen hoch und drehte die Handflächen nach oben.
»So ein Tier, gekreuzt – hybridisiert – mit einer Hausschweinvariante, die nur auf Größe gezüchtet wurde, könnte …«
Er verstummte. Sie brach den Blickkontakt ab und ließ langsam die Luft entweichen, die sie eingeatmet hatte, während er sich langsam an sein eigentliches Anliegen herangepirscht hatte.
»Sie sprechen von dem Tier, dass Ihre Tochter getötet hat«, sagte sie mit leiser und trauriger, aber fester Stimme.
Na klar. Sie hatte ihn gegoogelt, so wie er sie. Es hatte ja in allen Zeitungen gestanden.
Sie wartete, bis er nickte, ehe sie fortfuhr.
»Ein Hybrid von ungewöhnlicher Größe ist vorstellbar. Eigentlich sogar plausibel. Aber Achtung, je größer diese Tiere werden, desto mehr Futter brauchen sie, um zu überleben.«
Rufus war verblüfft darüber, dass sie das Wort »Achtung« benutzte, das er sonst vor allem auf Etiketten an Munitionskisten las. Sie schien ihn davor zu warnen, in irgendein intellektuelles oder ideelles Risiko zu geraten. Was bei einer Professorin ja durchaus einleuchtete.
»Wiegt also Ihr Hogzilla, Ihr Moby Pig zweihundert Kilo? Das nehme ich Ihnen ja noch ab«, fuhr sie fort. »Dreihundert? Da werde ich langsam skeptisch. Jenseits davon, glaube ich, bewegen Sie sich im Reich der Fantasie. Werden ein zweiter Käpt’n Ahab. Die ungeheure Größe, die Sie diesem Tier zuschreiben, spiegelt wider, welch ungeheure Rolle es in Ihrer Psyche spielt. Das ist einfach keine wissenschaftliche Tatsache. Müssen Sie sich erbrechen?«
»Wie bitte, Ma’am?«
»Sie haben die Zunge rausgestreckt. Als würden Sie würgen.«
»Das mache ich immer. Wegen meiner Psyche. Mir geht es gut.«
»Ich möchte Ihnen helfen«, sagte sie. »Ich meine, wenn Sie es sich zur Lebensaufgabe machen wollen, Jagd auf ein bestimmtes Schwein unter mehreren Millionen zu machen und es zu töten, sei’s drum. Es ist ein Menschenfresser. Es zu vernichten wäre ein Dienst an der Allgemeinheit. Meine Rolle, falls ich eine habe, besteht hingegen darin, Sie auf dem Boden der wissenschaftlichen Realität zu halten. Fakt Nummer eins ist nämlich, dass es vermutlich nicht mehr als zweihundert Kilo wiegt. Bestimmt keine dreihundert. Wenn Sie also Ihre Suche auf ungeheuer große Exemplare beschränken, über die Sie irgendeinen Witzbold in einem T. R. Mick’s haben reden hören, jagen Sie Märchenerzählungen nach und werden ihn nie finden.«
Das war ein kleiner Stich, denn es stimmte. Aber Rufus war Stiche gewohnt. Er ignorierte ihn und nickte. Das klang plausibel. Erklärte das eine oder andere.
»Fakt Nummer zwei ist, dass dieses Tier nach Ihrer eigenen Berechnung schon drei Jahre alt ist. In weiteren drei Jahren wird es an Altersschwäche gestorben sein.« Sie sah ihn stirnrunzelnd an. »Sie glauben mir nicht?«
»Was? Natürlich glaube ich Ihnen, Ma’am.« Diese Frage hörte Rufus ständig in unterschiedlichen Variationen. Dabei traf es nur selten zu. Das hatte ihn zu der Erkenntnis gebracht, dass sein Gesicht in seinem natürlichen Ruhezustand einen Eindruck skeptischer Ungläubigkeit vermittelte. Er vermutete, dass es mit seiner Stirn zu tun haben musste, auf der sich deutliche waagerechte Falten ausgebildet hatten. »So sehe ich nun mal aus, wenn ich nachdenke.«
Wieder drehte sie die Handflächen nach oben. »Also, diese Altersgrenze ist etwas Gutes. Sie hält Sie davon ab, ein zweiter Ahab zu werden.«
»Den haben Sie schon mal erwähnt, aber …«
»Walfänger-Kapitän, der davon besessen war, einen bestimmten Pottwal zu fangen und zu töten. Das Problem dabei war, dass Pottwale lange leben. Länger als Menschen. Deshalb gab es nie einen Punkt in Ahabs Leben, wo er sagen konnte« – und hier wischte sie sich abwechselnd mit der einen Handfläche über die andere – »so, das war’s, die Zeit ist um, Moby Dick muss jetzt seinen Geist aufgegeben haben, ich kann mich wieder …«
»… meinem normalen Ahab-Leben widmen?«
Sie zuckte die Schultern.
»Mariel – die Mutter des Mädchens – hat gesagt: ›Diese Sache mit Schnauz zerstört dein Leben.‹ Wissen Sie, was ich darauf gesagt habe?«
»Keine Ahnung.«
»Das ist mein Leben.« Er streckte die Zunge heraus.
»Nun, das geht mich nichts an«, sagte sie, während sie mit kühler wissenschaftlicher Distanziertheit seine Mandeln betrachtete, »aber haben Sie einen Plan dafür, woraus Ihr Leben in drei Jahren bestehen könnte, wenn Schnauz definitiv nicht mehr da sein wird?«
»Das wird keine drei Jahre dauern.«
Das also war die Unterhaltung, die sein Geschäftsunternehmen in seiner, wie er es nennen würde, ausgereiften Form letztlich auf den Weg brachte. Er beschaffte sich ein Exemplar von Moby Dick und hatte es immer bei sich, um anhand der Lektüre hin und wieder zu überprüfen, ob er wirklich den Verstand verloren hatte. Er besorgte sich auch ein Hörbuch davon, das er sich über Kopfhörer anhören konnte, während er im Dunkeln saß. Ahab tauchte erst ziemlich weit hinten im Buch auf. Und als besessener Fanatiker outete er sich noch etwas später. Da war natürlich völlig klar, warum Dr. Rutledge die Parallele zwischen Rufus und Ahab gezogen hatte. Für ihn selbst griff sie jedoch eigentlich nicht, denn an dieser Stelle im Roman war bereits sein Interesse an den Harpunieren geweckt worden: an dem tätowierten Kannibalen Queequeg, dem »reinen Indianer« Tashtego und Daggoo, dem »riesigen kohlschwarzen Wilden aus Afrika«. Das Interessanteste an diesen Figuren war, dass sie alle mehr Geld verdienten – einen größeren Teil der Gewinne des Schiffs – und einen höheren Rang und Status einnahmen als irgendjemand sonst auf der Pequod, abgesehen von Ahab und den drei Maaten. Laut Rufus’ Berechnungen, die er in seinem Wohnwagen mittels Tabellenkalkulation vornahm, verdiente Queequeg 3,333 Mal so viel wie Ismael, der Erzähler des Romans.
Die unmittelbare Wirkung von Rufus’ Moby Dick-Lektüre war also der Nachdruck, mit dem er in seinem Unternehmen wieder einmal klar Schiff machte, wie Walfänger-Kapitäne wie Ahab, Peleg und Bildad es wohl formuliert hätten. Bei all den komplizierten Tätigkeiten, die in dem Buch beschrieben wurden, war die Grundlage doch denkbar einfach: Sie ruderten in einem Boot hinaus, damit ein Mann einen Speer nach dem Wal werfen konnte. Burschen, die gut im Speerwerfen waren, machten Kasse. Ruderer dagegen waren nichts Besonderes und mussten ihr dürftiges Einkommen dadurch aufbessern, dass sie nach Hause gingen und dicke Romane schrieben.
Es ist ein Riesenunterschied, ob man zahlt oder bezahlt wird. Das hörte Rufus! Er verkleinerte sein Unternehmen, entledigte sich überflüssiger Ausrüstungsgegenstände. Seine Hauptwaffe war ein Präzisionsgewehr auf einem wuchtigen Dreibein mit einem ziemlich kostspieligen Infrarotzielfernrohr. Vor dem dunklen Hintergrund von Texas (wenn es nachts erst einmal abgekühlt hatte) leuchteten die Schweine optisch moby-dick-weiß. Rufus konnte sie beobachten und sich davon überzeugen, dass es Schweine waren – kein Vieh oder, Gott bewahre, Menschen –, ehe er sie in aller Ruhe ins Jenseits beförderte. Wenn die großkalibrigen Geschosse ihr Ziel trafen, konnte man die Innereien wie Funken beim Schweißen aus den Tieren herausspritzen sehen. Wenn Big Daddy oder Big Momma niedergingen und die steifen Beine zuckend in die Luft streckten, stob die Rotte immer in heller Panik auseinander, aber normalerweise konnte er noch ein paar weitere abschießen, ehe sie aus der Schussweite waren. Die Kunden, die am nächsten Tag das Blutbad vor Augen hatten, sahen nicht, wie viele entkommen waren. Die große Waffe machte also neunzig Prozent seines Geschäfts aus. Allerdings hatte er, wenn er im offenen Gelände unterwegs war und eher unvorbereitet und auf kurze Distanz einem Schwein gegenüberstehen konnte, auch immer ein Sturmgewehr zur Hand. Das bot ihm mehr Möglichkeiten für den Fall, dass er eingekreist war. Ehrlich gesagt hätte ein Gewehr vom Typ AR-15 denselben Zweck erfüllt, und er wäre leichter an Ersatzteile gekommen, aber die Kalaschnikow war einfach eine gute Waffe für den Einstieg. Einem Wildschwein ein 7,62-Millimeter-Geschoss zu verpassen, erschien einfach sinnvoller als eins vom Kaliber 5,56 Millimeter. Die rohe Einfachheit des AK und dass es sich auch dann noch abfeuern ließ, wenn es ihm in eine Suhle gefallen war, begeisterten ihn als Mechaniker. Es war das Wildschwein unter den Gewehren. ARs dagegen erinnerten ihn allzu sehr an die Army. Im zivilen Bereich assoziierte er sie inzwischen mit Jugendlichen am Schießstand, die überteuerte Rundumsonnenbrillen trugen. Typen in Armeehosen, die das offensichtlich nur wegen irgendeiner Geschichte taten, die sie sich selbst erzählten.
Jenseits der reinen Bewaffnung ging es ziemlich hochtechnisiert zu. Rufus teilte Google-Earth-Dateien mit Dr. Rutledge und ihren Doktoranden, schickte ihnen Schweißproben, checkte ständig seine Mails nach irgendetwas Nützlichem, was sie vielleicht herausgefunden hatten. Während der Untersuchung von Adeles Tod hatte der Sheriff gesammelt, was man höflich objektive Beweise nannte, und eine DNA-Analyse durchgeführt, um festzustellen, dass passiert war, was passiert war. Vermischt mit Adeles DNA fand sich dort Schweine-DNA des Täters, und diese Information konnte Rufus Dr. Rutledge übermitteln. Die Chancen einer eindeutigen genetischen Übereinstimmung waren minimal, aber sie konnte ihm immerhin ein paar »Jetzt wird es wärmer/kälter«-Hinweise geben, die seine Wanderungen kreuz und quer durch Texas bestimmten.
Den Umgang mit Drohnen beherrschte er immer besser. Es war eine gute Zeit für einen pensionierten, aber nach wie vor gesunden Mechaniker, der nicht durch eine Familie abgelenkt wurde. Dank der Verfügbarkeit von Geräten, YouTube-Videos und Amazon-Packstationen konnte er alles, was er können wollte, lernen und sich das dazu nötige Material beschaffen. Mittels Drohnen, die er über ein VR-Headset aus dem klimatisierten Komfort seines Wohnwagens heraus steuerte, folgte er den Wildschweinen zu ihren Suhlen und stellte Mutmaßungen an, wo sie in der folgenden Nacht nach Nahrung wühlen würden, nutzte dann Google Earth, um herauszufinden, wo er sein Dreibein am vorteilhaftesten aufstellte und wie er dorthin gelangte, ohne die Tiere aufzuscheuchen.
Getragen hätte sich das Unternehmen überall in Texas – eigentlich überall südlich der Mason-Dixon-Linie und östlich des Pecos. So besaß Rufus die Freiheit, seine Tätigkeit auf Gebiete zu konzentrieren, wo die Schweine, die er tötete, gemäß den Daten aus Dr. Rutledges Labor die größte genetische Ähnlichkeit mit Schnauz aufwiesen. Im Großen und Ganzen entsprachen diese offenbar dem Wassereinzugsgebiet des Brazos südlich von Waco und nördlich von da, wo er in die Vororte von Houston mäanderte. Rufus’ Vermutung nach trieb die Hitze Wildschweine im Allgemeinen und Schnauz im Besonderen auf die Flüsse zu, wo sie immer eine Möglichkeit zum Abkühlen fanden.