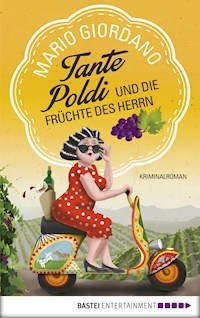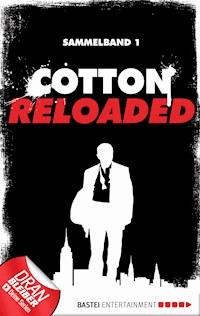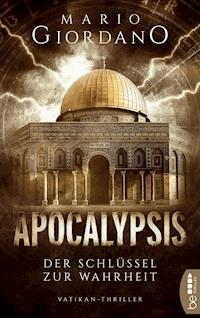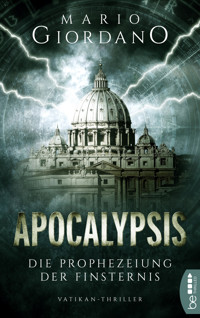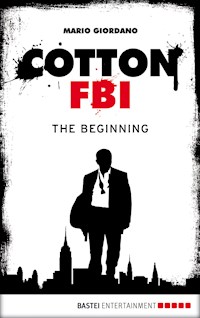9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Carbonaro-Saga
- Sprache: Deutsch
Das große deutsch-italienische Familienepos von Bestsellerautor Mario Giordano - sinnlich, farbenfroh, imposant.
Ende des 19. Jahrhunderts wächst Barnaba Carbonaro in einem archaischen Sizilien auf, den Kopf voller Träume von Reichtum und einer Familiendynastie. Und tatsächlich steigt er mit Gewitztheit und Mut vom bettelarmen Analphabeten zum Dandy auf und schließlich zum geachteten Zitrushändler auf dem Münchner Großmarkt. Ein Leben wie eine Odyssee, voller Triumphe und bodenloser Niederlagen, getrieben von einer unstillbaren Sehnsucht. Barnaba zeugt vierundzwanzig Kinder, verdient ein Vermögen und verliert alles. Am Ende seiner langen Reise blickt der Patriarch auf den hungrigen Jungen zurück, der auszog, den Göttern das große Glück abzutrotzen. Und er versteht, dass ihm zwischen Abschieden und Neuanfängen, zwischen süßen Mandarinen und bayerischem Schnee etwas viel Größeres gelungen ist.
Ein großes deutsch-italienisches Familienepos: sinnlich, farbenfroh, imposant.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Ende des neunzehnten Jahrhunderts wächst Barnaba Carbonaro in einem archaischen Sizilien auf, den Kopf voller Träume von Reichtum und einer Familiendynastie. Und tatsächlich steigt er mit Gewitztheit und Mut vom bettelarmen Analphabeten zum Dandy auf und schließlich zum geachteten Zitrushändler auf dem Münchner Großmarkt. Ein Leben wie eine Odyssee, voller Triumphe und bodenloser Niederlagen, getrieben von einer unstillbaren Sehnsucht. Barnaba zeugt vierundzwanzig Kinder, verdient ein Vermögen und verliert alles. Am Ende seiner langen Reise blickt der Patriarch auf den hungrigen Jungen zurück, der auszog, den Göttern das große Glück abzutrotzen. Und er versteht, dass ihm zwischen Abschieden und Neuanfängen, zwischen süßen Mandarinen und bayerischem Schnee etwas viel Größeres gelungen ist.
Weitere Informationen zu Mario Giordano finden Sie am Ende des Buches.
Mario Giordano
TERRA DI SICILIA
Die Rückkehr des Patriarchen
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe März 2022
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: buxdesign | Ruth Botzenhardt Covermotiv: © Granger/Bridgeman Images, mammuth/Getty Images und buxarchiv
CN · Herstellung: Han
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-26095-8V005
www.goldmann-verlag.de
FAMILIE CARBONARO
Barnaba (Nino) Carbonaro: *1880, Obstgroßhändler
Pancrazia Carbonaro: *1864, seine Mutter. Wunderheilerin und Schneiderin
Salvatore Raisi: *1850, sein Vater. Priester, Sänger, Behördengeher
Pina Passalacqua: *1884, seine Frau. Obstgroßhändlerin
Nino Carbonaro: *1910, Sohn von Barnaba und Pina. Schneider und Obstgroßhändler
Anna Mangano-Carbonaro: *1913, Ninos Frau. Schneiderin
Franz Aschenbrenner: *1933, Sohn von Barnaba Carbonaro. Einzelhändler
Die Kinder von Nino und Anna:
Pancrazia (Maria) Carbonaro: *1933, Obstgroßhändlerin
Barnaba (Toni) Carbonaro: *1935, Reiseleiter
Giuseppe Carbonaro: *1937, Schneider
Aurora Carbonaro: *1939, Schneiderin, Heilerin
Angela Carbonaro: *1946, Reiseleiterin
I ARKADIEN
MÜNCHEN 1960
Mein Urgroßvater Barnaba Carbonaro, Sohn eines Priesters und einer Wunderheilerin, hat vierundzwanzig Kinder gezeugt, einen Menschen getötet und ein Mandarinenimperium gegründet. Ein kleiner Mann mit rastlosen Augen, Analphabet, aber mit einem exzellenten Gedächtnis für Zahlen und ausstehenden Gefälligkeiten. Ein Mann mit einer Glückshaut, er bedauert nichts, als er nach langer Abwesenheit wieder nach München zurückkehrt. Wirklich stolz ist er jedoch vor allem auf zwei Dinge: seinen deutschen Pass und den Verlust seines Vermögens.
Wir Carbonaro sind seit Generationen eine Familie von Schneidern, Obsthändlern, Hypochondern, Cholerikern, Dandys, Wunderheilern, Sängern und Reiseleitern. Die meisten Carbonaro tragen die Namen ihrer zu früh verstorbenen Geschwister, denn in unserer Familie werden Namen aufgetragen wie in anderen Familien Kleider und Schuhe. Vielleicht sind die Toten uns deswegen so nah. Kinder sterben, Namen überleben: Maria, Nino, Pippo, Anna, Aurora, Turri, Pina, Angela, Ignazio. Wer bei diesem Reigen je den Vornamen Pancrazia oder Barnaba abbekam, hat ihn zeitlebens gehasst und sich Maria oder Antonio nennen lassen. Aber wie zum Ausgleich für den ungeliebten Namen werden alle Pancrazias und Barnabas der Familie Carbonaro mit einer Glückshaut geboren.
Von ihnen will ich erzählen.
Es ist Anfang Dezember. Der Nachtzug hält auf Gleis 11 wie alle Sonderzüge aus Italien. Um Missverständnisse mit den Bahnsteigordnern zu vermeiden, lässt Barnaba Carbonaro sich Zeit mit dem Aussteigen. Er raucht sein Zigarillo zu Ende und beobachtet aus dem Fenster seines Erste-Klasse-Abteils, wie Hunderte von jungen und nicht mehr ganz so jungen Männern auf den Bahnsteig rascheln wie trockenes Laub. Keine einzige Frau darunter, nur Männer aus dem mezzogiorno mit zu früh gealterten Gesichtern, angeweht vom Elend und dem Versprechen von Wohlstand. Fischer, Bauern, Hilfsarbeiter in viel zu dünnen Anzügen für den Münchner Winter, mit kleinen Handkoffern und gestempelten ärztlichen Attesten und Arbeitsgenehmigungen in der Tasche, die sie nicht lesen können.
»Du allerdings auch nicht, my friend.«
Ruggero sitzt vor ihm, in seiner faschistischen Fliegeruniform, Stiefel auf Hochglanz gewienert, Beine lässig übereinandergeschlagen. Er leuchtet wie eh und je nur so vor gut gelaunter Arroganz.
»Verschwinde!«, seufzt Barnaba, an Gespenster gewöhnt.
Die Männer da draußen lassen sich von den Bahnsteigordnern nach und nach ins Untergeschoss in einen ehemaligen Luftschutzbunker treiben. Dort werden sie ein heißes Getränk und einen Arbeitsvertrag auf Deutsch bekommen, auf dem eine rote Nummer darüber entscheidet, wo es kurz darauf hingeht: nach Essen, Wolfsburg, Köln. Orte, von denen die meisten noch nie gehört haben, wo man sie in hastig gezimmerten Baracken zusammenpferchen wird, damit sie Straßen bauen, Automobile bauen, den Deutschen ihr zerbombtes Land wiederaufbauen und etwas schaffen, was man später Wirtschaftswunder nennen wird.
Gleis 11 also. Sechzig Jahre zuvor ist Barnaba Carbonaro zum ersten Mal hier ausgestiegen, schon damals eleganter gekleidet als die anderen Fahrgäste. Den Bunker unter Gleis 11 hat er nie betreten, aber er weiß Bescheid. Er hat die Katzlmacher gesehen. Sechstausend Italiener in der Au, die unter erbärmlichsten Bedingungen Ziegel für die rasant wachsende Provinzhauptstadt brannten. Dreißig Jahre später nannte man sie dann Fremdarbeiter, als dieses Land die Arbeitskräfte ersetzen musste, die derweil an verschiedenen Fronten fielen, erfroren, verbluteten und verreckten. Barnaba Carbonaro weiß, dass das ganze Anwerbeverfahren, die Auswahl, die deutsche Außenstelle in Verona, die gesamte Organisation bis hin zu den Formularen exakt die gleiche ist wie zwanzig, wie fünfzig Jahre zuvor. Man hat praktisch alles übernehmen können. Inzwischen sagt man Gastarbeiter, weil man erwartet, dass die da in dem Kellerraum unter Gleis 11 irgendwann auch freiwillig wieder gehen werden.
Mein Urgroßvater Barnaba Carbonaro interessiert sich jedoch weder für die verschiedenen Bezeichnungen noch für die Bezeichneten. Er ist kein Gast in diesem Land, sondern ein deutscher Unternehmer. Er ist nach München zurückgekehrt, um ein Familienfoto zu machen, ein Bordell zu besuchen und ein Unternehmen zu gründen, auch wenn er noch nicht weiß, was für eines. Er reibt sich eine Hand am Hosenbein vor Vorfreude auf seinen Mercedes, den er vor zwölf Jahren bei seinem Sohn untergestellt hat mit der ausdrücklichen Anweisung, ihn zu hüten wie einen Schatz. Denn das ist er, ein Schatz. Eine viertürige 170-V-Limousine in edlem Maronenbraun, Baujahr 1938, mit synchronisiertem Getriebe, herrlicher Laufruhe und einer Kofferbrücke am Heck für die langen Fahrten nach Sizilien. Viertausendeinhundertdreißig Reichsmark hat Barnaba damals mit der Sonderausstattung und dem erhöhten Fahrersitz bezahlt, aber das war es wert. Denn erst der Mercedes verwandelte den Analphabeten aus Sizilien endgültig in einen Deutschen von Stand.
Alles lange her. Zunehmend ungeduldig, beleibt und rüstig, mit achtzig noch nahezu im Vollbesitz seiner Manneskraft, tadellos frisiert und manikürt wie immer und in einen unzerstörbaren Anzug aus grauer Schurwolle gekleidet, beobachtet Barnaba die Italiener, die sich noch auf dem Bahnsteig stauen, verloren unter dem großen Reklameschild des Tierparks Hellabrunn. Das Reklameschild erinnert Barnaba Carbonaro an die Zoobesuche mit Franz. Und während er sich erinnert, verklumpen die Männer da draußen zu kleinen Grüppchen, stampfen mit den Beinen auf gegen die Kälte, rauchen, wechseln kurze Sätze im Dialekt, sehen sich verstohlen um. Zwei halten sich an der Hand, ein Vater und sein erwachsener Sohn, wie Barnaba vermutet. Barnaba kann nicht wegsehen, so sehr trifft ihn die Ähnlichkeit des jungen Mannes mit Mariano Bagarella. Die gleichen arabischen Züge, beschattet von einem großen geheimen Kummer. Augen, die dem Blick stets ausweichen und doch alles ständig auf eine aufziehende Gefahr hin absuchen. Die gleichen Augen wie Rosaria.
Als der junge Mann ihn entdeckt, starren sich die beiden für einen kurzen Moment an. Der junge Mann winkt Barnaba, dass er aussteigen solle. Bis sein Blick sich verändert, als er versteht, dass der dort auf der anderen Seite der Glasscheibe ein Herr sein muss, Obrigkeit, Gefahr, der ewige Feind. Als Barnaba die Hand zu einem matten Gruß hebt, wendet sich der junge Mann ab.
Mehr als nur ein Fenster, eine ganze Welt und vor allem sein deutscher Pass in der Manteltasche trennen Barnaba Carbonaro von diesem Mann, der seinem Jugendfreund Mariano Bagarella so sehr gleicht, als habe er die Jahrzehnte übersprungen wie eine Pfütze. Durch das Abteilfenster sieht er ihn als verblichene Fotografie, nackt, mit Lorbeer geschmückt, in lasziver Pose und mit einer Panflöte auf einer umgestürzten Säule in der Ruine eines griechischen Amphitheaters mit Blick auf den Ätna.
Nein, nicht Mariano Bagarella, sondern sich selbst.
Wie immer sieht Barnaba Carbonaro nur sich selbst.
TAORMINA 1890
»Wie ist dein Name?«
»Barnaba, Herr. Aber alle nennen mich Nino. Ich bin auch ein Baron.«
»Soso. Hast du heute schon was gegessen, Barnaba?«
»Nein, Herr.«
»Hier, probier mal, mein kleiner Baron.«
Der Fotograf reicht ihm ein mit ricotta gefülltes Cremeröllchen und sieht zu, wie Barnaba mit aufgerissenen Augen den ersten cannolo seines Lebens verschlingt. Natürlich hat er cannoli schon gesehen, im Fenster der Pasticceria Russo am Corso Umberto, aber sein Vater hat ihm noch nie einen gekauft. Barnaba will die Köstlichkeit so lange wie möglich genießen, aber er hat Hunger, schrecklichen Hunger, er kann einfach nicht anders.
Der cannolo überrennt seine Sinne. Die Kruste des Röllchens zersplittert beim ersten Biss, und sein Mund füllt sich mit einer Wolke aus schneeweißem Quark. Aromen verpuffen wie Feuerwerksböller an San Pancrazio. Da knistert Karamell, pocht Vanille an seinem Gaumen, und er beißt auf, ach, bittersüße Orangenschale, kandierte Kirschen und geröstete Pistazien. Und überall zugleich wie die Hand seiner Mutter ist da die ricotta, mild-süß, säuerlich und ein kleines bisschen salzig.
Eruptionen der Seligkeit. Steinchen in ein stilles Meer geworfen, die Wellen schlagen, tiefer sinken und ganz unten am Grund schließlich etwas Uraltes aufwirbeln, aus dem seine Träume und Wünsche bestehen.
»Schmeckt er dir?«
Barnaba nickt ergriffen.
»Wunderbar«, sagt der Baron auf Deutsch. Und auf Sizilianisch weiter: »Wenn ich es sage, musst du ganz stillstehen. Kannst du das?«
»Ja, Herr.«
Mariano Bagarella und Vincenzo Cuddetta haben ihm bereits alles erklärt. Dass er nur stillsitzen und seinen Pimmel herzeigen müsse. Kleinigkeit.
Ein Hustanfall schüttelt den Baron. Er röchelt in sein Taschentuch. Barnaba weiß nicht, was Tuberkulose ist, er weiß nur, dass der Baron sich jeden Tag von Mariano Bagarellas Vater und zwei Maultieren Krüge voll frischem Meerwasser aus Giardini hinaufschaffen lässt. Jedenfalls muss der Baron sehr reich sein, wenn er sich jeden Tag Meerwasser bringen lassen kann. Die anderen Fremden, die mit Gespannen über die neue Straße anreisen, besuchen ihn in seinem Studio und lassen sich seine Fotografien zeigen. Also muss sein Reichtum damit zusammenhängen.
Barnaba überlegt, wie es sich wohl anfühlen mag, reich zu sein, und ob man davon Husten bekommt. Aber selbst mit Husten könnte man dann immerhin jeden Tag cannoli essen.
»Genau«, ächzt der Baron auf Deutsch, wirft einen Blick in sein Taschentuch und steckt es wieder ein. »Das ist ein schöner, verträumter Ausdruck. Genauso machst du es nachher. Ganz entspannt, aber beweg dich keinen Millimeter, hörst du?«
Barnaba hat keine Ahnung, was ein Millimeter ist, aber als er sich die letzten Krümel und Reste der Creme von den Fingern leckt, ist er bereit, alles zu versprechen.
»Ja, Herr.«
»Wenn du gut bist, kriegst du eine halbe Lira. Wirst du das schaffen, Barnaba?«
»Eine Lira.«
»Wie bitte?«
»Ich krieg es hin für eine Lira.« Er blinzelt nicht mal. Der Baron starrt ihn an und lacht dann.
»Wunderbar! Du wirst es noch weit bringen, Junge. Zieh dich aus, wir machen erst eine Probe.«
Der deutsche Fotograf, den sie im Ort u baruni nennen, sieht zu, wie Barnaba seine geflickte Hose und das Hemd abstreift. Als er Barnaba von allen Seiten mustert, lacht er nicht mehr.
»Wann hat dein Vater dich zuletzt geschlagen?«
»Heute Morgen, Herr.«
»Er soll damit aufhören, sonst kann ich dich nicht gebrauchen, sag ihm das.«
»Ja, Herr.«
»Komm mit.«
Barnaba hat noch nie ein Bad gesehen. Sein Vater wäscht sich fast nie, seine Mutter benutzt manchmal eine alte Zinkschüssel hinter dem Haus. Aber im Haus des Barons gibt es sogar ein kleines Zimmer mit gekachelten Wänden und einem Spiegel, mit einem gusseisernen Ofen und einer emaillierten Zinkwanne. Der Baron drückt Barnaba ein Stück Seife in die Hand, das nach Orangenblüten duftet, und deutet auf die Wanne.
»Weißt du, wie man sich wäscht?«
»Ja, Herr.«
»Gut. Aber richtig, hörst du, auch hinter den Ohren und untenrum, und vergiss die Finger nicht. Ein Baron darf nicht mit Seife sparen.«
Er lächelt ihn an und lässt Barnaba allein. Aus dem Garten dringen das Husten des Barons und Vogelgezwitscher herein. Ein schöner Tag.
Barnaba posiert vor dem Spiegel und inspiziert das Bad. Es gibt sogar ein hölzernes Wasserklosett, das erste, das Barnaba in seinem Leben sieht. Er öffnet vorsichtig den Deckel, drückt die Handpumpe und verfolgt begeistert, wie das Wasser durch den Abort strudelt.
Barnaba strullt ins Klosett und beeilt sich mit dem Waschen. Die Seife schäumt viel mehr als der graue Klotz, den seine Mutter für die Wäsche verwendet. Braunes, schaumiges Wasser gurgelt in den Ausguss und hinterlässt einen Rand. Barnaba sieht sich um, nach irgendwas, das sich eventuell zu klauen lohne, aber dann fällt ihm ein, dass er ja nackt ist.
Als er wieder in den Garten tritt, sitzt der Baron im Schatten einer Palme und häutet sorgfältig einen Pfirsich. Ab und zu hält er inne, um zu husten. Er trägt einen Strohhut, eine helle Leinenhose und ein offenes weißes Leinenhemd, die Ärmel hochgekrempelt. Er wippt versonnen mit den Füßen, die in hellen Slippern und Seidenstrümpfen stecken, was Barnaba noch nie gesehen hat.
Obwohl er aus dem Norden kommt, wie die Leute sagen, auch wenn Barnaba keinen Schimmer hat, was das eigentlich bedeutet, schwitzt der Baron kaum. Die Hitze scheint an seiner eleganten Erscheinung abzuperlen. Noch Jahre später wird sich Barnaba vor allem an die Eleganz dieses großen Mannes mit dem gezwirbelten Nazarenerbart erinnern, den die Tuberkulose und die Prüderie des wilhelminischen Deutschlands in Taormina angespült hatten. Wenn einer aus dem Ort klamm ist, beschäftigt der Baron ihn für eine Weile als Gärtner oder für irgendwelche handwerklichen Arbeiten, damit es nicht nach Almosen aussieht. Der Baron hat verstanden, wie wichtig bella figura in Sizilien ist. Daher schicken ihm die Leute ihre Töchter und Söhne zum Fotografieren und auch gelegentlich abends ihre halbwüchsigen Söhne, wenn der Baron wieder einmal ausländische Gäste in seinem Haus an der Piazza San Domenico hat.
Barnaba hat den Baron bislang nur aus der Entfernung gesehen, unterwegs mit seinem großen Fotoapparat und dem zusammengefalteten Zelt, in dem er die Platten anschließend entwickelt. Er kennt Namen und Verwandtschaftsbeziehungen, hat immer Zeit für kleine Plaudereien, stellt Fragen, hört zu. Obwohl er ein Herr aus dem Norden ist, spricht er den Dialekt der Leute.
Der Baron reibt Barnaba zuerst am ganzen Körper mit einer Creme aus Glyzerin, Milch und Olivenöl ein, um die blauen Flecken und Narben abzudecken, die Barnabas kleinen Körper zeichnen. Dann führt er ihn zu einer Steinbank zwischen Oleanderbüschen.
»Setz dich da hin und schlag die Beine untereinander. Nein, anders herum, ja, so. Genau. Bleib so.«
Er drückt Barnaba einen Blumenkranz auf den Kopf und eine Panflöte in die Hand und zeigt ihm, wie er sie halten soll. Wie er den Kopf drehen soll. Wie er sich hinsetzen soll, sodass man seinen Pimmel sehen kann. Es ist doch schwerer, als Barnaba gedacht hat, aber für einen cannolo und eine Lira hätte er sogar den ganzen Tag regungslos auf einem Bein gestanden. Eine Lira! Selbst wenn er den Vater und Mariano Bagarella und Vincenzo Cuddetta bescheißt und ihnen nur jeweils zehn Centesimi abliefert, kann er für die restlichen siebzig zwei Brote, Öl und Tomaten kaufen. Oder sparen. Er überschlägt kurz, wie oft er stillsitzen muss, um genug Geld für eine Zugfahrkarte nach Messina zurückzulegen, um für immer abzuhauen. Dann überschlägt er, wie lange er stillsitzen muss, um auch seine Mutter mitzunehmen. Dann überschlägt er, wie lange er stillsitzen muss, um …
»Eh!«
»Ja, Herr?«
»Warum verdrehst du die Augen? Still hab ich gesagt!«
»Verzeiht, Herr. Ich habe gerechnet.«
»Verdammt, du sollst nicht rechnen, Kerl, du sollst stillsitzen. Nein, wir lassen das. Du kannst gehen. Ich kann dich nicht gebrauchen.«
Ein Anflug von Panik erfasst Barnaba. »Ich werde stillsitzen, Herr! Ganz still. Ich kann das gut. Bitte!«
Der deutsche Fotograf sieht ihn prüfend an. Dann korrigiert er erneut Barnabas Pose, zupft, was Barnaba seltsam findet, an seinem Pimmel herum wie ein Doktor.
»Der ist schön, du hast Glück«, sagt der Fotograf. »Und ab jetzt keine Bewegung mehr.«
Der Fotograf zückt eine Stoppuhr und lässt Barnaba nicht aus den Augen. Und Barnaba tut das, was er immer tut, wenn sein Vater ihn verdrischt: stillhalten und rechnen. Er addiert die Neunerreihe, bildet die Quersumme der ungeraden Zahlen, sucht Zahlen, die sich durch drei teilen lassen. Alles diesmal ohne jeden Mucks. Die Zahlen beruhigen ihn, tragen ihn fort an einen schönen Ort. Jede Zahl von Null bis Neun hat ihre Farbe. Die Eins ist ganz aus cremigem Weiß gewebt. Die Zwei leuchtet wie eine Zitrone, die Drei wie eine Erdbeere. Die Fünf – das ist der Himmel an einem Sommernachmittag. Die Neun ist so violett wie eine vollreife Maulbeere. Und so bilden die Ergebnisse seiner Rechnungen immer schöne bunte Muster, an denen er sich erfreut, wenn sein Vater ihn schlägt oder wenn der Hunger zu stark wird. Nun jedoch haftet den Zahlen etwas Neues an, hüllt sie ein wie ein feines Gespinst. Die Eins duftet auf einmal nach Vanille, die Sechs wie herbes Karamell. Die Sieben kitzelt wie Orangenschale, die Acht verströmt betörendes Pinienharz. Die Vier ist aus Minze. Und die Null? Er spürt dem Duft seiner Lieblingszahl hinterher, kommt erst nicht darauf, bis es ihm dann aufgeht. Natürlich. Seine Lieblingszahl hat seinen Lieblingsduft: geröstetes Brot.
»Nicht perfekt, aber wir machen einen Versuch.«
Der Fotograf kriecht unter den Vorhang seines Fotoapparats und füttert ihn dann mit der großen Platte.
»Gehst du zur Schule?«
»Nein, Herr.«
»Wieso kannst du dann rechnen?«
»Mamma hat es mir gezeigt.«
»Auch lesen?«
»Nein, Herr.«
»Wenn sie rechnen kann, warum hat sie dir nicht auch Lesen beigebracht?«
Barnaba überlegt, was der Fotograf damit meint. Ob er ihn wegen der Sache mit dem Lesen womöglich ablehnen wird.
»Sie kann nicht lesen, Herr. Nur rechnen. Und Würmer besprechen, das kann sie auch. Meine Mutter ist eine Heilerin. Mein Vater ist ein Baron und meine Mutter eine Heilerin. Mamma kennt alle Geheimnisse und alle Würmer und auch die Läuse. Die Würmer, die im Fleisch leben, und die Kopfläuse, die von zu vielen Gedanken kommen. Sie macht Salben aus Fliegenschiss und Knoblauch gegen die Würmer und die Furu … furi … Sie hat Turriddu Navarra vom bösen Blick geheilt, bis er trotzdem gestorben ist. Und als er tot war, kamen überall Würmer aus ihm raus. Sie kann auch Talismane machen und dass Leute sterben. Es ist wahr. Die Frau von Carmelo Guarino wollte, dass mamma ihr einen Zauber macht, damit ihr Mann stirbt, aber sie hat es nicht gemacht. Und als Carmelo Guarino das rausgefunden hat, hat er sie grün und blau geschlagen, also seine Frau, nicht mamma, fast tot hat er sie geschlagen, das weiß ich von Mariano.«
»Sitz still.«
Niemand hat Barnaba irgendwas davon gesagt, dass man lesen können müsse beim Fotografen. Das macht ihn wütend. Mariano und Vincenzo haben nichts von Lesen gesagt. Sie haben ihn reingelegt, damit er seinen Pimmel vorzeigt für nichts, das macht ihn wütend. Aber so richtig. Er wird sich ein Messer besorgen und die beiden abstechen, auch wenn sie größer sind. Er wird es ihnen zeigen.
»Eh!«, ruft der Fotograf. »Was machst du da?«
»Nichts, Herr.«
»An was hast du gerade gedacht?«
»An nichts, Herr. Wirklich.«
Der Fotograf kommt wieder näher, er wirkt auf einmal aufgeregt und sieht ihm ins Gesicht, als ob er Barnaba erst jetzt richtig wahrnehme. »Wunderbar! Der junge Polyphem!«, ruft er aus. »Wie war dein Name?«
»Barnaba, Herr. Aber alle nennen mich Nino.«
»Egal, an was du gedacht hast, denk weiter dran, mein kleiner zorniger Zyklop. Und sieh direkt in die Kamera. Nimm die Flöte runter, ja, so. Genau.«
Er nimmt ihm den Blumenkranz vom Kopf, verwuschelt Barnabas Haare, korrigiert seine Haltung erneut, diesmal ohne an seinem Pimmel zu ziehen, dafür dreht er seinen Kopf zur Kamera.
»Immer weiter daran denken, Barnaba. Sieh in die Kamera, aber beweg dich nicht. Genau so.«
Er eilt zurück zu seinem Apparat und macht das Foto.
Barnaba hört ein Klacken und denkt an Mariano Bagarella und Vincenzo Cuddetta. Wie er sie umbringen wird, wenn er die Lira nicht bekommt, am liebsten würde er sofort aufspringen, um die beiden abzustechen und dann für immer davonzulaufen, aber geht ja nicht, weil er ruhig sitzen muss, keinen Mucks, aber am liebsten würde er alles zusammenschlagen, und der Baron steht da nur mit seiner Scheißstoppuhr und will ihm die Scheißlira nicht geben, hat ihn mit einem Scheißcannolo verhext. Und das alles zusammen macht ihn noch viel wütender, am liebsten würde er den Scheißfotoapparat kurz und klein treten.
»Sehr gut, kleiner Polyphem. Wunderbar.«
Barnaba hat keine Ahnung, was der Mann meint. Die deutschen Wörter beunruhigen ihn.
»Kriege ich jetzt die Lira?«
»Später. Wir sind noch nicht fertig.«
Der Fotograf macht noch drei weitere Bilder. Jedes Mal interessiert er sich nur für Barnabas Augen, jedes Mal verschwindet er danach für längere Zeit in der Dunkelkammer im Haus und kommt schweißgebadet, aber zufrieden wieder zurück. Die Mittagshitze setzt Barnaba nun ebenfalls zu. Auf der Bank gibt es keinen Schatten, dennoch rührt er sich nicht von seinem Platz, stochert nur weiter in seiner schwelenden Wut, um dem Baron zu gefallen. Der Fotoapparat mit dem großen Objektiv interessiert ihn. Nicht so sehr das fotografische Verfahren an sich, sondern der Wert des Apparats in Lire und Freiheit.
Der magische Prozess des Reichwerdens interessiert ihn, der Übergang von der einen in die andere Welt. Der Baron ist real, sein Apparat ist real, sie atmen beide die gleiche Luft. Dennoch trennt sie eine feine Membran. Also, überlegt Barnaba, wenn u baruni mit seinem Apparat und seinen Glasplatten reich werden kann, dann muss es auch für ihn einen Weg durch diese Membran auf die andere Seite geben.
Als mein Urgroßvater dem Baron von Gloeden Modell sitzt, ist Taormina ein sterbender Ort mit kaum mehr als zweitausend Einwohnern. Die strategisch bedeutsame Siedlung auf dem Monte Tauro hat viele Blütezeiten erlebt, in der Antike, im Mittelalter und in der Renaissance, aber schon als Goethe Taormina besucht, findet er das antike Amphitheater mit Blick auf den Ätna völlig überwuchert vor. Während der Baron dem europäischen Bürgertum die Fata Morgana eines mythischen Arkadiens verkauft, grassieren in Taormina Typhus, Malaria und jede Art von Wurmbefall. Jedes zweite Kind stirbt vor seinem vierten Lebensjahr, es gibt keine Kanalisation, der ganze Ort stinkt nach Exkrementen, Jasmin und Oleander. Häuser verfallen, gutes Land liegt brach. Die Zerschlagung der adligen Privilegien nach der Einigung Italiens hat zu unklaren Besitzverhältnissen geführt. Manches Land wird gar nicht mehr bestellt. In die Fußstapfen der bourbonischen Grundbesitzer ergießt sich wie ein klebriges Öl ein neuer Typus von Blutsaugern. Richter, Ärzte, Gutsverwalter ohne Skrupel, die im Schutz der Kirche so viel Land an sich reißen, wie es nur geht. Wer aufmuckt, verschwindet einfach.
Gleichzeitig strömt die europäische Boheme auf Goethes Spuren nach Sizilien, und der Baron lichtet Knaben in lasziven Posen auf Glasplatten ab, die mit einem Glibber aus Kollodiumwolle, Jod, Brom und Äther bestrichen sind.
Und wird reich damit.
Das will mein Urgroßvater auch. Barnaba Carbonaro, der nur eine Hose und ein Hemd besitzt, noch nicht einmal Schuhe. Der abends manchmal wilden Senf frisst, um überhaupt etwas in den Magen zu kriegen. Barnaba, der nicht lesen, aber rechnen kann, gerade zehn Jahre geworden. Barnaba träumt. Ein Steinchen hat den Grund seiner noch ungeträumten Träume aufgewirbelt. Träume, die nach Vanille und Orangenblüten duften. Von diesem Tag an träumt Barnaba Carbonaro von einem Leben, in dem es cannoli, Bäder und elegante Anzüge gibt. Von diesem Tag an träumt er unerschütterlich vom Reichwerden.
»Wie viel hat er dir gegeben?«
Barnaba streckt seinem Vater zehn Centesimi entgegen.
Salvatore funkelt ihn an. »Mehr nicht?«
Barnaba schüttelt den Kopf. »Ich bin nicht mehr wert, hat er gesagt. Weil wegen der blauen Flecken, hat er gesagt. Weil ich wie eine matschige Orange bin, hat er gesagt. Du sollst mich nicht mehr schlagen, sonst kann er mich nicht gebrauchen. Hat er ges…«
Da trifft ihn schon der erste Schlag ins Gesicht.
»Ich weiß genau, was du gekriegt hast! Wo ist der Rest?«
Barnaba wirft seinem Vater die restlichen siebzig Centesimi hin, denn zwanzig hat er ja bereits Mariano und Vincenzo abgeben müssen. Der Vater schreit, die Mutter schreit, und Salvatore prügelt jetzt abwechselnd auf beide ein in wachsender Raserei. Aber die Schläge sind wie ein Gewitter, das vorüberziehen wird. Kennt Barnaba alles schon, er igelt sich ein und rechnet sich an einen schöneren Ort. Die Zahlen hüllen ihn in Farben und Düfte, die Neunerreihe, die Achterreihe, die Primzahlen, so weit er kommt. Sie rascheln und tuscheln und weben ihm einen Traum aus Pomeranzenblütenöl und dämmerigem Nachmittag, von Reichtum, Fotoapparaten und cannoli. Ein Traum, von dem sein Vater nie erfahren wird.
Man konnte Salvatore Raisi ja vieles nachsagen, dass er ein Choleriker war, zum Beispiel, und ein Idiot dazu. Aber eben nicht Idiot genug. Salvatore weiß, wie viel die anderen Jungen bekommen. Salvatore Raisi weiß auch, was im Haus an der Piazza San Domenico geschieht, wenn der Baron Gäste hat und dazu junge Männer aus dem Ort einlädt. Jeder weiß das. Man spricht zwar nicht offen darüber, findet allerdings nicht viel dabei. Auch Salvatore Raisi nicht. Denn mal im Ernst: Hat er nicht am eigenen Leib die Verderbtheit des Weibes erfahren und die Macht, die die Frauen über ihn haben mit dem Moschusgeruch aus ihren Röcken und Achselhöhlen, ihren schamlosen Bewegungen? Hat Pancrazia ihn etwa nicht verhext, ihn, einen ehrbaren Priester, wie Eva einst Adam mit dem Apfel der Lust? Ist es daher nicht gar geboten, dass junge Männer ihre natürliche Begierde unter ihresgleichen austoben, um den Verlockungen des Weibes zu widerstehen und um allzu frühe Vaterschaft zu vermeiden?
Von den Gesetzen im fernen Kaiserreich Deutschland, die jede Art gleichgeschlechtlicher Zärtlichkeit unter harte Strafe stellen, weiß Salvatore Raisi nichts, aber er kennt die Fotos des deutschen Barons. Sie hängen ja für alle sichtbar im Schaufenster des Kunsthandelsgeschäfts Schuler an der Piazza Badia aus, und wenn sie so öffentlich aushängen und die Ausländer dafür viel Geld bezahlen, was kann daran groß schlecht sein?
Die Fremden reisen im Herbst an und bleiben bis Mai. Wie Zugvögel, wie die Gezeiten. Jedes Jahr werden es mehr. Die Welt des mondänen Europas tost durch Taormina wie eine eigene Jahreszeit aus Seidenstoffen, Gelächter, Hüten, blasser Haut und unerhörten Nachrichten über Erfindungen, Geschwindigkeit und Reichtum. Deutsche vor allem. Die Deutschen, scheint es Salvatore Raisi, sind alle krank. Sie kommen wegen des milden Klimas oder wegen der jungen Männer. Aber immer sind sie reich, diese Deutschen, das macht Salvatore wütend. Weil er sich für seine eigene Armut schämt, schlägt er seine Frau Pancrazia, die ihm das ganze Elend angehext hat, wie er findet, und seinen Sohn, dieses hungrige, scheißende Symbol seines Elends.
In seinen besseren Momenten erzählt Salvatore seinem Sohn gerne von ihrer bourbonischen Abstammung aus dem Geschlecht der Raisi, was schließlich von dem arabischen raʾīs abgeleitet sei und »Herrscher« bedeutet. Von sagenhaften Besitztümern am Ätna, endlosen fruchtbaren Hügeln, jeder einzelne mit einem Palast gekrönt. Dass sie baruni seien, genau wie der deutsche Fotograf.
Die Wahrheit ist nur, dass meine Vorfahren, die Raisi, niemals dem Hochadel des Königreichs beider Sizilien angehörten.
Bis ins siebzehnte Jahrhundert heißen meine Vorfahren noch Raguccio. Bauern aus Gravina bei Catania, die Maulbeerbäume und Seidenspinner für die sizilianische Seidenproduktion kultivieren. Durch Betrug und Mord zu Besitz gelangt, erkaufen sie sich für viel Geld den unteren Adelsstand, ändern ihren Namen und träumen zwischen ihren Maulbeerbäumen dynastische Träume.
Der Ruin kommt Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in Form von zwei Plagen über die Raisis: eines einzelligen Kleinsporentierchens namens Nosema bombycis und eines mehrzelligen Revolutionärs und Guerillakämpfers namens Giuseppe Garibaldi.
Nosema bombycis fegt durch die Maulbeerbäume wie die Pest einst durch Venedig und löscht in ganz Europa die empfindlichen Seidenraupen aus. Innerhalb weniger Jahre frisst die Flecksucht die sizilianische Seidenproduktion. Die Raisis besitzen Tausende von Maulbeerbäumen, von dessen Blättern die Seidenraupe ausschließlich lebt, die müssen sie laut Dekret nun alle abholzen. Da sie es aus schierer Gier versäumt haben, nebenbei Wein oder Zitronen anzubauen oder Schürfrechte an der einen oder anderen Schwefelmine zu erwerben, bleibt ihnen nur das nackte Land mit dem einstöckigen Gutshaus.
Fast gleichzeitig landet Garibaldi in Sizilien, um Italien zu vereinen und den Adel samt und sonders zu enteignen. Natürlich nicht die mächtigen Familien, die Pennisi, Manganelli, Biscari, Ursino oder Floristella. Die arrangieren sich mit dem neuen Regime und behalten die Hälfte ihrer Güter, Palazzi und Schwefelminen. Genug, dass noch ihre Ururenkel allein durch unvorteilhafte Landverkäufe in Wohlstand leben können, ohne je einen einzigen Tag arbeiten zu müssen.
Die Raisis dagegen verlieren alles. Als sich die Nachricht von der Landung Garibaldis verbreitet, läuten die Landarbeiter und Bauern von Gravina die Glocken und ziehen los mit Äxten und Sensen. Angetrieben von jahrhundertealter Wut und einem Schneider erschlagen sie innerhalb weniger Stunden jeden, der einen Hut trägt. Vor dem Gutshaus der Raisis dampft das Blut. Niemand entkommt außer der elfjährige Salvatore. Denn der verschläft jenen blutigen Nachmittag in dämmriger Kühle auf einer Kirchenbank, erschöpft von der Hitze und der Rührung über sich selbst, nachdem er mit seiner schönen Stimme und tüchtig Hall zuvor der Muttergottes vorgesungen hatte, während zur gleichen Zeit seine Familie ausgerottet wird.
Jedenfalls entgeht Salvatore als Einziger dem Gemetzel, und weil der Blutdurst gestillt ist und die Leute wie verkatert nach einem rauschenden Fest über eine seltsame Mattigkeit und einen pelzigen Geschmack im Mund klagen und weil in diesem Zustand niemand Lust verspürt, auch noch den kleinen Salvatore zu erschlagen, herrscht allgemeine Verlegenheit. Mützen werden geknetet, Flüche gestöhnt, Fenster verrammelt, Lippen verschließen sich für immer. Da Salvatores Anblick den Leuten unangenehm ist und niemand etwas mit ihm anzufangen weiß, ordnet der Schneider Carbonaro an, dass man das Waisenkind zu den Nonnen geben möge. Die Nonnen nehmen Salvatore auch nur wegen seiner Glockenstimme und einer mickrigen Kollekte, die der Schneider Carbonaro hastig im Ort organisiert. Bei den Nonnen wächst Salvatore ohne Liebe auf, aber als er sich zu einem schönen jungen Mann und einer lebendigen Prüfung ihrer Keuschheit entwickelt, schieben sie ihn mit sechzehn ins Priesterseminar nach Ragusa ab.
Trotz seiner eher unerfreulichen Kindheit träumt Salvatore unverdrossen vom dolce vita. Vom leichten Leben, angefüllt mit Bewunderung, sinnlicher Zuwendung und anmutigem Müßiggang, nur unterbrochen von regelmäßigen Mahlzeiten. Schon während seiner Ausbildung am theologischen Kolleg in Ragusa fällt er durch drei Dinge auf: seine Engelsstimme, seine Prahlerei und seine Techtelmechtel. Ein schöner junger Mann, aber oft kränklich. Sein Leben lang leidet er an Blutarmut, Schwindel und Gelenkschmerzen, an allerlei kleinen Infekten und Zipperlein, aber am allermeisten an sich selbst. Ganze Tage verbringt er im Bett, anmutig leidend und in der festen Überzeugung, bald sterben zu müssen.
Aber singen kann er. Wenn er anhebt in seinem Belcanto-Schmelz, einerlei ob Kirchenlieder oder Volksweisen, und seine Stimme in den oberen Lagen fast splittert wie dünnes Eis, weinen sogar die Felsen, sagen die Leute. Kein Wunder also vielleicht, dass ihm, der sich vor dem Zölibat mehr fürchtet als vor dem Fegefeuer, die Herzen der Mädchen und auch einiger Ehefrauen und Witwen nur so zufliegen. Unverschuldet, findet Salvatore, ganz unverschuldet gerät er unter den typischen Verführungsdruck sizilianischer Männer, die mit Schönheit geschlagen sind und von denen mythisches Feuer erwartet wird, selbst wenn sie Priester sind. Salvatore kommt noch nicht einmal dazu, sich zu schämen, während er sich so unverschuldet pflücken lässt wie eine überreife Feige.
Nach seiner Priesterweihe verbringt er einige freudlose Jahre in einer Pfarrei in Vizzini, sozusagen am Arsch der Welt, doch dann ergibt sich die Gelegenheit, die frei gewordene Pfarrstelle in seinem Heimatort Gravina zu übernehmen, eine schmucklose, rosa getünchte Kirche mit einem gedrungenen Turm und einer mickrigen Steintreppe, aber immerhin in Sichtweite der Domstadt Catania. Jeden Tag sieht Salvatore unten Catania liegen, die prächtige Barockstadt mit dem Dom, zum Greifen nah und doch unerreichbar für ihn.
Dort, in Gravina, trifft Salvatore schließlich Pancrazia Carbonaro. Meine Ururgroßmutter.
Pancrazia Carbonaro ist das zweite Kind des Schneiders Giuseppe Carbonaro aus Gravina. Die Familie lebt in bescheidenen, aber nicht ärmlichen Verhältnissen, nachdem der Schneider Carbonaro zur Plünderung des Gutshauses der Raisi aufgerufen und sich mit Garibaldis Freischärlerarmee arrangiert hat. Zwar erhält er danach Aufträge von höchster Stelle, aber die Schuldgefühle quälen ihn jede Nacht mit schrecklichen Albträumen. Kein Wunder also vielleicht, dass es dem Schneider Carbonaro gar nicht gefällt, als ihm das Schicksal den einzigen Überlebenden des Massakers sozusagen vor die Haustür spült. Da die Madonna ihm keine Antwort auf sein Flehen um Vergebung gewährt, beschließt er, ihr ein Opfer zu bringen, um sich für alle Zeiten reinzuwaschen.
Seine Tochter Pancrazia erlebt wie alle Schönheit Siziliens eine stürmische, überreife, die Sinne betäubende Blüte, die bald darauf in die Schönheit eines langsamen ewigen Verfalls übergeht. Ihr Vater wacht eifersüchtig über Pancrazias Ehre und hält sie bis zu ihrem vierzehnten Lebensjahr im Haus gefangen. Nicht einmal zur Schule gehen darf sie. Das ist aber auch so üblich, selbst seine Frau verlässt das Haus nur für die notwendigsten Besorgungen. Statt Lesen und Schreiben lernt Pancrazia von ihrem Vater das Schneiderhandwerk und von ihrer Großmutter die Kenntnis über Heilkräuter und das Rechnen. Von den Schuldgefühlen ihres Vaters ahnt sie nichts, sie wundert sich nur, warum er sie auf einmal so bereitwillig in Stellung bei dem neuen Priester gibt. Da ist sie fünfzehn und Salvatore neunundzwanzig.
Pancrazia mag den blassen Pfarrer wegen seiner schönen Stimme, seinen traurigen Augen und seinen linkischen Bewegungen, die sie an einen Hundewelpen denken lassen. Manchmal singt er für sie, nur für sie allein. Als er im ersten Winter schwer erkrankt, behandelt sie den Fiebernden mit Kräutern und Umschlägen aus Ziegenpisse und Wein. Kaum wieder bei Kräften, dankt es ihr der Rekonvaleszent, indem er sein Nachthemd lupft. Und danach immer und immer wieder. Von diesem Tag an bespringt Salvatore sie bei jeder Gelegenheit, unverschuldet natürlich. Manchmal schlägt er sie auch, nicht fest, einfach so. Danach ist er jedes Mal ganz unglücklich, weint viel, wird krank und muss viel schlafen und gepflegt werden. All das, Salvatores Begierde, die Schläge, sein Jammern und seine Trägheit, erträgt Pancrazia duldsam, denn sie hält alles für Zeichen, dass der Talisman wirkt, den sie unter seinem Bett versteckt hat, damit Salvatore ganz ihr gehöre. Denn die Wahrheit ist, dass Pancrazia bei Salvatore in Stellung zum ersten Mal so etwas wie Freiheit erlebt, nachdem sie zuvor ihr ganzes Leben im Haus ihres Vaters eingesperrt war und dort ebenfalls nicht nur Erfreuliches erlebt hat. Aber die Macht über einen Mann, die Macht über einen Priester, das gefällt Pancrazia, das will sie nicht mehr aufgeben. Dass sie dafür zwischendurch besprungen und geschlagen wird, nimmt sie hin wie den Wechsel der Jahreszeiten. Dafür gibt es ebenso Salben und Talismane wie gegen Verbrühungen und den bösen Blick, keine große Sache.
Sie wird schwanger. Da ist sie immer noch fünfzehn.
Dass ein Priester Vater wird, ist ein nicht unüblicher Fauxpas, für den es bewährte Verfahren der Vertuschung gibt. Die allerdings mit Unterhaltszahlungen und der Verheiratung des Mädchens mit einem anderen verbunden sind, und Salvatore ist arm. Man muss ihm zugutehalten, dass er Pancrazia nicht mit dem Kind sitzen lässt, sondern das ohnehin ungeliebte Priesteramt aufgibt und sie heiratet. Offiziell aus christlichem Mitleid und ohne die Vaterschaft anzuerkennen, obwohl jedermann Bescheid weiß. Daher erhält Barnaba später auch den Nachnamen seiner Mutter. Carbonaro.
Natürlich zerreißen sich die Leute das Maul, aber immerhin bleibt die Ehre des Mädchens gewahrt. Pancrazias Vater empfindet die Schwangerschaft seiner Tochter ohnehin als göttlichen Wink, dass seine Schuld an den Raisis damit nun endgültig getilgt sei. Um seine Albträume jedoch ganz und gar loszuwerden, will er auch Salvatore lieber loswerden. Also legt er ihm dar, dass er als gefallener Priester gut beraten sei, woanders neu anzufangen. Für diesen Neuanfang könne er Salvatore großzügigerweise eine Mitgift von hundert Lire anbieten.
Nicht gewohnt zu feilschen, sagt mein Ururgroßvater Salvatore sofort zu.
Warum Salvatore und Pancrazia ausgerechnet nach Taormina ziehen, ist nicht zuverlässig überliefert. Warum treffen Menschen Entscheidungen? Was krümmt den Schicksalsweg? Was führt zu was? Auf und ab treibt uns das Leben, immer wieder müssen wir hoch an die Oberfläche des Ozeans der Möglichkeiten, um zu atmen und Entscheidungen zu treffen, doch am liebsten würden wir unten im schlammigen Grund unserer Existenz die Zeit verträumen. Das Leben ist gerecht oder ungerecht oder einfach nur ein stilles Meer, in das kindliche Götter zum Spiel Steine werfen. Es gibt Neid und Leid und Verzweiflung, Zuversicht und Liebe. Menschen sind wütend, böse oder dumm, die meisten im Grunde freundlich, manche naiv, träge oder traurig. Der Tag, den wir herbeisehnen, kommt nie, oder er ist immer schon wieder vorbei. Einer erkennt das Glück am Wegesrand, ein anderer nicht. Kinder, die alles haben, treten mutwillig an einen Abgrund, um sich zu schaudern. Alle suchen ihren Platz, und wenn sie einen gefunden haben, dann wollen sie, dass alles so bleibt, wie es ist. Bis die kindlichen Götter wieder etwas kaputt machen wollen. Steine müssen in Meere fallen, müssen Wellen schlagen, sandigen Grund aufwühlen. Steine versinken, Schiffe versinken, Imperien versinken, Häuser und Gewissheiten versinken. Tränen trocknen. Rechnungen werden beglichen. Staub senkt sich. Meere ruhen wieder still, Wege gabeln sich. Etwas führt zu etwas. Geschichten werden erzählt.
Eine verblasste Urkunde in geschnörkelter Handschrift aus dem Nachlass meines Urgroßvaters lässt vermuten, dass der Umzug nach Taormina mit einem Scharlatan namens Musumeci zusammenhängt. Dieser Musumeci ist ein dürres Männchen mit schlechten Zähnen, leichengrauer Haut und farblosen, umschatteten Augen. Das Leben hat ihm übel mitgespielt, mehr als einmal saß er im Zuchthaus. Er zieht von Dorf zu Dorf, um Zicchinedda zu spielen, ein Kartenspiel der Landsknechte des Dreißigjährigen Krieges, das mit alten sizilianischen Karten gespielt wird und das dem Bankhalter schon ohne Betrug einen beträchtlichen Vorteil bringt. Musumeci ist so fingerfertig, dass die anderen Spieler beim Abheben gar nicht mitkriegen, wenn Musumeci sie anschließend wieder in ihre ursprüngliche Reihenfolge bringt. Er lässt die Leute zunächst gewinnen, aber danach verliert er kein einziges Spiel mehr. Er nimmt sie alle aus. Niemand kann ihm den Betrug nachweisen, aber natürlich verzweifeln die Leute, denn seine Opfer sind genau so arm und elend dran wie er selbst. Manchmal jagen sie ihn dann fort, aber für jedes Dorf, aus dem sie ihn fortjagen, kommen zwei neue hinzu, wo sie mit ihm spielen wollen, um eine Abkürzung ins Glück zu nehmen.
Musumeci hat sich außerdem auf den bösen Blick spezialisiert. Den heilt er so: Zunächst lässt er sich ein Stück Baumwolle von den Leuten geben, die ihn rufen, weil der Mann das Fleckfieber hat oder das Vieh stirbt. Mit seinen flinken Fingern versteckt Musumeci ein Stück Natriummetall in den Baumwollfetzen und lässt Wasser darauf träufeln. Dazu psalmodiert er: »Im Namen Samuels befehle ich dir, böser Geist, zeige dich!« Woraufhin die Baumwolle fauchend in Flammen aufgeht und die Leute ihm Geld geben, damit er sie vom bösen Blick erlöst. Neben seinen Natriumbröckchen und Karten führt Musumeci noch allerlei Talismane und Papiere voller alchemistischer Symbole und seiner eigenen Fantasieschrift mit, die er den Leuten verkauft. Wenn die Leute kein Geld haben, nimmt er auch alten Schmuck an oder die erpresste Duldung einer halbwüchsigen Tochter, denn er findet, dass ihm das Leben das schulde. Die Anziehungskraft der Wahrsager ist in jenen Tagen so groß, dass viele unverheiratete Mädchen und verheiratete Frauen bereit sind, alles Mögliche mit sich anstellen zu lassen. Weil Verlobungen in die Brüche gegangen sind, weil sie glauben, dass die Tochter von einem Dämon besessen ist, oder weil sie ihrem Mann den Tod wünschen. Musumeci weiß immer Rat.
Dieser Musumeci nun hat von Pancrazias Heilkunst gehört und ist neugierig, denn natürlich hält er sie für seinesgleichen, und man lernt ja nie aus. Umso verblüffter ist er, als er feststellt, dass Pancrazia wirklich heilen kann. Sie erkennt sofort den Scharlatan und erklärt ihm, dass er schleunigst verschwinden solle, sonst hetze sie ihm die Hunde auf den Hals. Diese Abfuhr zusammen mit Pancrazias unerreichbarer Schönheit pulverisiert Musumecis Selbstvertrauen, schürt seinen Hass auf die Welt, die ihn verhöhnt, wo sie nur kann. Am liebsten würde er sich die schwangere Pancrazia so richtig vornehmen und ihr ihre Schönheit anschließend mit Säure ausbrennen, so traurig macht ihn das alles.
Doch das mit den Hunden, das nimmt er immer ernst. Er ist zwar ein Scharlatan, aber blöd ist er nicht. Er kann Leute lesen, das ist wichtig in seinem Metier. Er hat sofort verstanden, dass diese Pancrazia meint, was sie sagt. Andererseits – so ganz ohne Entschädigung mit eingekniffenem Schwanz abzuziehen lässt seine Eitelkeit auch wieder nicht zu. Ein einziges Spiel würde er gerne machen, nur um sein Gesicht nicht zu verlieren, aber wie gesagt: die Hunde.
Da trifft es sich, dass er den Priester gesehen hat, und weil Musumeci Leute lesen kann, weiß er: Der ist auch traurig, der verzehrt sich nach Anerkennung und will etwas darstellen, was er nie sein wird. Musumeci hat ein Talent für Klatsch und Tratsch, denn davon lebt er wie der Pilz vom Mulch, also ist er rasch im Bilde. Er kann sein Glück kaum fassen, als er erkennt, dass er mit einem Streich drei wundervolle Dinge tun kann: einen ehemaligen Pfaffen auszunehmen, dieser Stute Pancrazia eins auszuwischen und mit hundert Lire dieses unselige Dorf zu verlassen. Hundert Lire, von denen er im Geiste bereits zwanzig in einem Bordell ausgibt, dreißig seiner Frau in Messina überlässt und zehn für Medizin für seinen Sohn. Den Rest will er behalten, das findet er nur gerecht.
Es läuft so: Musumeci fleht Salvatore an, dass er ihm bitte die Beichte abnehmen möge. Salvatore erklärt ihm zwar, dass er dazu nicht mehr befugt sei, aber Musumeci lässt nicht locker, klagt über seine Seelenqual. Und da es noch keinen neuen Priester gibt und Salvatore durchaus geschmeichelt ist und er außerdem immer noch die Schlüssel zur Kirche hat und es sowieso niemanden in Gravina interessiert, legt er ein letztes Mal die Stola an und nimmt dem durchreisenden Büßer die Beichte ab. Musumeci gesteht ein paar kleinere Betrügereien beim Kartenspiel und dann, unter Tränen, dass er im Streit einen Mann erschlagen habe, der seine Frau belästigt habe. Aber weil die Familie des Mannes sehr mächtig sei und Rache geschworen habe, habe er aus seinem Heimatort fliehen müssen. Ein wunderschönes Haus besitze er da in Taormina, mit einem Gemüsegarten und einem Brunnen, ein Paradies für eine Familie, die überall respektiert werde. Aber nun könne er nie wieder zurück. Er jammert und klagt, rauft sich die Haare. Salvatore gibt den strengen Priester, zeigt sich aber auch interessiert. Noch im Beichtstuhl schiebt ihm Musumeci unter Tränen eine amtliche Urkunde zu, üppig bestempelt, mit vielen Paragrafen und seinem Namen darauf, Calogero Musumeci.
»Ich würde es ja verkaufen, um meine arme Familie ernähren zu können, aber wer kauft einem Sünder wie mir schon ein Haus ab?«
»Wie viel ist es denn wert?«
»Nun ja, ich habe es damals für fünfhundert Lire gekauft und bestimmt weitere fünfhundert in die Verschönerung gesteckt. Aber in meiner Lage und um Buße zu tun, auch wenn es mir das Herz bricht, würde ich es auch für … fünfhundert abgeben.«
»Hundert«, sagt Salvatore. Es kommt ihm einfach so über die Lippen auf seiner Seite des Beichtstuhls. Als ob der Heilige Geist über ihn gekommen sei, um ihn für seinen Edelmut zu belohnen.
»Wie meinen, padre?«
»Hundert Lire. Und hundert Rosenkränze, und du wirst dich nie wieder dort blicken lassen. Das soll deine Buße sein.«
Musumeci windet sich, jammert, greint, rauft sich die Haare. »Zweihundert!«, fleht er, aber Salvatore bleibt eisern, ganz die strenge Stimme des Herrn. Fast bereut er, das Priesteramt bald aufgeben zu müssen.
Einen Monat später erreicht er mit der hochschwangeren Pancrazia einen sterbenden Ort mit großer Geschichte auf dem Monte Tauro. Vergeblich sucht er das Haus, dessen Besitzurkunde er überall herumzeigt. Niemand jedoch hat je von einem Musumeci gehört, geschweige denn von dem leer stehenden Haus. Der maresciallo der Carabinieri erklärt Salvatore, dass die Besitzurkunde eine Fälschung sei. Keine üble Fälschung, muss er schon zugeben, aber dennoch eine deutliche Fälschung. Der maresciallo lässt einen Bericht schreiben, und das war’s.
Salvatore tobt. Schreit, flucht, brüllt sich die Wut aus dem Leib, als ihm der Betrug endlich klar wird. Pancrazia bleibt die ganze Zeit ruhig, hält sich nur den Bauch, denn sie weiß, es ist bald so weit. Sie brauchen eine Unterkunft. Sie schlägt vor, zurück nach Gravina zu gehen, aber das kommt für Salvatore nicht infrage, zu ungeheuerlich die Schande. Er verkündet, dass Gott es eben so gewollt habe, dass sie in diesem Taormina enden wie einst Maria und Josef in Bethlehem. Und sie finden auch kaum etwas Besseres als einen Stall.
Durch die Vermittlung des maresciallo mieten sie von einem Dottore Passalacqua eine Ruine von Haus, direkt am Hang gelegen, mit Rissen in den Mauern, Türen, die nicht mehr schließen, und das nachts wie unter Qualen stöhnt. Salvatore gefällt das. Er fühlt sich sofort dem Haus verbunden und stöhnt nachts mit ihm um die Wette.
In diesem Haus, unter dem Stöhnen der Balken, dem Wehklagen des Vaters und dem Wimmern der Mutter, kommt mein Urgroßvater Barnaba Carbonaro im Jahre 1880 im Zeichen des Widders zur Welt, dem Zeichen des Willens und der unerschütterlichen Zuversicht.
Überhaupt ein Jahr der Durchbrüche. Auf der Baustelle des Gotthardtunnels erfolgt der Durchstich, Thomas Alva Edison erfindet die Glühbirne, der Kölner Dom wird nach sechshundert Jahren Bauzeit endlich fertig, und das zerstückelte Deutschland wird unter Otto von Bismarck zum Deutschen Reich. Die Welt elektrifiziert sich, in London, Paris und Berlin werden die ersten Telefonleitungen und Straßenbahnschienen verlegt. In den Fabriken laufen Fließbänder, und wie am Fließband produziert eine junge Industrie neue Errungenschaften, unter anderem eine immer selbstbewusstere Arbeiterklasse. Briefe werden jetzt mit vorbezahlten Briefmarken transportiert, und überall in Europa erheben sich die ersten Luftschiffe vom Boden. Die Welt träumt vom Fliegen und von Geschwindigkeit, die Welt liegt mit einem neuen Jahrhundert in den Wehen, und die europäischen Metropolen bereiten sich schon mal auf seine Geburt vor. Sie folgen endlich den Empfehlungen von Louis Pasteur und Robert Koch, lüften kräftig durch, legen Kanalisationen und Parks an, karren den Abfall weg, zentralisieren Schlachthöfe und Friedhöfe und beuten nebenbei ihre Kolonien aus. Die Städte stinken auf einmal weniger, werden luftiger und hygienisch, auch wenn es in Hamburg und Neapel immer noch zu Choleraausbrüchen kommt.
Als Barnaba Carbonaro in Taormina seinen ersten Schrei tut, stehen seine Überlebenschancen eins zu drei. Wegen der miserablen medizinischen Versorgung verlaufen schon kleinste Infektionen oft tödlich. Barnaba jedoch erweist sich von robuster Gesundheit, mit einer kräftigen Stimme und einem unerschütterlichen Überlebenswillen. Ein kleines Kind, und klein wird er immer bleiben, aber vielleicht toben die Wetter des Lebens deswegen ohne größeren Schaden über ihn hinweg.
Als er fünf wird, schickt ihn sein Vater statt zur Schule zum Arbeiten in die Orangenplantage des Dottore Passalacqua, die dieser von einem enteigneten Barone di Belfiore übernommen hat. Da die Orangenbäume im Wuchs niedrig gehalten werden, setzt man für die drei Ernten im Jahr gerne Kinder ein. Die bekommen auch noch weniger als die braccianti, die Landarbeiter und Tagelöhner.
Barnaba ist ein kräftiges Kind und verrichtet die schwere Arbeit ohne Murren. Er versteht schnell, dass man die Früchte nicht einfach vom Stiel abreißen, sondern sorgsam mit dem Fingernagel lösen muss, damit der Baum an dieser Stelle wieder blühen kann. Überhaupt gefällt Barnaba die Arbeit zwischen den duftenden Spalieren durchaus, und weil er sonst nichts lernt, lernt er eben begierig alles über die verschiedenen Orangensorten.
Sein Vater Salvatore dagegen hat es nicht so mit harter Landarbeit. Wenn er nicht gerade kränkelnd im Bett liegt, gewürgt von der Scham über Musumecis Betrug, holt er manchmal mit Antonio Bagarella frisches Meerwasser für den Baron aus Giardini herauf. Oder zieht wochenlang als cantastorie über die Dörfer, singt auf Marktplätzen Moritaten über die Wunder und Schrecken der Welt, die ihm in Taormina von den Fremden zu Ohren kommen. Sogar mit gewissem Erfolg, muss man sagen. Der Applaus, die paar Lire und die ergriffenen Blicke der Frauen wärmen sein Herz, das sich so sehr nach Aufmerksamkeit verzehrt. Irgendwo findet sich immer eine gastfreundliche Familie, die ihn aufnimmt, manchmal sogar eine Witwe, die ihn nachts wärmt.
Zu jener Zeit sind die cantastorie, die Geschichtensinger, für die sizilianische Landbevölkerung neben den amtlichen Bekanntmachungen die einzige Nachrichtenquelle über all das, was außerhalb ihrer kleinen Welt vorgeht. Manche Sängerinnen und Sänger werden verehrt wie Götter.
Vielleicht hätte Salvatore sogar berühmt werden können, aber irgendwann hört er von einem Tag auf den anderen damit auf. Vielleicht weil ihn zahllose Zipperlein plagen, unter anderem das Heimweh. Vielleicht weil er sich einem gehörnten Ehemann entziehen muss. Vielleicht einfach weil ihm der Mut fehlt.
Der Mut, an sich zu glauben.
Stattdessen richtet Salvatore in seinem Herzen ein kratziges Lager aus verletztem Stolz und Schuldzuweisungen ein, aus Bitterkeit, Neid und Scham, von dem er sich nie mehr erhebt.
Pancrazia muss die Familie mit Näharbeiten, Kräutermischungen und Talismanen durchbringen. Es reicht hinten und vorne nicht, aber Salvatore kümmert sich nicht gerne ums Finanzielle. Die Miete von zwanzig Lire pro Monat ist der reine Wucher, und Pancrazia bangt vor jedem Monatsersten, wenn der Dottore Passalacqua zum Kassieren kommt. Oft genug muss sie um Stundung bitten, muss sich drohen lassen, dass der Dottore sie allesamt von den Carabinieri rausschmeißen lassen wird. Einmal macht sich Pancrazia daraufhin auf den Weg, um Passalacqua persönlich um Aufschub zu bitten. Danach kehrt sie mit verschlossenem Gesicht zurück, und der kleine Barnaba beobachtet, wie sie sich hinter dem Haus am ganzen Körper mit Seife und einem Bimsstein aus Lava abschrubbt. Es wird auch nicht das letzte Mal bleiben, aber Salvatore fragt nie, wieso der Dottore ihnen manchmal die Miete stundet. Er betrachtet es als Zeichen des Respekts des Dottore vor seiner adligen Abstammung.
Da er lesen und schreiben kann und immer noch über eine Reserve an nobler Blasiertheit verfügt, verdient Salvatore sich hin und wieder ein paar Lire als Behördengeher. Eine Tätigkeit, die nicht gut angesehen ist und von den Behörden nur mehr oder weniger geduldet wird. Behördengeher gelten als gewinnsüchtige Blutsauger, dabei verdienen sie kaum etwas. Ein Behördengeher muss oft tagelang vor den Ämtern oder Gerichten herumlungern, um Heiratsurkunden, Geburtsurkunden, Todesurkunden, notarielle Verträge, Eintragungen ins Strafregister oder auch nur Auskünfte über schwebende Verfahren zu besorgen und abzuwickeln. Er muss Kontakte zu den Beamten in Giardini aufbauen, sie in Cafés einladen und sie von seinem kargen Lohn bestechen. Selbst die Pförtner kassieren ab. Ein Behördengeher muss gewitzter sein als die anderen Behördengeher, und von seinem Lohn muss er auch noch die Gebührenmarken bezahlen. Aber vor allem muss er für seine Kunden, die dafür entweder keine Zeit haben oder einfach Analphabeten sind, warten. Warten, Schlange stehen, den Beamten kurz nach Schalterschluss persönlich abpassen, ihm schmeicheln, sich abweisen lassen, wiederkommen und wieder warten. Je höher die Beamten, desto seltener erscheinen sie im Amt. Manchmal vergehen mehrere Tage nur für einen einzigen Auftrag, der Salvatore am Ende gerade mal zwei Lire einbringt.
Das alles, die Scham über die eigene Armut, das Warten, die Erniedrigung vor den Beamten, der Selbsthass und der Hass auf, ach, jede kleine Laus, die ihm über die Leber läuft, all das schürt Salvatores Wut. Tag für Tag. Lässt sie anschwellen wie ein Furunkel, gegen das Pancrazia keine Salbe hat. Nur ihren schimmernden Körper, den bespringt er immer noch gerne, aber kurz darauf schlägt er sie schon wieder grün und blau. Einmal so schlimm, dass er ihr eine Rippe bricht und Pancrazia das Bett für mehrere Wochen nur kniend machen kann.
»Der Mann ist der Herr des Hauses und auch der Frau«, sagen die Frauen am Waschplatz. »Die Frau muss kurzgehalten werden, wer weiß, wo sie sonst landet«, sagen die Frauen, laut genug, damit die jungen Mädchen es auch früh genug hören. »Wenn eine Frau eine Stute ist und dem Mann widerspricht und ihn beschimpft und ankeift und das letzte Wort haben will, dann ist es nur richtig, wenn der Mann sie schlägt.« Oder sie sagen: »Unser sind die Zärtlichkeiten und auch die Prügel. Man kommt nicht ohne Ordnung aus. Eine ordentliche Frau sagt nicht, dass es ihr Mann war, selbst ihrer Mutter nicht.«
Wenn ein Mann krank wird, betet seine Frau zur Muttergottes, sie leckt den Boden der Kirche vom Eingang bis zum Altar sauber, damit er wieder gesund wird. »Madonna, nimm mein Kind, aber lass mir den Mann«, hört man viele Frauen beten, während sie würgend Speichel, Staub, Schmutz und Kinderpisse auflecken, bis ihre ausgefransten Zungen bluten. Und dann, am Altar angekommen, bedanken sie sich bei der Muttergottes mit glühendem Herzen. Hartgesottene Männer hat man bei diesem Anblick weinen sehen, aber niemals hat man eine dieser Frauen weinen sehen, denn wer Buße tut, muss sich standhaft zeigen.
Auch Pancrazia sieht man niemals weinen. Aber auch nie lachen, und sie beteiligt sich auch nie am Dorftratsch und den Lästereien der Nachbarinnen. Das zusammen mit den Kräutermischungen und den Talismanen trägt ihr eine dunkle Aura ein, der man besser nicht zu nahe kommt.
Sie wird wieder schwanger, aber das Mädchen verstirbt nach einem halben Jahr an Unterernährung. Im nächsten Jahr gebiert Pancrazia ein weiteres Mädchen, das wird Maria getauft und überlebt. Salvatore liebt sie so sehr, dass er seine Frau fast gar nicht mehr schlägt. Aber in dem Winter, als sie vier wird, erkrankt Maria an Keuchhusten, und trotz Pancrazias ganzer Kunst verschlechtert sich ihr Zustand. »Du bringst sie um! Du bringst sie um!«, schreit Salvatore in Raserei. Er rennt zum Apotheker, einem Säufer und Quacksalber, der ihm für Salvatores letzte sechs Lire einen Sirup zusammenmischt. Kaum hat Salvatore der kleinen Maria den Sirup eingeflößt, bekommt sie fürchterliche Krämpfe und verstirbt noch in der gleichen Nacht. Der Apotheker hatte zwei Fläschchen verwechselt. Weil der Apotheker aber ein Cousin des Dottore Passalacqua und mit dem Priester gut bekannt ist, wird rasch der Totenschein ausgestellt. Barnaba, sieben Jahre alt, sieht stumm zu, wie seine tote Schwester früh am nächsten Morgen weggebracht wird, und das Sediment seiner Kindheitserinnerungen verdichtet sich um eine weitere schwarze Schicht.
Ohnmächtig vor Schmerz und Wut schreit Salvatore auf der Straße, dass er den Apotheker umbringen werde und den Dottore Passalacqua gleich dazu. Es gelingt den Nachbarn nur mit Mühe, ihn zurückzuhalten. Denn wer aufmuckt, verschwindet.
Und Salvatore verschwindet.
MÜNCHEN 1960
Erst als das Gleis sich fast vollständig geleert hat, betritt Barnaba Carbonaro wieder Münchner Boden. Er trägt einen grauen Wollmantel mit Pelzkragen, schlenkert mit seinem Gehstock, zum Zeichen, dass er ihn nicht braucht, während hinter ihm der Schaffner einen bulligen Überseekoffer, groß wie ein Tresor, und einen leichten Reisekoffer auf den Bahnsteig hievt. In dem Reisekoffer befindet sich, dick in Wachspapier und Zeitung verpackt, ein prächtiger Oktopus, den der Patriarch kurz vor seiner Abreise frisch auf dem Fischmarkt von Catania gekauft hat und der dringend ins kochende Wasser muss.
Mein Großvater Nino und mein Vater Barnaba, genannt Toni, erwarten ihn am Ende des Bahnsteigs. Mein Vater ist damals fünfundzwanzig, aber auf dem Familienfoto sieht er viel älter aus. Alle sehen in dieser Zeit viel älter aus. Der Patriarch drückt Toni herzlich an sich, küsst ihn auf beide Wangen, kneift ihn, sieht ihn sich an. Bevor er allerdings auch seinen Sohn Nino auf diese Weise begrüßen kann, küsst ihm mein Großvater schon die Hand.
Mein Großvater Nino wirkt nervös wie ein Jugendlicher, der heimlich geraucht hat. Wie eine hastig hingekritzelte, ängstliche Kopie seines Vaters. Er trägt einen weit geschnittenen kamelfarbenen Nadelstreifenanzug aus feinster Wolle, den er noch in der Nacht fertig genäht hat. Dazu polierte Budapester, Mantel und Hut und ebenfalls einen Gehstock. Alles zum Zeichen, dass er nicht zu den armen Schluckern gehört, die in Grüppchen im Bahnhof herumstehen, rauchen, reden, gestikulieren, nichts weiter, dennoch misstrauisch von den Deutschen beäugt. Dabei kommen sie einfach nur jeden Sonntag auf dem Bahnhof zusammen wie sonst auf der Piazza ihrer Heimatdörfer. Sie kommen aus Baracken in der Au, in Haidhausen und aus dem Hasenbergl, wo sie sich zu sechst ein Zimmer teilen. Sie haben den Hauptbahnhof zur Piazza gemacht und kommentieren verstohlen das Männertrio mit den zwei Koffern von Gleis 11.
Kennt man die? Ist das nicht? Der Sohn. Der Vater. Vom Billard. Catania. Terroni. Erdfresser. Halt bloß dein Maul, Polentafresser. Selbst dein Maul, Afrikanerzwerg. Hat der nicht? Doch hat er. Schon damals. Die Tochter, wie heißt die, Pancrazia, Maria? Die mit den Mandarinen? Pellen würd ich sie wohl, sanft ihr Häutchen zupfen. Nein, die trägt Hosen, die ist nicht Fisch noch Fleisch. Die andere, Aurora. Ja, die mit der Stimme. Madonna, diese Stimme. Wie eine Moro so schwarzrotsaftigsüß, die. Der würde ich. Den Saft. Vergiss es, Afrikanerzwerg.
Lippen werden beleckt, Zigaretten bis zum Daumennagel abgeraucht, Stummel ausgetreten, Blicke senken sich, als die drei Carbonaro vorbeigehen.
Nur ein Wörtchen. Das Zöpfchen flechten. Den Dienst ihr erweisen. Pancrazia, Aurora, wie auch immer. Die Schwarzrotsaftigsüße schon zum Singen bringen. Die Glocken läuten. Pass auf, was du redest. Pass selber auf. Zwei Brüder, der da, Toni, ist der ältere. Was schert’s mich.
Ausgehungertes Gerede, Sizilianer, Kalabresen, welche aus dem Norden. Sie ducken sich unter den Blicken der Deutschen weg, denn jeden Tag aufs Neue wird ihnen eingebläut, dass Gäste in diesem Land gefälligst still zu sein und nicht nach Knoblauch zu riechen haben. Die Fremdheit schweißt sie zusammen. Der Hauptbahnhof vereint sie, wo sie Neuigkeiten austauschen, wo sie Geilheit, Wut und Heimweh mit dem Zigarettenrauch aufsteigen lassen, denn morgen müssen sie schon wieder ran, schuften, malochen, die Knochen hinhalten.
Es ist ein Sonntag, und es schneit. Genau wie damals, als Barnaba neunzehnjährig zum ersten Mal in München ankam. Vor dem Bahnhof parkt ein Hanomag-Pritschenwagen im Halteverbot. Carbonaro – Südfrüchte Import steht auf der Plane, ein Schupo stiefelt grantig um den Kleinlaster herum und schreibt das Kennzeichen ab.
»Ah, gell, des hab i mir scho denkt«, grantelt er los, als er die drei Sizilianer mit dem Überseekoffer durch den Schnee heranschlurfen sieht. »Heda, Katzlmacher, ist des dein Fahrzeug da? Des. Fahrzeug. Deins? Hab i g’fragt. Papiere! Aber ganz schnell.«
Der Schnee fällt in dicken Flocken, dämpft alle Geräusche. Unbewegt sieht Barnaba Carbonaro zu, wie Nino und Toni mit dem Verkehrspolizisten diskutieren. Barnaba Carbonaro versteht kaum ein Wort, denn richtig Deutsch hat er nie gelernt. Er hofft nur, dass Nino sein Temperament im Griff hat, denn er hat erlebt, wie schnell Begegnungen mit uniformierten Deutschen eskalieren können. Er erinnert sich an Bianchinis Traum vor langer Zeit, der am Ende wahr geworden ist, als der Brennkofer von gegenüber und seine uniformierten Bestien das Ehepaar Reis auf offener Straße erschlugen. Gerade mal fünfzehn Jahre ist es erst her, dass sogar ein falsch geparktes Auto, ein hitziges Wort zur Deportation führen konnten.
»Hier in Deutschland, do hat’s a Straßenverkehrsordnung, hast mi, Makkaroni? Da gibt’s ned a so a Umanandergwurschtl wie bei euch dahoam.«
Barnaba spürt, wie ihm der Schweiß ausbricht. Er fasst sich an die Brusttasche, dort, wo sein deutscher Pass steckt, und sieht, wie Toni den Strafzettel entgegennimmt. Unter den strengen Blicken des Schupos bugsiert Nino den Patriarchen hastig auf den Beifahrersitz des Hanomag und quetscht sich selbst dazu. Im Wagen ist es kalt, eiskalt.
»Du hättest mich mit dem Mercedes abholen sollen, Nino«, brummt der Patriarch, als Toni den Hanomag durch den Schnee manövriert und das Heizungsgebläse endlich warme Motorluft in die Kabine pustet. »Vor einem Mercedes haben die deutschen Polizisten Respekt, da schreiben sie keine Strafzettel.«
Nino räuspert sich verlegen. Toni konzentriert sich aufs Fahren.
»Ist irgendwas mit dem Mercedes?«
Nino windet sich. »Es ist so, papà … Wir haben ihn … also letztes Jahr verkauft.«
»IHR HABT MEINEN MERCEDES VERKAUFT?«, brüllt der Patriarch. Da ist er gerade mal seit einer Stunde in München.
»Er war … nun ja, doch schon sehr alt, papà.«
»ER WAR SO GUT WIE NEU!«
»Er hatte über zweihunderttausend Kilometer auf dem Buckel.«
»Das ist kein Alter für einen Mercedes. Ein Mercedes kann hundert Jahre alt werden und Millionen Kilometer fahren. Er lief tadellos wie ein Uhrwerk.«
»Der Mercedes stand doch nur herum«, schaltet sich jetzt Toni ein. »Es gab schon Gerede, weil Autos immer noch knapp sind. Es war ein günstiger Zeitpunkt, nonno.«
»Wo ist der Wagen jetzt?«
»Mario Buscemi hat ihn gekauft.«
»Seid ihr wahnsinnig? Wie konntet ihr mir das antun!? Ihr hättet mich fragen müssen!«
»Aber das habe ich!«, beteuert Nino lebhaft. »Ich habe angerufen. Wegen des Kredits, erinnerst du dich? Du wolltest nichts davon hören. Da hat mamma gesagt, dass ich den Mercedes verkaufen soll.«
»Das hat sie gesagt? Dass du ihn verkaufen sollst?«
»Genau so hat sie es gesagt. Ich schwöre es, papà.«
»Ihr habt mich verraten!«