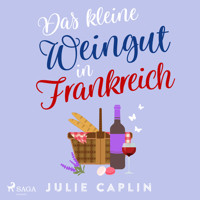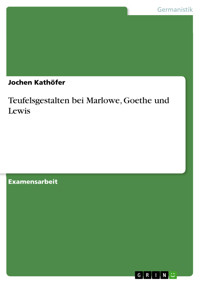
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 2,3, Universität zu Köln (Institut für deutsche Sprache und Literatur), Veranstaltung: 1. Staatsexamen für Lehramt an Schulen in der Sekundarstufe II, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Figur des Teufels hat eine Vielzahl von Autoren der verschiedenen literarischen Gattungen in den letzten Jahrhunderten wie kaum eine andere inspiriert. Die älteste im europäischen Kulturkreis weithin bekannte Teufelsgeschichte ist im alttestamentlichen Buch Hiob überliefert. Das Motiv der Versuchung des Menschen durch den Teufel hat bis in die heutige Zeit nichts von seiner literarischen Faszination verloren, wobei das Thema im Laufe der Zeit immer wieder variiert wurde. Auch die drei für diese Hausarbeit ausgewählten Autoren haben sich mit diesem Thema eingehend in ihren Werken auseinandergesetzt. Johann Wolfgang von Goethe (mit seinem zweiteiligen Drama Faust) und Christopher Marlowe (mit Doctor Faustus) haben sich der Faustsage angenommen, während C. S. Lewis mit den Screwtape Letters in diesem Themenbereich keinem literarischen Vorbild explizit folgt. Um eine möglichst genaue Analyse vornehmen zu können und sich nicht in Nebenschauplätzen zu verlieren, werden die Teufelsfiguren in anderen Werken dieser Autoren nicht erwähnt. Die hier ausgewählten Werke stellen unzweifelhaft die deutlichste Auseinandersetzung der Autoren mit der Teufelsthematik dar; dabei darf natürlich nicht vergessen werden, dass diese Thematik bei aller Wichtigkeit nicht immer im Mittelpunkt der Werke stand. Die Auswahl der drei Autoren geschah unter Berücksichtigung der Verknüpfungen zwischen den Werken: Goethe lernte Christopher Marlowes Drama zwar erst gegen Ende seiner Arbeiten am Faust kennen, greift aber auf den selben Grundstoff, die Volkssage von Dr. Johann Faust, zurück. Auf den ersten Blick scheint der Text von Lewis daneben ein wenig deplaziert, doch sei hier darauf verwiesen, dass Lewis in seiner Funktion als Literaturwissenschaftler die beiden anderen Texte bekannt waren. Hinzu kommt, dass die Texte drei verschiedenen kulturellen Epochen entstammen, die zwar zeitlich weit voneinander entfernt sind, aber durchaus miteinander in Beziehung stehen: die Renaissance bereitet der Aufklärung den Weg, die zu Zeiten Goethes ihren Weg nach Deutschland gefunden hat. Lewis schrieb die Screwtape Letters vor dem Hintergrund der Moderne, die die Aufklärung sowohl verinnerlicht als auch zum Teil überwunden hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2002
Ähnliche
Page 1
Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt
für die Sekundarstufe II, dem Staatlichen Prüfungsamt für Erste
Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen in Köln vorgelegt von:
Page 3
3. Das Wirken der Teufelsfiguren bei Marlowe, Goethe und Lewis
3.1. Die Werke in kurzen Zusammenfassungen 3.1.1. MarlowesDoctor Faustus3.1.2. GoethesFaust3.1.3. Lewis’Screwtape Letters
3.2. Die unterschiedlichen Strategien der Teufelsgestalten 3.2.1. Warum die Faustdramen getrennt von den 3.2.2. Der Teufelspakt bei Marlowe und Goethe
3.2.3. Der versteckte Versucher in Lewis'Screwtape
3.3. Die vertikalen und horizontalen Beziehungen der Teufelsfiguren
3.3.1. Das Verhältnis der Teufelsfiguren zu Gott 3.3.2. Die Teufelsfiguren im Umgang mit den 3.3.3. Das Selbstkonzept der Teufelsfiguren und ihre 3.4. Realität und Gestalt der Hölle
Page 4
4. Der unmittelbare Werkhintergrund4.1. Die Stellung des Werks innerhalb der Biographie und Schaffensgeschichte
4.1.1. Christopher Marlowe undDoctor Faustus4.1.2. DerFaustim Leben und literarischen Schaffen 4.1.3. C. S. Lewis und dieScrewtape Letters4.2. Die Bedeutung der Religion im Leben der Autoren 4.2.1. Christopher Marlowe unter dem Einfluss der 4.2.2. Goethes umfangreiche Beschäftigung mit den 4.2.3. Der lange Weg des C. S. Lewis zum 4.3. Literarische und historische Hintergründe 4.3.1. Das Buch Hiob und GoethesFaust4.3.2. Der zweite Weltkrieg und Lewis’Screwtape4.4. Die Intentionen der Teufelsgeschichten5. Zusammenfassung der Ergebnisse und abschließende Bemerkungen Literaturverzeichnis Abschlusserklärung
Page 5
- Seite 5 -1.Über das Thema, die Methode und die Intention dieser ArbeitDie Figur des Teufels hat eine Vielzahl von Autoren der verschiedenen literarischen Gattungen in den letzten Jahrhunderten wie kaum eine andere inspiriert. Die älteste im europäischen Kulturkreis weithin bekannte Teufelsgeschichte ist im alttestamentlichen Buch Hiob überliefert. Das Motiv der Versuchung des Menschen durch den Teufel hat bis in die heutige Zeit nichts von seiner literarischen Faszination verloren, wobei das Thema im Laufe der Ze it immer wieder variiert wurde. Auch die drei für diese Hausarbeit ausgewählten Autoren haben sich mit diesem Thema eingehend in ihren Werken auseinandergesetzt. Johann Wolfgang von Goethe (mit seinem zweiteiligen DramaFaust)und Christopher Marlowe (mitDoctor Faustus)haben sich der Faustsage angenommen, während C. S. Lewis mit denScrewtape Lettersin diesem Themenbereich keinem literarischen Vorbild explizit folgt. Um eine möglichst genaue Analyse vornehmen zu können und sich nicht in Nebenschauplätzen zu verlieren, werden die Teufelsfiguren in anderen Werken dieser Autoren nicht erwähnt. Die hier ausgewählten Werke stellen unzweifelhaft die deutlichste Auseinandersetzung der Autoren mit der Teufelsthematik dar; dabei darf natürlich nicht vergessen werden, dass diese Thematik bei aller Wichtigkeit nicht immer im Mittelpunkt der Werke stand. Die Auswahl der drei Autoren geschah unter Berücksichtigung der Verknüpfungen zwischen den Werken: Goethe lernte Christopher Marlowes Drama zwar erst gegen Ende seiner Arbeiten am Faust kennen, greift aber auf den selben Grundstoff, die Volkssage von Dr. Johann Faust, zurück. Auf den ersten Blick scheint der Text von Lewis daneben ein wenig deplaziert, doch sei hier darauf verwiesen, dass Lewis in seiner Funktion als Literaturwissenschaftler die beiden anderen Texte bekannt waren. Hinzu kommt, dass die Texte drei verschiedenen kulturellen Epochen entstammen, die zwar zeitlich weit voneinander entfernt sind, aber durchaus miteinander in Beziehung stehen: die Renaissance bereitet der Aufklärung den Weg, die zu Zeiten Goethes ihren Weg nach Deutschland gefunden hat. Lewis schrieb dieScrewtape Lettersvor dem Hintergrund der Moderne, die die Aufklärung sowohl verinnerlicht als auch zum Teil überwunden hat. Auf jeden Fall l ässt sich eine kontinuierliche Veränderung des Weltbildes in der Zeitspanne vom späten 16. bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts feststellen. Es stellt sich daher
Page 6
- Seite 6 -dieFrage, in welchem Ausmaß diese Veränderung in der Wahrnehmung des Teufels und seiner literarischen Ausgestaltung Niederschlag gefunden hat. In der Auswahl der Textvariante habe ich mich bei Christopher MarlowesDoctor Faustusfür den A-Text aus dem Jahr 1604 entschieden, weil dieser der ursprünglichen Version Marlowes am weitesten entspricht; eine noch zeitnähere Version ist leider nicht erhalten. Die späteren Versionen tragen eindeutig die Handschrift der späteren Bearbeiter und weichen dementsprechend vom Original ab. Bezüglich des Goetheschen Faust werde ich mich vor allem auf den ersten Teil der Tragödie beziehen, da hier die Figur Mephistos am stärksten entwickelt wird. Aus dem zweiten Teil sind vor allem die Schlussszenen interessant, weil sie Antworten auf die Fragen nach der Stellung Mephistos und nach seinem Selbstverständnis anbieten, die die Aussagen des ersten Teils nicht nur bestätigen, sondern auch ergänzen. Um den Umgang der hier ausgewählten Autoren mit der Figur des Teufels zu verdeutlichen, wird zuerst kurz die historische Entwicklung des Teufelsbildes von seinen Anfängen im A lten Testament über den Verlauf der mitteleuropäischen Kultur- und Kirchengeschichte bis in die heutige Zeit nachgezeichnet. Dabei geht es nicht darum, die verschiedenen Teufelskonzepte in bezug auf ihre Wahrscheinlichkeit zu bewerten, auch wenn uns einige von ihnen fremd und tief abergläubisch erscheinen; statt dessen soll auf diese Weise der historische und gesellschaftliche Hintergrund illustriert werden, vor dem die Werke der drei Autoren entstanden. Im Anschluss daran werden die ausgewählten Texte einer eingehenden Betrachtung unterzogen, um den Rückgriff auf die tradierten Teufelsvorstellungen ebenso wie ihre Variation herauszuarbeiten. Hierzu wird, soweit dies verfügbar ist, Material zur Gottesbeziehung der Autoren herangezogen. Es wird dabei versucht, auf eigene Aussagen der Autoren zu rekurrieren, da diese als glaubwürdiger zu bewerten sind als die Wertungen anderer. Zum näheren Hintergrund gehören ebenso literarische Vorlagen und historische Besonderheiten, die das jeweilige Werk beeinflussen. Es wird sich die Frage stellen, ob die Autoren in ihren Werken ein individuelles, alternatives Teufelsbild transportieren, oder ob sie darin das allgemein akzeptierte Bild ihres Umfeldes abgebildet haben. Zum Abschluss wird die Frage zu klären sein, welche Intentionen die drei Autoren mit der Verwendung teuflischer Figuren in ihren Werken verfolgen.
Page 7