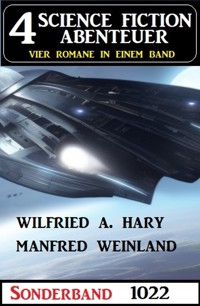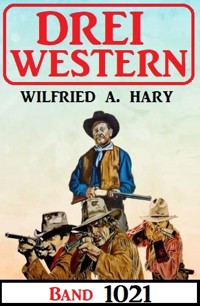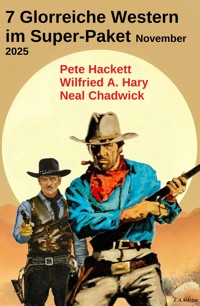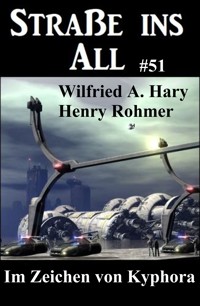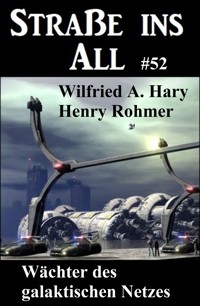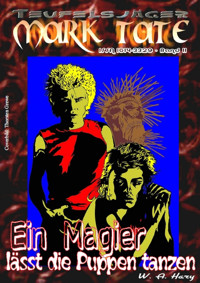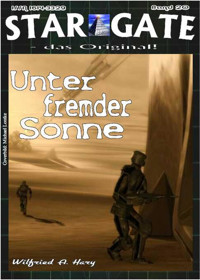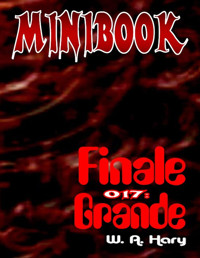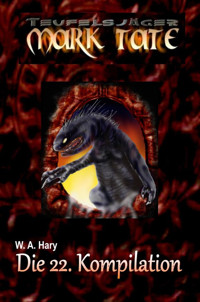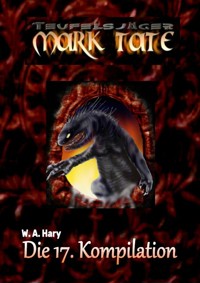
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
TEUFELSJÄGER: Die 17. Kompilation
- A. Hary (Hrsg.): „Diese Kompilation beinhaltet die Bände 101 bis 110 der laufenden Serie!“
Enthalten in dieser Sammlung:
101/102 »Killerdämonen« / »Dunkle Bruderschaft« W. A. Hary
103/104 »Krieg der bösen Geister« / »Der Werwolf« W. A. Hary
105/106 »Verlorene Seelen« / »Biss des Todes« W. A. Hary
107/108 »Sphäre der Erinnerung« / »New-York-Cops« W. A. Hary
109/110 »Blutiges Herz« / »Ort des Schreckens« W. A. Hary
Die Serie TEUFELSJÄGER Mark Tate erschien bei Kelter im Jahr 2002 in 20 Bänden und dreht sich rund um Teufelsjäger Mark Tate. Bis Band 20 wurde sie von HARY-PRODUCTION neu aufgelegt und ab Band 21 nahtlos fortgesetzt!
Nähere Angaben zum Autor siehe auf Wikipedia unter dem Suchbegriff Wilfried A. Hary!
Urheberrechte am Grundkonzept zu Beginn der Serie Teufelsjäger Mark Tate: Wilfried A. Hary!
Copyright Realisierung und Folgekonzept aller Erscheinungsformen (einschließlich eBook, Print und Hörbuch)
by HARY-PRODUCTION
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
TEUFELSJÄGER: Die 17. Kompilation
„Diese Kompilation beinhaltet die Bände 101 bis 110 der laufenden Serie!“
Die Serie TEUFELSJÄGER Mark Tate erschien bei Kelter im Jahr 2002 in 20 Bänden und dreht sich rund um Teufelsjäger Mark Tate. Bis Band 20 wurde sie von HARY-PRODUCTION neu aufgelegt und ab Band 21 nahtlos fortgesetzt!BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTEUFELSJÄGER: Die 17. Kompilation
TEUFELSJÄGER:
Die 17.
Kompilation
W. A. Hary (Hrsg.)
Impressum:
Diese Kompilation beinhaltet Bände aus der laufenden Serie rund um Mark Tate, natürlich für das Buchformat optimiert.
Alleinige Urheberrechte an der Serie: Wilfried A. Hary
Copyright Realisierung und Folgekonzept aller Erscheinungsformen
(einschließlich eBook, Print und Hörbuch) by www.haryproduction.de
Copyright dieser Fassung 2018 by www.HARYPRODUCTION.de
Canadastr. 30 * D66482 Zweibrücken
Telefon: 06332481150
eMail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung jedweder Art nur mit schriftlicher Genehmigung von HaryProduction.
Covergestaltung: Anistasius
Die Serie TEUFELSJÄGER Mark Tate erschien bei Kelter im Jahr 2002 in 20 Bänden und dreht sich rund um Teufelsjäger Mark Tate. Bis Band 20 wurde sie von HARY-PRODUCTION neu aufgelegt und ab Band 21 nahtlos fortgesetzt!
Es ist kein Wunder, dass sich Kompilationen, also Sammlungen von mehreren Büchern und Texten in einem einzigen Band vereint, immer größerer Beliebtheit erfreuen. Immerhin bieten sie eine Fülle von Lesestoff für einen kleineren Geldbeutel. Unsere Kompilationen gibt es für jede Serie, und darin sind die Romane und Texte in ihrer richtigen Reihenfolge geordnet, so dass jeder seine Lieblingsserie nach Belieben zusammenstellen und sie am Ende vollständig besitzen kann. Sowohl als eBook, erhältlich über wirklich alle relevante Plattformen, als auch (natürlich!) als gedruckte Bücher, ebenfalls über alle maßgeblichen Plattformen erhältlich.
Wie zum Beispiel dieser Band aus der Serie rund um Mark Tate:
TEUFELSJÄGER: Die 17. Kompilation
W. A. Hary (Hrsg.): „Diese Kompilation beinhaltet die Bände 101 bis 110 der laufenden Serie!“
Enthalten in dieser Sammlung:
101/102 »Killerdämonen« / »Dunkle Bruderschaft«
W. A. Hary
103/104 »Krieg der bösen Geister« / »Der Werwolf«
W. A. Hary
105/106 »Verlorene Seelen« / »Biss des Todes«
W. A. Hary
107/108 »Sphäre der Erinnerung« / »New-York-Cops«
W. A. Hary
109/110 »Blutiges Herz« / »Ort des Schreckens«
W. A. Hary
TEUFELSJÄGER 101:
W. A. Hary
Killerdämonen
...und blondes Gift für schwarze Seelen
Ich schätzte die Herde auf mindestens zwanzig ausgewachsene gigantische Drachen, bei denen auch der kleinste Zahn noch eine prima Sitzgelegenheit für einen Menschen ergeben hätte – und die größten Zähne ihn deutlich überragten.
Schon einmal hatte mich ein Drachenbein regelrecht in den Boden gestampft. Und jetzt waren das immerhin rund zwanzig Beinpaare, die nur danach zu gieren schienen…
*
Nicht nur May und mich schien die Unruhe gepackt zu haben angesichts der Gefahr, sondern auch den Elementargeist, dessen Erscheinungsweise als Irrlicht noch hektischer zu tanzen begann.
Es gab keinerlei Ausweichmöglichkeit für uns. Soviel stand fest. Die breite Front der Drachen preschte genau auf uns zu, unausweichlich. Sie strebten zum Ausgang aus dieser riesigen Schlucht, von dem also, was man in etwa als Drachennest bezeichnen konnte. Weil sie Angst hatten vor dem Elementargeist. Obwohl dieser ja den Ausweg eigentlich versperrte. Aber er war im Vergleich zu ihnen so winzig, dass sie in ihrer Panik wohl annahmen, an ihm vorbei zu können. Sie waren ja so viele – und er nur ein einzelnes winziges Irrlicht. Wenn ihre Front sich rechtzeitig teilte… Aber dann würden die meisten zumindest gegen die aufragenden Felswände donnern. Felsbrocken würden sich lösen. Wenn uns die Drachenbeine nicht zermalmten, dann zumindest eben diese Felsbrocken.
Obwohl wir in dieser Sphäre des Grauens so etwas wie unsterblich waren: Begraben unter tonnenschweren Felsmassen würde es für uns jedenfalls kein Entrinnen mehr geben. Blieben wir dann bis zum Ende aller Zeiten darunter lebendig begraben?
Dann lieber gleich tot!
Obwohl genau das uns hier nicht vergönnt war. Denn wir mussten überleben, unter allen Umständen. Sonst hoben wir die Neutralität der Sphäre auf und der Untote als ihr oberster Herr gelangte mit ihr wieder zur Erde. Um dort genau jenen Unfrieden zu stiften, wie er ihn sich vorgenommen hatte. Dann womöglich auch noch gemeinsam mit Mister X persönlich? Um die Hölle auf Erden triumphieren zu lassen, wobei alle Menschen deren Opfer werden würden?
Alles Dinge, die mir blitzschnell durch den Kopf schossen in diesen Sekundenbruchteilen, die uns noch verblieben.
Und dann stellte es sich heraus, was den Elementargeist so besonders unruhig hatte werden lassen. Nicht etwa Furcht vor den heran nahenden Drachenleibern, sonder eher wegen so etwas wie… Vorfreude!
Einen der Drachen hatte er ja bereits vor unseren Augen einfach verschlungen. Ich wusste aus eigener Erfahrung, wie das geschehen konnte: Dieses winzige Irrlicht war so etwas wie der Zugang zu einer inneren Sphäre des Elementargeistes. Sein ureigenes Universum, wenn man so wollte. Denn es war ziemlich groß. Ich war schließlich bereits persönlich dort gewesen. Und ich hatte einige der Dämonen, Magier und sogar Erzmagier gesehen, die Gefangene des Elementargeistes geworden waren im Verlaufe langer Zeit, um seine Macht zu mehren. Es war zwar trotzdem dem Untoten gelungen, ihn in seine eigene Falle zu locken und zum Bestandteil der Sphäre hier zu machen und somit zu seinem Gefangenen… Um seinerseits von der Macht des Elementargeistes zu zehren… Aber May und ich hatten ihn aus dem Einfluss des Untoten befreit. Jetzt war er mit uns, als unser wichtigster Verbündeter hier, in dieser Sphäre des Grauens.
Auch gegen die angreifenden Drachendämonen?
Blitzschnell blähte er sich auf – und erinnerte mich dabei wieder an mein Amulett, den Schavall, den ich hier schmerzlich vermisste. Obwohl: Hatte er mich denn nicht erst überhaupt in diese Lage gebracht?
Innerhalb eines winzigen Augenblicks war er groß genug, als ein aus sich heraus grell strahlendes Gebilde, um den erstbesten Drachen einfach zu verschlingen, den nämlich, der als erster anlangte.
Doch damit längst nicht genug: Auch in dieser Größe zuckte das Leuchtgebilde unruhig hin und her – und verschlang dabei jedes Mal einen anderen der riesigen Drachenmonster!
Ich vergaß, zu atmen – und natürlich auch, zu zählen. Schätzungsweise fünf oder sogar sechs riesige Drachen hatte der Elementargeist bereits verschlungen, als die Front endlich stoppte – und zurück drängte, weg von der Gefahr, die der Elementargeist für die Drachen bildete. Sie hatten endlich begriffen, dass es für sie in dieser Richtung kein Entrinnen gab - und jetzt flohen sie in entgegen gesetzter Richtung, um möglichst viel Entfernung zwischen sich und den Elementargeist zu bringen.
Schlagartig schrumpfte jener wieder bis auf Irrlichtgröße herab. Das Irrlicht tanzte in Brusthöhe vor uns herum. Ich beobachtete es aus weit aufgerissenen Augen und benötigte einige Sekunden, um endlich wieder meinen Blick davon lösen zu können.
„Wenn – wenn ich bedenke, dass es mir gelang, aus seinem Innern wieder zu entfliehen…“, murmelte ich brüchig.
May nickte heftig. Ich sah es, weil ich sie jetzt anschaute.
„Das hat ja auch dafür gesorgt, dass er einen solchen Respekt vor dir hat, Mark. Du hast in dieser Sphäre hier, wohl Dank des Schavalls, wirklich beeindruckende Möglichkeiten.“
„Sie haben allerdings nicht gereicht, in all den Jahren, die ich hier schon zwangsläufig verbringe, auch nur das Geringste zu erreichen. Das ist erst möglich durch dich.“
„Und durch den Elementargeist!“, fügte May betont hinzu.
Jetzt nickte ich in seine Richtung.
„Stimmt allerdings. Obwohl ich mich dabei unwillkürlich frage, ob das wirklich ein solcher Vorteil ist.“
„Ja, wäre es dir denn lieber gewesen, die Drachen hätten uns in Grund und Boden gestampft – und anschließend hätten uns tonnenschwere Felsmassen unter sich begraben?“, wunderte sich May.
Ich lachte heiser und winkte ab.
„Nein, natürlich nicht. Ich sehe ja ein, dass der Elementargeist ein unersetzlicher Verbündeter ist, obwohl sich alles in mir dagegen sträubt. Vergiss nicht, May, er ist zum Dämon geworden, weil er so viele Dämonen verschlungen hat. Alle Eigenschaften von denen sind auf ihn übergegangen.“
May hatte keine Gelegenheit mehr, darauf einzugehen, denn der Elementargeist wurde schon wieder tätig: Er entfachte einen Sturm in der Schlucht, im Nest der Drachen. Erst war es ein normaler Sturm, immerhin stark genug, dass er Menschen wie Trockenobst durch die Luft hätte wirbeln lassen. Aus diesem Sturm wurde ein Hurrikan, so gewaltig, dass er eine Stadt wie New York dem Erdboden gleich gemacht hätte.
Wollte der Elementargeist damit seine Macht demonstrieren oder was?
Er war der Herr des Elementes Wind beziehungsweise Sturm – und das mit allen Facetten, also einschließlich Regen, Hagel, Schnee. Und genau dies alles entfachte er praktisch auf einmal. Wir konnten davon nicht viel sehen, denn knapp vor uns begann dieses Chaos. Es schadete uns in keiner Weise. Der Elementargeist konnte es gewissermaßen punktgenau wirken lassen. Während also unmittelbar bei uns nicht einmal das geringste Lüftchen wehte, verwandelte sich der Rest der Schlucht in eine eisige, finstere Hölle. Und dann grollte auch schon mächtiger Donner. Blitze zuckten nieder und erzeugten ein Irrlichtern als wollten sie vom Ende der Welt künden.
Ich begann endlich zu begreifen: Wenn der Elementargeist jetzt von hier aus Jagd machte auf die Drachendämonen, konnte der Rest doch noch fliehen, weil er dazu eben seinen Standort hätte verlassen müssen. Er hätte dabei den einzigen Durchgang aus der Flucht frei gegeben. Es wäre doch noch dazu gekommen, dass uns die Front der Fliehenden in den Boden gestampft hätte. Mit diesem urweltlichen Sturm wollte er sie stattdessen in seine Richtung zwingen. Einen nach dem anderen oder vielleicht sogar alle zusammen? Das war für uns nicht mehr feststellbar.
Aber May wusste besser Bescheid als ich, weil sie in gedankenlicher Verbindung mit dem Elementargeist stand.
„Sie kommen!“, sagte sie. Eher ein Schrei als gesprochene Worte, denn sie musste die akustischen Nebenwirkungen des gewaltigsten Sturmes übertönen, den ich jemals gesehen hatte. Hätte der Elementargeist eine solche Macht auf Erden entfacht, wäre die Wirkung nicht weniger schlimm gewesen als der gefürchtete dritte Weltkrieg. Er hätte einen Großteil der Erde damit zerstören können. Ein Schadensausmaß, das die menschliche Zivilisation auf lange Sicht gesehen in die tiefste Steinzeit zurück geworfen hätte.
Dagegen hatten auch mächtige Drachendämonen nichts einzusetzen.
Ich sah sie nur als Schatten, wie sie heran schlitterten, sich vergeblich gegen die unvorstellbaren Kräfte des Sturmes zur Wehr setzend.
Mir ging wieder mal auf, welche gewaltige Macht der Elementargeist besaß, und ich verspürte unwillkürlich dabei eine dicke Gänsehaut. Denn mit jedem einzelnen Drachendämon, den er verschlang, mehrte er auch noch diese Macht.
Was, wenn es wirklich gelang, die Sphäre des Untoten zu vernichten? Was, wenn der Elementargeist damit wieder Zugang zur Erde bekam? War er dann nicht eine noch viel größere Gefahr als die Sphäre des Untoten jemals hätte werden können? Vielleicht war er nur deshalb unser Verbündeter geworden – und auch nur für so lange, bis genau dieses Ziel erreicht war?
Ich wusste es nicht, obwohl ich es befürchtete. Nur May schien nach wie vor mehr Positives in dem Elementargeist zu sehen.
Möglicherweise hatte sie ja sogar eher Recht als ich?
Immerhin hatte ich selbst erlebt, dass er mit seiner Macht durchaus auch Gutes bewirken, Leben schenken konnte, nicht nur Leben vernichten. Ich hatte immer wieder erlebt, wenn er den toten Friedhof der Verdammten regelrecht beseelte. Ich hatte die Pflanzen gesehen, die in Sekundenschnelle aus dem Boden wuchsen. Er hatte es für sie regnen lassen. Er war ein laues Lüftchen geworden, das die neuen Pflanzen umschmeichelte. Aus dem toten Friedhof der Verdammten war ein regelrechter Garten Eden geworden.
Bis der nächste Zyklus begann, wenn der Untote sich ächzend aus seinem Grab erhob, um erneut die Macht zu übernehmen, gegen die ich letztlich nichts ausrichten konnte. Aber er hatte auch nichts gegen mich ausrichten können. Er, der selbst einen solchen mächtigen Dämon wie den Elementargeist bezwungen hatte, war mir gegenüber machtlos. Kein Wunder, dass letztlich auch der Elementargeist selbst gegen mich machtlos geblieben war.
Und das, obwohl er jetzt die gigantischen Drachen verschlang, einen nach dem anderen.
Als der Sturm schlagartig abebbte, wusste ich definitiv, dass wir inzwischen allein waren in der Schlucht: Es gab die Dämonendrachen nicht mehr. Das hieß, sie waren nicht mehr hier, in ihrem Nest, sondern in der inneren Sphäre des Elementargeistes.
Täuschte ich mich oder wirkte jetzt das tanzende Irrlicht irgendwie… satt und zufrieden?
Nein, nur Einbildung, ganz gewiss! Denn Sattheit und Zufriedenheit waren Dinge, die ihm völlig fremd waren. Wahrscheinlich gierte er eher danach, den nächsten Dämon zu verschlingen. Vielleicht den Zyklopen, dem ich schon einmal begegnet war? Oder den Werwolf? Oder den ganzen Dämonenwald?
Obwohl, diesen hätte er längst verschlingen können, falls es gegangen wäre. Ich hatte keine Ahnung, wieso er es noch nicht getan hatte oder wieso es ihm nicht möglich sein sollte. Vielleicht, weil er als Brocken sogar für ihn noch eine Nummer zu groß war?
Möglich war alles, und ich hatte keine Lust mehr, mir länger Gedanken darum zu machen. Stattdessen schaute ich mit großen Augen umher. Es war nicht mehr dieselbe Schlucht. Denn sie zeigte deutlich Spuren der Urgewalten, die hier getobt hatten. Diese hatten nicht nur ausgereicht, die Drachen zu bezwingen, sondern auch die umgebenden Felswände hatten darunter gelitten. Sie waren merklich zurück getreten. Dafür war der Schluchtboden übersäht mit Gesteinstrümmern, die sich aus den Felswänden gelöst hatten.
„Uff!“, seufzte May. Sie war genauso beeindruckt wie ich.
Doch dann lachte sie humorlos.
„Ein Problem weniger!“
Ich jedoch dachte schon wieder: Um vielleicht dem nächsten Problem Platz zu machen, das noch gravierender ist?
Aber ich behielt diese pessimistischen Gedanken lieber für mich - vorerst.
*
Nahe Pearlhampton, USA
Als die drei Freunde wie aus dem Nichts materialisierten, wurden sie bereits erwartet. Lord Frank Burgess und die zweite Hälfte von May Harris, die bei der Trennung im Diesseits verblieben war, kannten den Fremden nicht. Sie konnten sich jedenfalls beide nicht an ihn erinnern. Sven Katovich, der mit ihnen materialisiert war, zeigte jedoch deutliches Erkennen und nickte dem Fremden zum Gruße zu.
Der Fremde grinste schief, anstatt zurück zu grüßen.
„Peter Stenford!“, stellte er sich gegenüber May und Frank selber vor. Er hob in einer eigentlich hilflos anmutenden Geste die Schultern und drehte die Handinnenflächen nach außen. „Es tut mir leid, dass ich mich jetzt erst offenbare. Vor allem bei dir muss ich mich entschuldigen, May Harris.“
„Kennen wir uns denn?“, wunderte diese sich.
„Und ob!“ Es klang reichlich geheimnisvoll, und May hasste Geheimnisse. Davon hatte sie in letzter Zeit einfach zu viele erlebt. Doch der Fremde, der sich als Peter Stenford vorgestellt hatte, fuhr sogleich fort: „Ich war zum Beispiel mit von der Partie in London, als es um den vorgeblichen ‚Zorn Afrikas’ ging, eine Organisation, die überhaupt nicht wirklich existiert. Damit hat Mister X und seine X-Organisation nur von sich selber ablenken wollen. Seine Terrorakte sollten anderen in die Schuhe geschoben werden. Zum Glück gelang es Mark Tate mit meiner Hilfe, das Missverständnis zu beenden und den Verantwortlichen das Handwerk zu legen.“
„Sie sind…?“ May stockte der Atem. Sie benötigte einen erneuten Anlauf: „Sie sind der… Dämon, der ihm geholfen hat?“
Peter Stenford nickte und wich ihrem forschenden Blick in gespielter Verlegenheit aus. Er wandte sich halb ab und schaute in Richtung Pearlhampton.
„Ja, sicher, es hat eine kleine Weile gedauert, bis ich den Mut fand, mich zu offenbaren“, sagte er, ohne sie dabei noch einmal anzusehen. „Ich muss mich dafür entschuldigen.“ Er deutete auf die nahe Stadt. „Aber hier ist der Grund, wieso ich es überhaupt tat. Ich musste persönlich her kommen. Es genügt nicht mehr, dass ich andere vor schicke. Ich muss gewissermaßen Farbe bekennen. Sonst schmälert es die Aussichten auf Erfolg. Und ohne Erfolg…“ Er ließ den Rest unausgesprochen und wandte sich wieder an May. Diesmal wich er ihrem forschenden Blick nicht mehr aus.
„Mit dem stimmt was nicht“, murmelte in diesem Augenblick Lord Frank Burgess brüchig. Seine Augen hatten sich zu schmalen Schlitzen verengt.
Sven Katovich erschrak an seiner Seite, doch das bemerkte niemand, wie er halbwegs erleichtert feststellte. Konnte es sein, dass Frank die Maske des angeblichen Peter Stenford durchschaute? Aber nein, das war unmöglich. Dafür war Peter Stenford, alias Leo Stein, viel zu geschickt. Immerhin stand er in direkter Verbindung mit dem übermächtigen Urdämon Belial. Das Vortäuschen der Erscheinung eines Peter Stenford war gegenüber dem, was Belial ansonsten noch drauf hatte, wirklich eine Kleinigkeit, um nicht zu sagen, es war das, was man salopp einen „Klacks“ nennen durfte.
Trotzdem blieb Sven Katovich alarmiert. Er beobachtete Frank. Was ging in dem Lord vor?
May nickte.
„Ja, das habe ich auch schon festgestellt.“
Sie tat einen Schritt auf Peter Stenford zu.
Dieser wich sofort vor ihr weiter zurück und streckte dabei auch noch wie abwehrend seine Hände vor.
„Nein, nicht zu nahe kommen!“, bat er.
Es sah doch tatsächlich danach aus, als hätte er Angst vor May.
Sie sprach es an: „Angst vor mir?“
„Und ob!“, gab er unumwunden zu. „Du bist eine Weiße Hexe – genauso wie der Lord ein Weißer Hexer ist. Und ich bin ein Dämon. Das verträgt sich nicht. Gewissermaßen ein Naturgesetz. Und trotzdem müssen wir gemeinsam vorgehen. Dabei müssen wir allerdings gewisse Regeln einhalten. Eine davon lautet: Bloß nicht zu nahe kommen. Ich weiß nicht, was passieren wird dabei. Ich will es aber auch gar nicht wissen.“
May wechselte einen raschen Blick mit Frank.
„Mit dem stimmt was nicht!“, wiederholte dieser stoisch.
Abermals nickte May.
„Ja, er macht uns was vor, nicht wahr?“
Peter Stenford lachte heiser.
„Und das wundert euch? Ja, glaubt ihr denn im Ernst, ich sehe in Wirklichkeit so aus? Nein, natürlich nicht! Peter Stenford ist lediglich eine Tarnexistenz für mich. Wie ich wirklich aussehe, das wollt ihr mit Sicherheit nicht erfahren.“
„Wieso eigentlich nicht?“, provozierte ihn May.
Peter Stenfords Haltung entspannte sich wieder.
„Wollen wir jetzt hier herum stehen und über meine Person diskutieren oder was? Ich bin persönlich hier. Das muss genügen. Und ich bin hier, weil wir ein gemeinsames Anliegen haben. Falls wir dabei versagen, dann Gnade euer Gott der Menschheit!“
„Wieso eigentlich?“, fragte jetzt auch Frank, ohne auf die Erklärung von Stenford einzugehen. Er präzisierte seine Frage sogar noch: „Wieso machst du gemeinsame Sache mit uns, Peter Stenford oder wie immer du dich nennen magst? Du bist doch ein Dämon - und hilfst uns im Kampf gegen Dämonen? Was ist dein eigentliches Motiv?“
„Du zweifelst an meiner Loyalität?“, lautete die Gegenfrage.
„Natürlich tu ich das, und May genauso, wie ich mir vorstellen kann.“
„Genügt es euch nicht, dass ich euch hierher teleportiert habe – gemeinsam mit meinem Freund Sven Katovich?“
„Freund?“ Es kam aus beider Mund, und sie schauten jetzt Sven an, der sich ziemlich unbehaglich dabei fühlte.
„Ja – ja, klar!“, beeile er sich verdattert zu versichern. „Wir sind in letzter Zeit in der Tat so etwas wie Freunden geworden. Zunächst war es nur eine Zweckgemeinschaft. Er hat mich gebeten, euch nichts von seiner Identität als Peter Stenford zu verraten. Er wollte im Hintergrund bleiben. Seine dämonischen Brüder und Schwestern sollten nichts von ihm erfahren, denn wenn sie sich gegen ihn verbünden, nutzte ihm auch all seine Macht nichts mehr.“
Sie schauten wieder den Mann an, der von sich selbst behauptete, ein echter Dämon zu sein.
„Das mag einleuchten“, murmelte May. „Trotzdem bin ich misstrauisch. Denn wir wissen immer noch nichts über seine wahren Motive.“
„Das ist doch ganz simpel“, behauptete Peter Stenford: Die X-Organisation will die Menschheit versklaven, sozusagen die Hölle auf Erden etablieren – in Konkurrenz zur Schwarzen Mafia. Aber hat nicht Mark Tate selbst immer wieder zitiert, dass das Gute und das Böse zueinander stehen wie das Licht zum Schatten? Es gibt keinen Schatten ohne das Licht – und kein Licht ohne Schatten. Mark Tate hat immer wieder behauptet, das Kräfteverhältnis müsse möglichst ausgewogen bleiben, denn wenn beispielsweise das Licht obsiegte, wäre das genauso das Ende der Welt wie wenn die Dunkelheit die alleinige Herrschaft übernähme. Und wir stehen jetzt vor einer solchen Entwicklung: Das Dunkle schickt sich an, über alles Licht zu triumphieren. Und dann? Ist es nicht das Ende der Welt, das Ende eines jeglichen Daseins? Niemand weiß, wie das dann aussehen wird. Aber denkt einfach einmal an das Zeitalter der Goriten, sofern sich Mark Tate noch daran erinnern konnte, Ihr habt sicherlich oft genug darüber mit ihm geredet. Die Goriten haben das Böse besiegt und gewissermaßen abgeschafft. Und dabei verschwanden sie selber spurlos – und das Böse kehrte anschließend Schritt für schritt wieder zurück. Weil es ein ehernes Naturgesetz ist und bleibt, dass beide Kräfte sich die Waage halten müssen.“
„Es wird aber auch behauptet, sämtliche Georiten seien auf dem Höhepunkt ihres Kampfes und als Preis für ihren Sieg aufgegangen im Schavall!“, warf May ein.
Peter Stenford lächelte nur.
„Das eine schließt das andere ja nicht aus. Niemand weiß hundertprozentig genau, was damals geschah. Sogar Mark wusste es nicht, so lange er sich noch erinnern konnte.“
„Mir gefällt nicht, dass du soviel über Mark weißt“, schnarrte der Lord. „Wie kommt das eigentlich?“
„Ich war ziemlich innig verbunden mit ihm, um es einmal so zu umschreiben – und ehe er sein Gedächtnis verlor. Zumindest mit der Hälfte von ihm, die sich hier, im Diesseits, befindet“, gab Peter Stenford zu bedenken.
„Weißt du vielleicht sogar, wo er sich zurzeit befindet?“, erkundigte sich May lauernd.
Zu ihrer Überraschung nickte der Fremde.
„Ich habe es inzwischen erfahren. Es war nicht einfach, ihn zu finden. Unsere Verbindung ist nachhaltig gerissen. Als Corinna Hacksmith ihm in einem Anflug von Irrglauben eins auf den Schädel gab, war ich fest verbunden mit ihm. Es war eine reine Reflexhandlung von mir gewesen, dass ich ihn nach Chikago teleportierte, aber gleichzeitig verlor ich den Kontakt mit ihm, bis jetzt. Ich wusste noch nicht einmal, dass ich ihn überhaupt nach Chikago teleportiert hatte, weil es eben lediglich reflexartig geschah und ich den genauen Ort der Materialisierung dabei nicht hatte bestimmen können und ich dadurch komplett seine Spur verlor. Und jetzt komme ich immer noch nicht an ihn heran. Ich muss auch sehr vorsichtig sein.“
„Vorsichtig?“, erkundigte sich May atemlos. Konnte sie den Worten des Dämons wirklich glauben?
„Wo Mark Tate ist, kann Mister X nicht weit sein, und weder Mister X noch seine Schergen von der X-Organisation sollen von mir etwas erfahren.“
„Und trotzdem willst du hier mit uns gegen sie kämpfen?“, wunderte sich Frank, der darin einen offensichtlichen Widerspruch sah.
„Ja, das will ich - und werde ich auch, wenn ihr es nicht länger verhindert“, gab Peter Stenford bissig zurück.
„Moment mal, du weißt also tatsächlich, wo sich Mark zurzeit befindet?“, vergewisserte sich May. „Und wo soll das sein?“
„In New York, May. Es geht ihm gut, aber er kann sich leider immer noch nicht an sein vorheriges Leben erinnern. Im Gegensatz zu seiner zweiten Hälfte in der Sphäre des Untoten, nicht wahr, May? Aber darüber kannst du sicherlich eher berichten als ich. Seiner zweiten Hälfte fehlt nur die Erinnerung an das, was sich seit seiner Abwesenheit im Diesseits alles ereignet hat.“
„Woher willst du das alles wissen?“, erkundigte sie sich jetzt misstrauisch.
„Aus zweiter Hand. Sven hat es mir erzählt. Er war so frei. Weil er in mir im Gegensatz zu euch keinen Feind sieht, dem man mit unberechtigtem Misstrauen begegnen muss, sondern als den, der ich wirklich für euch bin, nämlich als einen wichtigen Verbündeten. Und habe ich nicht auch dir längst und eindringlich genug bewiesen, May, dass man sich auf mich verlassen kann? Ohne mich würde Mark Tate – seine Hälfte hier, im Diesseits – schon gar nicht mehr existieren. Siehst du das nun endlich ein oder nicht?“
Sie nickte zögernd.
„Ja, du hast einerseits recht, aber andererseits… Ich traue dir trotzdem nicht.“
„Aber dem Elementargeist hast du vertraut – und ihn am Ende sogar als einen Freund bezeichnet? Worin liegt der Unterschied zwischen ihm und mir?“
„Ich war mit ihm gedankenlich verbunden und kenne ihn so gut, als wären wir seit Jahren eng bekannt. Sogar besser noch. Aber von dir bekomme ich keinerlei Gedanken mit. Du blockierst alles geschickt ab. Ich sehe dich zwar vor mir stehen, aber ich spüre nichts von dir. Als wärst du nur ein Trugbild und der eigentliche Dämon würde sich sonstwo befinden.“
„Genau das ist ja auch meine Absicht!“, behauptete Peter Stenford.
In diesem Augenblick streckte Frank seine linke Hand vor, in Richtung des Dämons. Und dann verlängerte sich sein Arm blitzschnell und überbrückte die Entfernung von vielleicht drei Schritten, die jetzt noch geblieben war, in einer Zeitspanne, die nicht einmal einem Augenzwinkern entsprach.
Der Dämon konnte die Berührung mit der Hand Franks nicht rechtzeitig vermeiden. Er schreckte zwar zurück, doch diese Reaktion kam dennoch zu spät.
Frank zog seine Hand wieder zurück. Sein Arm normalisierte sich wieder.
Jeder wusste, dass er ein begabter und auch geübter Gestaltwandler war, doch ein solches Kunststück war auch für May neu. Sie erschrak regelrecht darüber.
Jetzt nickte auch Frank, doch nicht weniger misstrauisch als bisher, sondern eher noch misstrauischer:
„Er fühlt sich unecht an. Wir sehen in der Tat nur ein Trugbild. So wirksam allerdings, dass er auch auf Fotos nicht anders erscheinen würde. Was sich hinter diesem geschickten Trugbild verbirgt, das bleibt unwägbar. Zwar hat er sich als Peter Stenford vorgestellt, aber der ist er mit Sicherheit nicht.“
„Erwähnte ich nicht sowieso, dass ich in Wirklichkeit kein Mensch, sondern ein Dämon bin?“, fragte Peter Stenford süffisant, der sich von seinem Schrecken rasch erholt hatte.
„Ja, das erwähntest du bereits, und insofern erscheint es logisch, dass du uns ein Trugbild bietest. Aber ich gehe immer noch nicht mit deinen vorgeblichen Motiven konform.“
Jetzt mischte sich Sven Katovich ein. Er war ziemlich ärgerlich geworden und konnte sich nicht mehr länger zurück halten:
„Ja, was denn nun? Sollen wir auf seine Hilfe etwa verzichten, nur wegen euren dummen Vorurteilen? Wollt ihr den Kampf allein aufnehmen auf der anderen Seite der Stadt, gegen dreizehn mächtige Magiere aus den Reihen der X-Organisation, die sich bemühen, die Kultstätte unter ihre magische Knute zu bringen, um auf diese Weise die Sphäre des Untoten kontaktieren und vielleicht sogar zurück bringen zu können? Falls ihnen das gelingt, falls sie die Energien, die in jener Sphäre gespeichert wurden, beherrschen lernen – auch noch im Verbund mit dem Untoten selbst, der sich dem gegenüber ja mehrfach schon als sehr offen bekundet hat… Und wenn ihr wirklich glaubt, Peter Stenford sei ein Risiko, dann muss ich euch wirklich fragen, ob das Risiko ohne ihn nicht tatsächlich wesentlich größer wird!“
May und Frank schauten ihn überrascht an.
Sven war noch nicht fertig mit seiner flammenden Rede, obwohl sie ihn so gar nicht kannten:
„Herrschaft Zeiten, was soll er denn jetzt noch Übles im Schilde führen? Hat er denn nicht deutlich genug ausgeführt, dass er genau weiß, worauf es ankommt? Eben auf das Gleichgewicht der Kräfte! Ja, er ist ein Dämon und steht somit auf der Seite des Bösen. Doch wenn das Böse wirklich auf der ganzen Linie siegt, entzieht ihm das praktisch die eigene Grundlage. Etwas, was verwirrte Geister wie Mister X und Konsorten anscheinend in keiner Weise zu begreifen scheinen. Vielleicht hätten sie hierzu einmal Mark Tate befragen sollen, den uralten Georiten, der in unserer Zeit als Mensch geboren wurde?“
Peter Stenford lachte humorlos.
„In der Tat, ich habe ihn gefragt - und er hat mir ungewollt viele Antworten gegeben. Hätte ich niemals einen solch engen und persönlichen Kontakt mit Mark Tate bekommen, hätte sich alles anders entwickelt. Vielleicht wäre ich dann sogar auf die andere Seite übergewechselt – oder von vornherein schon dort geblieben, wie May und Frank eher sagen würden?“
May blies die Wangen auf. Dann winkte sie mit beiden Händen ab.
„Ist ja schon gut, Sven – Peter. Ich habe begriffen, dass wir einfach keine andere Wahl haben.“
Auch Frank gab sich sichtlich einen Ruck.
„Einverstanden, auch ich sehe es ein, dass Mistrauen uns keinen Deut weiter bringt. Ganz im Gegenteil: Wir können unter keinen Umständen auf ihn verzichten. Also, du kannst dich wieder abregen und entspannen, Sven.“
„Danke für die Hilfe!“, sagte Peter Stenford zu Sven Katovich.
Dieser lächelte verzerrt.
„Wozu hat man Freunde?“
Danach fragte Peter Stenford und tat dabei, als sei überhaupt nichts geschehen:
„Was schlagt ihr vor: Teleportieren wir direkt zur uralten Kultstätte der Goriten?“
„Der Goriten?“, echote May verblüfft.
„Ja, hatte ich das denn nicht schon erwähnt? Es handelt sich um eine viele Jahrtausende alte Kultstätte der Goriten. Es gibt das Gerücht, dass von hier aus den Goriten ihr Vorhaben gelang, nämlich das Böse aus der Welt zu verbannen.“
„Wonach sie anschließend spurlos verschwanden?“, vergewisserte sich Frank.
„Ja, wie gesagt, es handelt sich um ein Gerücht. Mehr weiß ich auch nicht darüber. Und dann kamen irgendwann die Indianer und haben sie zur eigenen Kultstätte ernannt. Sie haben daraus ihren Friedhof gemacht. Doch die Seelen ihrer Verstorbenen gingen nicht ein in das Jenseits, sondern blieben an diesen Ort gebunden. Viele tausend Seelen wurden das mit der Zeit, die sich durchaus hier wohl fühlten, wie es schien. Aber sie verunreinigten mit ihrer Anwesenheit die Kultstätte gewissermaßen. Sie verunreinigten vor allem die dort herrschenden Energien. Nur so war es dem Untoten überhaupt möglich, damals noch ein mächtiger Magier, den Friedhof der Verdammten aus dessen eigenen Sphäre hier materialisieren zu lassen. Als er dann darauf selber begraben wurde und als Untoter sein Grab wieder verließ, hatte er seine Macht über diesen Ort endgültig manifestiert. Aber diese Macht war auch gebunden an die Erscheinung des Friedhofs der Verdammten. So nahm das Unglück seinen Lauf. Der Friedhof verschwand zurück in seine eigene Sphäre. Der Untote begann, seine Macht zu mehren, indem er andere Dämonen in die Falle lockte. Unter anderem eben den Elementargeist. Das musste es besonders geschickt angestellt haben, denn der Elementargeist ist so mächtig, dass er unter den Dämonen einen recht üblen Ruf genießt, wenn ich das einmal so formulieren darf. Kein Wunder, denn er hat einige unserer Art bereits verschlungen, bevor er in die Falle des Untoten ging. Ich hatte selbst einmal ein Begegnung mit ihm vor langer Zeit, wo ich ihm nur ganz knapp entrann. Damals lernte ich zumindest, dass ich keinen meiner Brüder und Schwestern unterschätzen darf. Es ist der Hauptgrund dafür, dass ich so lange gezögert habe, mich euch gegenüber zu offenbaren.“
„Jetzt wissen wir immer noch nicht, was mit Mark Tate ist!“, erinnerte ihn May.
„Der befindet sich in New York. Hatte ich das nicht schon erwähnt? Er handelt gemeinsam mit Don Cooper und Corinna Hacksmith im Auftrag derselben geheimen Organisation, der auch Adam angehört, den ihr in London zurück gelassen habt. Natürlich ist die Sache alles andere als ungefährlich, aber ich kann ihm leider in keiner Weise helfen, so sehr ich gehofft hatte, dies tun zu können. Die Nähe von Mister X und seinen Helfershelfern, gegen die Mark ja letztlich kämpft, einerseits… Aber das ist es andererseits nicht allein.“
„Was denn noch?“ rief May besorgt.
„Hast du nicht den Schavall in London zurück gelassen?“
„Den Schavall? Ja, klar, sonst hättest du uns ja nicht hierher teleportieren können, weil der Schavall dich dabei vernichtet hätte.“
„Nun, du hattest ihn die ganze Zeit über bei dir in London, doch er war ganz offensichtlich gleichzeitig auf der Suche nach Mark Tate. Und er hat inzwischen Mark gefunden, fast zeitgleich mit mir.“
„Wie bitte?“
„Nein, nicht, was du jetzt meinst, May: Der Schavall ist jetzt nicht dort, bei Mark Tate, sondern liegt immer noch auf dem Tisch in London, vor Adam, der darüber ganz und gar nicht erfreut zu sein scheint, wie er seinen Kontaktleuten mitteilte.“
„Das – das alles weißt du?“
„Ja!“, antwortete er schlicht – und fuhr fort: „Der Schavall kommt genauso wenig an Mark heran wie ich. Fragt mich nicht, woran das liegt. Ich tippe mal darauf, es hat zumindest etwas mit seinem totalen Gedächtnisverlust zu tun. Aber ihr versteht, dass ich mich unter diesen Umständen nicht noch mehr um Mark bemühen kann? Der Schavall würde das nachhaltig verhindern – sehr nachhaltig sogar. Ihr würdet künftig dann wohl doch noch ganz ohne mich auskommen müssen.“
Auch für Sven waren das Neuigkeiten. Er bekam diesbezüglich noch einen heimlichen Gedankenimpuls von Peter Stenford, alias Leo Stein:
„Ich hätte es dir bereits mitgeteilt, Sven, aber ich weiß es auch erst seit wenigen Minuten. Belial hat die Spur aufgenommen und festgestellt, dass es eine ganz dünne Verbindung zwischen Mark Tate und dem Schavall gibt. Das schützt ihn wahrscheinlich weitgehend und nachhaltig gegen magische Einflüsse, ohne dass er sich des Schutzes überhaupt bewusst wird. Aber gegen physische Kräfte ist er natürlich nach wie vor nicht gefeit.“
Sven atmete erleichtert auf. Er hatte schon befürchtet, Leo hätte es ihm bewusst vorenthalten.
In der Gestalt von Peter Stenford sagte Leo Stein zu May und Frank: „Es tut mir leid, wenn ich nichts Positiveres berichten kann. Wir können halt im Moment überhaupt nichts für ihn tun. Aber haben wir nicht auch so schon genug eigene Sorgen?“
„Deine Frage war wohl, ob wir unmittelbar hin teleportieren sollen, nicht wahr?“, fragte Frank brüchig. „Dabei kommt es sicherlich darauf an, wie du deinen Plan umsetzen willst – den Plan, die konkurrierenden Kräfte des personifizierten Bösen gegeneinander kämpfen zu lassen, damit wir am Ende die lachenden Dritten spielen dürfen. Ich nehme an, dass sich an diesem Plan nach wie vor nichts geändert hat? Ich meine, siehst du inzwischen noch eine andere Möglichkeit? Beispielsweise, dass wir auch ohne diese Finte eine Chance gegen diese Dunkle Bruderschaft vor Ort hätten?“
Ernst schüttelte Peter Stenford den Kopf.
„Nein, diese Möglichkeit sehe ich leider nach wie vor nicht. Das liegt nicht daran, dass ich an euren Fähigkeiten zweifele, aber das Risiko ist zu groß gegenüber der Aussicht auf möglichen Erfolg. Es wäre sinnlos, wenn ihr euch praktisch opfern würdet, um letztlich nur einen Zeitaufschub zu bewirken. Denn selbst wenn es euch gelingen sollte, die dreizehn Magier vor Ort, die du zu Recht eine dunkle Bruderschaft nennst, zu besiegen, hieße das noch lange nicht Sieg auf der ganzen Linie. Die Kultstätte ist durch die Vorgänge in der Vergangenheit so sehr verunreinigt, dass ihr auf ihre Kräfte nicht zurückgreifen könnt. Ich glaube fest daran, dass wir erst eine Art Reinigung vornehmen müssen.“
„Und diese Reinigung… wäre der Kampf zwischen den Konkurrenten des Bösen?“, vergewisserte sich May wenig überzeugt.
„Ich nehme es fest an, ja, aber natürlich gibt es keinerlei Garantien hierfür. Andererseits, wenn ich falsch liegen sollte, gehen wir dabei kein extra Risiko ein.“
„Aber du musst dabei persönlich in Erscheinung treten, wenn ich das richtig verstanden habe“, warf jetzt Sven Katovich ein. „Was, wenn du dich dadurch auch gegenüber dem Erzfeind outest? Es könnte dein Ende bedeuten.“
Peter Stenford nickte ernst.
„Ich bin selbstverständlich bemüht, dieses Risiko so gering wie möglich zu halten, das darfst du mir glauben. Du weißt ja, wir Dämonen sind von Natur aus besonders feige. Aber diese Feigheit sorgt andererseits auch dafür, dass wir schier unbegrenzt alt werden können. Wenn uns nicht gerade so etwas wie der Schavall in die Quere kommt.“ Er lachte wie über einen gelungen Scherz, wurde jedoch sogleich wieder ernst und fuhr fort: „Es gibt keine andere Möglichkeit, und dabei muss ich meinen eigenen Fähigkeiten vertrauen. Ich war zwar selbst niemals ein Mitglied der Schwarzen Mafia oder auch des vorangegangenen Schwarzen Adels und empfand diese Vereinigungen stets als sehr untauglich, weil es gewissermaßen der dämonischen Natur widerspricht, sich mit anderen zu vereinigen… Aber ich weiß, wie die ticken. Also kann ich meine Mitgliedschaft sozusagen simulieren.“
„Hoffen wir das Beste“, meinte May Harris, und man sah ihr an, dass sie jetzt ehrlich besorgt war um den Dämon, als der sich Peter Stenford ausgab.
Sie ahnte ja genauso wenig wie Lord Frank Burgess, dass er in Wirklichkeit Leo Stein hieß, ein Unsterblicher war, der selber gar keine magischen Kräfte besaß, der es aber geschafft hatte, den mächtigen Urdämon Belial zu seinem Sklaven zu machen. Zwar würde Belial alles tun, um dieser Sklaverei zu entkommen, zumal er ja ursprünglich umgekehrt Leo hatte versklaven wollen, aber Leo würde schon akribisch darauf achten, dass ihm Belial niemals wieder entrinnen konnte. Und da er nach Lage der Dinge ewig leben konnte, würde diese Allianz auch noch ewig wären.
Falls er nicht wirklich einen gravierenden Fehler beging bei ihrem künftigen Vorgehen.
Frank blies die Wangen auf und sagte schließlich:
„Also gut, nach Lage der Dinge… Ich würde vorschlagen: Teleportiere uns zumindest in die Nähe – so nah, dass wir vielleicht zunächst genauer die magischen Kräfte dort sondieren können, aber nicht zu nah, um möglichst nicht gleich von den Magier bemerkt zu werden.“
Als sich auch May damit einverstanden zeigte, tat ihr Verbündeter wie vorgeschlagen.
Sie verschwanden von einem Augenblick zum anderen wieder von dem kahlen Fleckchen Erde vor den Toren der Stadt Pearlhampton – um auf der gegenüberliegenden Seite der Stadt zu materialisieren, nahe dem, was man vergleichend „die Höhle des Löwen“ hätte nennen mögen…
*
New York, USA
Lagebesprechung bei Koordinator Ben Atleff
»Fassen wir also zusammen«, sagte er und blickte sich in der Runde um. Mit anwesend war außer meiner Wenigkeit, Mark Tate, noch Corinna Hacksmith und Don Cooper. »Wir wissen jetzt, wie man auf Professor Spencer und sein Projekt gestoßen ist und dass Doktor Bennisters Weste in diesem Zusammenhang in der Tat alles andere als rein ist. Außerdem musste ich erfahren, dass Diana Bouhl von der Polizei nicht mehr angetroffen wurde. Ich befürchte das Schlimmste für ihr Leben. Trotz aller Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, bleiben letzten Endes noch eine Menge Fragen offen.
Diana Bouhl war unser einziger Ansatzpunkt. Unser Pech ist, dass sie ihren Auftraggebern lästig wurde. Wie sollen wir jetzt an diese Auftraggeber noch heran kommen?«
Bewusst vermied er es, auf meinen Verdacht zu sprechen zu kommen, dass hinter allem mal wieder Mister X und seine Organisation steckte. Das erste Mal begegnete uns Mister X als Professor Armstrong. Inzwischen war klar, dass dies nur eine von vielen Identitäten sein konnte. Mister X wechselte seine Identität sozusagen wie andere das Oberhemd.
»Durch mich werden wir an die Auftraggeber heran kommen!«, sagte Corinna Hacksmith in die entstandene Stille hinein. Es klang ziemlich zuversichtlich - für meinen Geschmack eigentlich zu zuversichtlich. »Ich meine, selbst wenn Mister X hinter allem steckt, hat er seine Helfershelfer, die wir ausschalten müssen. Nennen wir die zunächst einmal die Auftraggeber. Und es wird mir jemand helfen dabei, nämlich Dr. Ken Bennister selber. Wenn auch nicht ganz freiwillig und vor allem nicht… willentlich. Ich werde mich allerdings gehörig beeilen müssen, denn wir wissen nicht, was aus Diana Bouhl geworden ist. Jedenfalls befindet sie sich in tödlicher Gefahr.
Ich bin im Gegensatz zu dir, Ben Atleff, nicht der Meinung, dass sie wirklich eine Schlüsselfigur darstellt. Ich tippe eher auf Bennister. Also befindet auch er sich in akuter Lebensgefahr, denn jetzt, da die Gangster Professor Spencer haben, ist dessen Assistent Bennister für sie so gut wie wertlos. Sie können ihn töten, ohne noch befürchten zu müssen, damit auf sich aufmerksam zu machen. Schließlich ist das durch die Affäre Bouhl schon hinreichend geschehen.«
»Mir ist noch etwas eingefallen«, sagte ich nachdenklich. »Jetzt, im Nachhinein betrachtet, glaube ich nicht mehr, dass die Gangster in der Villa Diana Bouhl umbringen sollten. Nein, ich neige inzwischen vielmehr zu der Annahme, dass sie lediglich… gekidnappt werden sollte.«
»Aber wieso...?«, fragte Ben überrascht.
»Ich habe noch einmal an das seltsame Gespräch zwischen ihr und diesem angeblichen Matt gedacht. Warum hat er überhaupt angerufen? Was hatte das denn noch für einen Sinn?«
»Du glaubst, Mark, es war nicht nur Ihretwegen - falls es sich bei diesem Matt wirklich um Mister X handeln sollte...?«
»Ich meine, dass die X-Organisation mit allem handelt, was Geld einbringt. Vielleicht auch - mit blonden Frauen?«
Sie sahen mich ungläubig an.
Nur Corinna schien in etwa meinen Verdacht zu teilen. Sie stand auf.
»Ja, vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Aber ich finde, es ist mehr als nur ein Strohhalm, an dem wir uns festhalten sollten. Und ich weiß auch schon, wie wir vorgehen... wie ich vorgehen muss!«, verbesserte sie sich schnell. »Diana war blond, nicht wahr? Und ich werde es ab sofort auch sein - blond wie die sprichwörtliche Sünde, wenn es sein muss.«
Don Cooper an meiner Seite grinste: »Blondes Gift?«
»Ja, so etwas ähnliches«, entgegnete sie kühl und verließ die Runde.
Sie war weg, also war es zu spät, sie darum zu beten, ihre Pläne etwas genauer darzulegen. Möglicherweise war es ein schlimmer Fehler, dass sie uns damit im Ungewissen ließ...
*
Kenneth Bennister war in den letzten Tagen sehr nervös. Er fühlte sich ständig beobachtet.
Natürlich war ihm klar, dass ihn der Geheimdienst so schnell nicht aus den Augen lassen würde. Schließlich galt er noch immer als der Hauptverdächtige in der Entführungsaffäre Professor Spencer.
Aber auch die Gangster, denen er sich verschrieben hatte, ließen nicht mehr von ihm ab.
Inzwischen bereute er alles. Er hatte es nicht etwa aus Liebe zu Diana Bouhl getan. Sie war wenig mehr als eine willkommene Abwechslung für ihn gewesen.
Bennister war nicht gerade eine stattliche Erscheinung mit seinem kleinen Bauchansatz und den schlaffen Muskeln, doch brauchte er sich trotzdem über Mangel an Gelegenheiten nicht zu beklagen.
Nein, Diana Bouhl war für ihn ein Sprungbrett zu Höherem gewesen.
Neben den Schäferstündchen, die er in angenehmer Erinnerung hatte, hatte sie ihm zu dem Kontakt mit der Organisation verholfen.
Bennisters Motiv war klar: Er hatte sich durch das Misstrauen, das Professor Edward Spencer ihm gegenüber gehegt hatte, ständig gedemütigt gefühlt und auf Rache gesonnen.
Jetzt, da es ihm gelungen war, Spencer auszuschalten, musste er allerdings erkennen, dass er sich in einer Sackgasse befand. Er hatte sich selbst in die Isolierung gebracht. Zugegeben, das Hauptmotiv seiner Überwachung durch den Geheimdienst war wohl die Tatsache, dass auch er nun gefährdet war, aber den Beamten musste längst aufgegangen sein, dass man ihn gleichzeitig mit Spencer kassiert hätte, wäre er für die Gangster wirklich von Wichtigkeit gewesen.
Außerdem: Man würde sich hüten, Bennister jemals wieder zum Geheimnisträger zu machen, ehe seine Unschuld völlig zweifelsfrei bewiesen war. Das Pentagon hatte das Vertrauen in ihn verloren. Vorerst wenigstens - und auf unabsehbare Zeit.
Von solcherart düsteren Gedanken beseelt, verbrachte Dr. Bennister eine sehr unruhige Zeit. Wie ein Schlag mit dem Hammer traf ihn dann die Berichterstattung über den Vorfall in der Bouhlschen Villa.
Die TV-Leute wussten nichts Genaues, mit dem sie die eigentlich völlig nichtssagenden Bilder der Villa kommentierten, aber Bennister konnte sich auch selbst alles zusammenreimen. Er ahnte, dass ab sofort auch sein Leben nicht mehr viel wert war.
Noch etwas kam hinzu: Er hatte von der Art der Bewachung, die während Spencers Arbeit dem Elisabeth-Hospital zuteil geworden war, naturgemäß selber nicht viel gewusst. Ausgerechnet eine der Krankenschwestern hatte es für ihn ausspioniert.
Plötzlich hatte Bennister auch vor ihr Angst.
Die Gangster wussten zwar nichts von ihrem Vorhandensein, aber wenn die Krankenschwester sozusagen zwei und zwei zusammenzählen konnte, dann ahnte sie, welche Rolle Bennister bei der Entführung gespielt hatte.
Bisher hatte sie es noch nicht mit Erpressung versucht. Bennister war ihr auch tunlichst aus dem Weg gegangen. Nun beschloss er, endlich das nervenzermürbende Versteckspiel aufzugeben und sich der Gefahr zu stellen.
Der Abend brach gerade herein, als er sein Apartment in der Nähe des Krankenhauses verließ. Es war nicht weit bis zum Schwesternheim.
Er ging zu Fuß hinüber.
Die Schwestern wurden nicht sonderlich bewacht. Es fiel nicht auf, wenn ein Mann unbefugterweise in das Heim eindrang. Bennister wusste, dass er sich nicht besonders vorzusehen brauchte.
Unterwegs erkannte er einen seiner Verfolger. Der Mann hing ihm wie ein zweiter Schatten an den Fersen. Bennister ahnte, dass er nicht der einzige war, der ihn an diesem Abend beobachtete. Aber das konnte er sicher riskieren.
Überall im Schwesternheim brannte Licht. Bennister zögerte einen Augenblick, dann gab er sich einen Ruck und stieß das breite Eingangsportal auf. Lauernd blickte er sich um. Es würde wohl nicht besonders schlimm erscheinen – er als Besucher im Schwesternheim -, aber er wollte nicht unbedingt dabei beobachtet werden, welches Zimmer er betrat.
Er hatte Glück. Im Moment war der lange Flur leer. Und bis seine Bewacher aufgeholt hatten, war er verschwunden. Die würden schon warten müssen, bis er das Schwesternheim wieder verließ.
Bennister hastete die breite Steintreppe hinauf in den ersten Stock.
»Vierte Tür links«, murmelte er vor sich hin.
Während er weiter ging, überlegte er, wie Biggi Crosby wohl reagieren würde, wenn er so unerwartet bei ihr auftauchte. Durchaus war er der Rothaarigen inzwischen im Hospital begegnet, hatte aber dabei so getan, als wären sie sich fremd.
Ob sie sauer dessentwegen auf ihn war?
Vor der Tür blieb Bennister stehen und hob die rechte Faust. Aber er zögerte mit dem Klopfen. Da näherten sich Schritte über den Flur. Sofort drückte er auf die Türklinke und trat ein, bevor er doch noch an der richtigen Tür erwischt wurde.
Biggi Crosby saß an ihrem kleinen Schreibtisch und setzte offenbar gerade einen Brief auf. Erschrocken blickte sie hoch.
»Ich werde verrückt«, entfuhr es ihr. »Wer hätte gedacht, dass du dich noch einmal hierher verirren könntest?«
Bennister schloss rasch die Tür hinter sich und lehnte sich mit dem Rücken dagegen.
»Entschuldige, dass ich so einfach hier herein platze«, sagte er unsicher, »aber es kam jemand den Flur entlang. Ich wollte nicht gesehen werden.«
Die Rothaarige nickte.
»Das kann ich allerdings verstehen.« Es klang spöttisch.
Langsam stand sie auf. Sie trug einen weißen Kittel, der ihre Knie frei ließ. Die zierlichen Füße steckten in Holzpantinen. Der Kittel spannte sich über dem Busen. Da das weiße Kleidungsstück keine Knöpfe besaß und in der Art eines Kimonos durch einen Stoffgürtel vorn zusammengehalten wurde, klaffte es etwas auseinander. Die Brüste der Rothaarigen schimmerten ein Stück hervor. Ja, deutlich waren ihre Ansätze zu sehen. Biggi Crosby hatte keinen BH an.
Bennisters Herz schlug schneller, als er näher trat. Die Rothaarige lächelte anmutig und bleckte dabei zwei Reihen makellos weißer Zähne.
Biggi deutete auf das schmale Bett.
»Setz' dich doch, Ken!«
Bennister leckte sich über die trocken und spröde gewordenen Lippen und kam der Aufforderung nach. Biggi blieb vor ihm stehen. Ken verschlang sie mit den Blicken. Er ahnte, dass sie unter ihrem dünnen Kittel überhaupt nichts an hatte, und spürte, wie sein Blut in Wallung geriet.
»Nun, was führt dich hierher?«, fragte sie herausfordernd.
»Das weißt du ganz genau.«
Sie hob die Augenbrauen.
»So?«, machte sie gedehnt. »Wie sollte ich denn?«
Der Chemiker machte eine hilflos anmutende Geste.
»Es - es tut mir leid, dass ich mich nicht gleich um dich gekümmert habe. Es ging einfach nicht. Du musst das verstehen. Da war die Sache mit dem Professor. Ich werde jetzt ganz speziell deswegen überwacht - seitdem.«
Blitzschnell beugte sie sich vor, bis ihr Gesicht nahe dem seinen war. In ihren braunen Augen blitzte es.
»War nicht eher diese aufgetakelte Blondine der Grund?«, zischelte sie.
Bennister erschrak.
»Was - was willst du denn damit sagen?«
»Hältst du mich eigentlich für blöd?« Sie tippte sich an die hübsche Stirn.
»Aber das ist doch Unsinn.« Er massierte sein Kinn, als hätte sie ihm bereits einen schmerzhaften Haken verpasst. »Also gut«, räumte er ein, »da war so eine Blondine, doch das ist längst wieder vorbei. Der wahre Grund ist, dass ich...«
Biggi richtete sich auf und stemmte die zu Fäusten geballten Hände in die Seiten. Wie ein Racheengel stand sie vor dem Chemiker.
»Komm mir nicht mit der Überwachung. Heute Abend hat dich das schließlich auch nicht von einem Besuch abgehalten.«
Er sah sie an und gab sich dabei alle Mühe, möglichst unschuldig zu wirken.
»Es ist halt nur, dass ich es nicht mehr länger ohne dich aushielt, Sweetheart.« Er wollte nach ihr greifen, doch sie entzog sich ihm geschickt. »Ich - ich hatte solche Sehnsucht nach dir, Sweetheart. So glaube mir doch!«
»Hat dich diese Blondine eigentlich dazu gebracht?«
Bennister wand sich unbehaglich.
»Wozu?«
»Meinst du, ich weiß nicht, warum du mit mir angebändelt und mich über die Bewachung des Hospitals ausgefragt hast? Bei mir warst du genau richtig. Als Oberschwester habe ich überall Zutritt. Außerdem habe ich bei der Überprüfung vor der Einrichtung des geheimen Labors einen hohen Sicherheitsgrad erhalten.«
Bennister stand auf und streckte flehentlich die Arme aus.
»Liebes, ich gebe ja zu, dass ich mich erst nur an dich heran gemacht habe, um dich auszuhorchen. Aber glaubst du wirklich, das sei der einzige Grund geblieben? Wir lieben uns doch.«
Brüsk wandte sich die Rothaarige von ihm ab.
Ken Bennister trat hinter sie und berührte sanft ihre Schultern.
»Mach uns nichts vor, Kleines. Ich weiß doch, dass ich deine Zuneigung nicht verloren habe. Andernfalls hättest du mich längst verpfiffen oder doch zumindest versucht, mich zu erpressen.«
Er drehte sie langsam zu sich herum. Biggi hielt den Kopf gesenkt, so dass er nicht ihr Gesicht sehen konnte. Zärtlich fasste er ihr unter das Kinn und hob ihren Kopf, bis sich ihre Blicke begegneten.
Tränen hatten sich aus den Augenwinkeln gelöst. Bennister küsste sie von den heißen Wangen.
»Dummerchen«, flüsterte er leicht tadelnd.
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich weiß, dass du mich nur ausnutzt«, seufzte sie, »aber ich kann einfach nicht dagegen an.«
Die rothaarige Süße schlang ihre Arme um seinen Nacken und zog ihn zu sich herunter. Fest drückte sie ihre bebenden, verlangend geöffneten Lippen auf seinen Mund.
Wohlige Schauer liefen dem Mann über den Rücken, als er den leidenschaftlichen Kuss erwiderte. Er wusste, dass er gewonnen hatte. Sie war auf seiner Seite.
Bennister drückte das erregte Mädchen fest an sich. Seine Hände zogen die aufregenden Kurven ihres Körpers nach. Er spürte den federnden Druck der Brüste, das fordernde Drängen.
Mit der Rechten massierte er Biggis Schulter, näherte er sich mehr und mehr dem Ausschnitt.
Die rothaarige Schöne zuckte leicht zusammen. Ihr Atem beschleunigte sich. Gierig saugten sich ihre Lippen am Mund des Mannes fest.
Biggi drehte sich etwas zur Seite, damit die runde Wölbung ihrer linken Brust frei kam.
Erregt zog Bennister den weißen Kittel auseinander. Die Brust kam nackt zum Vorschein. Zart streichelte er den Ansatz, umschloss ihn mit der ganzen Hand, massierte ihn.
Das Mädchen zerfloss schier unter seinen geschickten Liebkosungen.
Ihre Lippen lösten sich voneinander. Verlangend blickte Bennister auf die entblößte Brust. Biggi streckte sie herausfordernd vor. Er griff wieder danach, drückte sie sanft, küsste die rosafarbenen Warzen. Seine Sinne waren wie umnebelt.
Er umschlang Biggis Hüften und trug sie zum Bett.
Vorsichtig ließ er sie darauf nieder.
Die Rothaarige rekelte sich wohlig seufzend in den Kissen.
Bennisters Atem kam heiß und stoßweise, als er sich vorbeugte.
Biggi stöhnte, drängte sich gegen ihn, schloss die Augen.
Umständlich schälte sie ihren erhitzten Körper vollends aus dem sie plötzlich beengenden Kittel.
Dann ließ der Rausch der Sinne die beiden liebenden Menschen alles vergessen.
*
Später lagen sie rauchend nebeneinander. Bennister hatte den Ascher auf seiner Brust stehen. Er dachte daran, dass er sich schon lange nicht mehr so wohl gefühlt hatte.
Sein Inneres war wieder weitgehend ausgeglichen, seine ständigen Ängste waren zum großen Teil zu Erinnerung geworden.
Eines war sicher: Er besaß einen treuen Verbündeten. Biggi Crosby würde für ihn durchs Feuer gehen, ohne lange zu fragen. Das war wichtig zu wissen.
Und vor allem war es außerordentlich beruhigend.
Eine Stunde danach ging Bennister nachhause. Er war in Gedanken versunken, verzichtete auf den Fahrstuhl und benutzte die Treppe hinauf in den ersten Stock.
Als er das Licht des Flures einschalten wollte, wo sich sein Apartment befand, erstarrte wie zur Salzsäule.
Nur wenig Licht drang bis zum Eingang seines Apartments. Durch die schmalen Fenster auf der gegenüberliegenden Straßenseite fiel bleiches Mondlicht und malte bizarre Muster auf die steinernen Fußbodenplatten.
Trotz des dürftigen Lichtes erkannte er deutlich das schulterlange Blondhaar der Besucherin, die ihn vor dem Eingang zu seiner kleinen Mietwohnung erwartete.
Bennister rang um Fassung.
»Diana!«, entfuhr es ihm.
Er erwachte aus seiner Erstarrung und eilte weiter. Er vergaß völlig, das Licht im Flur einzuschalten. Er sah die Blondine und konnte nicht mehr klar denken.
Die Blonde reagierte erst gar nicht. Erst als er fast bei ihr war, bedeutete sie ihm mit einer Geste, zu schweigen. Lauschend hob sie ihren Kopf.
Was hatte sie?
Bennister konnte das Gesicht nicht genau sehen. Doch es konnte nur Diana Bouhl sein. Wer denn sonst?
Und was suchte sie hier? Wie war sie ihren Häschern entwischt? Wo waren seine Bewacher? Sie mussten doch ihr Kommen bemerkt haben. Natürlich waren auch sie scharf darauf, zu erfahren, wo sich die Vermisste befand. Warum griffen sie nicht ein?
Tausend Fragen dieser und ähnlicher Art durchfuhren Bennisters Kopf. Er brachte sie alle auf einen gemeinsamen Nenner: »Zum Teufel, was suchst du hier?«
Aufgrund des seltsamen Gebarens des rassigen Mädchens hatte er seine Stimme unwillkürlich gesenkt.
»Sie warten in deiner Wohnung!«, zischte die Blondine leise zurück.
»Was ist los?«, fragte er verwirrt.
»Du Narr, ich bin hier, um dich zu warnen. Matt will dir an den Kragen. Zwei seiner Killer sitzen da drin und können dein Kommen kaum erwarten.«
Hatte er nicht auch die Stimme anders in Erinnerung?
Bennister hatte Mühe, sich auf das Gesagte zu konzentrieren. Ja, zum Teufel, was ging hier vor?
Er schluckte einen Kloß hinunter, der sich in seiner Kehle gebildet zu haben schien. Seine Gedanken wirbelten im Kreis.
»Was - was sollen wir denn machen?«, raunte er. Die nackte Angst kam in ihm hoch.
Die blonde Sexbombe bedachte ihn mit einem verächtlichen Blick.
»Reiß' dich gefälligst zusammen!«, zischte sie. »Wir müssen uns was ausdenken.«
»Vielleicht...?« Die Stimme versagte ihm den Dienst.
Er brauchte alle Kraft, um fortzufahren: »Vielleicht wäre es besser, wir machen meine Bewacher auf sie aufmerksam?«
»Du bist dümmer, als ich ohnehin schon angenommen habe, Sweetheart.«
Bennister fuhr zusammen.
Sie fragte: »Meinst du nicht auch, dass die beiden Gangster da drin schon vorgesorgt haben?«
»Das kann doch nicht wahr sein!«, entgegnete er bestürzt. »Aber tatsächlich, ich habe keinen mehr von meinen Bewachern gesehen. Sie waren auf einmal - einfach weg!«
»Wer spricht denn hier in der Mehrzahl? Das war nur ein einziger Agent gewesen, der dich bewachen sollte. Du scheinst dir ja ziemlich wichtig vorzukommen. Was glaubst du, was den Staat eine solche Überwachung rund um die Uhr kostet? Und dann auch noch mit einem ganzen Agentenstab, was?«
Bennister kam sich wie ein Trottel vor. Das gefiel ihm ganz und gar nicht.
»Ich habe ein paar Mal mehrere gesehen!«, verteidigte er sich trotzig.
»Natürlich, weil Matts Leute auch da waren. Die ließen dich ebenfalls nicht aus den Augen. Und heute ist es endlich soweit. Die Würfel sind gefallen, dein Todesurteil gefällt. Sie mussten erst sicher sein, dass du nur von einem geschützt wirst, bevor sie das Todesurteil auch vollstrecken konnten. Den einen haben sie bereits ausgeschaltet. Jetzt bist du selber dran.«
»Am - am besten, wir verschwinden schleunigst von hier, Blondy!«, ächzte er.
»Die Hosen voll, was?«
Das war verdammt stark. Aber es war auch wahr. Zumindest bildlich gesprochen.
Seine Blicke saugten sich an dem ausladenden Busen fest. Er hatte alle Mühe, sich von diesem Prachtstück wieder los zu reißen.
»Ach, ich sehe nur nicht ein, warum wir uns unnötig in Gefahr bringen sollten. Was können wir schon gegen zwei so brutale Kerle ausrichten?«
Sie schüttelte den Kopf, streckte die Hand aus.
»Gib mir deine Schlüssel, los! Wir haben schon genügend Zeit vergeudet.«
»Was denn? Du willst doch nicht etwa...?«
Jetzt versagte ihm die Stimme auf Dauer.
Trotzdem nestelte er umständlich seine Schlüssel aus der Tasche und übergab sie. Gleichzeitig kam ihm ein Gedanke: So kannte er Diana gar nicht. Gut, eine scharfe Blondine, aber dass sie mit soviel Mut ausgestattet war...?
*
Ungerührt steckte sie den passenden Schlüssel ins Schloss und drehte ihn herum. Die Tür schnappte laut auf.
Bennister ergriff die Flucht, hielt aber schon nach wenigen Schritten inne.
Nein, diese Blöße durfte er sich ihr gegenüber nicht geben. Das wäre zuviel gewesen. Sie war gekommen, um ihm das Leben zu retten. Verdammt, und sie schien tatsächlich einen Ausweg aus dieser Misere zu kennen. Sonst würde sie doch nicht so ohne Weiteres...?
Der kalte Schweiß perlte auf seiner Stirn. Er bekämpfte die Angst und näherte sich wieder.
Unschlüssig schaute er umher. He, wo war Diana denn abgeblieben?
Die Tür stand halb offen. Der rassige Blondschopf jedoch schien sich in Luft aufgelöst zu haben.
Dr. Ken Bennister wuchs förmlich über sich selbst hinaus. Mit dem Fuß kickte er die Tür ganz auf.
In der Wohnung war es noch dunkler als draußen auf dem Gang. Alles war ruhig. Das Apartmenthaus schien völlig leer zu sein.
Bennisters Herz pochte so stark, dass er befürchtete, es müsste laut zu hören sein.
Seine Sinne schwanden ihm schier, als er die Wohnung betrat.
Mit schweißnasser Hand tastete er nach dem Lichtschalter, fand ihn aber in der Aufregung nicht.
In diesem Augenblick flammte die Treppenhausbeleuchtung ganz vorn wieder auf. Sie war inzwischen wieder automatisch erloschen.
Ein Stockwerk höher knallten die Absätze hochhackiger Schuhe über Marmorfliesen.
Ken Bennister wollte schreien, irgendwie auf sich aufmerksam machen, doch kein Laut entrang sich seiner ausgedörrten Kehle.
Wie mit magischer Gewalt zog es ihn tiefer in das Innere des Apartments.
Das schwache Licht, das durch die offene Tür herein fiel, ließ ihn nichts erkennen.
Plötzlich wusste Bennister, dass die Blondine recht gehabt hatte. Es musste sich jemand in der Wohnung befinden, denn vor dem Weggehen hatte er nicht die Rollos herunter gelassen. Das war aber inzwischen geschehen.
Die Schritte oben verstummten. Der Fahrstuhl surrte. Bennister fand endlich den Lichtschalter und betätigte ihn.
Inmitten des Wohnraums, der in blendende Helligkeit getaucht wurde, befand sich eine geschmackvoll arrangierte Sitzgruppe.
Bennister blinzelte geblendet.
Direkt rechts von ihm befand sich der Garderobenschrank. Er war geschlossen. Daneben war die Tür zur winzigen Kochküche. Sie stand offen. Einen Schritt weiter ging es zum Schlafzimmer und von da aus zum Bad.
Bennister wusste es auswendig.
Alles war soweit in Ordnung, wie es schien. Bis auf eine Kleinigkeit: Sein Blick ging zurück zur Sitzgruppe. Da waren die beiden. Sie hatten sich in die Polster geflegelt.
Ihre Gesichter waren maskenhaft starr. Bennister starrte direkt in die kleinen Pistolenmündungen, in denen der Tod auf ihn lauerte. Sicherheitshalber hatten die Gangster Schalldämpfer vorgeschraubt. Bennister allerdings würde das überhaupt nichts nützen.
Die Knie des Chemikers wurden butterweich. Er kam ins Wanken.
»Nur keine falsche Scheu«, sagte einer der Killer ironisch. »Tritt näher, und vergiss nicht, hinter dir die Tür zu schließen. Wir wollen doch schließlich ungestört unter uns sein, nicht wahr?«
Bennister gehorchte. Was blieb ihm anderes übrig?
Der Schrank neben dem Eingang kam wieder in sein Blickfeld. Jetzt erst fiel ihm die Unordnung auf: Schubladen waren heraus gerissen worden. Ihr Inhalt lag zum Teil am Boden. Man hatte die Schubladen wieder hinein geschoben, aber Wäscheteile lugten heraus. Am Boden lagen auch irgendwelche Scherben.
»Schau nicht so entgeistert!« Einer der Gangster lachte brutal. »Du brauchst eh nicht mehr aufzuräumen. Tote können das anderen überlassen. Sie haben damit keinerlei Probleme mehr.«
Der Lauf deutete auf Bennisters Bauchnabel, wanderte langsam höher, blieb in Richtung Herz stehen. Der Zeigefinger krümmte sich um den Abzug.
Auch der zweite Killer war schussbereit.
»Hast du uns noch was zu sagen? So zum Abschied? Vielleicht fällt dir auch noch etwas betreffend Spencers Forschungsergebnissen ein?«
Bennister dachte gerade wieder an Diana, die ihn vor der Tür gewarnt hatte. Die Angst fiel wie Schuppen von ihm ab. Er lachte irr.
»Also seid ihr mit dem alten Professor keinen Deut weiter gekommen!«, sagte er triumphierend.
»Soll dich nicht mehr stören.« Der Zeigefinger des Gangsters hatte den Druckpunkt erreicht.
In diesem Augenblick richtete sich aus der Deckung hinter ihnen eine blonde Amazone auf. Ihr schulterlanges Haar umrahmte ein ebenmäßig geformtes Gesicht mit einer fein geschnittenen Nase und vollen, sinnlichen Lippen.
Die leuchtenden Blauaugen schienen förmlich Blitze zu verschleudern.
Ja, Diana Bouhl sah in diesem Augenblick tatsächlich wie eine der sagenhaften Amazonen aus. Sie packte die Gangster kurzerhand im Genick und knallte sie mit den Köpfen kräftig gegeneinander.
Zwei Schüsse lösten sich, verfehlten Bennister jedoch bei weitem. Quasi übergangslos landeten die beiden Gangster im Land der Träume.
Lange bevor sie begriffen hatten, wie ihnen überhaupt geschah, gaben sie keinen Mucks mehr von sich.
Bennister erinnerte sich an ähnliche Szenen, wie sie häufig in uralten Klamottenfilmen zu sehen waren, doch war ihm diesmal keineswegs zum Lachen zumute. Er schaffte es gerade noch bis zum nächst besten freien Sessel und ließ sich schwer darauf nieder.
Keine Sekunde hätte er sich mehr länger auf den Beinen halten können. Sein Gesicht war kreidebleich, die Pupillen unnatürlich geweitet.
Der Mann war endgültig am Ende seiner Nervenkraft.
Aber noch war nicht alles ausgestanden. Ganz im Gegenteil.
Zum ersten Mal hatte er echt Gelegenheit, seine Lebensretterin einmal genauer in Augenschein zu nehmen.
»Das - das ist doch nicht möglich!«, stotterte er. »Sie - Sie sind ja überhaupt nicht Diana Bouhl!«
Die rassige Blondine lächelte spöttisch.
»Natürlich nicht. Mein Name ist Corinna!«
*