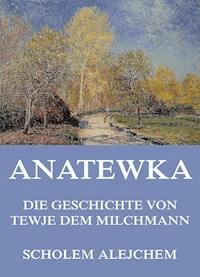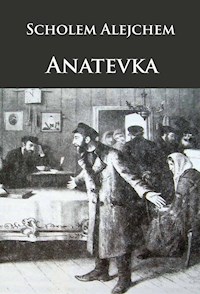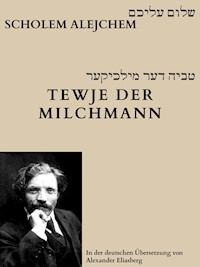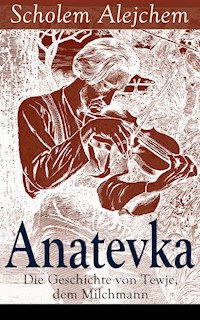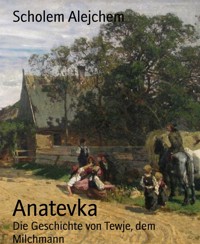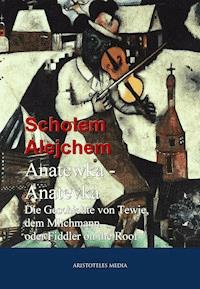14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Einer der berührendsten Romane der modernen Weltliteratur: eine Entdeckung!
Arm an Geld, reich an Kindern, träumt der Milchmann Tewje von einem Leben ohne Not und Leid. Doch nach einem unverhofften Geldsegen wendet sich das Blatt, und unser Held muss mitansehen, wie man ihm seine Familie und seine Heimat nimmt. So bleibt er ganz allein in der Welt zurück, mit nichts als seinem Gottvertrauen und seinem unerschütterlichen jüdischen Humor. Allen Schikanen des Daseins setzt er ein humanes, verschmitztes Trotzdem entgegen, das Trotzdem des wahren Humoristen, der noch unter Tränen lacht und scherzt.
Mit seinem Hauptwerk hat Scholem Alejchem seinen Ruf als einer der größten Humoristen der Weltliteratur begründet und dem untergegangenen Milieu des Schtetls ein Denkmal gesetzt. Keine nostalgische Verklärung, keine geschönte Idylle, sondern ein berührend tragikomischer Blick auf die Katastrophen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts drohend am Horizont aufziehen: Pogrome, Vertreibungen, Revolutionen. Dies macht den jiddischen Schicksalsroman zu einem der wichtigsten Bücher der Weltliteratur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Ähnliche
SCHOLEM ALEJCHEM
Tewje, der Milchmann
Roman
Aus dem Jiddischen übersetztund mit einem Nachwortvon Armin Eidherr
MANESSE VERLAG
ZÜRICH
ICH BIN ZU GERING
Ein Brief von Tewje, dem Milchmann,an den Verfasser
Dem sehr geschätzten, meinem geliebten teuren Freund Reb Scholem Alejchem. Gott gebe Euch Gesundheit und Auskommen, Euch mit Eurer Frau und Euren Kindern, auf dass Ihr groß’ Behagen habet, wohin immer Ihr Euch kehret und wendet. Amen sela!1
Ich bin zu gering! – Das muss ich Euch mit den Worten sagen, die unser Vater Jakob im Wochenabschnitt2 «Jakob aber schickte» verwendet hat, als er sich rüstete, dem Esau entgegenzugehen, mit dem Ihr aber nicht verglichen werden sollt … Doch im Falle, dass das eventuell nicht so passt, bitt’ ich Euch, Herr Scholem Alejchem, Ihr mögt es mir nicht übelnehmen, denn ich bin ein simples Geschöpf, aber Ihr wisst gewiss besser über mich Bescheid – was gibt es da also noch zu reden? In einem Dorf, mit Verlaub gesagt, verpöbelt man ja! Wer hat Zeit, in ein heiliges Buch zu schauen oder einen Pentateuch-Abschnitt3 mit dem Raschi-Kommentar4 durchzustudieren oder sonst was? Noch ein klein bisschen Glück, dass der Sommer kommt. Da fahren die Jehupezer Reichen alle nach Bojberik auf ihre Datschen hinaus, und man kann schon mal mit einem feinen Menschen zusammentreffen und ein gutes Wort hören. Ihr könnt mir glauben, dass ich mich noch an jene Tage erinnere, als Ihr neben mir im Wald gesessen seid und meinen törichten Geschichten gelauscht habt. Das ist mir so, wie wenn ich wer weiß wie viel verdienen würde! Ich bin mir nicht im Klaren darüber, weshalb ich bei Euch solchen Anklang gefunden habe, dass Ihr Euch mit einem so geringen Menschlein wie mir abgebt, mir sogar Briefe schreibt und, damit nicht genug, auch noch meinen Namen in einem Buch benützt und aus mir einen abgerundeten Menschen macht, als ob ich weiß Gott wer wär’ – da darf ich doch gewiss sagen: Ich bin zu gering …! Wahrlich, ich bin Euch tatsächlich ein guter Freund, und Gott möge mir mit einem Hundertstel dessen, was ich Euch wünsche, aushelfen! Ihr habt offensichtlich gut gesehen, wie ich Euch in den guten Jahren gedient habe, als Ihr noch auf der großen Datscha gesessen seid – erinnert Ihr Euch? – Ich hab’ Euch eine Kuh für einen Fuffziger gekauft, und für fünfundfünfzig war sie eine echte Okkasion. Ei, sie ist am dritten Tage krepiert? Da bin ich nicht schuld dran. Warum die andere Kuh, die ich Euch gegeben habe, auch krepiert ist …? Ihr wisst selbst recht gut, wie sehr mich das gekränkt hat! Kopflos lief ich damals durch die Gegend! Was weiß ich? War scheinbar vom Schönsten und Besten, und Gott soll mir so helfen und Euch auch, so Gott will, im neuen Jahr, auf dass es sei, wie Ihr so schön sagt, «erneure unsre Tage von einst» … Und mir möge Gott beim Verdienen meines Lebensunterhalts helfen, dass ich gesund bin und – es sei ein Unterschied – mein Pferd ebenso, und meine Kühe sollen so viel Milch geben, dass ich Euch weiterhin auch mit meinem Käse und meiner Butter so gut wie möglich dienen kann, Euch und allen Jehupezer Reichen, denen Gott Glück und Geldsegen gebe und alles Gute und viel Freude. Und Euch für Eure Bemühung, dass Ihr Euch wegen mir so viel Mühe macht, und für die Ehre, die Ihr mir durch Euer Buch erweist, Euch sage ich noch einmal: Ich bin zu gering!Womit verdiene ich mir so einen Ehrenhut, dass die ganze Welt plötzlich gewahr wird, dass es jenseits von Bojberik, nicht weit von Anatewka, einen Mann gibt, der da heißt Tewje, der Milchmann?
Aber Ihr wisst doch gewiss, was Ihr tut, ich muss ja nicht Euren Lehrmeister spielen, und wie man schreiben muss, wisst Ihr selber gut genug, und was all das Übrige dort angeht, verlass’ ich mich schon auf Euren feinen Charakter, dass Ihr nämlich dort in Jehupez für mich alles tut, damit das Buch auch meinem Geschäft halbwegs zustattenkommt. Das hätt’ ich, meiner Seel’, tatsächlich gerade jetzt höchst nötig: Ich rechne damit, so Gott will, in Bälde an die Verheiratung einer Tochter zu denken zu beginnen; und schenkt Gott, wie Ihr sagt, das Leben, dann möglicherweise tatsächlich zwei auf einmal … Inzwischen seid mir gesund und gehabt Euch wohl, wie es Euch von ganzem Herzen von mir wünscht Euer bester Freund
Tewje.
Ah ja, das Postskriptum! – Wenn das Buch fertig sein wird und Ihr Euch daranmacht, mir etwas Geld zu schicken, dann seid so gut und schickt es nach Anatewka, an die Adresse des Schächters. Ich hab’ dort zweimal im Winter eine Jahrzeit: einmal noch im Herbst, vor «Mariä Schutz und Fürbitt’», und das andere Mal um «Neujahr» herum – dann bin ich, soll das heißen, ein Stadt-Jude. Und die übrigen, ganz normalen Briefe könnt Ihr mir direkt nach Bojberik schicken, an meine Adresse, mit den folgenden Worten: Auszuhändigen dem s. g. Herren Tobias, dem Milchwarenhändler, dem Hebräer.
DAS GROSSE LOS
Eine wunderbare Geschichte, wie Tewje, der Milchmann, arm an Geld, aber reich an Kindern, plötzlich undmit einem Schlag durch ein äußerst sonderbaresEreignis, das es wert ist, in einem Buch beschriebenzu werden, sein Glück machte. Erzählt von Tewjeselbst und wortwörtlich hier wiedergegeben
«Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutze …»
Psalm 113, 7
Wenn einem das große Los beschert ist, hört Ihr, Herr Scholem Alejchem, kommt es geradewegs ins Haus, denn wie sagt Ihr: Lamnazejach al hagithiß – wenn es geht, dann läuft es auch; es ist dabei keinerlei Verstand und Wahlmöglichkeit vorhanden. Und wenn – Gott behüte – das Gegenteil der Fall ist, könnt Ihr vor lauter Reden zerplatzen, und es wird Euch so viel helfen wie der Schnee vom vergangenen Jahr, denn wie sagt Ihr: Es gibt keine Weisheit, keinen Verstand, keinen Rat gegen ein schlechtes Pferd. Ein Mensch schuftet, quält sich, bis er sich am liebsten hinlegen und – die Feinde Zions sollen’s – sterben würde. Auf einmal, man weiß nicht weswegen und woher, pferdet es von allen Seiten daher, wie es in der Bibel geschrieben steht: So wird eine Hilfe und Errettung den Juden erstehen. Das muss ich Euch ja nicht mehr extra auslegen; die Stelle lässt sich so deuten, dass ein Jude – solange die Seele noch in mir ist (solange noch eine Ader pulst) – das Gottvertrauen nicht verlieren darf. Ich hab’ das tatsächlich bei mir selbst gesehen, wie der Oberste mich geleitet hat bei meinem jetzigen Broterwerb: Denn wie käme ich sonst gerade dazu, mit einem Male Käse und Butter zu verkaufen, wo doch meiner Großmutter Großmutter niemals mit Milchwaren gehandelt hat? Es ist’s wahrhaftig wert, dass Ihr Euch die ganze Geschichte vom Anfang bis zum Ende anhorcht. Ich werd’ mich für eine Weile hier neben Euch hin ins Gras setzen, soll das Pferd derweil ein bisschen was kauen, wie Ihr sagen würdet: Der Odem alles Lebenden lobe deinen Namen, Ewiger – auch ein Pferd ist ein Geschöpf Gottes.
Kurz und gut, es war um die Zeit des Wochenfests5, das heißt, damit ich Euch keine Lügen erzähle, eine Woche oder zwei vor dem Wochenfest; und vielleicht auch – hm? – ein paar Wochen nach dem Wochenfest. Vergesst nicht, es war bereits – gemach, gemach, ich will’s Euch ja ganz genau sagen – vor Jahr und Tag, das heißt genau neun Jahre her oder zehn und vielleicht eine Idee mehr. Damals war ich gar nicht der, so wie Ihr mich jetzt hier seht, das heißt, zwar wirklich derselbe Tewje und doch wieder nicht dieser, wie sagt Ihr so schön: dieselbe Jente6, nur mit einem anderen Schleier. Was bedeutet das? Ich war, nicht auf Euch gedacht, ein bettelarmer Habenichts, obwohl ich natürlich, wenn wir schon bei dem Thema sind, auch jetzt noch sehr weit von einem reichen Mann entfernt bin. Was mir fehlt, ein Brodski7 zu sein, das könnten wir beide uns in diesem Sommer bis nach dem Wochenfest zu verdienen wünschen; aber im Vergleich zu einst bin ich heute, heißt das, ein reicher Mann – mit eigenem Pferd und Wagen, mit – fern bleibe ihnen der böse Blick – ein paar Kühen, die Milch geben, und noch einer, die jeden Augenblick kalben müsste. Es ist – man soll sich nicht beklagen – Käse und Butter und Rahm jeden Tag frisch vorhanden, alles selbst hergestellt, denn wir alle arbeiten hart, keiner sitzt müßig herum. Meine Frau – sie soll leben – melkt die Kühe, die Kinder tragen Krüge, schlagen Butter, und ich selbst, wie Ihr hier seht, fahre jeden Morgen auf den Markt, geh’ alle Datschen in Bojberik ab, man trifft mit diesem zusammen und mit jenem, mit allen größten Patriziern von Jehupez, und redet man einmal richtig ein wenig mit einem Menschen, fühlt man, dass man auch so etwas wie ein Mensch auf Erden ist und nicht – wie Ihr sagt – bloß ein hinkender Schneider; und vom Sabbat gar nicht zu reden – da bin ich doch gar ein König, schaue in ein jüdisches Buch rein, lese einen Abschnitt aus dem Pentateuch mit dem Kommentar dazu, Psalmen, die Sprüche der Väter, dieses, jenes, Strudel, Budel … Ihr guckt mich an, Herr Scholem Alejchem, und denkt Euch wahrscheinlich währenddessen im Herzen: «Ei, dieser Tewje, der ist doch wirklich und wahrhaftig ganz und gar ein Mann, welcher …!»
Kurz und gut, wovon hab’ ich Euch zu reden angefangen? Ah ja, ich war, heißt das, damals, mit Gottes Hilfe, ein ganz armer Schlucker, bin, mit Weib und Kindern – keinen Juden möge es treffen – dreimal am Tag vor Hunger gestorben, außer zum Abendessen. Geschuftet hab’ ich wie ein Esel, ganze Wagenladungen Baumklötze aus dem Wald zum Bahnhof geschleppt für – es soll Euch nicht beschämen – zwei Gulden am Tag! Und das nicht einmal jeden Tag. Und damit gehe hin und halte, unberufen, so ein Haus voller Esser, sie sollen gesund sein, aus und dazu noch, es sei ein Unterschied zwischen diesen und jenen, ein Pferd in Kost, das sich um Raschis Kommentare nicht schert, aber jeden Tag was zum Kauen braucht, ohne Wenn und Aber. Was aber tut Gott? Er ist doch, wie Ihr sagt, ein Speiserund Nährer von allen – Er führt die Welt klug und mit Verstand; wie Er sieht, wie ich mich da so für das bisschen Brot abquäle, sagt Er zu mir: «Du meinst wohl, Tewje, dass schon das Ende aller Dinge gekommen sei – der Weltuntergang, der Himmel auf dich herniedergestürzt? Pfui, bist ein großer Narr! Doch sollst du sehen, wie, wenn Gott nur will, das Schicksal von einer Minute auf die andere einen Dreh – links um! – macht und es in allen Winkeln hell wird.» Es ist so, wie wir es im Gebet zu Neujahr und am Versöhnungstag8 sagen: … Der eine wird erhöht und der andere erniedrigt – das heißt: Der eine fährt, und der andere geht zu Fuß. Aber die Hauptsache ist – Gottvertrauen, ein Jude muss hoffen, nichts als hoffen! Oder was? Wenn man derweilen Schlimmes durchmacht? Nun, dazu sind wir Juden doch gerade auf der Welt, denn wie sagt Ihr: Du hast uns auserwählt … – Nicht umsonst beneidet uns die ganze Welt … Aber weshalb sage ich jetzt das? Ich sage es im Zusammenhang damit, wie Gott es mit mir angestellt hat: wahrlich nur Wunder und Mirakel, Ihr könnt Euch das anhören.
Eines schönen Tages im herrlichsten Sommer, es war schon Abend, fahre ich einmal so durch den Wald, bereits auf dem Nachhauseweg, ohne Baumklötze; den Kopf zur Erde gebeugt, im Herzen gram und trist. Das Pferd, das arme, taumelt mühselig auf schwachen Beinen dahin, da hilft kein Bleuen und kein Dräuen. «Vorwärts», sage ich, «du Unglückstier, geh zugrunde mit mir zusammen, sollst auch wissen, was das bedeutet, ein Fasten an einem langen Sommertag, wenn du schon bei Tewje als Pferd Quartier genommen hast!»
Still ist es ringsumher, jeder Peitschenknall hallt im Walde wider; die Sonne steht schon ganz tief, der Tag – er scheidet dahin; die Schatten der Bäume strecken sich lang, lang hin – so lang wie die jüdische Diaspora; es beginnt zu dunkeln und sehr trübe ums Herz zu werden. Verschiedene Vorstellungen und Gedanken steigen im Kopfe auf, allerlei Gestalten von Menschen, die schon lang gestorben sind, kommen mir entgegen; und da erinnere ich mich an mein Zuhause – und ach und weh ist mir! In der Hütte ist es finster, Dunkelheit; die Kinderchen, sie sollen gesund sein, nackt und bloßfüßig, halten, die Armen, nach dem Vater, dem Unglücksraben, Ausschau, ob er nicht ein frisches Stück Brot oder sogar eine Semmel mit nach Hause bringt; und sie, meine Alte, wie das Frauen so tun, brummt: «Kinder muss ich ihm zur Welt bringen, und noch dazu sieben, nimm sie – Gott möge mich für diese Worte ungestraft lassen – und wirf sie lebend in den Fluss!» Angenehm, solcher Suada zuzuhören? Man ist doch nicht mehr als ein Mensch, ein, wie man sagt, Wesen aus Fisch und Blut, und der Magen lässt sich mit keinen Worten füllen; nimmt man ein Stück Hering zu sich, verlangt einen nach Tee, und für den Tee braucht man Zucker, und Zucker, heißt es, gibt’s bei Brodski. «Wenn’s das Stückel Brot nicht gibt», sagt meine Frau – sie soll leben –, «mag das ja der Magen noch möglichst verzeihen, aber ohne das Gläschen Tee», sagt sie, «bin ich in der Früh’ wie tot; das Kind», sagt sie, «saugt mir die ganze Nacht lang die Kraft heraus!» Und dabei ist man doch auch noch ein Jude auf der Welt, und das Nachmittagsgebet ist doch wahrlich, wie Ihr sagen würdet, keine Ziege und läuft nicht davon, aber beten muss man. Stellt Euch vor, was für ein schönes Beten das sein kann, wenn genau zu dem Zeitpunkt, wo man sich hinstellt und die Achtzehn Segenssprüche9 beten will, teuflischerweise das Pferd durchdreht und durchgeht; da muss man dem Wagen nachrennen, die Zügel zu fassen kriegen und dabei singen: «Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs!» – schön «hingestellt» zum Achtzehngebet! Und gerade dann, wie zufleiß, wenn man Lust gehabt hätte, recht innig und aus ganzem Herzen zu beten, sodass einem vielleicht etwas von der Last auf der Seele genommen wird …
Kurz und gut, ich renne so dem Wagen hinterdrein und spreche laut das Achtzehngebet, mit einer Melodie wie der Vorbeter in der Synagoge: «Der die Lebewesen mit Gnade nähret – der da tut speisen alle seine Geschöpfe – und der die Treue denen hält, die im Staube schlafen» – sogar denjenigen, die schon unter der Erde liegen und Erdkipfel backen. «Oj», denk’ ich mir, «wie liegt man selbst unter der Erde! Ach, muss man sich quälen! Nicht so wie jene, per exemplum, die Jehupezer Reichen meine ich, die einen ganzen Sommer lang in Bojberik in ihren Datschen sitzen, essen und trinken und im Besten vom Besten baden. Oj, Herr der Welt, womit habe ich das verdient? Ich bin doch, hat es den Anschein, genauso ein Jude wie alle anderen. Zu Hülf, lieber Gott, schaue doch auf unser Elend – sieh», sag’ ich, «und denk einmal darüber nach, wie wir schuften müssen, und setz dich ein für die armen Leute, nebbich10, denn wer sonst soll sich ihrer annehmen, wenn nicht du? Heile uns, dann sind wir geheilt – schick du uns nur die Arznei, das Geschwür haben wir schon selber … Segne uns – ja, segne uns mit einem guten Jahr, auf dass es reiche Ernte gebe von allen Arten Getreide – vom Roggen und vom Weizen und von der Gerste; obwohl ich mich, wenn ich nachfrage, fragen muss, was ich, Pechvogel, schon davon habe? Beispielsweise zum Exempel: Was geht es mein Pferd – von dem ich unterschieden sei! – an, ob der Hafer teuer oder billig ist …?» Doch pfui, Gott stellt man keine Fragen, und speziell ein Jude muss doch sicher alles als etwas Gutes hinnehmen und zu allem «Auch dies ist zu meinem Wohle» sagen, denn gewiss ist dies Gottes Geheiß. «Und den Verleumdern» – singe ich weiter – «und den Verleumdern …» Und die Errostokraten11, die da sagen, es gäbe keinen Gott auf der Welt, werden schön dreinschaun, wenn sie dereinst dorthin kommen; sie werden dafür mit Zinsen büßen müssen, denn Er ist ein Zerschmetterer der Feinde – ein guter Zahler, mit Ihm treibt man keine Spielchen, mit Ihm muss man gut umgehen, Ihn bitten, Ihn anrufen: «Barmherziger Vater – erbarmungsvoller, lieber Vater! Höre unsere Stimme – horch auf unser Geschrei, schone uns und erbarme dich unser – hab Erbarmen mit meiner Frau und meinen Kindern, denn sie sind, nebbich, hungrig! Habe Wohlgefallen – bewillige doch», bete ich, «deinem lieben Volk Israel, wie einst, im heiligen Tempel, als noch die Priester und die Leviten12 …» Auf einmal: halt! Das Pferd ist stehengeblieben. Ich rattere schnell noch den Rest des Achtzehngebets herunter, hebe die Augen und werfe einen Blick – gerade aus dem Wald heraus kommen mir zwei seltsame Wesen entgegen: verhüllt und ungewöhnlich gekleidet. «Räuber!» – Dieser Gedanke durchzuckte mein Hirn. Jedoch fasste ich mich sogleich wieder: «Pfui, Tewje, bist ein Narr! Ja was denn! Du fährst schon so viele Jahre lang durch den Wald, bei Tag und bei Nacht; wie kommst du heute mir nichts, dir nichts auf Räuber?»
Dann mache ich «hü!» zum Pferd, fass’ mir ein Herz, geb’ ihm ein paar Hiebel aufs Gesäß, als ginge mich das alles nichts an.
«Reb Jude! Hört doch, Reb Gevatter!», ruft mir eines der beiden Wesen mit der Stimme eines Frauenzimmers zu und winkt mir mit einem Tuch. «Na los, haltet einmal einen Moment an, wartet ein Weilchen, fahrt nicht davon, es wird Euch – Gott behüte – nichts geschehen!»
«Aha, ein böser Geist!», denk’ ich mir, spreche aber gleich darauf so zu mir selbst: «Rindvieh in Rossgestalt! Woher denn auf einmal Geister und Dämonen?» Und halte das Pferd an. Jetzt schaue ich mir die zwei Wesen genauer an: Frauenzimmer! Das eine, eine ältere, mit einem seidenen Kopftuch; die andere, eine jüngere, mit einer Perücke. Beide feuerrot und stark verschwitzt.
«Einen guten Abend, herzlich willkommen!», sage ich sehr laut zu ihnen, so als wäre ich in bester Stimmung. «Was ist Euer Begehr? Wenn Euer Sinn danach steht, etwas zu kaufen, werdet Ihr bei mir leider nichts finden, es sei denn Bauchweh – das soll meinen Feinden in die Köpfe fahren! – oder eine volle Woche Herzkrämpfe oder ein bissel Kopfschwindel, trockene Schmerzen, nasse Leiden, rieselnde Zores13 …»
«Pst, pst», machen sie. «Da schau her, was der für einen kleinen Redeanfall bekommen hat. Wenn man so einen Juden mit nur einem Wort antippt, ist man seines Lebens nicht mehr sicher! Wir müssen», sagen sie, «gar nichts kaufen, wir wollten Euch nur eine Frage stellen, ob Ihr eventuell wisst, wo hier der Weg nach Bojberik sein könnte?»
«Nach Bojberik?», sage ich und breche in gespieltes Gelächter aus. «Das wirkt ja», sage ich, «ganz genau so auf mich, als würdet Ihr mich beispielsweise fragen, ob ich wisse, dass ich Tewje gerufen werde.»
«So, so? Ihr werdet Tewje gerufen? Dann einen guten Abend Euch, Reb Tewje! Wir verstehen nicht», meinen sie, «was da das Gelächter soll? Wir sind Fremde, aus Jehupez sind wir und wohnen gerade dort in Bojberik auf unserer Datscha. Wir sind», sagen sie, «für ein Minütchen zum Spazieren rausgegangen und wandeln in diesem Wald schon seit dem Morgen gemächlich herum, gehen immer wieder fehl und können nicht und nicht auf den rechten Weg zurückfinden. Dabei haben wir auf einmal», sagen sie, «jemanden im Walde singen hören und anfänglich gemeint, denn man kann ja nie wissen, das könnte möglicherweise – Gott behüt’ – ein Räuber sein? Aber nachdem wir», sagen sie, «aus der Nähe gesehen haben, dass Ihr – Gott sei Dank – ein Jude seid, wurde uns ein wenig leichter ums Herz. Versteht Ihr nun?»
«Ha, ha, ha! Ein schöner Räuber!», sage ich. «Habt Ihr schon einmal», sage ich, «die Geschichte von einem jüdischen Räuber gehört, der einen Spaziergänger anfällt und von ihm eine Prise Tabak erbittet? Wenn Ihr wollt», sage ich, «kann ich Euch diese Geschichte erzählen.»
«Hebt Euch», sagen sie, «die Geschichte für ein andermal auf; jetzt zeigt uns lieber den Weg nach Bojberik!»
«Nach Bojberik?», sage ich. «Aber was denn! Das da ist doch der richtige Weg nach Bojberik! Auch wenn Ihr», sage ich, «nicht wolltet, würdet Ihr doch unweigerlich auf dieser Straße geradewegs nach Bojberik kommen.»
«Warum schweigt Ihr denn jetzt?», fragen sie mich.
«Zu was sollte ich denn schreien?»
«Wenn das so ist», sagen sie zu mir, «müsstet Ihr doch auch wissen, ob es noch recht weit nach Bojberik ist?»
«Nach Bojberik», sage ich, «ist es nicht weit, nur einige Werst14; das heißt», sage ich, «so fünf, sechs oder sieben Werst oder in Wirklichkeit vielleicht ganze acht.»
«Acht Werst?!», riefen beide Frauen gleichzeitig aus, rangen die Hände und wären beinahe in ein Weinen ausgebrochen. «Verflixt, was redet Ihr? Wisst Ihr, was Ihr da sagt? Das spricht sich wohl leicht – acht Werst!?»
«Nun», sage ich, «was soll ich denn tun? Würde es von mir abhängen, dann würd’ ich ja die Strecke ein bisschen kürzer machen; ein Mensch soll», sage ich, «alles auf der Welt ausprobieren. Unterwegs kann es schon mal vorkommen, dass man», sage ich, «sich im Matsch einen Berg hinaufschleppen muss und das noch dazu kurz vor Beginn des Sabbats, der Regen peitscht ins Gesicht, die Hände werden klamm, das Herz stockt – und mit einem Mal: bumm! Eine Achse birst …»
«Ihr redet ja wie ein Verrückter», sagen sie zu mir, «Ihr seid wohl nicht recht bei Verstand, meiner Seel’. Was erzählt Ihr da für Litaneien, Ammenmärchen aus Tausendundeiner Nacht? Wir haben schon keine Kraft mehr, uns auf den Beinen zu halten; den ganzen Tag lang haben wir außer einem Gläschen Kaffee und einer Buttersemmel noch nichts im Mund gehabt, da kommt Ihr mit Euren Geschichten daher.»
«Wenn das so ist», sage ich, «ist das was anderes; wie sagt man: Kein Tanz geht vor dem Essen. Wie Hunger schmeckt, versteh’ ich ganz gut, Ihr braucht mir da nichts zu erzählen. Es kann recht gut sein», sage ich, «dass ich schon ein Jahr lang keinen Kaffee und keine Buttersemmel zu Gesicht bekommen habe …» Und während ich so rede, sehe ich in meiner Phantasie ein Gläschen heißen Kaffee mit Milch und eine frische Buttersemmel und andere gute Dinge … «Du Unglücksmensch», denke ich mir, «du bist doch tatsächlich anders groß geworden als nur mit Kaffee und Buttersemmeln! Aber nicht einmal ein Stückel Brot und Hering kannst du dir leisten!» Doch er, der Böse Trieb – nicht einmal gedacht soll er werden –, zufleiß Kaffee, zufleiß Buttersemmel! Ich spüre den Duft des Kaffees, ich fühle den Geschmack der Buttersemmel – der frischen, wohlschmeckenden. Wie wunderbar!
«Also wisst Ihr was, Reb Tewje?», sagen die beiden Frauen zu mir. «Vielleicht wäre es nicht dumm, wenn wir, so wie wir hier stehen, zu Euch auf den Wagen hinaufklettern und Ihr selbst die Mühe auf Euch nehmt, uns – mit Verlaub – nach Hause zu fahren, nach Bojberik? Was würdet Ihr dazu sagen?»
«Das passt jetzt so gut», sage ich, «wie ein zerbrechender Tontopf: Ich komme von Bojberik, und Ihr müsst nach Bojberik! Wie soll die Katze übers Wasser kommen?»
«Nun, was ist?», sagen sie. «Wisst Ihr nicht, was zu tun ist? Ein gelehrter Mann weiß sich zu helfen: Er wendet den Wagen und fährt zurück. Habt keine Angst, Reb Tewje», sagen sie, «sondern seid versichert, dass wir uns, wenn uns Gott – so Er will! – sicher nach Hause gebracht haben wird, wünschen werden, so viel erleiden zu müssen, was Ihr bei uns draufzahlen werdet.»
«Die sprechen mit mir in einer fremden Sprache!», denke ich. «In einer Geheimsprache, nicht so, wie es normal ist!» Und mir kommt wieder allerhand in den Sinn: die Geister Verstorbener, Hexen, Kobolde, eine verschleppte Krankheit. «Strohdummer Strohkopf!», denke ich mir. «Was stehst du wie ein Stecken? Spring auf den Wagen, zeig dem Pferd die Peitsche und gib Fersengeld!» Aber wie wenn der Teufel seine Hand im Spiel hätte, kommt mir ungewollt Folgendes über die Lippen: «Klettert auf den Wagen!»
Die beiden haben’s gehört, sich nicht lange bitten lassen, und – marsch! – in den Wagen hinein! Danach ich auf den Kutschbock, die Deichsel gewendet, dem Pferd ein Hiebchen: eins, zwei, drei, vorwärts! – Wer, was, wen? Verlor’ne Liebesmüh! Es will sich nicht von der Stelle rühren, selbst wenn du’s auseinanderschneiden würdest. «Nu», denke ich mir, «jetzt verstehe ich schon, was das für Frauen sind … Der Gottseibeiuns hat mich dazu gebracht, grad’ in der Mitte meines Wegs anzuhalten und mich auf einen Plausch mit Frauen einzulassen!» … Ihr versteht doch: auf der einen Seite der Wald, still und düster, Nacht bricht herein, und hier die zwei Wesen, vorgeblich Frauenzimmer … Die Phantasie spielt hitzig auf allen Saiten meines Inneren. Ich erinnere mich an die Geschichte eines Fuhrmanns, der einmal ganz allein durch den Wald gefahren ist und auf der Landstraße einen Sack Hafer liegen sah. Als mein Fuhrmann also den Sack Hafer gesehen hat, er nicht faul, herunter vom Wagen, den Hafersack auf die Schultern gepackt, dass er sich fast einen Bruch gehoben hätte, und brachte den Hafersack mit größter Mühe auf den Wagen hinauf und – er ging den Weg allen Fleisches, vorwärts weiter! Wie er so eine Werst zurückgelegt hat, dreht er sich nach dem Sack Hafer um – aber da war kein Sack und kein Hafer! Eine Ziege ist es, die auf seinem Wagen liegt, eine Ziege mit Bärtchen; er möchte sie mit der Hand antappen, streckt sie ihm die Zunge einen Arschín15 weit entgegen, stößt ein seltsam wüstes Gelächter aus und verschwindet …
«Warum fahrt Ihr nicht endlich?», fragen mich die Frauen.
«Warum ich nicht endlich fahre? Ihr seht doch», sage ich, «warum: Das Pferd will nicht beten, ist nicht dazu aufgelegt.»
«Zieht ihm die Peitsche über», meinen sie, «Ihr habt doch eine Peitsche.»
«Ich danke Euch», sage ich, «für den Ratschlag. Gut, dass Ihr mich daran erinnert habt. Die Sache hat nur den einen Schönheitsfehler», sage ich, «dass sich der Bursche von solchen Sachen nicht beeindrucken lässt; er ist schon so an die Peitsche gewöhnt wie ich an die Armut!» – Also spreche ich zu ihnen, als würd’ ich uralte höhere Volksweisheiten zitieren, und zittere dabei in einem Anfall der alle paar Jahre auftauchenden erhöhten Temperatur.
Kurz und gut, was soll ich Euch unnötig aufhalten – alle Verbitterung meines Herzens bekam mein armes Pferd zu spüren – so lange und so weit, bis Gott geholfen hat und es sich fortzubewegen begann, und sie zogen aus von Raphidim – und wir brausten schnurstracks durch den Wald unseres Weges. Und wie wir so fahren, fliegt mir ein gänzlich neuer Gedanke durch den Kopf: «Oj, Tewje, bist du ein Rhinozeros! Du hast zu fallen angefangen – warst ein Habenichts und wirst ein Habenichts bleiben. Ja, wie denn, was denn? Gott hat für dich so eine Begegnung in die Wege geleitet, wie sie sich einmal in hundert Jahren ergibt, und wieso bedingst du dir nicht von Anfang an aus, was du zu kassieren hast – was es dir bringt? Egal aus welcher Perspektive man die Sache auch betrachtet: von der Gerechtigkeit her oder vom Gewissen, von der Menschlichkeit oder vom himmlischen oder vom irdischen Gesetz her und sogar von was weiß ich her – es ist keineswegs ein Unrecht, wenn man dabei etwas verdient; und warum sollst du den Knochen nicht ablecken, wenn sich so eine Gelegenheit bietet? Halte das Pferd an, du Ochse, rede mit den beiden Tacheles16 – wie vor deiner entkleideten Tochter Rachel: «Bekomme ich von Euch soundso viel, ist es gut, falls nicht, bitten wir Euch, nichts für ungut! – runter vom Wagen!» Doch dann denke ich wieder: «Bist wirklich ein Rindvieh, Tewje! Weißt du nicht, dass man das Bärenfell im Wald nicht verkaufen darf, denn wie sagt der Goj17: Bevor er ihn gefangen hat, will er ihm schon das Fell abdecken …»
«Weshalb fahrt Ihr nicht ein bisschen schneller?», sagen die Frauen und stupsen mich von hinten.
«Was habt Ihr denn», sage ich, «so gar keine Zeit? Vom Gehetze», sage ich, «kommt nichts Gutes heraus», sage ich und werfe einen Blick von der Seite auf meine Passagiere; wie es aussieht – Frauen, natürlich, Frauen: eine mit einem seidenen Kopftuch, die andere mit einer Perücke; da sitzen sie und schauen eine die andere an und tuscheln.
«Ist es denn noch weit?», fragen sie mich.
«Näher», sage ich, «als von hier gewiss nicht; gleich», sage ich, «kommt ein Bergab und dann ein Bergauf; danach», sage ich, «geht’s wieder bergab und dann bergauf, und erst danach», sage ich, «haben wir das große Bergauf, und von dort geht dann der Weg eben dahin, geradewegs bis Bojberik …»
«Was für ein Unglücksrabe!», meint die eine zur anderen.
«Eine verschleppte Krankheit!», sagt die andere.
«Das, was einem gerade noch gefehlt hat!», sagt wieder jene.
«Mich deucht, ein Meschuggener18!», sagt die andere.
«Gewiss», denk’ ich bei mir, «bin ich ein Meschuggener, wenn ich mich so an der Nase herumführen lasse …!»
«Wo werdet Ihr Euch denn, beispielshalber zum Exempel, meine lieben Frauen, abwerfen lassen?», wende ich mich an sie.
«Was heißt», sagen sie, «abwerfen? Was für eine Abwerferei soll das sein?»
«So redet man», sage ich, «in der Fuhrmannssprache. In unserer Diktion bedeutet das: Wohin wollt Ihr Euch bringen lassen, wenn wir», sage ich, «nach Bojberik gelangen, so Gott will, mit des Höchsten Hilfe, gesund und stark, wenn Er uns das Leben vergönnt? Wie sagt man: Besser zweimal fragen als einmal irregehen.»
«Ah? Das meint Ihr also? Ihr werdet», sagen sie, «die Güte haben, uns zur grünen Datscha zu bringen, die neben dem Fluss, jenseits des Waldes. Wisst Ihr, wo das ist?»
«Weshalb soll ich das nicht wissen?», sage ich. «Ich bin in Bojberik wie bei mir daheim. So viele Tausender soll ich besitzen», sage ich, «wie viele Klötze ich dorthin hineingefahren habe! Erst letztes Jahr im Sommer», sage ich, «hab’ ich bei der grünen Datscha zwei Klafter Holz auf einmal abgeladen; dort hat ein großer Magnat geweilt, aus Jehupez, ein Millionär mit bestimmt einem Hunderttausend Rubeln und vielleicht sogar mit zweihunderttausend!»
«Der weilt auch heut’ dort», sagen die beiden Frauen zu mir und sehen einander an und tuscheln und lachen.
«Pscht!», sage ich. «Wenn das Leid des In-anderen-Umständen-Seins schon so groß ist, könnte es doch vorstellbar sein, dass Ihr zu ihm irgendwie in einer Beziehung steht – da würde es doch nicht als abwegig erscheinen», sage ich, «wenn Ihr Euch dorten ein bisschen bemühtet, für mich ein gutes Wort einlegtet, wegen einer kleinen Wohltat für mich, einer Beschäftigung, einer Anstellung oder was weiß ich? Ich kenne», sage ich, «einen jungen Mann, Jißroel heißt er, nicht weit von unserem Städtel, der war ein Nichts und Wiedernichts; aber er erreichte sein Ziel, man weiß nicht von wo und wie – kurz und gut, er ist heute ein bedeutender Mann, verdient vielleicht zwanzig Rubel die Woche oder vielleicht sogar vierzig, was weiß ich? – Menschen haben Glück! Oder, zum Beispiel, was geht», sage ich, «dem Schwiegersohn unseres Schächters ab? Was wäre aus ihm geworden, wär’ er nicht nach Jehupez gegangen? Wahrlich, die ersten paar Jahre hat er’s furchtbar schwer gehabt, wär’ beinahe vor Hunger gestorben. Dafür aber jetzt! – Könnte das, außer seinem Schaden, über mich gesagt werden! Er schickt bereits Geld nach Hause und würde schon liebend gern seine Frau und Kinder dorthin nachkommen lassen, aber man lässt ihn dort nicht weilen. Ei, bleibt doch die kniffelige Frage, wie er denn dort weilt? Er quält sich wirklich ab … Pst», sage ich, «wenn man lebt, kann man was erleben. Da habt Ihr schon», sage ich, «den Fluss, und dort ist die große Datscha», sage ich und fahre bequem und mit großem Krawall hinein – geradewegs mit der Deichsel in die Veranda hinein.
Kaum dass man uns erblickt hatte, brach schon überall Jubel, Trubel, Heiterkeit aus, ein Geschrei und ein Lärmen: «Oj, die Großmutter! Die Mutter! Die Tante …! Alles gut ausgegangen! Masel-tov19 …! Herrgott, wo seid ihr denn gewesen …? Den ganzen Tag wie kopflos … haben Boten nach allen Richtungen ausgesandt … haben gemeint, man kann ja nie wissen, dass vielleicht Wölfe, Räuber, behüt’ Gott … Was ist passiert?»
«Eine schöne Geschichte ist passiert: Wir sind im Wald herumgeirrt, weit in die Irre gegangen, vielleicht zehn Werst. Plötzlich ein Mann … Was für ein Mann …? Ein Jude, ein Unglücksmensch, mit Pferd und Wagen … Nur mit Ach und Weh hat er sich bitten lassen …»
«Potz Schreck und Albtraum … Ganz allein und unbehütet …? Was für eine Geschichte … Gott sei Dank, nun ist’s vorbei!»
Kurz und gut, man trug Lampen auf die Veranda heraus, deckte den Tisch, holte heiße Samoware und Teekannen her und Zucker und Eingemachtes und leckere Omeletten und frisches, duftendes Buttergebäck und dann allerlei Esssachen, die teuersten Speisen, fette Suppen und Braten und eine Menge Gänsernes, dazu die besten Weine und Schnäpse.
Ich bin nur in einiger Entfernung dagestanden und habe beobachtet, wie – unberufen – man bei den Jehupezer Reichen so isst und trinkt, kein böser Blick möge ihnen Schaden bringen! «Alles Verpfändbare versetzen», denke ich mir, «und ein Vermögender sein!» Mir scheint – was weiß ich? –, was hier auf den Boden fällt, würde meinen Kindern eine ganze Woche lang reichen, bis zum Sabbat. «Hilfe, lieber Gott, fürsorglicher und getreuer, der du doch ein mitleidvoller Gott, ein großer Gott und ein guter Gott voller Gnade und Gerechtigkeit bist, wie kommt es, dass du dem einen überreichlich und dem anderen überhaupt nichts gibst? Dem einen Buttersemmeln, dem anderen Krümel vom Schlangenfraß?» Aber dann überlege ich wieder so: «Pah, bist doch ein großer Narr, Tewje, bei meiner Seel’, was soll denn das, dass du Ihm deine Ansichten darüber unterbreitest, wie die Welt zu führen sei?» Gewiss, gewiss, wenn Er es so befiehlt, muss es so sein; Ihr könnt das klar daran erkennen, dass es, wenn es anders sein müsste, doch auch anders wäre. Ei was? Weshalb es tatsächlich nicht anders ist? Darauf lautet die Entgegnung: Knechte waren wir – dafür sind wir Juden doch auf dieser Welt da. Ein Jude muss in Glauben und Gottvertrauen leben; er muss erstens daran glauben, dass es einen Gott auf der Welt gibt, und dann in den seine Hoffnung setzen, der ewig lebt, dass alles, gewiss, so Gott will, besser wird …
«Still, wo ist denn der Jud’ hingekommen?», höre ich jemanden fragen. «Schon wieder weggefahren, der Unglücksmensch?»
«Gott behüte!», versetze ich aus der Ferne. «Glaubt Ihr denn, ich werde einfach so wieder wegfahren, ohne eine Verabschiedung? Schalom-alejchem!», sage ich. «Einen guten Abend Euch, wünsche gesegneten Appetit und gut zu speisen und wohl bekomm’ es Euch!»
«Kommt doch her», reden sie mich an, «was steht Ihr dort im Dunkeln? Wir wollen Euch doch wenigstens anschauen, sehen, was für ein Gesicht Ihr habt. Vielleicht nehmt Ihr ein bisschen Branntwein?»
«Ein bisschen Branntwein? Ach», sage ich, «wer würde ein bisschen Branntwein ablehnen? Wie steht es dort geschrieben: Der eine wird leben – prost! – und der andere sterben – dazu kommentiert Raschi: Gott ist Gott und Branntwein ist Branntwein. Also – sollt leben!», sag’ ich und stürz’ einen guten Trank hinunter. «Gebe Gott», sage ich, «Ihr möget immer reich sein und viel Freude haben; Juden», sage ich, «sollen immer Juden bleiben; Gott gebe ihnen», sage ich, «Gesundheit und Kraft, damit sie alle Zores ertragen können.»
«Was ist Euer Name?», fragt mich der Hausherr selbst, ein stattlicher Mann mit einem Käppchen auf. «Woher kommt Ihr, wo wohnt Ihr, was ist Euer Geschäft? Seid Ihr verheiratet? Habt Ihr Kinder und wie viele Kinder?»
«Kinder?», sage ich. «Ich kann mich nicht beklagen! Wenn jedes Kind», sage ich, «eine Million wert ist, wie meine Golda mir einreden will, bin ich reicher als der größte Vermögende in Jehupez. Der wunde Punkt», sage ich, «ist, dass arm nicht reich ist und krumm und grad’ nicht gleich ist, so wie es geschrieben steht: Der, welcher unterscheidet zwischen dem Heil’gen und dem Wochentäglichen – der, welcher Pinkepinke hat, der lebt eben im Behaglichen. Das Geld haben eben die Brodskis, und ich habe Töchter. Und hat man, sagt man, Töchter, vergeht einem ’s Gelächter. Aber nicht doch, Gott ist ein Vater. Er führt aus, das heißt, Er sitzt oben, und wir quälen uns unten ab. Man schuftet, man schleppt Klötze, aber hat man eine Wahl? Wie’s im Talmud heißt: An einem Ort, an dem kein Mensch ist – bleibt ein Hering trotzdem noch ein Fisch. Das ganze Unglück ist – das Essen. Wie meine Großmutter, sie ruhe in Frieden, zu sagen pflegte: ‹Wenn das Maul unter der Erde läge, würde der Kopf in Gold gekleidet gehen.› … Nehmt es mir nicht übel», sage ich, «es gibt nichts Geraderes als eine schiefe Leiter und nichts Schieferes als ein gerades Wort, und speziell», sage ich, «wenn man sich einen Schnaps auf nüchternen Magen zu Gemüte führt.»
«Man soll dem Mann doch etwas zu essen geben!», ruft der Hausherr, und gleich wird von allem Vorstellbaren auf den Tisch gebracht: Fisch und Fleisch und Braten und Geflügelteile und Gänsemagen mit Leberchen ohne Ende.
«Ihr werdet doch etwas essen?», fragen sie mich. «Geht Euch waschen!»
«Einen Kranken fragt man, einem Gesunden gibt man; also», sage ich, «herzlichen Dank. Ein bisschen Schnaps», sage ich, «mit Vergnügen; aber sich einfach da hinsetzen und ein Festmahl schmecken lassen, während dort, bei mir daheim, meine Frau und Kinder, sie sollen gesund sein … Wenn es aber Euer guter Wille ist …»
Kurz und gut, man kapierte offenkundig, was ich meinte, und jeder einzelne begann mir auf den Wagen aufzupacken: der – eine Semmel, jener – Fische, der – Braten, jener – ein Viertel Geflügel, der – Tee und Zucker, jener – einen Topf Schmalz, der – ein Glas Eingemachtes.
«Das bringt Ihr», meinen sie, «als Geschenk für Eure Frau und Kinder nach Hause. Und jetzt sagt, wie viel wollt Ihr, dass man Euch für Eure Mühe zahlt, die Ihr unseretwegen auf Euch genommen habt?»
«Wie kann man das», sage ich, «in Beziehung setzen, dass ich bestimmen könnte, was mir zuzumessen wäre? Ihr werdet mich», sage ich, «Eurem guten Willen gemäß bezahlen. Wir werden uns schon einigen, denn wie heißt es: Ein Rubel mehr, ein Rubel weniger … Ein ausgetretener Schuh kann nicht noch ausgetretener werden …»
«Nein», sagen sie, «wir wollen es von Euch selbst hören, Reb Tewje! Fürchtet Euch nicht, man wird Euch, Gott bewahre, schon nicht köpfen.»
«Was soll man da machen?», denke ich mir. «Das ist schlecht: Wenn ich sage: einen Rubel, wär’s schade, wenn ich vielleicht zwei hätte nehmen können. Sage ich aber: zwei, fürchte ich, sie könnten mich für einen Wahnsinnigen halten: ‹Weshalb macht das zwei Rubel?›»
«Drei Rubelchen …!!!», platzt es aus meinem Mund heraus. Und unter den Leuten bricht so ein Gelächter aus, dass ich mich am liebsten tief in die Erde eingegraben hätte.
«Nehmt es mir nicht übel», sage ich, «wenn es so aus mir herausgeplatzt ist; ein Pferd», sage ich, «auf vier Füßen strauchelt auch, um wie viel mehr ein Mensch mit seiner einen Zunge …»
Das Gelächter wurde noch stärker; man hält sich einfach die Seiten vor Lachen.
«Lasst es genug sein mit dem Lachen!», ruft der Hausherr, nimmt aus der Brusttasche eine große Börse und kommt und zieht aus der Börse – was meint denn Ihr, wie viel? Nun, ratet! – einen Zehner, einen, der so rot wie Feuer war, wie ich mit Euch zusammen gesund sein möge! – Und er spricht so: «Das bekommt Ihr von mir, und ihr, Kinder, gebt nun aus eurer Tasche, soviel euch angemessen erscheint.»
Kurz und gut – was interessieren Euch Details? –, es begannen Fünfer, Dreier und Einer auf den Tisch zu fliegen … Arme und Beine haben mir gezittert; ich hab’ gemeint, ich fall’ gleich in Ohnmacht.
«Nu, was steht Ihr so da?», macht der Hausherr zu mir. «Sammelt die paar Rubelchen auf dem Tisch ein und fahrt gesund zu Eurer Frau und den Kindern.»
«Gott gebe Euch», sage ich, «das x-fache davon; Ihr sollt zehnmal, hundertmal so viel besitzen, sollt das Allerbeste haben – und Freude dazu!» Und ich scharre mit beiden Händen das Geld zusammen – wie hätt’ ich’s zählen sollen? – und stopfe es in alle Taschen. «Eine gute Nacht!», sage ich. «Und seid wohlauf und gesund und», sage ich, «viel Glück Euch und Euren Kindern und Kindeskindern und Eurer ganzen Familie», sage ich und gehe in Richtung Wagen los.
Da ruft mir die Hausherrin zu – jene mit dem seidenen Tuch: «Bleibt noch eine Weile, Reb Tewje, denn von mir bekommt Ihr noch ein besonderes Geschenk; so Gott will, fahrt morgen noch einmal her; ich habe», sagt sie, «eine braune Kuh, die war mal eine wertvolle Kuh und pflegte vierundzwanzig Glas Milch zu geben; jetzt hat sie wahrscheinlich ein böser Blick getroffen, und sie hat aufgehört, sich melken zu lassen, das heißt, melken lässt sie sich wohl noch, aber sie gibt keine Milch mehr …»
«Lange leben sollt Ihr», sage ich, «Ihr sollt keine Leiden haben. Bei mir wird sich Eure Kuh sowohl melken lassen als auch Milch geben; meine Alte ist, toi-toi-toi, eine solche Hausfrau, die aus nichts Nudeln fabriziert, aus den Fingern heraus macht sie Einbrenn, mit Mirakeln bereitet sie Sabbat, und mit Ohrfeigen legt sie die Kinder schlafen … Nehmt es mir nicht übel», sage ich, «wenn mir schon wieder ein überflüssiges Wort entschlüpft sein sollte. Eine gute Nacht und seid wohlauf und seid gesund», sage ich und mache mich auf den Weg.
Ich schau’ in den Hof zum Wagen, ich will zum Pferd hin – o weh, ein Unglück, Zores, Schicksalsschlag! Ich schaue nach allen Seiten, und das Kind ist fort – kein Pferd mehr da!
«Nun, Tewje», denke ich mir, «jetzt hast du das Schlamassel!» … und es kommt mir eine schöne Geschichte in den Sinn, die ich irgendwann einmal in irgendeinem Buch gelesen habe, wie die «Rotte» in der Fremde einmal einen ehrlichen Juden, einen Chassid20