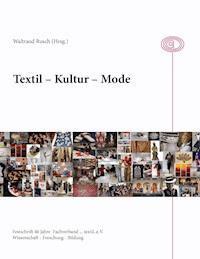
Textil - Kultur - Mode E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Fachverband …textil..e.V., Wissenschaft–Forschung–Bildung feiert sein 40-jähriges Bestehen. Der fundamentale Bildungsgehalt des Textilen wird bis heute kaum wahrgenommen. Mit den vielfältigen technologischen, ökologischen, ökonomischen, soziologischen, psychologischen, kulturwissenschaftlichen, historischen und ästhetischen Anteilen trägt das Textile und dessen Vermittlung mit alltagsrelevanten Theorie- und Praxisanteilen zu einer umfassenden zeitgemäßen Allgemeinbildung bei. Der Fachverband …textil..e.V. sieht sich in der Verantwortung, die Relevanz des Textilen in der Bildung zu manifestieren und zu legitimieren. In der vorliegenden Festschrift spiegeln sich sowohl die fachwissenschaftliche Breite als auch das Ringen um die didaktische Weiterentwicklung des Textilunterrichts in Vergangenheit und Gegenwart wider. Alle Autorinnen und Autoren sind dem Fachverband …textil..e.V. als Mitglieder oder Förderer verbunden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinweis: Die Rechte an Bild und Text wurden von den Autoren und Autorinnen gegenüber der Herausgeberin verbindlich geregelt. Sollte es trotz dieser Absicherung nicht gelungen sein, alle Rechtsinhaber zu ermitteln, werden Ansprüche direkt über die Autoren und Autorinnen im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Waltraud Rusch 40 Jahre Fachverband …textil..e.V. Wissenschaft – Forschung – Bildung
Renate Schwender, Hella Helfrich, Dorothea Didlaukies Lang ist es her, 40 Jahre – und von Anfang an dabei!
Ingrid Bindzus Erika Cohn – eins der aktivsten Mitglieder des Fachverbandes
Erika Cohn Texere
Marlene Seedig Erinnerungen und Gedanken zu 40 Jahre Fachverband für Textilunterricht
Gert Eberhardt Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiliäum des Fachverbands …textil..e.V. 2015
Jutta Lademann Kultur als Chance
Iris Kolhoff-Kahl Von Textil aus kreativ…
Beate Schmuck Vom Textilen aus! Konzeptionelle Überlegungen zu einer kulturanthropologischen Textildidaktik
Barbara Hanne Museen heute: Archiv, Schaufenster und mehr?
Norbert Schütz Traditionelle Webkultur in Litauen
Roswitha Zwerger Stroh – ein seltener Werkstoff der Textilkultur
Annette Hülsenbeck Textiles lehren – Komplexität vermitteln, das Selbstverständliche begreifen
Monika Hoede Trachtenkulturberatung – eine Einrichtung des Bezirks Schwaben
Waltraud Rusch „Handarbeitslehrerinnenausbildung“ zwischen Perfektion und Ästhetik
Karin Terdenge Digitale Medien in der beruflichen Bildung
Barbara Denker Internationalisierung der B5 Modeschulen Nürnberg
Wiebke Harms-Hollmann, Anna Sophie Müller Bodification an mir Puppe
Anne-Marie Grundmeier Vogue for me – Mode und Accessoires auf dem Runway
Dorit Köhler Rokoko goes Outdoor – Kleidobjekte von Studierenden aus Funktionstextilien
Katja Bierkandt-Mühlenz Monica Menez – Modefotografin und Shootingstar im neuen Genre Fashion-Film
Anni Kropf Weltumspannend: Kultur – Kleidung – Mode. Mein persönlicher Beitrag
Autorenverzeichnis
Vorwort
Textilien in den verschiedensten Formen gehören zu den ältesten Artefakten, die seit der Frühzeit der Menschheit hergestellt werden. Bis heute zählen sie zu einer der wenigen Produktgruppen, die in allen Lebensbereichen der Menschen Anwendung finden. Die „Handarbeit“ hat in der Gegenwart gesellschaftlich eine Aufwertung erfahren, verknüpft mit der Sehnsucht nach dem Echten, dem Handgemachten, dem Individuellen. Sinnliche Erfahrungen und sinnvolle Erlebnisse werden spürbar und wirken.
Diese Worte stelle ich voran, um auf die Bedeutung der und den Umgang mit Textilien hinzuweisen. Der Fachverband …textil..e.V. existiert nun 40 Jahre. Er hat an Bedeutung gewonnen, denn die Gründe seiner Gründung bestehen bis heute und zeigen sich in den Zielen, die noch immer Gültigkeit haben. Zum Geburtstag haben sich dem Fachverband zugehörige oder nahe stehende Autoren und Autorinnen bereit erklärt, ein Geschenk für die Festschrift „Textil – Kultur – Mode“ abzugeben, zum Teil wissenschaftlich, zum Teil sehr persönlich verpackt. Die Sammlung von Aufsätzen spiegelt sowohl die fachwissenschaftliche Breite als auch das Ringen um die didaktische Weiterentwicklung des Textilunterrichts in Vergangenheit und Gegenwart wider. Die persönliche Auseinandersetzung mit dem Textilen wird in zahlreichen Beiträgen spürbar.
Der Fachverband …textil..e.V. ist seit der vergangenen 40 Jahre den Herausforderungen einer steten Legitimation eines Faches „Mode und Textil“ ausgesetzt. Der kreative, funktionale und modische Umgang mit diesem Material und dessen Vermittlung in Schule und Hochschule ist eine Zielsetzung, die der Fachverband …textil..e.V. nun schon seit 40 Jahren verfolgt. Die Bildungslandschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Gleichzeitig haben sich auch die Schwerpunkte und Inhalte des Textilen verändert. Aktualität und Zeitgemäßheit sind die zu berücksichtigenden Aspekte, die wohlweislich auf Kultur, Historie und Können bauen und die Zukunftsorientierung in sich bergen.
Möge der Fachverband …textil..e.V. noch lange bestehen und seine Ziele erfolgreich umsetzen. Das gelingt ihm nur, wenn viele engagierte Mitglieder den Verband tragen, unterstützen und fördern. Hier ist es Zeit, sich zu bedanken bei den Autoren und Autorinnen, die mit ihren Beitrag ihr Engagement öffentlich werden lassen. Großer Dank geht an die Initiative Handarbeit e.V., an die Firmen Myboshi und Senci, die den Druck dieser Festschrift finanziell großzügig unterstützten.
Muggensturm, im September 2015
Waltraud Rusch
Waltraud Rusch
40 Jahre Fachverband …textil..e.V. Wissenschaft – Forschung – Bildung
1975 wurde der Fachverband unter dem Namen „Fachverband Textilunterricht e.V.“ in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Hannover eingetragen. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten damals Prof. Dr. Ruth Bleckwenn aus Münster und Prof. Dr. Eva Schmidt aus Weingarten. Diese beiden Hochschullehrerinnen haben in der Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Verbandes die „Vorgeschichte und erste Zeit des Fachverbandes Textilunterricht e.V. im kaleidoskopischen Rückblick skizziert“. Ich erlaube mir ihren Beitrag von vor 15 Jahren hier einzupflegen. Meine Person könnte diese Zeit nur aus der Aktenlage heraus beschreiben, denn ich bin kein Zeitzeuge. Deshalb hier O-Ton Ruth Bleckwenn und Eva Schmidt:
„Jeder Verein hat eine Vorgeschichte, die zu seiner Gründung führt. Anlässlich des 25. Jubiläums unseres Fachverbandes Textilunterricht e.V. bietet es sich an, grundsätzliche Überlegungen und Vorstellungen, die zu seiner Existenz geführt haben, Revue passieren zu lassen, die ersten Anfangsjahre zu skizzieren und sich dann zu fragen, was daraus geworden ist. Inwieweit ließen sich die Vorgaben realisieren, haben sich verändert, sind überhaupt noch aktuell, bzw. was ist an deren Stelle getreten?
Am Anfang war die HEF
Für die Pädagogischen Hochschulen, die in den 60er und 70er Jahren im gesamten Bundesgebiet für die Ausbildung von Lehrern an Grund-, Haupt- und Realschulen zuständig waren, hatte die KMK (ständige Konferenz der Kultusminister der Länder) in Bonn ein Zentralorgan eingerichtet, die Hochschulkonferenz für Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik (HEF). Alle Vertreter einer Fachdidaktik an den Pädagogischen Hochschulen waren in einer Bundesfachgruppe zusammengefasst, die sich einmal jährlich traf und über einen Sprecher Kontakte zur HEF pflegte.
So versammelten sich auch die Lehrenden, Lehrbeauftragten und StudentenvertreterInnen an den Pädagogischen Hochschulen in der Bundesfachgruppe Textiles Gestalten aus den damaligen Ländern der BRD einschließlich Westberlin zum ersten Male am 15./17.5.1969 in Hannover unter dem Vorsitz von Frau Meffert, Hannover, und von Frau Meinkens, Bremen. Der Vorstand wurde bei dieser Tagung erweitert durch Frau Nippel, Hagen, und Frau Köller, heute Oldenburg. Die jährlichen Tagungen fanden seitdem an verschiedenen Hochschulorten statt.
Die Geschäftsordnung der Fachgruppe nannte als wichtigste Aufgabe: „Sie (die Fachgruppe) vertritt das Interesse des Fach Textiles Gestalten innerhalb der Hochschulen und in der Öffentlichkeit. Die Beschlüsse der Fachgruppe gelten als Empfehlungen.“ (Fassung vom 24.5.70). Die Lehrenden der Pädagogischen Hochschulen in einigen Bundesländern wiederum trafen sich in Landesfachschaften, um die Bundestagungen inhaltlich vorzubereiten und die landesspezifischen Anliegen einzubringen. In Baden-Württemberg existiert die Landesfachschaft HTW (Hauswirtschaft/Textiles Werken) als wohl letztes Relikt heute noch und fungiert als informeller Ansprechpartner des Ministeriums.1
Die Inhalte der Diskussionen, die bei den Treffen der Bundesfachgruppe geführt wurden, betrafen höchst brisante Themen: Von Anfang an und in erster Linie ging es um die Existenz des Faches. Eine Bedrohung ging einmal von der geplanten Koedukation aus – es galt zu beweisen, dass die Inhalte des Textilen Gestaltens keineswegs nur für die Mädchenerziehung wichtig, sondern von allgemeinem Bildungswert, d.h. eben auch für die Jungen unverzichtbar sind und in den Fächerkanon der Allgemeinbildenden Schulen gehören – ein Desiderat, das bis heute noch nicht eingelöst ist.
Eine weitere existentielle Sorge betraf die Auswirkungen der Bildungsreform, die sich – als Folge des berühmten Sputnikschocks – die Verwissenschaftlichung der Schulbildung auf die Fahnen geschrieben hatte. Tradierte Bildungsrelevanz wurde nicht mehr akzeptiert, es galt auch für das Fach Textiles Gestalten einen Wissenschaftsbezug nachzuweisen, was nicht einfach war, da wir uns eben nicht von einer universitären Fachwissenschaft ableiten, sondern uns eine Vielzahl von Bezugswissenschaften aus dem kulturhistorischen, naturwissenschaftlichen, soziologischen und künstlerischen Bereich als Fundus dient.
Auf der anderen Seite drohte massive Gefahr durch Vereinnahmung durch neu entstehende Schulfächer, bzw. fachübergreifende Lernbereiche. In der Grundschule war die Selbständigkeit des Faches bedroht durch den Bereich Bildende Kunst oder Werken. In der Sekundarstufe I waren es die neu installierten Fächer wie Arbeitslehre, Polytechnik oder ähnliche Konstruktionen, die in der Folgezeit bewirkten, dass in manchen Bundesländern Textilunterricht ganz aus dem Lehrplan verschwand oder sich textile Inhalte höchstens noch als rudimentäre Einsprenglinge mit bestimmten, technisch oder berufsorientierten Aspekten wiederfanden.
Wenn es galt, in den bildungspolitischen Gremien der Länder oder des Bundes die Relevanz des Faches im Fächerkanon für eine Allgemeinbildung zu verteidigen, war es stets besonders frustrierend festzustellen, dass häufig weder Name, Inhalte noch Anliegen des Textilunterrichts bekannt waren – wie sollten sie auch, wenn schon die Bezeichnungen in den einzelnen Bundesländern voneinander abwichen und noch verschiedener waren als es heute der Fall ist.
Eine moderne fachdidaktische Literatur des Textilunterrichts existierte überhaupt nicht; erste Anstöße lieferte Grete Meyer-Ehlers, von der Werkpädagogik geprägt, in „Textilwerken“ 1965. Dieser Ansatz wurde jedoch nicht weiter verfolgt, da die Fachdidaktik, die sich in den 70er und 80er Jahren allmählich zu Wort meldete, eine andere Richtung einschlug. Es war daher zu jenen Zeiten nicht möglich, sich auf einschlägige schriftliche Argumentationen zu berufen, während etablierte Fächer viele Regalmeter didaktischer Literatur in den Bibliotheken aufzuweisen hatten.
Weitere wichtige Themen der Bundesfachtagungen betrafen Ansehen und Ausstattung des Faches in Schule und Hochschule, Zielvorgaben der KMK bezüglich der anstehenden neuen Lehrplankonzeptionen, Lehrverpflichtungen, Numerus clausus, Kapazitätsfragen und dergleichen mehr – diese Themen sind bis dato den Hochschulen bekannt und haben leider bis heute nichts von Aktualität eingebüßt.2
Die Umstrukturierung der Hochschule und ihrer Organisation führten dazu, dass die HEF zum 31.12. 1974 aufgelöst wurde. Auf unserer letzten Bundesfachgruppentagung in Münster wurde deutlich, dass ein enger Kontakt zwischen den Hochschulen innerhalb der Bundesrepublik überlebensnotwendig für ein Fach wie das unsere war. Die Gefahr, in der Öffentlichkeit keine Stimme, keine Lobby zu haben, irgendwelchen anderen Interessen geopfert zu werden, durch Lehrplankürzungen aus dem Fächerkanon der Schulen zu fallen, anderen Bildungsbereichen zugeschlagen zu werden, machten gegenseitige Unterstützung notwendig, landauf landab war ein engmaschiges Verbindungsnetz unabdingbar. Die inhaltliche Diskussion zum Selbstverständnis des Faches musste dringend weitergeführt werden; die Klärung fachdidaktischer und auch organisatorischer Fragen stand erst am Anfang. Ein ausschlaggebender Gesichtspunkt war außerdem, dass gegenüber den Ministerien nur ein Verband Chancen hatte, überhaupt angehört zu werden und berechtigt war, offizielle Stellungnahmen abzugeben. Die Gründung eines Vereins war daher der einzige Ausweg aus dieser Situation.
Bei der letzten Fachgruppentagung der HEF war ein neuer Vorstand gewählt worden – Frau Bleckwenn, Münster, Frau Siemann, Oldenburg, Frau Dr. Schmidt, Weingarten, Frau Dr. Zeh, Dortmund, Frau Zimmermann, Freiburg, Frau Giese, Oldenburg – mit dem Auftrag, sich konkret mit den Problemen einer Vereinsgründung auseinander zu setzen. Mit der Beratung zur Vorbereitung der Vereinsgründung wurden betraut: Frau Fiedler, Berlin, Frau Köller, heute Oldenburg, Frau Nippel, Hagen.
Ein strittiger Diskussionspunkt war schon im Vorfeld der Name für einen entsprechenden Verein/Verband. Schließlich einigte man sich auf die Fachbezeichnung „Textilunterricht“ – bis heute ist dazu keine bessere Alternative aufgetaucht. Eine weitere zukunftsträchtige Neuerung war der Beschluss, den zukünftigen Verband auch für LehrerInnen, die Textilunterricht in welcher Form auch immer erteilten, zu öffnen, um eine enge Verzahnung von Hochschule und Schule zu garantieren.
Wie gründet man einen Verein?
Nach vielen, intensiven, vorbereitenden Gesprächen wurde auf der Sitzung am 13. August 1974 in Stuttgart ein erster Satzungsentwurf vom Vorstand unter der Federführung von Frau Bleckwenn erarbeitet. Für Ungeübte in Satzungsfragen – wie wir es alle waren – bereitete es einige Schwierigkeiten, ein solches Papier formgerecht zu entwickeln, und so leisteten Satzungen anderer Vereine u.a. des Vereins für Kostüm- und Waffenkunde sowie ein Kompendium über Vereinsrecht aus dem BGB wertvolle Dienste.
Dieser Vorschlag wurde an alle Mitglieder der Fachgruppe verschickt und die Änderungswünsche wurden in die Satzung eingearbeitet.
Am 8. November 1974 wurde die Satzung in Münster verabschiedet. Durch Briefwahl im Januar 1975 wurde der bisherige Vorstand mit Frau Bleckwenn als Vorsitzende und Frau Siemann als Stellvertreterin in seinem Amt bestätigt.
Nach zahlreichen, aufgrund des Vereinsrechtes erforderlichen Regelungen im Detail und etlichen Vorsprachen beim Amtsgericht Hannover, das als Vereinssitz gewählt worden war, erfolgte dann schließlich am 27. Juni 1975 die Eintragung in das Vereinsregister.
Die Arbeit des Fachverbandes in den ersten Jahren
Der vorläufige Vorstand erstellte eine Geschäftsordnung, die die Funktionen der einzelnen Vorstandsmitglieder festschrieb. Möglichkeiten der Mitgliederwerbung wurden eruiert und vor allem Weichen für die Vereinsarbeit gestellt. Was die finanzielle Seite anbetraf, so war es sehr günstig, dass die freiwilligen Beiträge der Fachgruppe der HEF (immerhin über DM 2000,00) als Grundlage für die Vereinskasse zur Verfügung standen.
Vorbereitet durch den Vorstand, erfolgte die Einladung zur 1. Mitgliederversammlung in die Pädagogische Hochschule Hannover für Sonnabend, 29.11. und Sonntag 30.1.1975. Neben den dringend zu klärenden organisatorischen Fragen wie Vorstandswahl, Festsetzung eines Beitrags und weiteres Vorgehen, standen im Mittelpunkt der aktuellen inhaltlichen Auseinandersetzung ein Vortrag von Frau Siemann „Studium des Faches bzw. Lehrgebiets Textil/ Bekleidung in Verbindung mit Arbeitslehre“ und „Aktuelle Studienprobleme im Fach bzw. Lehrgebiet Textil/Bekleidung; speziell Numerus clausus, Kapazitätsberechnung, Lehrdeputate u.a.“ von Frau Bleckwenn. Über „Situationen und Entwicklungstendenzen des Faches bzw. Lehrgebiets“ sollten Berichte aus Ländern aufklären, „Fachfremder Einsatz von Absolventen des Faches“ wurde ebenfalls thematisiert.
Aus dem Protokoll dieser ersten Mitgliederversammlung geht außerdem hervor, dass Anfragen an die zuständigen Kultusministerien der damaligen EG-Länder sowie der Schweiz, Schwedens, Finnlands und der DDR die Stellung des Textilunterrichts im Fächerkanon der Schulen in den jeweiligen Ländern klären sollten, um so einen Vergleich zu den eigenen Verhältnissen herstellen zu können. Freundschaftliche Kontakte, die sich damals mit FachvertreterInnen anbahnten, bestehen bis heute noch und es ist inzwischen selbstverständlich, dass Abordnungen der nordischen Länder, der Schweiz und Österreichs Gäste der Bundesfachtagungen sind.
Ein Informationszentrum als Sammelstelle für wichtige Erlasse, Richtlinien, Studienordnungen und Prüfungsordnungen wurde ebenfalls angeregt.
Die Mitglieder des Verbandes sollten durch ein Mitteilungsblatt halbjährlich über die Tätigkeiten des Vorstandes, über Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt, über aktuelle bildungspolitische Themen informiert werden.
Als zukunftsweisender organisatorischer Schritt wurde die Gründung von Landesverbänden beschlossen und die jeweiligen Landesvertreter gebeten, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Im Protokoll der Mitgliederversammlung 1978 tauchen dann zum ersten Mal einzelne Ländergruppen auf, denen dann entsprechend ihrer Mitgliederzahl Zuschüsse vom Bundesverband zuerkannt wurde, was bis heute so gehandhabt wird.
Die zweite Mitgliederversammlung mit 21 TeilnehmerInnen fand am 16./17. Oktober 1976 an der Gesamthochschule Essen statt. Neben den Regularien, die in jenen Anfangszeiten des Verbandes sehr viel Raum einnahmen, stand der Textilunterricht an den Grundschulen im Mittelpunkt. Die Diskussion entzündete sich an der Grundschullehrerausbildung, an Zielen und Inhalten eines koedukativen Angebots und vor allem an den bildungspolitischen Tendenzen, den Textilunterricht der Bildenden Kunst oder dem Sachunterricht zuzuordnen.
Eine dritte Tagung des Fachverbandes am 8./9. Oktober 1977 an der Pädagogischen Hochschule Weingarten, setzte sich vertieft mit der Lage und den Perspektiven des Textilunterrichts an der Sekundarstufe auseinander. Durch die Entwicklung und anschließende Auswertung detaillierter Fragebögen, die die Situation des Textilunterrichts in allen Schultypen und Klassenstufen des allgemeinbildenden Schulwesens in den Bundesländern erfassten, konnte zum ersten Mal eine Synopse erstellt werden, die einen Einblick in die sehr vielfältigen und verwirrenden Verhältnisse dieses Bereiches erlaubte.
Mit dem Referat eines Erziehungswissenschaftlers, Herrn Prof. Dr. Neff, über „Möglichkeiten und Grenzen einer Erziehung zur Kreativität“ war der Anfang gemacht für eine Auseinandersetzung mit aktuellen, allgemein interessierenden pädagogischen Fragen, die eine besondere Affinität zum Textilunterricht aufweisen.
Immer noch glichen die Tagungen größeren Familientreffen, der Verband zählte Ende 1977 57 Mitglieder. Ein deutlicher Aufwärtstrend setzte ein, als sich der in Weingarten neu gewählte Vorstand mit Frau El-Gebali-Rüter, PH Flensburg, als Vorsitzender und Frau Beyer, PH Schwäbisch Gmünd, als Stellvertreterin, Frau Schwender, Rheinland-Pfalz, Frau Fiedler, Berlin , und Frau Tümena, Bremen, verstärkt der Mitgliederwerbung annahmen.
Neue Impulse im Fachverband
Im März 1978 erschienen die ersten maschinengeschriebenen „Informationen“ des Fachverbandes mit einer kritischen Stellungnahme zu den Ausführungen zu „Textiles Gestalten als Teil der musisch-kulturellen Bildung“, die im Ergänzungsplan zum Bildungsgesamtplan, herausgegeben von der Bund-Länder-Kommission, als richtungsweisende Zielvorgaben für die Weiterentwicklung des Faches veröffentlicht worden waren. Der „Auftrag des Textilunterrichts an der Sonderschule für Lernbehinderte gemäß den KMK-Empfehlungen“ von 1977 wurde ebenfalls reflektiert. Verbandsnachrichten ergänzten diese historische Erstausgabe, der im Juli 1978 Nummer 2 und im Dezember 1978 Nummer 3 folgten. Hauptthemen waren die aktuellen bildungspolitischen Entscheidungen, die das Fach betrafen, Verbandsnachrichten, Protokolle der Mitgliederversammlungen.
Bei der 4. Verbandstagung in Oldenburg (30.9./1.10.1978) wurden mit schulrelevanten Themen zum ersten Mal die wirklichen Interessen der LehrerInnen angesprochen wie etwa mit den „Arbeitspapieren zu Verfahrensweisen im projektorientierten Werkstatt- und Fachraumunterricht unter sonderpädagogischen Aspekten“ oder mit einer Dokumentation über Bremer Schulversuche in der Sekundarstufe.
Die Lehrerfortbildung wurde als wichtiges Anliegen des Fachverbandes artikuliert und stand fortan nicht nur bei den Bundesfachtagungen im Mittelpunkt, sondern wurde auch als Aufgabe an die Landesverbände weitergegeben.
Für die folgende Tagung in Münster wurden Ende September 1979 bereits drei Tage angesetzt, um für das Themen „Weben“ genügend Zeit für Ausstellungen und praktische Anregungen zu haben. Dieser Schwerpunkt wurde ergänzt durch einen Vortrag über das „Missverhältnis zwischen Theorie und Praxis im Schulunterricht“.
Nach wie vor aber blieb die Öffentlichkeitsarbeit, die Korrespondenz mit den Ministerien, ein Zentralanliegen, vor allem des Vorstands. Die bildungspolitische Situation hatte sich in der Zwischenzeit keineswegs entschärft und bedurfte der ständigen Beobachtung. So wurde dem Schulausschuss der BLK (Bund-Länder-Kommission) an der KMK ein „Memorandum“ über die Entwicklung des Textilunterrichts seit 1945 und dessen Situation in der Bundesrepublik Deutschland zur Beratung überreicht, das 1978/79 von Frau Bleckwenn verfasst worden war. Die offizielle Resonanz hielt sich allerdings in Grenzen.
Dessen ungeachtet begann der Aufwärtstrend des Fachverbandes. Kurzgefasste Handzettel mit Zielen und Inhalten des Fachverbandes Textilunterricht e.V., die bundesweit von den Landesgruppen verteilt wurden, erwiesen sich u.a. als effektive Werbeträger: im März 1983 zählte der Verband bereits 383 Mitglieder.
1980 fand vom 3.-5. Oktober zum ersten Mal eine dreitägige Veranstaltung statt in einer richtigen Tagungsstätte in Ludwigshafen, professionell mitorganisiert von Mitgliedern der Landesgruppe Rheinland-Pfalz. Eine neue Ära hat sich angebahnt – fortan mit großen Programmen und Workshops für LehrerInnen als praktische Hilfe für den Unterricht oder auch zur persönlichen Weiterbildung mit Besuchen von Museen und sonstigen kulturhistorischen Ereignissen.
Die einzelnen Landesgruppen wechseln bis heute in der Regel mit der Ausrichtung der Tagungen ab, die längst zum festen Fortbildungsprogramm der Unterrichtenden im Textilbereich gehören und auch die ministerielle Anerkennung als offizielle Fortbildungsveranstaltungen in Anspruch nehmen können.
Zu den „Highlights“ in der Verbandsgeschichte zählen zweifellos auch die ersten Tagungen in den neuen Bundesländern, die mit ihrem anders entwickelten Textilverständnis erneute Diskussionen befruchteten.3
Betrachtet man die Programme der Bundesfachtagungen der letzten Jahre, so fragt man sich schlussendlich, wo die Aktivistinnen der Gründerzeit geblieben sind. Ein großer Teil der ehemaligen Kolleginnen ist längst pensioniert, wenn nicht gar gestorben wie die Professorinnen Frau Siemann, Frau Meinken, Frau Dr. Immenroth.4 Die übrigen pflegen zum Teil auf ihre Weise die einst geknüpften persönlichen Kontakte auf informeller Ebene und freuen sich, dass der Verband eine selbstverständliche und vielversprechende Einrichtung geworden ist.
Bei allen Neuentwicklungen und Veränderungen an Schulen wünschen wir, dass der Fachverband nie die einst formulierten Anliegen und Ziele des Textilunterrichts, die bis heute nicht überholt sind, aus den Augen verlieren möge!“5
15 Jahre später – Fachverband …textil..e.V., Wissenschaft – Forschung – Bildung
Die Anliegen und Ziele des Textilunterrichts haben wir nicht aus den Augen verloren. Sie bleiben präsent wie zu den Anfangszeiten des Fachverbandes. Die Bildungslandschaft ist im steten Fluss. Die Begrifflichkeiten der Didaktik und Pädagogik scheinen der Mode unterworfen zu sein. Die Mitgliederversammlung beschließt am 5. Februar 2011 in Karlsruhe, dass der Verein nun den Namen „…textil..e.V., Wissenschaft – Forschung – Bildung“ trägt, um der konservativen Sichtweise des „Handarbeitens“ etwas entgegenzusetzen. Nach außen werden die umfassenden Betätigungsfelder des Verbandes sichtbar. Mit einem attraktiven Auftreten nach außen ist die Hoffnung nach mehr öffentlicher Aufmerksamkeit verbunden.
Ziele und Aufgaben des Verbandes
Die Ziele und Aufgaben des Fachverbandes werden im Jahre 2011 neu gefasst und in einem attraktiven Flyer eingepflegt:
Fachverband: Er ist ein Zusammenschluss von Lehrenden und Lernen des Faches aus dem gesamten Bildungswesen sowie außerordentlichen Mitgliedern und vertritt die Interessen des Faches in allen Bildungsbereichen.
Flyer des Fachverbandes 2011
Ziele und Aufgaben:Relevanz von Textilien in Kultur, Gesellschaft, Umwelt und Gesundheit, Relevanz eines aktuellen Textilunterrichts, Relevanz des Studiums der Textilwissenschaften, Relevanz in Gesellschaft und Politik aufzeigen. Kontakte zwischen Lehrenden und Lernen aller Bundesländer, zu Fach-, Interessen- und Elternverbänden, zur Textil- und Bekleidungsindustrie, zu Museen, zu Textilkunst anbahnen und pflegen. Projekte aus Lehre und Forschung in Fachwissenschaft und Fachdidaktik, in den Schulen, im textilkünstlerischen Bereich fördern und präsentieren. Angebote: Bundesfachtagungen im Zweijahresrhythmus, Landesfachtagungen mit länderspezifischen Aspekten, Fortbildungsveranstaltungen, 4x im Jahr kostenlos die Fachzeitschrift …textil…
Die letzten Jahre sind vor allem davon geprägt, den Kampf um den Erhalt des Faches im allgemeinbildenden Schulwesen weiter zu führen. Dieser Kampf ist in vielen Bundesländern mit einer Niederlage beendet. Die textilen Inhalte sind in Fächerverbünden aufgegangen oder in andere Fächer insbesondere in die Kunst eingeflossen. Das Wort Textil oder Textilunterricht scheint nur noch in Bayern und Schleswig-Holstein in den Bildungsplänen/Lehrplänen/ Richtlinien auf. Die bildungspolitische Entwicklung ist der gesellschaftlichen gegenläufig. „Handarbeiten“ ist wieder groß angesagt – auch bei jungen Menschen. „Handarbeit ist die Gegenwelt zur Virtualisierung. In der virtuellen Welt spürt der Mensch nichts. … Aber wie sich Bio-Lebensmittel in den Massenmarkt hineingespült haben, so wird es auch mit dem Schneiderhandwerk passieren. Handwerk und Handarbeit werden zu wichtigen Bestandteilen des Massenmarktes.“6 Die Medien beschäftigen sich zunehmend mit den Problemen und Gefahren, die im Textilen stecken. Globalisierung, Nachhaltigkeit und Gesundheit werden exemplarisch am Textilen festgemacht und thematisiert. Mit dem Schwinden des Schulfaches dezimieren sich entsprechend die Lehrerausbildungsstätten. Im Jahre 2008 findet auf Initiative einer Hochschullehrerarbeitsgruppe aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen – alles Mitglieder des Fachverbandes – der Studienbereich Textil Eingang in die Ländergemeinsamen inhaltlichen Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung des Studienbereichs im Fächerkomplex Arbeit, Wirtschaft, Technik inhaltlich Eingang.7 Auffallend ist das „Nichtbenennen“ des Studienbereichs Textil im Titel. Mittlerweile hat sich eine Zufriedenheit eingestellt, wenn wir nicht ganz vergessen werden! Die inhaltliche Spreizung des Studienbereichs Textil ist hier abzulesen. Viele Bezugswissenschaften fließen ein, um die Komplexität des Phänomens Textil zu durch- und zu erleuchten. Diese KMK-Standards liegen heute allen Prüfungs- und Studienordnungen zur Lehrerbildung in der BRD zugrunde:
2.2.4 Studienbereich Textil
2.2.4.1 Bereichsspezifisches Kompetenzprofil
Die Studienabsolventinnenund -absolventen verfügen über die unter Abschnitt 1.1 genannten Kompetenzen, bezogen auf diesen Studienbereich, und zwar m it folgenden Schwerpunkten: sie
beherrschen elementare natur- und kulturwissenschaftliche Arbeitsmethoden und reflektieren kult urelle, ästhetische, ökonomische, ökologische und gesundheitliche Aspekte von Mode und Textil;haben Erfahrung im Entwerfen, Gestalten, Experimentieren und Bewerten im Bereich Modeund Textil;verfügen über grundlegende Kenntnisse d er Berufe im Bereich Textil undMode;kennen Modelle und Konzepte der Analyse, Planung, Organisation und Evaluation der Vermittlung von mode- und textilwissenschaftlichen Inhalten und verfügen über erste reflektierte Erfahrungenim Planen und Gestalten von Textilunterricht.2.2.4.2 Studieninhalte
Modewissenschaften
Anthropologische Grundlagen und kulturethnologischeAspekte des Kleidens und WohnensKulturgeschichte des Kleidens und WohnensMode und Modetheorien, Modepsychologie und -soziologieGender Studiesim Kontext Mode und TextilMode- und TextildesignBiografische und ästhetische Zugangsweisenzur ModeTextilwissenschaften
Materialkunde, Funktionstextilien und technische TextilienTextiltechnik und -technologieBekleidungsphysiologie, Bekleidungstechnik und -technologieTextilwirtschaft, textile Kette und Textilökologie, NachhaltigkeitTextilhygiene, G esundheits- und Verbraucherschut znationale und internationale GesetzgebungBerufe im Bereich Mode und Textil, globale Zusammenhänge, ArbeitsplätzeFachpraxis
Textile Kulturtechniken und Objekte in Alltagskultur, Kunst und TechnikWahrnehmung und KreativitätTextiles Werken in den Erfahrungsfeldern von Kindern und JugendlichenTechniken der Herstellung und Gestaltung von TextilienNachhaltige Konsum- und ProduktionsstrategienFachdidaktik
2.1.2 Studieninhalte Fachdidaktik
Die inhaltlichen Anforderungen an das fachdidaktische Studium sind für die einzelnen Studienbereiche inhaltlich und strukturell vergleichbar; deren konkrete Ausgestaltung bezieht sich auf die jeweiligen Gegenstände der einzelnen Studienbereiche.
In Bayern gibt es bis heute die Fachlehrerausbildung in München und in Ansbach. In Baden-Württemberg werden die Lehrkräfte sowohl als Fachlehrer – mit einem niedrigen Gehalt – als auch als Primar- und Sekundarlehrer an den Pädagogischen Hochschulen ausgebildet. Die durch Pensionierung frei werdenden Professuren an den Hochschulen werden nicht wieder besetzt. So gibt es an den sechs Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg nur noch drei Professuren für Mode- und Textilwissenschaft und ihrer Didaktik. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Zahl in den kommenden Jahren weiter reduzieren wird.
Weitere Professuren finden wir noch in Flensburg, Osnabrück, Oldenburg und Paderborn mit unterschiedlicher inhaltlicher Ausrichtung. In vielen Bundesländern ist die Lehrerausbildung eingestellt. Die gestärkte Hochschulautonomie lässt Eingaben von Seiten des Fachverbandes wirkungslos.
Mitglieder – aktiv und passiv
Heute ist der Verband mit knapp 400 Mitgliedern auf dem Stand des Jahres 1983. Die Entwicklung nimmt jedoch eine Gegenrichtung ein. Das Durchschnittsalter der Verbandsmitglieder steigt ständig. Wer Mitglied ist, bleibt meist bis zum Berufsende, wenige darüber hinaus. Neue, junge Mitglieder zu gewinnen ist aufgrund der sukzessiv zurückgehenden Ausbildungsstätten und durch das Schwinden des Faches im allgemeinbildenden Schulwesen nur in geringem Maße möglich. Schnuppermitgliedschaften zum Kennenlernen gibt es seit 2011. Studierende, Referendare und Referendarinnen können ein Jahr lang kostenlos die Mitgliedschaft nutzen. Verbands- und Vereinsmitgliedschaften sind in der Gegenwart nicht en vogue. Das spüren auch alle anderen Vereinigungen vom Sportverein bis zum Hausfrauenbund. Der Mitgliederrückgang zieht das Phänomen der fast leeren Kassen nach sich. Viele Projekte und Vorhaben sind kaum mehr finanzierbar. Ruth Fiedler berechnet seit vielen Jahren den Schwund und stellt fest, wenn sich die Kontinuität des Mitgliederschwundes fortsetzt, können wir noch weitere 15 Jahre bestehen.
Je größer die Zahl der passiven Mitglieder, desto größer ist auch die Zahl derer, die sich mit aktivem Engagement im Verband einbringen. Seit 2000 vollziehen sich im Vorstand nur wenige personelle Veränderungen. 2004 zieht sich Romana Schweizer, Ettlingen, nach acht Jahren Vorsitzende und einem Jahr stellvertretende Vorsitzende aus der Vorstandsarbeit endgültig zurück. Nach 16 Jahre verantwortungsvoller Geschäftsführung übernimmt Heidi Büngeler, Osnabrück, den Posten der stellvertretenden Vorsitzenden, um Ruth Fiedler, Berlin, Gründungsmitglied, ab 2005 noch die nötige Unterstützung bei der Übernahme der Geschäftsstelle zukommen zu lassen. Mit Ruth Fiedler wird die Geschäftsstelle von Osnabrück in die Hauptstadt Berlin verlegt. 2009 tritt Anni Kropf, Sulzbach, die Nachfolge von Heidi Büngeler als stellvertretende Vorsitzende an, 2013 folgt Barbara Hanne. Waltraud Rusch gehört dem Vorstand seit 1997 an, sechs Jahre als stellvertretende Vorsitzende, anschließend als Vorsitzende. Die Bereitschaft ehrenamtlich verantwortungsvolle Posten im Verband zu übernehmen, ist aufgrund der Altersstruktur und der schwindenden Mitglieder sehr schwierig geworden. Gerade in Zeiten, wo an allen Fronten noch für das Textile gekämpft wird, ist der Einsatz mit viel Zeit und auch mit eigenen finanziellen Mitteln nicht attraktiv. Es fehlen die Personen, die sich noch vor oder hinter der Familienphase befinden, die ihre Zeit den Zielen und Zwecken des Fachverbandes …textil..e.V. zur Verfügung stellen. Nach wie vor ist es Aufgabe des Vorstandes, die Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, die Kommunikation mit den Ministerien zu pflegen, die Situation des Textilunterrichts in Schule und Hochschule zu beobachten und evtl. Aktionen zu planen und umzusetzen. Eine wesentliche Aufgabe ist auch, Sponsoren für die textile Sache zu akquirieren und Mitstreiter durch Kooperation mit anderen Verbänden und Wirtschaftsunternehmen zu gewinnen.
Landesgruppen
Ähnliche Probleme stellen sich in den Landesgruppen dar. Strukturell werden die ursprünglich zehn Landesgruppen Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen/Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz/Saarland, Sachsen/Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein/Hamburg zu größeren Einheiten zusammengefasst. Seit 2010 gibt es nur noch sieben Landesgruppen. Es werden 2016 voraussichtlich weitere vier Landesgruppen fusionieren, so dass es nur noch fünf geben wird. Einerseits benötigt man weniger aktive Mitglieder für die kontinuierliche Arbeit, andererseits werden Kosten für die Verwaltungsarbeit eingespart. Die zu betreuende Fläche ist größer. Die Kommunikation der Landesvorsitzenden zu den Mitgliedern findet über die Zeitschrift …textil…, über Mailinglisten und die Homepage des Fachverbandes statt. Fortbildungen und Infos werden dadurch grenzüberschreitend wahrgenommen und genutzt.
Die Landesgruppen kommen nach wie vor ihrer Aufgabe von Lehrerfortbildungen hoch wirksam nach. In fast allen Bundesländern werden die Fortbildungsveranstaltungen von … textil..e.V. als solche anerkannt. Damit wird die Qualität dieser Aktionen von ministerieller Seite nachhaltig bekundet. Wettbewerbe zusammen mit der Initiative Handarbeit und den Kultusministerien finden alljährlich statt. Sie dienen der öffentlichen Darstellung unserer Arbeit in allen Schulen. Die Zahl der teilnehmenden Schulen ist nach wie vor hoch. Mit modernen Medien und Kommunikationsmitteln sind diese Wettbewerbe zusätzlich ein Angebot Textil mit Medienbildung zu verbinden. In der Jury sind jeweils Mitglieder der Kooperationspartner der Wettbewerbe.
Auslandskontakte – Berufsbildendes Schulwesen – Hochschullehrerausschuss
Erika Cohn, Hamburg, ist bis heute von der Bedeutung der textilen Auslandskontakte überzeugt, die als zentrales Element den Blick für das Textile weiten. Sie hat sich dafür zu ihrer Zeit als Vorsitzende (19851989) aktiv eingesetzt. Der Fachverband ist Mitglied in Texere und European Textil Network (ETN). Lange Jahre hält Ulrike Kirchner, München, die Fäden zu den internationalen Textilern fest in der Hand und reist mit persönlichem Einsatz zu den europäischen Tagungen von Texere und ETN.8
Gesamtsieger des Wettbewerbs „Hülle und Fülle“ 2014
Nach der Öffnung der Grenzen 1989 wird ETN gegründet. Viele Jahre hat Beatrijs Sterk und Dietmar Laue sich um den Verband verdient gemacht. 2012 wurde die hochwertige Zeitschrift TEXTILFORUM eingestellt. Auf der letzten Mitgliederversammlung in Leiden hat sich ein neuer Vorstand gefunden. Prof. Dr. Irina Hundt ist unsere Kontaktperson und belebt den Kontakt, in dem die Informationen ausgetauscht werden und diese unseren Verbandsmitgliedern auf der Homepage zur Verfügung gestellt werden.
Prof. Gudrun Schreiber ist langjährige Professorin in Hannover für das berufsbildende Schulwesen. Sie hat uns kontinuierlich und profunde über die Veränderungen und Neuerungen in diesem Bereich informiert und uns diese auch in der …textil… schriftlich zukommen lassen. Das berufsbildende Schulwesen erlebt viele Einschnitte, Kürzungen, Wegfall von Instituten u.a. auch das von Gudrun Schreiber. Mit ihrer Pensionierung wickelt Hannover die Berufsschullehrerausbildung ab. Die Kontaktstelle übernimmt 2008 Caroline Tiedtke, Kellinghusen, jetzt Berlin. Zusammen mit Barbara Denker, Nürnberg, und Meike Ostermann, Menden, beleben sie auf der Bundesfachtagung 2013 in Dresden die berufsbildende Szene im Verband neu. Verschiedene Bundesländer, verschiedene inhaltliche Ausrichtungen fusionieren, die Berufsschullehrer werden angesprochen, es treten neue Mitglieder ein. Um die aktiven drei jungen Frauen bildet sich eine aktive Gruppe, die auf der Bundesfachtagung 2015 in Potsdam tagen und präsentieren.
Die Hochschullehrerkonferenz für Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik (HEF) ist der Vorläufer des Fachverbandes. Die Professorinnen und Hochschullehrenden des Faches Textiles Gestalten sehen nach der Auflösung dieses Zentralorgans die Gründung eines Vereins als Notwendigkeit an. Im Laufe der 40 Jahre ist die Mitgliederzahl der Hochschullehrenden prozentual stark zurückgegangen. Der Fachverband hat sich geöffnet: Lehrern und Lehrerinnen, Erziehern und Erzieherinnen, Künstlern und Künstlerinnen. Die Vertretung der Hochschul- und Bildungsangelegenheiten ist nicht gebündelt in einer Interessengemeinschaft der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen. Die Vorsitzende lädt im Februar 2010 zu einem Hochschullehrertreffen Mode und Textil an die Pädagogische Hochschule Karlsruhe ein. Im Vorfeld verfasst sie einen Pressetext: „Erstmalig treffen sich Hochschullehrer des Bereiches Mode und Textil aus der Bundesrepublik Deutschland und den angrenzenden deutschsprachigen Ländern, um die inhaltliche Standortbestimmung sowie zukunftsweisende Forschung auf dem Gebiete der Bildung zu diskutieren.
Die Forschung konzentriert sich auf die beiden Bereiche: Fachinhaltliche und fachdidaktischen Forschung. Neben der fachinhaltlichen Forschung spielt der Wissenschaftstransfer in die Schule bei uns naturgemäß eine sehr große und zentrale Rolle. Die Zusammenarbeit muss in unserem Bereich aber nicht nur interdisziplinär und international erfolgen, sondern in jedem Falle auch mit Vertretern der Praxis, in unserem Falle der Schulen und der 2. Phase der Lehrerbildung. Besonderes Augenmerk legt der Fachverband Textilunterricht darauf, dass genuin didaktische Forschungsleistungen zu verzeichnen sind, die nicht mit unterrichtspraktischen Beiträgen und auch nicht mit fachinhaltlichen Forschungsarbeiten ersetzt werden können. Der Verband hat hier viel Arbeit investiert, um den Nachwuchs im forschungsmethodischen Bereich zu schulen.
Eine wichtige Rolle spielt im fachdidaktischen Bereich die theoriegeleitete Entwicklung, sei es die Entwicklung von Bildungsstandards, Lehrplänen, Schulbüchern, Unterrichtsmaterialien, Filmen, Software, Konzepten für Ausstellungen u.ä. Der Verband hat sich in diesem Zusammenhang sehr stark engagiert. Die Entwicklung von Bildungsstandards im deutschsprachigen Raum nach den Ergebnissen der PISA-Studie wurde von unserem Verband im letzten Jahr aufgegriffen und hat zu einer Stellungnahme geführt, mit der wir die Standards für unser Fach definiert haben. Dies ist auch insofern hilfreich, als die neue Kultusministerin in Baden-Württemberg Schick ausdrücklich erklärt hat, die Bildungsgänge aller Schularten auf dem Prüfstand zu stellen und im Hinblick auf eine Weiterentwicklung zu prüfen. Auch hier können die von uns formulierten Standards für den Bereich Mode und Textil eine wichtige Weichenstellung bedeuten.
Wir sind heute hier zusammengekommen, um innerhalb des Fachverbandes Textilunterricht eine eigene Hochschullehrergruppe zu implementieren, die sich speziell dem Wissenschaftstransfer zwischen Schule, Hochschule und Politik widmet, um das Anlegen des Bereiches Mode und Textil auch bei den politischen Entscheidungsträgern mit der notwendigen Nachhaltigkeit zu vertreten.“9
Die Presse kommt und schreibt:
„Mehr als stricken und batiken“
Treffen an der PH: Hochschullehrer beklagen zu geringeWertschätzung des Textilunterrichts
me. Hochschullehrer des Bereichs Mode und Textil aus Deutschland und der Schweiz trafen sich gestern an der Pädagogischen Hochschule (PH) zur inhaltlichen Standortbestimmung und um die zukunftsweisende Forschung auf dem Gebiet der Bildung zu diskutieren. „Uns kommt es darauf an, zwischen der Hochschullehre und dem Wirken der Lehrer an den Schulen eine stärkere Verknüpfung zu erreichen“, erklärt Waltraud Rusch. Sie ist an der Professorin in der AbteilungHaushalt/Textil und leitet das Institut für technische und haushälterische Bildung, gleichzeitig ist sie Bundesvorsitzende des Fachverbands Textilunterricht.
Der Fachverband wurde vor 35 Jahren gegründet und war ursprünglich ein reiner Hochschullehrerverband. „Im Laufe der Jahre hat sich der Verband jedoch auch anderen Berufsgruppen geöffnet“, so Rusch. Die Hochschullehrer sehen ihre speziellen Interessen daher nicht mehr ausreichend berücksichtigt. Eine Folge des gestrigen Treffens war daher die Gründung einer eigenen Hochschullehrergruppe innerhalb des Fachverbandes.
Den Hochschullehrern ist es wichtig, die Bedeutung ihres Faches in die Öffentlichkeit zu tragen: „Leider wird alles, was mit Mode und Textil zu tun hat, nicht sehr hoch bewertet“, meint Rusch. „Wir sind aber keine Handarbeitslehrerinnen, die immer nur stricken und batiken“, erklärt sie. „Wir betreiben eine integrative Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie Textilien unseren Alltag bestimmen.“ Disziplinen wie Psychologie, Anthropologie, Kulturwissenschaft, Ökologie oder Ökonomie spielen in das Fach hinein. Das habe sich in den vergangenen Jahren sehr gewandelt. Und all die neuen Ansätze seien bereits in die Lehrerausbildung integriert, versichert Rusch. „Wir haben die traditionellen Pfade schon lange verlassen, nur leider haben die Öffentlichkeit und die Politik das noch nicht erkannt.“
Unzufrieden sind die Hochschullehrer auch damit, dass in den Schulen zurzeit noch viel zu traditionell gearbeitet werde. Mit einem Wissenschaftstransfer in die Schule soll dem entgegengewirkt werden. „Es darf im Unterricht nicht mehr nur um die Produktion von Textilien gehen, sondern auch um den Umgang mit ihnen“, sagt die Professorin. So könnten sich Schüler damit beschäftigen, welche Auswirkungen Kleidung auf die Leistungsfähigkeit des Körpers und auf die Wahrnehmung eines Menschen in der Öffentlichkeit hat: „Sportler schaffen mit High-Tech-Kleidung Spitzenleistungen und Politiker holen sich nicht ohne Grund Hilfe bei Modeberatern“, erklärt Rusch.
Der Hochschullehrerausschuss wird gegründet, Vorsitzende werden Prof. Dr. Anne-Marie Grundmeier, Freiburg, und Prof. Dr. Norbert Schütz, Flensburg. Eine Geschäftsordnung wird entwickelt. Regelmäßige Sitzungen werden angesetzt und die Ergebnisse kommuniziert. Der Hochschullehrerausschuss wird auf der Bundefachtagung tagen und Ergebnisse präsentieren.
Bundesfachtagungen
Die regelmäßigen Tagungen sind Tradition. Der Vorstand und eine Landesgruppe sind jeweils in der Verantwortung, die Bundesfachtagung durchzuführen. Die jährlich stattfindende Mitgliederversammlung ist in ihr implementiert. Alle zwei Jahre wird hier der Vorstand neu gewählt:
Die Tagungsorte variieren ebenso wie die Tagungsthemen:
Tagungsstätten, Übernachtungsmöglichkeiten, Referenten, Selbstdarstellung, Workshops – ein komplexer Organisations- und Arbeitsaufwand ist damit verbunden. Immer wieder ist es gelungen namhafte Referenten und Kooperationspartner für die Tagungen mit wissenschaftlich-theoretischem und fachpraktisch-künstlerischem Beiträgen zu gewinnen. Die Bundesfachtagungen nutzen die Mitglieder und Gäste zur Weiter- und Fortbildung und auch zum miteinander Reden und Austauschen. Herausragend sind die Tagungen in Dresden – wo wir das 25-jährige Bestehen würdig begehen, Berlin und jetzt auch in Potsdam mit der Feier zum 40jährigen Geburtstag. Zu diesen beiden großen Ereignissen der Jahrestage erscheint jeweils eine Festschrift.10
Dies schmälert keineswegs den Wert all der anderen Tagungen, die ich erleben durfte. Den Fachverband fordern diese großen Tagungen zunehmend heraus: einerseits durch die vorbereitenden Arbeiten (aktive Mitglieder) und andererseits auch finanziell (Kosten steigen). 2005 findet die letzte Bundesfachtagung im jährlichen Rhythmus in Vallendar statt. Ab 2007 beginnt der Zweijahresrhythmus, der die Organisatoren und die Kasse entspannen. An diesem Ort sei all denjenigen gedankt, die die zahlreichen Bundesfachtagungen inhaltlich wie organisatorisch begleitet haben.
Der Faden der Ariadne
Bei der Vorplanung der Bundesfachtagung 1984 in Karlsruhe/Ettlingen entsteht die Idee für den „Faden der Ariadne“. Auf den Plakaten prangte dieses bildhafte Symbol des Textilen. Die Presse meldet: „Schon die bildhafte Aussage des Plakates zur Bundesfachtagung 1984 weist auf eine völlig andere Thematik und ganz neue und andere Aspekte des Textilunterrichts hin.“11 Der magentafarbene textile Faden mit dem unendlichem Fadenende steht für die „Bezüge zwischen Alltagskultur und Kunst, Tradition und Zukunft, Wissen und Tun, Festhalten und Loslassen…12 Dieser Faden der Ariadne steht seit dieser Bundesfachtagung als aussagekräftiges Symbol des Fachverbandes …textil..e.V.
…textil…
Der Kontakt zu den Mitgliedern des Fachverbandes ist in regelmäßigen Abständen herzustellen. Seit 1978 erscheinen Informationen des Fachverbandes in schriftlicher Form. 1984 wird erstmals das Protokoll der Mitgliederversammlung zur BFT in einer Informationsschrift mit dem Faden der Ariadne Nr. 12 – Dezember 1984 veröffentlicht. Seit 1991 werden die Mitteilungen und noch etwas mehr im gedruckten „Textil-Info“ an alle Mitglieder per Post versendet. Die ersten Werbeblöcke finanzieren Druck und Porto. Ende der 90er Jahre signalisiert der Schneider Verlag, der dem Fachverband seit Beginn sehr verbunden ist, dass er die grüne Fachzeitschrift Textilunterricht einstellen werde. Ulrich Schneider bot uns die Übernahme der Zeitschrift an. Im neuen Jahrtausend – also 2000 – erscheint die erste …textil… Wissenschaft – Forschung – Bildung. Herausgeber sind der Fachverband …textil..e.V. und der Schneider Verlag Hohengehren. Die Schriftleitung übernimmt Dr. Waltraud Rusch; dort ist sie bis heute angesiedelt, obwohl die Übernahme der inhaltlichen Arbeit nur für zwei Jahre geplant ist.
Die Bundesvorsitzende Romana Schweizer führt in die neue Zeitschrift ein:
„Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder des Fachverbands Textilunterricht, das Ihnen vorliegende Heft …textil… ist eine Zeitschrift in einem neuen Kleid. Es handelt sich um den Zusammenschluss der Fachzeitschrift Textilarbeit + Unterricht des Schneider-Verlags mit dem Textil-Info, dem Verbandsorgan des Fachverbands Textilunterricht e.V.
…textil… erscheint weiterhin in der Ihnen gewohnten Weise viermal jährlich. Der Untertitel „Wissenschaft Forschung Unterricht“ zeigt Ihnen die Schwerpunkte dieser Fachzeitschrift: Aktuelles aus der Wissenschaft und Forschung aus Hochschule und Lehrerbildung, Aktuelles für den Schulalltag neben Verbandsinterna und Nachrichten aus den Landesverbänden. Die Farbe symbolisiert Ihnen die Zeitschrift als Verbandsorgan des Fachverbandes Textilunterricht e.V. Für den Titel „…textil…“ haben wir uns entschieden, da er vielfältige Begriffsbildungen zulässt, bei denen …textil… im Mittelpunkt steht: Naturtextilien, Textilindustrie, textile Kette, Textilunterricht, Ökotextilien, Textilmuseum …“13
Alle Mitglieder erhalten …textil… viermal jährlich kostenlos. Nichtmitglieder können ein Abonnement beim Schneider Verlag abschließen. Die Zeitschrift entwickelt sich als echtes Kommunikationsorgan des Verbandes zu den Mitgliedern mit Infos aus den Landesgruppen, aus dem Vorstand und Beirat, Berichte zu den Bundesfachtagungen und Landesfachtagungen, Rezensionen zu Buchneuerscheinungen, Ausstellungsgeschehen. Wertvolle fachwissenschaftliche und didaktische Beiträge lassen …textil… zu einer echten Fachzeitschrift werden, in denen auch viele Autoren aus anderen Bereichen zu textilen, bildungspolitischen und didaktischen Aspekten Stellung beziehen. Die Breite und Anzahl der Aufsätze und Veröffentlichungen nehmen stetig zu, Wartezeiten für Veröffentlichungen sind mittlerweile nicht unüblich. Auf diesem Wege können wir auch zahlreichen jungen NachwuchswissenschaftlerInnen die Möglichkeit einräumen, ihre wissenschaftliche Arbeit kostenneutral zu veröffentlichen.
Bewusst wurde der Titel …textil… gewählt. So kann der Begriff von vorne als auch von hinten ergänzt werden wie z. B. Funktionstextil oder Textilkultur.
Ausgabe ... textil ... Nr. 1/2000
Seit 2014 liegt das Layout der Zeitschrift aus Kostengründen ebenfalls bei der Schriftleitung. Gedruckt wird nach wie vor in schwarz/weiß. Seit diesem Zeitpunkt werden als besonderer Service an unsere Mitglieder drei Monate nach dem Erscheinen der Zeitschrift die Artikel der …textil… in Farbe auf der Homepage des Fachverbandes eingestellt und veröffentlicht. Meine Vision: in einigen Jahren eine reine Online-Zeitschrift, auf die alle Mitglieder direkt zugreifen können.
Homepage
Moderne Kommunikation läuft heute über das Internet. Seit Ende der 90er Jahre ist der Fachverband über eine eigene Homepage zu erreichen. Die damalige Vorsitzende Romana Schweizer hat dieses Anliegen konsequent durch- und umgesetzt. Hilfestellung erfahren wir einige Zeit später durch unser Mitglied Erika Sigrist-Kuch aus der Schweiz, die über viele Jahre zusammen mit ihrem Mann und Christiane Trunz am Internetauftritt feilt und diesen technisch stets auf den neuesten Stand bringt. Christiane Trunz arbeitet viele Jahre zusammen mit den Redakteurinnen der Landesgruppen an unserem öffentlichen Erscheinungsbild. Viele Stunden Arbeit stecken hinter dieser Homepage, die nicht zu erahnen ist. Der Wandel ist schnell. Als 2013 Barbara Hanne, Nürnberg, mit ihren reichhaltigen Interneterfahrungen in den Vorstand gewählt wird, erfährt die Homepage eine zeitgemäße, moderne Auffrischung, die vor allem junge Menschen ansprechen soll. Es bewegt sich etwas, es ist bunt, es ist strukturiert, es ist aktuell und macht neugierig. Die Zugriffszahlen erhöhen sich.
Ein frisches Informationsportal rund um das Textile im und außerhalb des Verbandes zieht neue Interessierte an – vielleicht auch die neuen zukünftigen Mitglieder?
Projekte
Für die vielen Projekte, die im Fachverband umgesetzt werden, möchte ich heute stellvertretend eines herausgreifen, das bis heute nachwirkt. Der Fachverband Textilunterricht e.V. und die Künstlerin Ursel Arndt wählen für die Bundesfachtagung 2003 in Berlin eine außergewöhnliche Aktion, den Zehntausendblütenteppich. Im Jahr 2002 beginnen Ruth Fiedler und Ursel Arndt damit, die Aufmerksamkeit auf das textile Kulturerbe zu richten. In kulturhistorischer Anlehnung an die „Millefiori-Teppiche“ soll ein Zehntausendblütenteppich entstehen, um zu einer besonderen Demonstration mit textilen Mitteln aufzurufen und ein Zeichen für den Textilunterricht zu setzen. Drei Jahre werden nun Blüten gesammelt. Menschen aller Generationen aus allen Teilen Deutschlands haben sich mit Blüten in vielfältigen Formen und textilen Techniken beteiligt. Später kommen noch Beiträge von vier Generationen aus 15 Nationen hinzu.
Zehntausendblütenteppich: Gesamtansicht und Detail
Alle Blüten, gestickt, gestrickt, geknüpft, appliziert, geknotet, gehäkelt, gewebt, geklöppelt, gewickelt, gemalt oder genäht, ob Meister- oder Erstlingswerk, kommen auf den Teppich, eine Zensur findet nicht statt. Die Blüten werden nicht erst für den Teppich erarbeitet. Sie sind alt und neu, geformt aus unterschiedlichen Materialien und Techniken. Es ist nun ein bunter Blütenteppich von 14 m Länge und 2,20 m Höhe, zusammengestellt von der Textilkünstlerin Ursel Arndt. Der Teppich birgt eine reiche und abwechslungsreiche Textiltradition. Er präsentiert und veranschaulicht den Bestand und die Pflege textiler Kultur. Der Teppich besteht aus über 10 000 Blütenformen, die in einem dichten Streubild montiert sind. Die Blüten sind nach farblichen Aspekten, Artenähnlichkeiten und Techniken geordnet. Eine große textile Fläche mit organischen Blütenmotiven hat eine enorme Fernwirkung, die hier kaum beschreibbar ist.
Der Teppich ist im Besitz des Fachverbandes und wird von Ruth Fiedler auf seinen Reisen im In- und Ausland begleitet.14
Kooperierende Verbände
Seit vielen Jahren pflegt der Fachverband die Kooperation mit der Initiative Handarbeit e.V. Zur Bundesfachtagung 2000 in Dresden erscheint erstmals Gert Eberhardt. Als Geschäftsführer der Initiative Handarbeit fördert und unterstützt er mit seinem Verband die Anliegen und Interessen des Fachverbandes …textil..e.V. Er stellt Kontakte zur Handarbeitsindustrie her. Die alljährlichen Wettbewerbe werden gemeinsam ausgelotet, ausgelobt, juriert und mit Preisen prämiert. Bildung ist Herrn Eberhardt wichtig – unsere Arbeit auch, so dass wir immer wieder Rückhalt und Unterstützung bei Flyern, Veröffentlichungen usw. erhalten. Zu allen Bundesfachtagungen erfahren wir ein Sponsoring der in der Initiative Handarbeit e.V. versammelten Handarbeitshersteller. Nach 40 Jahren – ein herzliches Dankeschön für das Festhalten und Unterstützen unserer Ziele.
Ebenso lange pflegen wir mit dem Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.V., Frankfurt, jetzt gesamtverband textil + mode in Berlin eine rege Zusammenarbeit. Karin Terdenge arbeitet im Bildungsresort. Gemeinsame Anliegen werden besprochen und verfolgt. Ein regelmäßiger Austausch findet statt, gegenseitige Anregungen werden aufgenommen und verarbeitet. Der gesamtverband textil + mode unterstützt Wettbewerbe auf Bundesebene wie 2014 zusammen mit der Initiative Handarbeit e.V. und liefert stets neue Infos, die in der …textil… veröffentlicht werden. Dieser Verband gehört ebenfalls zu unseren Sponsoren zur Umsetzung unserer Ziele.
Über Gundula Wolter findet ein reger Austausch mit dem





























