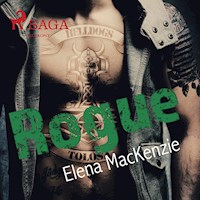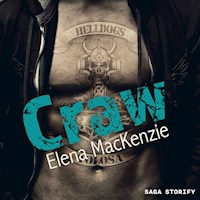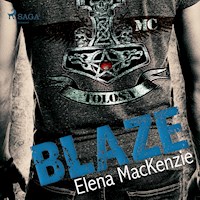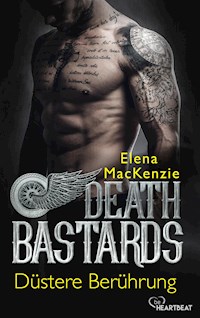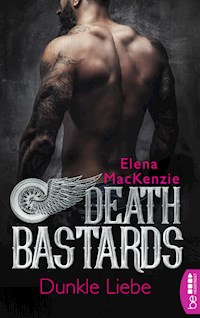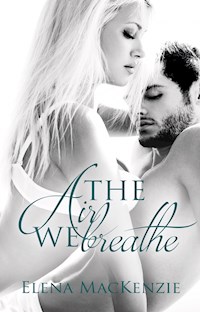
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Romance Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach einer unschönen Ehe kauft sich Tessa Carmichael eine kleine Farm und lebt dort recht zurückgezogen am Rande einer Kleinstadt. Eines Abends steht ein Soldat vor ihrer Tür und behauptet, diese Farm würde ihm gehören. Liam Thompson hat nicht ganz Unrecht, Tessa kennt sein Gesicht aus dem Fernsehen. Er ist der Soldat, der fünf Jahre lang ein Gefangener von Terroristen war. Alle hatten ihn für tot gehalten und so wurde die Farm nach dem Tod seiner Großmutter an Tessa verkauft. Liam sieht so müde aus, dass Tessa ihn nicht einfach wegschicken will, sie lässt ihn in ihr Haus. Für eine Nacht. Doch aus einer Nacht werden viele und Tessa und Liam kommen sich langsam immer näher, bis sie beide von ihrer Vergangenheit eingeholt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
THE AIR WE BREATHE
ELENA MACKENZIE
Lektorat/Korrektorat: Valeska Reon
Copyright © 2020
Coverfoto: © AS-ink - shutterstock
Umschlaggestaltung: Nadine Kapp – Booklover-Coverdesign
1. Auflage 04/2018
Elena MacKenzie
Dr-Karl-Gelbke-Str. 16
08529 Plauen
INHALT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Epilog
22. Chicago Style Deep Dish Pizza
23. Apple Pie
24. Brombeeren und Himbeerenmarmelade
25. Iced Tea
Nachwort
Über den Autor
Bücher von Elena MacKenzie
KAPITELEINS
Tessa
Bella schnaubt leise, als ich sie zwischen den Ohren kraule, und dreht mir ihren Kopf zu. Sie schnuppert an meinem Unterarm. Ihre Lefzen zupfen an meiner Haut und krabbeln mich. Ich lache leise, streichle ihr über ihre große Nase und striegle weiter ihr wundervoll in der untergehenden Sonne schimmerndes schwarzes Fell. Die in die Tage gekommene Friesin habe ich zusammen mit dieser Ranch vor ein paar Monaten gekauft. Manchmal glaube ich, sie liebt unser ruhiges, zurückgezogenes Leben genauso sehr wie ich.
Sie abends zu striegeln, während im Westen hinter den Rocky Mountains die Sonne untergeht und die Gipfel der Berge blutrot färbt, ist zu unserem Ritual geworden.
Meine Ranch ist die kleinste hier in der Gegend. Es gibt hier nur das kleine zweistöckige Farmhaus mit zwei Zimmern, einem Stall, in den fünf Pferde passen - in dem aber derzeit nur zwei Boxen bewohnt sind - eine Scheune, zwei Koppeln und den alten George, der schon immer auf dieser Ranch Vorarbeiter war und der sich geweigert hat, sie zu verlassen, nur weil ich sie gekauft habe. George ist ein ruhiger, brummiger alter Mann, der 45 Jahre seiner 67 Lebensjahre auf dieser Farm verbracht hat. Er wohnt in der kleinen Wohnung über der Garage, und da er nichts anderes als das hier kennt, teilt er sich die Einsamkeit der Ranch jetzt mit Bella, ihrer Tochter Camilla, der Schäferhündin Trixie und mir.
Leider ist George auch zu alt, um alle anfallenden Reparaturarbeiten auf der Ranch zu erledigen, und ich bin handwerklich zu ungeschickt. Ich weiß, wie man ein Buch schreibt, in seinem Blog über Kirschmarmelade und Maisbrot berichtet, aber wie man einen Zaun repariert, davon habe ich keine Ahnung. Aber der Zaun der Südkoppel sollte unbedingt repariert werden, solange können Bella und Camilla sie sonst nicht mehr benutzen. Es fehlt mir auch nicht am Geld, um jemanden kommen zu lassen, sondern an willigen Handwerkern. Denn keiner, der was auf sich hält, würde freiwillig hier rauskommen, um etwas für mich zu tun. Und deswegen mute ich George viel zu viel zu. Obwohl ich versuche, ihn davon abzuhalten, auf Dächer zu steigen, um Löcher zu reparieren, er tut es trotzdem, weil es getan werden muss. Und »die Idioten aus der Stadt einen ordentlichen Schlag gegen ihre Hohlrüben verdient hätten«, wie er es gern formuliert.
»Also dann mein Mädchen, du bist jetzt schön genug für die Nacht«, sage ich, hebe das Halfter auf, das neben mir im Gras liegt und lege es ihr an. Zur Antwort schnaubt sie wieder bloß. Unsere Unterhaltungen sind leider immer so einseitig. Ich führe sie zum Tor der Koppel, dann den befestigten Weg am Haus vorbei zum Stall und in ihre Box. Gemeinsam mit George habe ich die Trennwände zwischen den Boxen herausgenommen, so können sich Bella und ihre Tochter frei bewegen. Bella hat es mir nicht gesagt, aber ich glaube, mit ihrer neuen Wohnsituation ist sie sehr zufrieden.
Bevor ich den Stall für die Nacht verschließe, bekommen die beiden Mädchen noch frisches Wasser und Futter von mir. Als ich aus dem Stall komme, läuft Trixie mir entgegen. Den halben Tag über sehe ich sie kaum. Die meiste Zeit hält sie sich bei George auf, aber abends, wenn es ans Essen geht, ist sie pünktlich und begrüßt mich mit wedelndem Schwanz vor dem Haus. Wahrscheinlich liegt es aber an George, der die Schäferhündin mitbringt, wenn er zum Abendbrot kommt.
Ich streichle über ihr tiefschwarzes Fell, als sie meine Hand mit ihrer kühlen, feuchten Nase anstupst, dann öffne ich die Fliegengittertür und die Haustür und lasse sie an mir vorbei in den kleinen Flur laufen, in dem ich die schmutzigen Gummistiefel auf die dafür vorgesehene Unterlage stelle. Ich begrüße George, der in der Küche den Tisch für uns deckt, und gehe dann nach oben, um zu duschen, bevor ich mich zu ihm an den Tisch setze.
»Wie war dein Tag?«, frage ich den alten Mann, der mit gerunzelter Stirn von seinem Chili aufsieht. Seine Stirn kann er sehr tief runzeln und dabei sehr unwillig aussehen. Ich weiß nicht, ob das an seiner Halbglatze liegt, oder weil er einfach jemand ist, der immer grimmig aussieht. Aber ich habe mich daran gewöhnt, weswegen mich auch das grummeligste Brummen nicht mehr beeindrucken kann. Hinter George steckt in Wirklichkeit ein gemütlicher und sehr freundlicher älterer Herr.
»Der Traktor springt nicht mehr an«, antwortet er knapp, dann isst er weiter.
Wenn der Traktor nicht mehr anspringt, bedeutet das, dass wir kein Heu mehr machen können. Unsere Wiesen werfen ohnehin nicht genug für den ganzen Winter ab, aber für uns ist jeder Heuballen wichtig, weil wir von den umliegenden Farmen nichts bekommen. Wir müssen die Ballen von weiter weg anliefern lassen und das kostet Geld. Auch, wenn ich es mir leisten könnte, muss ich vorsichtig mit meinen Ausgaben sein. »Und du weißt nicht, wie man ihn reparieren kann?«
George kaut ruhig, dann schluckt er sehr langsam. »Ich weiß es schon, aber ich kann das unmöglich ohne Hilfe reparieren.«
Die Frage, ob ich ihm helfen könnte, spare ich mir, sein Blick ermahnt mich deutlich, es auch nur in Betracht zu ziehen. Ich bin nicht besonders hilfreich, wenn es darum geht, irgendetwas zu reparieren. Genau genommen bin ich wohl viel eher eine Belastung, wenn es nach George geht, weil ich einen Schraubenschlüssel nicht von einem Schraubendreher unterscheiden kann. Ich presse die Lippen aufeinander und konzentriere mich wieder auf mein Essen. Es lohnt sich nicht, mit George zu streiten, er gewinnt immer.
»Dann werde ich es in die Jobbörse stellen.«
»Hmm«, macht George. Das Internet ist für ihn etwas von einem anderen Planeten. Vielleicht auch die Hölle persönlich. Auf jeden Fall findet er es suspekt genug, um immer, wenn ich es anspreche, dieses merkwürdige »Hmm« auszustoßen.
Wir essen ruhig weiter, viel reden tun wir nie. Wir beschränken es auf das Nötigste und das ist uns beiden sehr recht. Wenn es darauf ankommt, dann findet George die richtigen Worte, das weiß ich. Er hat sie auch gefunden, als er mir mit erstaunlich vielen Sätzen klargemacht hat, dass es diese Ranch nur mit Bella, Camilla, Trixie und ihm gibt. Und den paar Hühnern, die in und um die Scheune herum leben, die ich aber kaum beachte, weil Hühner mir nicht geheuer sind. Nur ihre Eier mag ich gern. Draußen auf der Südkoppel am Waldrand hat George auch noch ein paar Bienenstöcke, um die er sich so große Sorgen macht, dass er mir ständig zeigen will, wie man mit ihnen umgeht, für den Fall, dass er mal nicht mehr ist. Aber ich habe zu viel Angst, weswegen ich ihm immer sage, ich werde sie dann in die sorgsamen Hände von jemanden geben, der sich damit auskennt. Das wird dann für fünf Sätze zum Streitthema zwischen uns, bis George sich einfach umdreht und geht.
»Ich wasche ab«, sagt George und steht auf.
»Nein, ich mach das schon«, sage ich und lege eine Hand auf seine, die gerade nach meinem Teller greifen will. »Heute ist Mittwoch, kommt nicht gleich »Unsere kleine Farm«?, frage ich ihn, weil ich weiß, dass diese Serie seine Leidenschaft ist. Manchmal erzählt er mir schimpfend, was seiner Meinung nach nicht richtig recherchiert wurde.
»Also gut«, sagt er. »Ich geh dann mal rüber.«
Ich stehe auf, räume das Geschirr in die Spüle und beginne, es mit der Hand zu spülen. Die Küche ist schon etwa so alt wie die Ranch selbst: 97 Jahre. Alles hier im Haus ist mindestens so alt. Anfangs habe ich überlegt, es zu modernisieren. Neue Möbel, vielleicht einen Fernseher, einen Geschirrspüler oder ein modernes Bad. Aber die einzigen modernen Dinge, die ich in das Haus geholt habe, sind eine Waschmaschine, meinen Laptop, meine Kamera für den Blog und eine Dusche. Denn so sehr mich das alles zu Beginn hier gestört hat, jetzt habe ich erkannt, dass genau diese Dinge es sind, die den Charme meiner Abgeschiedenheit ausmachen.
Ich trockne mir die Hände ab, als es an der Tür klopft. George klopft niemals an, weswegen ich sofort in Alarmbereitschaft bin. Es gibt nicht viele Menschen, die hier rauskommen, der Paketbote, weil er es muss, wenn die Pakete zu groß für unser Postfach in der Stadt sind, der Tierarzt, weil er sich von niemanden abhalten lässt, wenn ein Tier ihn braucht, mein Ex-Ehemann, weil er es kann. Da es zu spät für die Post ist, ich den Tierarzt nicht gerufen habe, bleibt nur noch eine Person übrig: mein Ex-Mann. Ich seufze schwer, hänge das Handtuch an den metallenen Haken neben dem Spülbecken und gehe zur Tür.
Der Schatten, den ich durch das Glas erkenne, ist nicht George und auch nicht mein Ex, dafür ist dieser Schatten viel zu groß und breitschultrig. Ich werfe einen flüchtigen Blick neben die Tür, wo die Schrotflinte steht, von der George will, dass sie dort steht, damit ich sie jederzeit benutzen kann, falls der »Idiot von Ex« hier auftaucht. Eine Sekunde überlege ich, ob ich die Schrotflinte jetzt brauchen werde, nicht nur mein Ex könnte mir hier draußen gefährlich werden. In dieser Gegend weiß jeder, dass ich allein hier draußen lebe, nur mit einem alten Mann, der im Apartment über der Garage wohnt, und einer grundfreundlichen Schäferhündin an meiner Seite. Trixie steht neben mir und starrt erwartungsvoll und mit wedelndem Schwanz auf die Tür. Sie winselt leise. Über Besuch freut sie sich die meiste Zeit deutlich mehr als ich.
»Du bist mir keine Hilfe«, murmle ich zu ihr nach unten. Sie antwortet mit einem langgezogenen Maulen.
Ich öffne die Tür und vor mir steht ein Mann, dessen Gesicht mir vage bekannt vorkommt. In seiner Hand trägt er einen dunkelgrünen Seesack, wie ihn Soldaten besitzen. Er sieht mich mit ernstem, leicht wütenden Blick aus leuchtend blauen Augen an. Und er atmet erregt, was wohl Teil seiner Wut ist, ganz genauso wie das Zittern seiner Wangenmuskeln. Sein dunkles Shirt hat ein paar kleine Löcher am Kragen, seine Jeanshose sitzt so eng, dass ich deutlich seine muskulösen Oberschenkel sehen kann, auch seine Arme sind muskulös, seine Schultern breit und er hat einen dunklen Dreitagebart. Alles in allem, wirkt der Mann bedrohlich und das düstere Glitzern in seinen Augen, die sich so stark von seinem dunklen Haar abheben, wirkt auch nicht beruhigend auf mich.
»Das hier ist mein Haus«, sagt er bedrohlich.
Ich schnappe nach Luft und sehe ihn erschrocken an. Mein Blick geht wieder zur Waffe, aber er hat sie sich genommen, bevor ich überhaupt in Erwägung ziehen kann, sie zu benutzen. »George hat schon immer Wert darauf gelegt, dass die hier steht« erklärt er knapp.
Laut winselnd drückt sich Trixie an mir vorbei und springt den Mann an. Sie springt an ihm hoch, nicht um mich zu verteidigen, nicht um ihn anzugreifen, sondern um ihn mit einem herzzerreißenden Jaulen zu begrüßen. Er kniet sich vor sie, streichelt sie und umarmt die Hündin, die ihm bellend und heulend das Gesicht leckt.
»Sie sind der Enkel von Rose«, stelle ich gedehnt fest, als mir wieder einfällt, woher ich sein Gesicht kenne. Rose hat mir oft ihre Fotoalben gezeigt und von ihrem Enkel erzählt, der bei einem Einsatz für die Seals verschwunden war.
Er steht wieder auf, seine Hand ruht auf Trixies Kopf, die sich brav neben ihn setzt und ihn ansieht, als würde Gott neben ihr stehen. »Bin ich, und deswegen gehört dieses Haus mir«, sagt er mit hartem, bestimmenden Tonfall und starrt mich zornig an.
Ich mustere den Mann nach außen unbeeindruckt, aber innerlich macht sich in meiner Magengrube ein ungutes Gefühl breit. Er steht mit Jeans und Shirt vor mir und verlangt sein Haus zurück. Mein Zuhause. Wahrscheinlich hat er nicht einmal unrecht. Rose wird ihm diese Ranch vererbt haben, da man ihn aber für tot hielt, wurde sie an mich verkauft. »Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber die Besitzurkunde ist auf meinen Namen ausgestellt. Ich habe die Ranch der Bank abgekauft.«
»Der Verkauf war nicht rechtens. Wie Sie sehen, lebe ich noch und ich hätte die Ranch meiner Familie niemals verkauft.« Er starrt von oben mit hartem Blick auf mich herab und ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Ich bin keine Anwältin, ich weiß nicht, was man in einer solchen Situation tut. Wer hat das Recht, hier zu sein? Wer hat es nicht?
Ich sehe den Mann mit zitternder Unterlippe an und bin völlig überfordert. Ich habe keine Ahnung, wie ich hierauf reagieren soll. Natürlich habe ich seine wundersame Befreiung in den Medien verfolgt – das halbe Internet war voll damit -, aber ich habe nicht daran gedacht, dass er zurückfordern könnte, was ihm gehört hat.
»Hören Sie, ich weiß nicht, was wir jetzt tun können. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich dies alles hier gekauft habe, und zwar ganz legitim.«
Er verzieht das Gesicht, dabei zieht er seine rechte Augenbraue so hoch, dass die Narbe direkt darüber jetzt einen noch steileren Bogen um seine Braue herum nimmt, als sie es vorher getan hat. »Das ist mein Zuhause. Ich habe die letzten fünf Jahre in der Hölle verbracht und ich will jetzt nur nach Hause.«
Ich schlucke, weil ich ihn gut verstehen kann, aber ich bin auch ratlos. Sollte ich vielleicht George dazu holen? Liam tut mir leid und er sieht müde aus. Und ich möchte mir nicht annähernd vorstellen, was er durchgemacht hat während seiner Gefangenschaft. Er müsste im Alter meines Ex-Ehemanns sein, von ihm weiß ich, dass Liam und er mal Freunde waren. Er hat oft von ihm gesprochen. Schon auf dem College, als wir uns kennengelernt haben.
»Lassen Sie uns drinnen weiterreden«, schlage ich vor, trete zur Seite und lasse ihn in mein Haus. Ob das eine gute Entscheidung ist, darüber möchte ich gar nicht nachdenken. Aber aus irgendeinem Grund, der mir absolut nicht bekannt ist, vertraue ich ihm. Obwohl ich es wahrscheinlich nicht tun sollte, denn Marks Freunde sind alle gleich. Und wenn Liam einmal sein Freund war, dann sollte ich eigentlich genau wissen, dass das hier nur ein Fehler sein kann. Aber er tut mir leid und ich kann ihn unmöglich da draußen stehenlassen. Dieser Mann hat eine Menge schlimme Dinge durchmachen müssen. Wahrscheinlich schlimmer, als sich jemand wie ich vorstellen kann.
Er sieht sich kurz um, tätschelt Trixies Kopf und folgt mir mit ihr dann in die Küche. Hier draußen ist die Küche der Raum, in dem sich das halbe Leben abspielt. Die Menschen hier verbringen viel Zeit und viele Gespräche in der Küche. Ich komme aus Jamestown, wo man seine Gäste zumeist ins Wohnzimmer führt, aber in den zwei Jahren, die die Ehe mit Mark angedauert hat, habe ich manche Eigenheiten des Lebens auf dem Land übernommen. Außerdem ist diese Küche auch mein wichtigster Arbeitsplatz. Hier lasse ich meiner Kreativität freien Lauf und versuche alte ländliche Rezepte wiederaufleben zu lassen, um sie dann auf meinen Blog zu stellen oder als Buch zu veröffentlichen.
»Sie haben alles gelassen, wie es war«, stellt er fest, lehnt seinen Seesack gegen einen der hellgelben Küchenschränke und setzt sich an den Tisch. Er wirft meiner teuren Kamera einen neugierigen Blick zu. Sie steht auf ihrem Stativ in einer Ecke und wartet darauf, dass ich mit ihr Fotos von meinen Kreationen mache.
»Ja, habe ich«, antworte ich nervös. Die Küche ist nicht besonders groß, aber mit diesem Mann in ihrer Mitte wirkt sie noch viel kleiner, was nicht nur an seinen gut 1,80 Metern, den breiten Schultern und den vielen Muskeln liegt, es liegt auch an dem, was er erlebt hat. Es geistert jede Sekunde durch meinen Kopf. Vor mir sitzt ein Mann, der wahrscheinlich die schlimmsten Jahre hinter sich gebracht hat, die man sich vorstellen kann. Und das schüchtert mich ein. »Möchten Sie etwas trinken?«
»Kaffee«, sagt er knapp, verschränkt die Finger auf dem Tisch und sieht mich abwartend an. »Es tut mir leid, dass ich hier so einfalle, aber dass die Ranch verkauft wurde, habe ich vorhin erst erfahren. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Wenn ich ehrlich zu Ihnen sein soll, dass es das hier gibt, dass die Ranch auf mich wartet, war der Grund, der mich überleben ließ.«
Ich zucke innerlich zusammen, wende mich bestürzt von ihm ab und gebe Wasser und Kaffeepulver in die Maschine. Diese Ranch ist sein Zuhause, natürlich wird er sich all die Zeit, die er weg war, nach diesem Zuhause gesehnt haben, sich an der Hoffnung, es eines Tages wiederzusehen, festgehalten haben. Wahrscheinlich kann ich mir nicht annähernd vorstellen, wie es für ihn sein muss, zu wissen, dass er dieses Zuhause verloren hat.
»Das tut mir leid. Wirklich, aber jetzt ist sie mein Zuhause und ich habe auch nichts anderes als diese Ranch.«
Er seufzt. »Ich weiß nur nicht wohin.«
Liam wirft mir einen so traurigen, erschöpften Blick zu, dass es mich innerlich zerbrechen lässt. Da steht dieser Mann vor meiner Tür, ein Soldat, der einen Albtraum durchlebt hat und nur nach Hause will und dann feststellt, dass sein Albtraum noch kein Ende gefunden hat. Was soll ich nur tun? Ich stelle ihm eine Tasse mit Kaffee auf den Tisch, schenke auch mir eine ein. Was macht es schon, dass es schon viel zu spät für Kaffee ist, ich werde ohnehin nicht schlafen können.
»Sie können heute Nacht erstmal bleiben und dann sehen wir weiter«, schlage ich vor.
»Danke, aber ich denke, das ist keine gute Idee.« Er legt seine großen rau aussehenden Hände um die Tasse und mustert mich traurig. »Das Angebot ist nett, aber ich kann es nicht annehmen.«
Und wahrscheinlich ist es gut so, dass er es nicht annehmen will, aber mein schlechtes Gewissen plagt mich. Ich kann ihn unmöglich vor die Tür setzen. Auf der anderen Seite dieses Flurs gibt es ein Zimmer und dieses Zimmer gehört ihm. Seine Sachen hängen in den Schränken, weil ich noch keine Zeit hatte, sie auszuräumen. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich einfach nicht den Mut dazu, weil ich Rose so sehr geliebt habe wie meine eigene Großmutter und sie es nicht übers Herz gebracht hat, die Sachen wegzuwerfen. Sie hat immer fest daran geglaubt, dass Liam eines Tages nach Hause zurückkehren würde. Und das hat er jetzt getan. Nur leider hat die arme Rose es nicht mehr erleben dürfen.
»Sie bleiben«, sage ich knapp. »Ihre Sachen sind alle noch da. Es ist Ihr Zimmer.«
Er sieht mich erstaunt an. Diese strahlend himmelblauen Augen, das dunkle glatte, etwas zu lange Haar und sein Bartschatten machen aus ihm einen sehr attraktiven Mann mit einem markanten, scharf geschnittenen Kiefer, einem Grübchen im Kinn und vollen Lippen. Lippen, die er jetzt zu einem harten Strich zusammenpresst. Aber man sieht ihm auch an, dass er viel erleiden musste. Seine Augen haben tiefe Ringe, seine Wangen sind etwas eingefallen und um seine Augenwinkel herum haben sich tiefe Falten gegraben, die ihn älter aussehen lassen, als er sein dürfte, wenn er wirklich mit Mark in einer Jahrgangsstufe war.
»Es ist alles noch da?«, fragt er fassungslos und das Blau seiner Augen verschwimmt, als sich Tränen in ihnen sammeln.
Ich nicke und lege eine Hand auf seine. »Trinken Sie Ihren Kaffee und bleiben Sie. George wird sich bestimmt freuen.«
»George«, sagt er lächelnd, jetzt bebt seine Unterlippe und seine Finger zittern unter meinen. Mich packt eine so heftige Welle Mitleid, dass ich gegen die Tränen an schlucken muss, die in meine Augen schießen wollen.
Ich kann mir vorstellen, dass es sich in seiner Brust eng anfühlt, nach so langer Zeit nach Hause zurückzukehren. Nach allem, was er durchgemacht hat. Wahrscheinlich kann ich mir nicht annähernd vorstellen, wie schlimm die letzten fünf Jahre in Gefangenschaft von Terroristen für ihn gewesen sein mussten. Die Nachrichten im Internet waren voll von seiner wundersamen Heimkehr. Ein erschöpfter Mann, mit zu langen, strähnigen Haaren, einem dichten Vollbart und müdem Blick. Obwohl sein Bart verschwunden ist, seine Haare geschnitten sind und er nicht mehr ganz so erschöpft wirkt, kann ich in seinen Augen noch immer den Schmerz sehen, den auch die vielen Fotos von ihm gezeigt haben.
»Ja, er ist auch noch hier«, sage ich und versuche mich an einem aufmunternden Lächeln. Jede Faser meines Körpers will diesem Mann so viel Trost spenden, wie man nur spenden kann. »Ich weiß nicht, ob er schon immer so schlecht gelaunt war, wie er es jetzt ist. Aber es gibt ihn noch«, erkläre ich und hole zitternd Luft.
Liam sieht mich musternd an, dann huscht ein Lächeln um seine Mundwinkel. »George war schon immer so. Besonders wenn Großmutters Äpfel geerntet werden mussten.«
»Mittlerweile ernten wir nur noch, was wir für uns brauchen. Das gilt auch für die Kirschen und Beeren. Ich hab einen Teil der Farm verkauft. Es gibt hier nur noch George und mich.«
Liam nickt nachdenklich. »Ich hab davon gehört. Wahrscheinlich ist es das Beste für Sie und George gewesen.«
Ich lache. »Ist es, sonst hätte George mir wohl den Kopf vom Hals gerissen. Rose hat ihre Rinder schon vor einigen Jahren verkauft.«
»Kannten Sie sie?«
»Sie war meine Freundin. Wir haben uns gegenseitig gebraucht, das hat uns verbunden.«
Liam trinkt seinen Kaffee, dann sieht er sich in der Küche um. »Es riecht noch immer so, als hätte sie eben erst gekocht. Warum hat sie Sie gebraucht?«
Ich sehe mich nervös um. »Ich habe vorhin gekocht. Es ist noch etwas da, wenn Sie möchten.«
»Nein, ich bin nur müde. Danke.« Er schüttelt den Kopf. »Warum hat Rose Sie gebraucht? Ging es ihr schlecht?«, fragt er besorgt.
Mein Herz zieht sich etwas zusammen, eigentlich möchte ich ihm nichts erzählen, was ihm das alles hier noch schwerer macht. Aber ich kann ihn auch unmöglich belügen. »Sie hat Sie vermisst und jeden Tag damit verbracht, auf Sie zu warten. Es gab nicht einen Tag, an dem sie nicht fest daran geglaubt hat, dass Sie noch am Leben sind.«
»Woran ist sie gestorben?«
»Reden wir ein anderes Mal darüber«, sage ich, viel weniger aus Mitleid für ihn, als aus Mitleid für mich, denn ich werde nicht gern an die schwersten Monate in meinem Leben erinnert.
»Reden wir jetzt darüber«, fordert er mit hartem Blick.
»Sie hatte Krebs«, presse ich nach einem tiefen Atemzug heraus, den ich brauche, um die Kraft dafür aufzubringen, auszusprechen, was mir noch immer wehtut.
Liam schluckt, weicht meinem Blick aus, dann presst er die Lippen fest aufeinander und atmet hörbar tief ein. »Sie wollte immer hier auf der Farm sterben und begraben werden. Neben Großvater.«
»Das ist sie. Ich hab sie gepflegt, sie ist hier eingeschlafen.«
»Danke«, sagt er mit gesenktem Blick. »Ich hätte hier sein müssen.«
Ich schnappe nach Luft und lege eine Hand auf seine. »Das ist nicht Ihre Schuld.«
»Ist es, sie wollte nicht, dass ich gehe, aber ich bin trotzdem gegangen.« Sein Gesichtsausdruck ist hart, als er das sagt, gleichzeitig sieht er verschämt weg.
Ich sollte etwas sagen, um ihm die Schuldgefühle zu nehmen, die fast spürbar in der Luft knistern. Aber was soll ich sage? Mir fällt nichts Passendes ein. In solchen Dingen bin ich nicht gut. Ich weiß, wie man Apfelkuchen backt, wie man eine gute Marmelade hinbekommt und ein noch besseres Gumbo. Aber ich weiß nicht, wie man in solchen Augenblicken die richtigen Worte findet. Das wusste ich noch nie. »Sie war immer stolz auf Sie und hat nur gut über Sie geredet. Für sie waren Sie ein Held.«
Liam stößt ein abfälliges Lachen aus, dann schüttelt er den Kopf. »Sie hat es gehasst, als ich gegangen bin.«
»Weil sie Angst hatte, aber sie war stolz«, versuche ich es weiter.
Liam sieht mich an, sein Blick ruht auf meinem Gesicht, als suche er darin nach dem Beweis für eine Lüge, aber den gibt es nicht, weil Rose immer voller Stolz von ihrem Enkel gesprochen hat. »Mein Zimmer?«, will er wissen. »Ich kann auch im Wohnzimmer schlafen.«
»Das müssen Sie nicht, es ist alles noch da.«
Liam
»Zieh deinen verdammten Schädel ein«, donnert die Stimme von Sgt. Becks durch die Dunkelheit. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt verstehe, was er brüllt. Überall um uns herum schlagen Granaten ein, fliegen Geschosse durch die Luft, erklingen Gewehrsalven.
Das hier ist ein Hinterhalt, Al-Quaida hat uns erwartet und dem Sergeant ist längst klar, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Der CH-47 Chinook Hubschrauber hat uns mitten in einem Wespennest abgesetzt und ist dann unter dem Beschuss der Gegner nicht weit von unserer jetzigen Position runtergegangen.
Ich lehne mich gegen den Felsen in meinem Rücken und sehe rüber zu Charles, der mich mit dem Wissen im Gesicht ansieht, dass wir hier sterben werden. Wir werden definitiv nicht den Takur Ghar sichern, um einen Posten auf dem Gipfel errichten zu können. Eine Kugel schlägt neben meinem Schuh in den Boden ein und wirbelt Dreck auf. Ich ziehe meinen Fuß weg und drücke mich noch fester gegen den Felsen, der nicht groß genug ist, um Charlie und mich zu verstecken.
Ich schiebe das Nachtsichtgerät von meiner Stirn zurück auf meine Nase und sehe mich nach dem Rest der Truppe um. Der Sgt. liegt hinter der kleinen Anhöhe hinter uns zusammen mit Tom. Davis versteckt sich rechts von uns hinter einem einzelnen Baum. Die anderen kann ich nicht sehen, nur Henson, der direkt links von uns liegt in seinem eigenen Blut, mehrere Kugeln haben seinen Körper zerfetzt. John ist auch tot, aber ich kann ihn nicht entdecken, er liegt irgendwo ein paar Meter rechts von uns. Von dort hat Black vor wenigen Minuten gemeldet, dass John tot ist und er allein im Schatten eines Felsens liegt. Und Miller liegt direkt vor uns, wenn ich den Kopf über den Felsen hebe, kann ich ihn sehen. Er wurde in die Brust getroffen. Wenn es ruhig wird, kann ich ihn stöhnen hören.
Er liegt da und wartet, dass wir ihn retten, ihn in Deckung ziehen. Aber die Terroristen warten auch. Darauf, dass wir versuchen, ihn zu retten. Deswegen knallen sie ihn nicht ab, weil sie darauf warten, dass wir das Ächzen und Stöhnen unseres Kameraden nicht mehr ertragen können. Das Flehen, ihn zu retten. Sie warten darauf, dass wir hervorkriechen, damit sie uns umbringen können. Sie verstecken sich um uns herum in Gräben, hinter Felsen und Bäumen, oben auf der Anhöhe. Sie sind einfach überall.
Ich stoße verzweifelt die Luft aus und schließe wie betäubt die Augen. Es gibt keinen Ausweg. Nicht für jeden von uns. Vielleicht ein paar, aber wir lassen keinen Mann zurück. Das ist unsere wichtigste Regel. Das Seal 6 lässt niemals jemanden zurück. Wir müssen versuchen, Miller zu retten.
»Charlie, hast du noch eine Granate?«, frage ich leise.
»Eine«, antwortet er in die plötzliche Stille. Jetzt ist nur noch das Keuchen von Miller zu hören. Sie lauern.
»Siehst du den Felsen dort drüben?«, frage ich Charlie. »Wirf die Granate in diese Richtung, ich renne dort rüber, dann werden sie das Feuer auf mich eröffnen und du kannst Miller hinter den Felsen hier ziehen.«
»Sie werden dich erwischen.«
»Werden sie nicht. Und wenn doch, wir sterben hier sowieso alle. Aber wir können Miller dort nicht liegenlassen.«
Ich sehe in die Richtung, in der der Sergeant liegt. Er wird stinksauer sein. »Bereit?«
Charlie zieht den Sicherungsstift der Granate heraus und nickt. Ich gehe in die Hocke, Charlie wirft die Granate und ich renne in die entgegengesetzte Richtung. Schüsse pfeifen an mir vorbei, schlagen vor meinen Füßen in den Boden ein. Die Gewehrsalven zerreißen die Stille der Nacht schlimmer noch als das Donnern eines Sommergewitters. Sogar noch schlimmer als eine Silvesternacht auf dem Times Square in New York. Ein heftiger Schmerz zerreißt meinen Oberschenkel, ich knicke ein, stolpere, rapple mich auf, dann brennt meine Brust.
Ich schreie auf, gehe auf alle Vier runter, rasender Schmerz schießt durch meinen Körper, ich breche zusammen, bleibe liegen und schreie auf, als ich ein drittes Mal getroffen werde. Ich schmecke Blut und Dreck. Jemand ruft meinen Namen. Ich soll mich beruhigen. Als ich die Augen öffne, blendet mich helles Licht, etwas berührt meine Schulter, ich schlage um mich, richte mich ruckartig auf und erstarre.
Das hier ist nicht Takur Ghar und auch nicht das Al-Qaida-Camp in der Nähe von Tora Bora.
»Verdammt«, stöhne ich auf und sehe mich verwirrt um. Das hier ist mein Zimmer und die Frau, die dort auf dem Boden liegt und mich aus schreckgeweiteten Augen mit einem blutenden Riss auf der Wange ansieht, ist Tessa Carmichael. »Verdammt!«, fluche ich noch heftiger. Ich springe auf und knie mich neben sie. Sie hat eine Hand an ihre Wange gehoben und ihre Finger schweben über der Wunde. »Es tut mir leid«, sage ich und sehe sie erschrocken an. Ich kann nicht fassen, dass ich ihr das angetan habe.
»Sie haben geschrien, ich wollte nur nachsehen, ob alles in Ordnung ist.«
Ich untersuche ihren Wangenknochen, aber sie schiebt meine Hand nur weg und schüttelt den Kopf.
»Das wollte ich nicht«, versichere ich ihr und fühle mich dreckig. Wie der letzte Abschaum. Ich habe eine Frau geschlagen. Noch dazu eine, die mich bei sich aufgenommen hat. Sie lässt sich ohne zu zögern von mir aufhelfen, als ich ihr die Hand reiche. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich diese zierliche Frau verletzt habe. Mein Herz hämmert und ich möchte mich am liebsten selbst umbringen für das, was ich ihr angetan habe. »Es war ein Fehler hier zu bleiben.« Ich runzle die Stirn und sehe mich nach meiner Kleidung um. Ich sollte hier verschwinden. Schnell.
»Nein. Nein, es war mein Fehler. Ich hätte nicht in Ihr Zimmer kommen sollen.« Sie legt eine Hand auf meinen Unterarm und sieht mich mit diesem mitleidigen Blick an, den ich so hasse, weil er bedeutet, dass die Menschen wissen, dass ich im Arsch bin. Dass sie mich so ansieht, stört mich irgendwie besonders. Wahrscheinlich, weil sie sowieso schon alles hat, was mir gehört. Jetzt auch noch meine Würde, die vor ihren Füßen herumkriecht. Ich schüttle ihre Hand ab, dann packe ich sie an den Oberarmen und sehe zornig auf sie herunter.
»Tessa, das hier ist meine Schuld. Ich wusste, dass das passieren könnte. Ich verschwinde.«
»Oh nein! Du bleibst. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Du wirst nicht mitten in der Nacht gehen.« Damit dreht sie sich zur Tür um. »Ich hab schon Schlimmeres erlebt als diesen kleinen Hieb. Das war gar nichts.«
Mein Herz stolpert. »Was heißt Schlimmeres?«, frage ich und verspüre plötzlich eine Wut, die ich nicht empfinden sollte. Aber bei dem, was sie gesagt hat, spielen sich Bilder in meinem Kopf ab, die mich rot sehen lassen.
Sie sieht über die Schulter zu mir zurück und lächelt müde. »Geh wieder schlafen!«
Damit lässt sie mich stehen. Mit einer Menge Fragen, die plötzlich in meinem Kopf sind und verwirrenden Gefühlen. Meine Hände zittern und jeder Muskel scheint zu schmerzen in meinem Körper. Wieder nach Hause zu kommen hatte ich mir anders vorgestellt. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Herz rast noch immer und ich spüre, wie sich das Adrenalin durch meine Venen brennt. Ich werfe einen Blick auf das Bett neben mir, in dem ich schon so lange ich denken kann, geschlafen habe. Es hat sich gut angefühlt, wieder darin zu liegen. Eigentlich will ich es nicht aufgeben, aber es wäre auch nicht richtig, Tessa weiter in Gefahr zu bringen.
»Ich schließe ab«, rufe ich ihr hinterher, gehe auf die Zimmertür zu und greife nach dem Schlüssel, der im Schloss steckt.
»Mach das!«
Tessa
Ich stelle eine Tasse mit Earl Grey vor George, der morgens immer Tee trinkt, weil er so früh am Tag keinen Kaffee verträgt, wie er gern behauptet. Dann wende ich mich wieder dem Speck zu, der in der Pfanne brutzelt. Ich unterdrücke ein Gähnen. Seit ich auf der Ranch lebe, stehe ich deutlich früher auf, als ich das in meinem alten Leben getan habe. George besteht darauf, dass die Tiere schon vor dem Morgengrauen versorgt werden. Ich habe mich an das frühe Aufstehen gewöhnt, aber in der vergangenen Nacht habe ich nicht mehr viel geschlafen, nachdem Liams laute Schreie mich aus dem Schlaf gerissen hatten.
Ich teile den Speck auf die drei Teller mit Ei auf und wende mich aber noch nicht gleich um, um sie auf den Tisch zu stellen. In meinem Rücken redet George auf Liam ein. Man kann am Zittern seiner Stimme hören, wie aufgewühlt der alte Mann ist. Als er vorhin in die Küche kam und Liam am Tisch sitzen sah, ist er in Tränen ausgebrochen und wäre fast in die Knie gegangen, hätte Liam ihn nicht aufgefangen.
»Es ist verdammt schade, dass deine Großmutter das nicht mehr erleben durfte«, sagt George und stößt einen lauten, schweren Seufzer aus. Ich höre ihn in seiner Tasse rühren. Er rührt seinen Tee immer lange und ausgiebig um. Lange genug, damit er sicher sein kann, dass kein Zucker mehr auf dem Boden der Tasse liegt.
»Ist es«, gibt Liam leise von sich.
Ihn kann ich viel schlechter einschätzen als George, da ich ihn kaum kenne. Ich bin mir nicht sicher, ob er eher traurig ist, weil seine Großmutter nicht mehr lebt, oder ob es ihn überwältigt, dass George noch da ist. Vielleicht ist er auch nur völlig damit überfordert, dass George ihn mit Fragen attackiert. Oder vielleicht ist ihm auch die vergangene Nacht noch unangenehm.
»Sie hat jeden Tag auf der Terrasse gesessen, die Straße runtergeschaut und zu mir gesagt, dass du eines Tages diesen Weg entlangkommen wirst. Sie war sich so sicher. Und ich konnte es ihr nicht ausreden.« George seufzt wieder und Liam brummt leise. »Also habe ich ihr zugestimmt und sie dadurch in ihrer Hoffnung noch unterstützt.«
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich fühle mich, als wäre ich ein Eindringling, als würde ich hier nicht hergehören. George und Liam, sie gehören hierher, aber nicht ich. Ich atme zitternd ein und nehme zwei Teller, setze ein Lächeln auf und drehe mich zu den beiden Männern um. George sieht lächelnd zu mir auf, aber in seinem Gesicht erkenne ich, wie aufgewühlt er ist. Der Junge, den er hat zu einem Mann werden sehen, und von dem er geglaubt hat, er wäre tot, sitzt neben ihm in der Küche, in der sie viele Jahre zusammen gegessen haben. Und ich glaube, er fühlt sich genauso ratlos wie ich, denn sein Blick wirkt auch fragend auf mich. Wie geht man mit einem Menschen um, den alle für tot gehalten haben und der die schlimmsten Dinge gesehen und erlebt hat, die ein Mensch sehen und erleben kann? Ihn heute Nacht schreien zu hören und zu sehen, wie er um sich schlug und wie schmerzerfüllt der Ausdruck in seinem Gesicht war, hat mir klar gemacht, dass niemand von uns nur annähernd nachvollziehen kann, was dieser Mann erlebt hat.
Liam bedankt sich bei mir, aber sein Blick weicht meinem hastig aus. Wahrscheinlich ist ihm die vergangene Nacht peinlich. Aber das muss sie nicht. Solche Dinge geschehen auch mit Menschen, die weniger Schlimmes erlebt haben als er. Ich nehme meinen Teller und setze mich ihm gegenüber. Ich kann nicht verhindern, dass mein Blick über seinen Oberkörper gleitet, die breite Brust, die muskulösen Oberarme, die den Stoff des Shirts über die Maßen dehnen. Auf seinem Unterarm entdecke ich eine breite Narbe, die das Tattoo des Seal Team Six in zwei Hälften spaltet. Der Seeadler, der auf einem Anker sitzt, ein Gewehr und einen Dreizack zwischen den Krallen, wird von der wulstigen Narbe geradezu geköpft. Ich frage mich, ob das die Terroristen waren oder er es sich selbst angetan hat.
»Der alte Traktor ist kaputt«, sagt George kauend und schiebt das Ei auf seinem Teller mit der Gabel hin und her, als läge ihm etwas auf dem Herzen und er wüsste nicht, wie er es sagen könne.
Liam sieht mich an und dieser Blick aus seinen Augen lässt meine Haut kribbeln. Obwohl seine Augen so hell sind, habe ich das Gefühl, dass sie von Dunkelheit beherrscht werden. Dieser Mann sieht unglaublich attraktiv aus und mein Körper ist sich dessen mit jeder Faser bewusst. Ich weiß, ich sollte wegsehen, aber ich fühle mich wie gefesselt.
»Ich fahre dann in die Stadt und nehme mir erstmal ein Zimmer. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht«, sagt Liam und widmet sich wieder seinem Essen.
George verzieht enttäuscht das Gesicht. »Du bist gerade erst zurück. Das hier ist dein Zuhause.«
Ich verschlucke mich fast und muss mich anstrengen, Luft zu bekommen. Ich fühle mich plötzlich noch schuldiger. Noch mehr fehl am Platz.
»Jetzt ist es das nicht mehr«, sagt Liam und sieht mich nachdenklich und ein wenig traurig an.