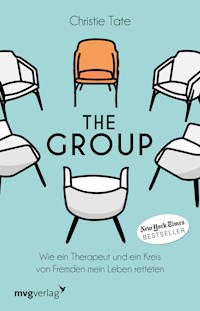
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mvg Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
»Was wird mit mir geschehen, wenn ich der Gruppe beitrete?« »All deine Geheimnisse werden ans Licht kommen.« Christie Tate ist jung, erfolgreich und … will nicht mehr leben. Zunächst widerwillig schließt sich die zurückhaltende, ehrgeizige Anwältin einer Psychotherapiegruppe an, um sich in einem Raum mit sechs Fremden emotional zu entblößen. Christie lässt die Gruppe an ihrer Kindheit und den psychischen Folgen im Erwachsenenleben teilhaben: ihr Kampf gegen Bulimie, ihr gescheitertes Sexualleben, das überwältigende Gefühl der Einsamkeit und die akute Sehnsucht nach einer Beziehung. Im Gegenzug für ihre schonungslose Ehrlichkeit erfährt sie endlich Nähe und findet zu sich selbst. Ein hoffnungsvolles Memoir, das seelische Tiefpunkte nicht verschweigt und zeigt, wie menschlicher Kontakt Leben retten kann. »Auf jeder Seite dieses unglaublichen Memoirs von Christie Tate dachte ich: Ich wünschte, ich hätte dieses Buch gelesen, als ich 25 war. Es hätte mir so sehr geholfen!« Reese Witherspoon »Oft wahnsinnig komisch und am Ende doch unglaublich berührend.« People »Dieses unbändige Memoir ist ein mitreißendes Erlebnis und eines der erstaunlich hoffnungsvollsten Bücher, die ich je gelesen habe.« Lisa Taddeo (Autorin des Spiegel-Bestsellers »Three Women«)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christie Tate
THEGROUP
Christie Tate
THEGROUP
Wie ein Therapeut und ein Kreis von Fremden mein Leben retteten
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
1. Auflage 2021
© 2021 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2020 bei Avid Reader Press unter dem Titel Group. © Published by arrangement with the original publisher, Avid Reader Press, a new division of Simon & Schuster, Inc. All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Monika Kempf
Redaktion: Nadine Lipp
Umschlaggestaltung: Karina Braun
Umschlagabbildung: Shutterstock.com/Oksana Plieva
Satz: Carsten Klein, Torgau
Druck: CPI books GmbH, Leck
eBook by tool-e-byte
ISBN Print 978-3-7474-0282-5
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96121-635-2
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96121-636-9
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.mvg-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Meinem Therapeuten und den Mitgliedern der Gruppe, mit denen ich das Glück hatte, in einem Kreis zu sitzen
INHALT
TEIL 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TEIL 2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TEIL 3
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
28
39
40
41
NACHWORT
DANK
Über die Autorin
TEIL 1
1
Als ich mich das erste Mal nach dem Tod sehnte – als ich mir wirklich wünschte, dass er mir seine knochige Hand auf die Schulter legt und »Hier entlang« sagt –, saß ich im Auto. Auf dem Beifahrersitz lagen zwei Einkaufstüten mit Obst und Gemüse. Kohl, Karotten, ein paar Pflaumen, Paprika, Zwiebeln, zwei Dutzend roter Äpfel. Drei Tage zuvor hatte ich im Büro der Stipendienverwaltung gesessen, und der Beamte der juristischen Fakultät hatte mir einen Zettel gereicht. Auf ihm stand der Platz, den ich derzeit bei der Leistungsbewertung meines Jahrgangs einnahm – eine Zahl, die mich seither ständig verfolgte. Ich drehte den Schlüssel im Zündschloss und wartete darauf, dass der Motor bei dieser Hitze ansprang. Es waren über 30 Grad. Ich fischte eine Pflaume aus der Tüte, drückte sie leicht und biss hinein. Die Haut war dick, aber das Fleisch darunter zart. Ich ließ den Saft mein Kinn hinunterlaufen.
Es war 8 Uhr 30. Samstagmorgen. Ich musste nirgendwohin, hatte nichts zu erledigen. Am Montagmorgen würde ich wieder in die Arbeitsrechtskanzlei Laird, Griffin & Griffin gehen, wo ich gerade ein Praktikum machte, doch bis dahin erwartete mich niemand. Die Rezeptionistin und der Teilhaber der Kanzlei, der mich eingestellt hatte, waren bei LG&G die Einzigen, die von meiner Existenz wussten. Am Mittwoch war der 4. Juli. Das bedeutete, dass mich mitten in der Woche ein weiterer erstickend leerer Tag erwartete. Ich würde mir irgendein Selbsthilfetreffen suchen und hoffen, dass jemand anschließend Lust auf einen Kaffee hatte. Vielleicht fand ich eine andere einsame Seele, die einen Film ansehen oder etwas essen gehen wollte. Der Motor sprang an, und ich fuhr ruckartig los.
Wieso schießt mir nicht einfach jemand in den Kopf?
Unter seiner finsteren Oberfläche war das ein beruhigender Gedanke. Wenn ich sterbe, muss ich mich nicht darum kümmern, die kommenden 48 Stunden dieses Wochenendes zu füllen, und auch nicht den Feiertag am Mittwoch oder die Woche danach. Die mir bevorstehenden Stunden erdrückend schwerer Einsamkeit blieben mir erspart. Stunden, die zu Tagen, Monaten, Jahren wurden. Ein ganzes Leben, in dem es nichts gab außer mir, einer Tüte Äpfel und der fadenscheinigen Hoffnung, dass irgendeinem Nachzügler nach einem Selbsthilfetreffen noch nach Gesellschaft zumute war.
Ich erinnerte mich daran, dass kürzlich in den Nachrichten von einer Schießerei in Cabrini Green berichtete wurde, Chicagos berüchtigtem Sozialbauprojekt. Ich fuhr Richtung Süden auf die Clybourn Avenue und bog nach links auf die Division Street ab. Vielleicht würde mich ja eine verirrte Kugel treffen.
Wieso erschießt mich nicht einfach jemand?
Ich wiederholte diese Frage immer und immer wieder, wie ein Mantra. Ein Gebet, das vermutlich nicht erhört werden würde, denn ich war eine 26-jährige weiße Frau, die an einem strahlenden Sommermorgen in einem zehn Jahre alten Honda Accord herumfuhr. Wer sollte mich erschießen? Ich hatte keine Feinde, ich existierte ja kaum. Dieser Traum baute zu sehr auf Zufall – Glück oder Unglück, je nachdem, wie man es betrachten wollte –, und ich konnte nicht verhindern, dass ich mir weitere Szenarien ausmalte. Aus einem hohen Fenster springen. Mich vor eine U-Bahn werfen. Ich hielt an und malte mir immer exotischere Arten des Abtretens aus. Mich während des Masturbierens erhängen. Aber wem will ich etwas vormachen? Dafür wäre ich viel zu verklemmt.
Ich pulte den Stein aus der Pflaume und schob mir den Rest der Frucht in den Mund. Wollte ich wirklich sterben? Wohin würden mich diese Gedanken treiben? Waren es wirklich Selbstmordgedanken? Depressionen? Würde ich sie in die Tat umsetzen? Sollte ich es tun? Ich ließ das Fenster herunter und warf den Stein hinaus, so weit ich konnte.
In meiner Bewerbung fürs Jurastudium hatte ich geschrieben, dass ich davon träumte, mich für Frauen mit nichtnormativen (fetten) Körpern einzusetzen. Aber das stimmte nur teilweise. Mein Interesse an feministischer Anwaltschaft war aufrichtig, aber es war nicht meine ausschlaggebende Motivation. Es waren auch nicht die aufgeblasenen Gehaltsschecks oder einschüchternden Hosenanzüge. Nein, ich wollte Jura studieren, weil Anwälte 60 bis 70 Stunden pro Woche arbeiteten. Anwälte laden selbst im Weihnachtsurlaub zu Telefonkonferenzen und verbringen den Labor Day in Konferenzräumen. Anwälte essen ihr Abendessen am Schreibtisch, umgeben von Kollegen mit hochgekrempelten Hemdsärmeln und Schweißflecken unter den Achseln. Anwälte können mit ihrem Job verheiratet sein – einem Job, der so wichtig ist, dass es sie nicht kümmert oder sie nicht merken, dass ihr Privatleben so leer ist wie ein Supermarktparkplatz um Mitternacht. Das Anwaltsdasein war ein gesellschaftlich akzeptierter Deckmantel für mein trostloses Privatleben.
Meinen ersten Zulassungstest für das Jurastudium machte ich an dem Schreibtisch, an dem ich einen Job als Sekretärin ausübte, der mich nirgendwohin führen würde. Ich hatte einen Masterabschluss, den ich nicht nutzte, und einen Freund, mit dem ich nicht schlief. Jahre später würde ich Peter einen arbeitssüchtigen Alkoholiker nennen, aber zu dieser Zeit nannte ich ihn die Liebe meines Lebens. Abends um halb zehn, bevor ich ins Bett ging, rief ich regelmäßig bei ihm im Büro an und warf ihm vor, dass er nie Zeit für mich hatte. »Ich muss arbeiten«, sagte er meist und legte auf. Wenn ich noch einmal anrief, ging er nicht mehr ran. An den Wochenenden zogen wir in Wicker Park von Bar zu Bar, damit er lokale Biere trinken und über den künstlerischen Wert früher R.E.M.-Alben philosophieren konnte. Ich hoffte, dass er am Ende des Abends noch nüchtern genug für Sex sein würde, was allerdings nur selten der Fall war. Letztlich kam ich zu dem Schluss, dass ich etwas brauchte, was so vereinnahmend war, dass es all die Energie aufsog, die ich bisher in meine erbärmliche Beziehung gesteckt hatte. Eine junge Frau, die auf meinem Stockwerk wohnte, erzählte mir, dass sie ab Herbst die juristische Fakultät besuchen wollte.
»Kann ich mir eines deiner Übungsbücher für die Aufnahmeprüfung ausleihen?«, fragte ich sie. Ich las die erste Aufgabe:
Eine Professorin muss an einem Tag sieben Studenten in sieben durchnummerierten, aufeinander folgenden Zeitslots einplanen.
Es folgte eine Reihe von Bedingungen: Mary und Oliver müssen direkt nacheinander eingeplant werden und Sheldon muss nach Uriah eingeplant werden. Für die Beantwortung von sechs Multiple- Choice-Fragen über die Professorin und ihren kniffligen Zeitplan beraumte die Prüfungsanweisung 35 Minuten ein. Ich brauchte beinahe eine Stunde. Und die Hälfte meiner Antworten war falsch.
Trotzdem fiel es mir leichter, mich durch die Vorbereitung für den Zulassungstext und das anschließende Studium zu plagen, als eine Lösung für meine Geschichte mit Peter zu finden. Ich hatte keine Ahnung, was mich dazu gebracht hatte, mich in ihn zu verlieben und mir dazu noch Abend für Abend die gleichen Streitereien anzutun.
An der Uni würde ich endlich dazugehören und das gleiche Ziel verfolgen wie alle anderen.
***
Damals, in meinem ersten Jahr auf der Highschool in Texas, die eine reine Mädchenschule war, belegte ich einen Töpferkurs als Wahlfach. Wir begannen mit handgeformten Schüsseln und arbeiteten uns nach und nach bis an die Töpferscheibe vor. Als wir unterschiedliche Gefäße formen konnten, zeigte unsere Lehrerin uns, wie man Henkel anbrachte. Wenn man zwei Tonteile zusammenfügen wollte – etwa einen Henkel an eine Tasse anbringen –, musste man zunächst die Oberfläche beider Teile anrauen. Das Einkratzen von horizontalen und vertikalen Kerben in den Ton sorgte dafür, dass die beiden Teile im Brennofen verschmolzen. Ich saß auf meinem Hocker und hielt meine plump geformte »Tasse« in der einen Hand und einen c-förmigen Henkel in der anderen, als die Lehrerin zeigte, wie man das Einkerben macht. Aber ich wollte die glatte Oberfläche meiner liebevoll geformten Tasse nicht ruinieren, also drückte ich den Henkel an, ohne den Ton vorher einzukerben. Einige Tage später wurden unsere gebrannten, glänzenden Werke auf einem Regal an der hinteren Wand des Werkraums ausgestellt. Meine Tasse hatte überlebt, aber der Henkel lag in bröckeligen Stücken daneben. »Zu wenig eingekerbt«, sagte die Lehrerin, als sie mein enttäuschtes Gesicht sah.
Genau so hatte ich mir auch die Oberfläche meines Herzens vorgestellt – glatt, glitschig und leer. Nichts, woran man sich festhalten konnte. Keine Kerben. Sobald die gnadenlose Hitze des Lebens auf mich niedergebrannt war, konnte sich niemand mehr an mich binden. Ich vermute, die Metapher ging sogar noch weiter. Ich hatte Angst davor, mein Herz zu ruinieren mit den Kerben, die unweigerlich entstanden, wenn man sich mit den Bedürfnissen, Forderungen, Belanglosigkeiten und Vorlieben anderer Menschen auseinandersetzte und sich den täglichen Verhandlungen darüber stellte, die eine Beziehung ausmachten. Bindung funktionierte nicht ohne Kratzer, aber mein Herz hatte keine Furchen.
***
Ich bin keineswegs eine Waise, auch wenn dieser Text bisher vielleicht diesen Eindruck vermittelt hat. Meine Eltern sind immer noch glücklich verheiratet und leben noch immer in demselben roten Backsteinhaus in Texas, in dem ich aufgewachsen bin. Wenn man an der 6644 Thackeray Avenue vorbeifährt, sieht man einen abgegriffenen Basketballkorb und eine mit drei Flaggen behangene Veranda: Old Glory, die Flagge der Vereinigten Staaten, die texanische Flagge sowie eine kastanienbraune mit dem Logo der Texas A&M University. Die Texas A&M war die Alma Mater meines Vaters. Und die meine.
Meine Eltern riefen mehrmals im Monat an, um zu hören, wie es mir ging, meist sonntags nach dem Gottesdienst. Jedes Weihnachten fuhr ich nach Hause. Als ich nach Chicago zog, kauften sie mir einen riesigen grünen Wintermantel. Meine Mutter schickte mir 50-Dollar-Schecks als Taschengeld, und mein Vater diagnostizierte über das Telefon Probleme mit den Bremsen meines Hondas.
Meine jüngere Schwester schloss gerade das Masterstudium ab und würde sich demnächst mit ihrem Langzeitfreund verloben. Mein Bruder und seine Frau, die schon seit Schulzeiten ein Paar waren, lebten in Atlanta inmitten von Dutzenden Collegefreunden. Niemand von ihnen ahnte etwas von meinem Herzen ohne Kerben. Für sie war ich die schrullige Tochter und Schwester, die die Demokraten wählte, Gedichte mochte und sich nördlich der Mason-Dixon-Linie niedergelassen hatte. Sie liebten mich, aber ich passte nicht wirklich zu ihnen und zu Texas.
In meiner Kindheit spielte meine Mutter häufig die Hymne der Aggies, des Footballteams der Texas A&M, und mein Vater sang aus voller Kehle mit. Hullaballoo-canek-canek, Hullaballoo-canek-canek. Vor meinem Schulabschluss führte mein Vater mich auf dem Campus herum, und als ich mich schließlich für die Texas A&M University entschied, war er ganz aus dem Häuschen. Endlich ein weiterer Aggie in der Familie! Er sprach es zwar nie aus, aber ich bin mir sicher, dass er enttäuscht war, als er erfuhr, dass ich in der Bibliothek saß und Textstellen markierte, während bei den Footballspielen 20 000 Fans so laut sangen, stampften und jubelten, dass die Wände der Bibliothek vibrierten. Es schien so, als liebte jeder in meiner Familie und ganz Texas Football.
Ich war eine Außenseiterin. Das war das große Geheimnis, das ich mit mir herumtrug: Ich gehörte nicht dazu. Nirgendwo. Den halben Tag verbrachte ich damit, mir Gedanken über Essen und meinen Körper zu machen und beides auf verschiedene Arten zu kontrollieren. Die restliche Zeit versuchte ich, durch schulische Leistungen meine Einsamkeit zu verdrängen. Weil ich mich sieben Tage die Woche damit beschäftigte, Gesetzestheorien zu büffeln, sprang ich von der Bestenliste der Highschool direkt auf die Bestenliste des Colleges, wo ich die meisten Semester mit voller Punktzahl abschloss. Ich träumte davon, eines Tages unangekündigt vor dem Haus meiner Eltern aufzutauchen – mit meinem Traumgewicht, Arm in Arm mit einem psychisch stabilen Mann. Ich wäre stolz wie Bolle.
Als sich meine beunruhigenden Todessehnsüchte langsam bemerkbar machten, dachte ich nicht daran, meiner Familie davon zu erzählen. Wir konnten über das Wetter reden, den Honda und die Aggies. Meine geheimen Ängste und Fantasien passten in keine dieser Kategorien.
Ich sehnte mich zwar passiv nach dem Tod, doch ich legte mir keinen Tablettenvorrat an und abonnierte auch nicht den Newsletter der Hemlock Society, die für das Recht auf assistierten Selbstmord kämpfte. Ich recherchierte nicht, wie ich an eine Waffe kommen oder aus einem meiner Gürtel eine Schlinge binden könnte. Ich hatte keinen Plan im Kopf, keine Methode, kein Datum. Aber ich spürte dieses Unbehagen, es pulsierte ständig im Hintergrund wie ein schmerzender Zahn. Dieser passive Wunsch, dass mich der Tod holt, fühlte sich nicht normal an. Irgendetwas an meinem Leben sorgte dafür, dass ich mich nach seinem Ende sehnte.
Ich erinnere mich nicht, welche Wörter ich genau im Kopf hatte, wenn ich an mein Unwohlsein dachte. Ich weiß, dass ich ein Verlangen spürte, das ich nicht in Worte fassen und dem ich auch nicht nachkommen konnte. Manchmal redete ich mir selbst ein, dass ich mich nur nach einer Beziehung sehnte oder Angst hatte, allein zu sterben. Beide Aspekte stimmten zwar, aber sie waren nicht der Kern meiner Verzweiflung.
In meinem Tagebuch umschrieb ich mein Unbehagen und meinen Schmerz nur vage: Ich habe Angst und mache mir Sorgen um mich selbst. Es macht mir Angst, dass es mir nicht gutgeht, dass es mir nie wieder gutgehen könnte, dass ich verdammt bin. Ich zu sein fühlt sich sehr unangenehm an. Was stimmt nicht mit mir? Damals wusste ich nicht, dass es ein Wort gab, das mein Leiden genau beschrieb: Ich war einsam.
Auf diesem Zettel der Stipendienverwaltung, der meinen Jahrgangsrang angab, stand übrigens die Nummer Eins. Uno. Primero. First. Alle anderen 170 Studenten meines Jahrgangs hatten einen schlechteren Schnitt als ich. Ich hatte mein Ziel, in der oberen Hälfte zu landen, übertroffen. Und angesichts meiner nicht einmal mittelprächtigen Leistung beim Zulassungstest – ich hatte niemals herausgefunden, an welcher Stelle die Professorin Uriah hätte einplanen sollen – hatte schon dieses Ziel ambitioniert gewirkt. Ich hätte also wirklich begeistert sein müssen. Ich hätte direkt eine Kreditkarte ohne Dispolimit beantragen können. Mir High Heels von Louboutin kaufen. Ein neues Apartment in Gold Coast mieten. Doch stattdessen war ich Jahrgangsbeste und neidisch auf den Sänger von INXS, der an autoerotischer Strangulation gestorben war.
Was zum Teufel war los mit mir? Ich trug Hosen in Größe 34, BHs mit D-Körbchen und konnte mir von meinem Studienkredit ein Apartment in einem aufstrebenden Viertel im Norden Chicagos leisten. Seit acht Jahren machte ich bei einem Zwölf-Schritte-Therapieprogramm mit, wo ich gelernt hatte zu essen, ohne mir eine halbe Stunde später die Finger in den Hals zu stecken. Meine Zukunft lag so glänzend vor mir wie das polierte Silber meiner Großmutter. Ich hatte allen Grund dazu, optimistisch zu sein. Doch jede Zelle meines Körpers war angewidert davon, wie sehr ich in diesem Zustand feststeckte – ich hatte keine Verbindung zu anderen Menschen, war meilenweit entfernt von einer romantischen Beziehung. Und es gab einen Grund dafür, warum ich mich so abseits und so einsam fühlte, warum mein Herz so aalglatt war. Ich wusste nicht genau, was es war, doch ich spürte, wie es in mir arbeitete, wenn ich einschlief und mir wünschte, nicht mehr aufzuwachen.
Ich war bereits in einem Zwölf-Schritte-Programm. Gemeinsam mit der mir zugeteilten Sponsorin, die in Texas lebte, hatte ich im vierten Schritt eine gründliche Bestandsaufnahme meines Lebens gemacht und bei den Menschen, die ich verletzt hatte, Wiedergutmachung geleistet. Mit einem 100-Dollar-Scheck in der Tasche war ich zur Ursuline Academy, meiner Highschool, gefahren, um zurückzuzahlen, was ich bei der Verwaltung der Parkplatzgebühren in meinem ersten Schuljahr dort gestohlen hatte. Das Zwölf-Schritte-Programm hatte den schlimmsten Seiten meiner Essstörung Einhalt geboten, und ich schrieb ihm zu, dadurch mein Leben gerettet zu haben. Warum wünschte ich mir dann nun, nicht mehr zu leben? Ich beichtete meiner Sponsorin, dass ich düstere Gedanken hatte.
»Ich wünsche mir jeden Tag den Tod.«
Sie sagte, ich solle besser doppelt so häufig zu Selbsthilfetreffen gehen wie bisher.
Ich verdreifachte die Häufigkeit und fühlte mich so einsam wie nie zuvor.
2
Einige Tage nachdem ich erfahren hatte, welchen Platz ich im Jahrgangsrang meiner Uni einnahm, lud mich eine Frau namens Marnie nach einem Zwölf-Schritte-Treffen zum Abendessen ein. Auch sie war ehemalige Bulimikerin. Doch anders als ich hatte sie ihr Leben komplett im Griff: Sie war nur ein paar Jahre älter als ich, arbeitete in einem Labor und forschte an innovativen Behandlungsmethoden bei Brustkrebs. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hatte sie den Eingangsbereich ihres Kolonialstilhauses in sündhaft teurem Orange gestrichen. Sie wusste genau, wann ihr Eisprung war. Ihr Leben war nicht perfekt – ihre Ehe oft turbulent –, aber sie versuchte, das zu bekommen, was sie wollte.
Aus Reflex wollte ich ihre Einladung zum Abendessen ablehnen, damit ich nach Hause gehen, meinen BH ausziehen und meine 120 Gramm Truthahnbrust und geschmorte Karotten essen konnte, während ich mir die Sitcom Scrubs anschaute. Wenn mich Leute nach dem Treffen zum Kaffee oder Essen einluden – »Kameradschaft«, wie sie es nannten –, lehnte ich normalerweise ab. Doch bevor ich ablehnen konnte, berührte Marnie mich am Ellbogen. »Komm schon. Pat ist unterwegs, und ich will nicht allein essen.«
Wir saßen uns gegenüber in einem dieser »gesunden« Restaurants, wo Brot mit Keimlingen und Süßkartoffelpommes serviert wurden. Marnie wirkte ungewöhnlich beschwingt. Trug sie Lipgloss?
»Du wirkst glücklich«, sagte ich.
»Das liegt an meinem neuen Therapeuten«, antwortete sie.
Konnte mir vielleicht auch ein Therapeut helfen? Ich ließ ein wenig Hoffnung in mir aufflackern. Der Sommer vor Beginn des Jurastudiums. Dank der freundlichen Unterstützung eines Mitarbeiterförderprogramms konnte ich acht kostenlose Sitzungen mit einem Sozialarbeiter in Anspruch nehmen. Ich wurde einer sanftmütigen Frau namens June zugeteilt, deren Kleidungsstil mehr als fragwürdig war. Aus Angst, es könnte sie zu sehr mitnehmen, offenbarte ich ihr keines meiner Geheimnisse. Therapie schien mir wie eine enge Bindung zu anderen Menschen. Das war etwas, an dem ich nur als Zuschauerin teilhaben konnte, das Gesicht an die Scheibe gepresst.
»Ich bin in einer Gruppe nur für Frauen.«
»In einer Gruppe?« Mein Nacken spannte sich augenblicklich an. Seit einer schlechten Erfahrung in der fünften Klasse misstraute ich jeder Form von Gruppen. Nachdem die Klassen an meiner kleinen katholischen Schule immer weiter geschrumpft waren, hatten mich meine Eltern auf eine öffentliche Schule geschickt. Ich schloss mich den beliebten Mädchen an. Sie wurden von Bianca angeführt, die in jeder Mittagspause Süßigkeiten verteilte und eine Kette mit massiven Goldkugeln um den Hals trug. Einmal übernachtete ich bei Bianca, und ihre Mutter fuhr uns in ihrem silbernen Mercedes ins Kino, damit wir Footloose sehen konnten. Doch in der Mitte des Schuljahrs wendete Bianca sich gegen mich. Sie dachte, ihr Freund würde mich mögen, weil wir in Geschichte nebeneinandersaßen. Eines Tages bot sie in der Mittagspause jedem am Tisch einen Kaubonbon an, nur mir nicht. Mir steckte sie einen Zettel zu: Wir wollen dich nicht an unserem Tisch. Alle Mädchen hatten unterschrieben. Spätestens da wusste ich, dass etwas nicht stimmte zwischen mir und anderen Menschen. Ich spürte, dass ich einfach nicht wusste, wie man eine Verbindung hielt, ohne irgendwann beiseitegeschoben zu werden. Die Zwölf-Schritte-Gruppen ertrug ich nur, weil die Besetzung bei jedem Treffen wechselte. Man konnte kommen und gehen, wie man wollte, und niemand kannte deinen Nachnamen. Bei einem Zwölf-Schritte-Treffen gab es keinen Anführer – keine Bianca, die andere ausbooten konnte. Eine Reihe spiritueller Prinzipien hielt eine Zwölf-Schritte-Gruppe zusammen: Anonymität, Demut, Integrität, Einigkeit, Gegenleistung. Ohne diese Prinzipien wäre ich niemals geblieben. Dazu kam, dass die Teilnahme quasi kostenlos war, obwohl sie eine Spende in Höhe von zwei Dollar empfahlen. Zum Preis einer Cola light konnte ich mir 60 Minuten lang meine Essstörung eingestehen und mir die Ernährungsqualen und -triumphe anderer Leute anhören.
Ich spießte ein Stück Tomate auf und überlegte, welchen interessanten Gesprächsthemen ich mich mit Marnie noch widmen könnte – der Hinrichtung des Oklahoma City Bombers oder der Frage, was auch immer Colin Powell gerade trieb. Ich verspürte das Bedürfnis, sie mit meinem Wissen über aktuelle Geschehnisse zu beeindrucken, um selbst so zu wirken, als hätte ich mein Leben im Griff. Aber eigentlich wollte ich mehr über ihre Therapiegruppe erfahren. Möglichst beiläufig fragte ich, wie es so war.
»Wir sind nur Frauen. Mary ist fast taub, und Zenia verliert demnächst ihre ärztliche Zulassung wegen eines vermeintlichen Krankenkassenbetrugs. Emilys Vater ist drogenabhängig – er drangsaliert sie mit Hassmails aus seinem Einzimmerapartment in Wichita.« Marnie hob ihren Arm und zeigte auf die weiche, fleischige Innenseite ihres Unterarms. »Unsere Neue ist eine Ritzerin. Trägt immer lange Ärmel. Ihre Geschichte kennen wir noch nicht, aber sie ist sicherlich ziemlich düster.«
»Klingt heftig.« So hatte ich es mir tatsächlich nicht vorgestellt. »Darfst du mir das alles erzählen?«
Sie nickte. »Der Therapeut hat die Theorie, dass jedes Geheimnis toxisch ist. Also dürfen wir Gruppenmitglieder über alles sprechen, überall. Der Therapeut ist an die ärztliche Verschwiegenheitspflicht gebunden, aber wir sind es nicht.«
Keine Vertraulichkeit? Ich lehnte mich zurück und schüttelte den Kopf. Unter dem Tisch wickelte ich die Serviette um mein Handgelenk. Das könnte ich nicht. In der Highschool hatte ich gegenüber meiner Gemeinschaftskundelehrerin, Miss Gray, einmal angedeutet, dass etwas mit meinem Essverhalten nicht stimmte. Als Miss Gray meine Eltern anrief und eine Beratung empfahl, wurde meine Mutter fuchsteufelswild. Ich verputzte gerade einen ganzen Teller Kekse und sah mir Will Smith im Interview mit Oprah Winfrey an, als meine Mutter wie von der Tarantel gestochen ins Wohnzimmer gestürmt kam. »Warum erzählst du den Leuten so etwas? Du musst dich selbst schützen!« Meine Mutter ist eine richtige Südstaatlerin; sie ist in den 1950ern in Baton Rouge aufgewachsen. Vor anderen etwas Persönliches preiszugeben, galt ihr als stillos und konnte unschöne soziale Konsequenzen haben. Sie war überzeugt, ich würde geächtet werden, falls andere Leute von meinen psychischen Problemen erfuhren, und sie wollte mich beschützen. Als ich während des College das erste Mal ein Zwölf-Schritte-Treffen besuchte, musste ich also all meinen Mut zusammennehmen und all mein Vertrauen in die Hoffnung setzen, dass die anderen die Sache mit der Anonymität genauso ernst nahmen wie ich.
»Und wie soll es da irgendjemandem besser gehen?«, fragte ich. Marnie ging es offensichtlich besser als mir. Wären wir in einer Tamponwerbung, wäre ich diejenige, die über Gerüche und Auslaufen klagte, und sie diejenige, die am stärksten Tag ihrer Periode in weißen Jeans Ballettsprünge übte.
Sie zuckte mit den Schultern. »Du könntest es dir mal ansehen.«
Ich war schon in anderen Therapien. Während der Highschool hatte ich ein kurzes Intermezzo mit einer Frau, die aussah wie Paula Dean und pastellfarbene Hosenanzüge trug. Meine Eltern schickten mich zu ihr, nachdem Miss Gray wegen meines Essverhaltens angerufen hatte, aber ich war so konzentriert darauf, mich selbst zu schützen – wie es mir aufgetragen worden war –, dass ich nie mit ihr darüber sprach, wie ich mich fühlte. Stattdessen plauderten wir darüber, in welchem Klamottenladen ich während der Sommerferien jobben sollte. Einmal gab sie mir einen psychologischen Test mit 500 Fragen mit nach Hause. Als ich ihn ausfüllte, keimte die Hoffnung in mir auf, dass ich nun endlich herausfinden würde, warum ich nicht aufhören konnte zu essen. Warum ich mich überall wie eine Außenseiterin fühlte, und warum sich keiner der Jungs für mich interessierte, während all die anderen Mädchen geküsst und begrapscht wurden.
Paula D. verlas die Ergebnisse in ihrer perfekt modulierten Therapeutenstimme: »›Christie ist perfektionistisch und hat Angst vor Schlangen. Der ideale Beruf für sie wäre Uhrmacher oder Chirurg.‹« Sie lächelte und neigte den Kopf zur Seite. »Schlangen sind ganz schön gruselig, nicht?«
Es kam mir nie in den Sinn, ihr meine Tränen und Ängste zu offenbaren. Um mich zu öffnen, brauchte ich einen Therapeuten, der in meinem Schweigen den Widerhall des Schmerzes hörte, der unter meinen Verleugnungen den Hemdzipfel der Wahrheit entdeckte. Paula D. tat das nicht. Nach dieser Sitzung setzte ich mich mit meinen Eltern zusammen und erzählte ihnen, dass die Therapie nun abgeschlossen sei. Alles sei jetzt besser. Meine Eltern strahlten vor Stolz, und meine Mutter teilte ihre Lebensphilosophie mit mir: »Glücklich zu sein, ist einfach eine Entscheidung. Konzentriere dich auf das Positive und verschwende keine Energie an negative Gedanken.« Ich nickte. Tolle Idee. Auf dem Weg zu meinem Zimmer bog ich ins Bad ab und erbrach mein Abendessen – eine Angewohnheit, die ich entwickelt hatte, nachdem ich ein Buch über eine Turnerin gelesen hatte, die alle ihre Mahlzeiten erbrach. Ich liebte das Gefühl, mich des Essens zu entledigen, und den Adrenalinstoß dieses Geheimnisses. Mit 16 dachte ich, Bulimie sei eine geniale Lösung, um die nicht enden wollenden Wellen von Angst, Einsamkeit, Wut und Trauer zu bewältigen. Ich wusste nicht, wie ich sie sonst loswerden sollte.
Marnie zog noch eine Pommes durch den Ketchuprest auf ihrem Teller. »Dr. Rosen würde dich treffen …«
»Rosen? Jonathan Rosen?«
Dr. Rosen konnte ich definitiv nicht anrufen. Blake ging zu Dr. Rosen.
Ich hatte Blake im Sommer vor dem Jurastudium auf einer Party kennengelernt. Er hatte sich neben mich gesetzt und gefragt: »Welche Art Essstörung hast du?« Er hatte auf den Karottenstreifen auf meinem Teller gezeigt. »Schau mich nicht so an. Ich war mit einer Magersüchtigen zusammen, und mit zwei Bulimikerinnen, die gerne magersüchtig gewesen wären. Ich erkenne solche Menschen wie dich.«
Er war bei den Anonymen Alkoholikern, hatte gerade keinen Job und lud mich ein, mit ihm segeln zu gehen. Wir fuhren am 4. Juli mit dem Rad ans Seeufer, um uns das Feuerwerk anzusehen. Wir lagen auf dem Deck seines Boots, Schulter an Schulter, starrten auf die Skyline von Chicago und sprachen über den Prozess des Gesundwerdens. Wir probierten das vegane Essen im Chicago Diner und gingen samstagnachmittags vor seinem Treffen der Anonymen Alkoholiker ins Kino. Als ich ihn fragte, ob wir nun zusammen wären, antwortete er nicht. Manchmal verschwand er für ein paar Tage, um in seiner abgedunkelten Wohnung Johnny-Cash-Alben zu hören. Selbst wenn ich kein Problem damit haben sollte, Marnies Therapeuten zu treffen, konnte ich auf keinen Fall zu demselben Therapeuten gehen wie mein Ex oder was auch immer Blake war. Sollte ich Dr. Rosen etwa anrufen und sagen: »Erinnern Sie sich an das Mädchen, das mit Blake Analsex hatte, um seine Depression zu heilen? Nun, das war ich! Hier ist meine Versicherungskarte.«
»Wie viel kostet diese Therapie?« Es konnte nicht schaden, das zu fragen, auch wenn ich keineswegs vorhatte, einer Gruppentherapie beizutreten.
»Es ist superbillig – nur 70 Dollar pro Woche.«
»Puh.« Ich atmete hörbar aus. 70 Dollar waren Kleingeld für Marnie, die ein Labor an der Northwestern University leitete und deren Ehemann ein kleines Vermögen geerbt hatte. Wenn ich an Lebensmitteln sparte und mit dem Bus anstelle des Autos fuhr, hätte ich vielleicht am Ende des Monats 70 Dollar übrig. Aber jede Woche? Bei meinem Praktikum verdiente ich 15 Dollar die Stunde, und meine Eltern, die sagen würden, ich solle doch einfach glücklich sein, konnte ich nicht fragen. In zwei Jahren würde ich ein festes Einkommen haben, aber woher sollte das Geld jetzt, während meines Studiums, kommen?
Marnie diktierte mir Dr. Rosens Telefonnummer, aber ich schrieb sie nicht auf.
Doch dann sagte sie noch etwas.
»Er hat gerade neu geheiratet – er lächelt die ganze Zeit.«
Sofort stellte ich mir Dr. Rosens Herz vor: ein rotes Papierherz, wie man sie in der Schule für den Valentinstag ausschneidet, mit Linien, die sich wie kahle Zweige über die Oberfläche zogen.
Ich hatte Dr. Rosen nie getroffen, doch nun malte ich mir eine zermürbende Scheidung aus, einsame Nächte in einer Einzimmerwohnung zur Zwischenmiete, zum Abendessen Tiefkühlgerichte aus der Mikrowelle, aber dann die Wende: eine zweite Chance auf die Liebe mit einer neuen Frau. In der Brust eines lächelnden Therapeuten schlug ein angekratztes Herz. Mein Inneres füllte sich mit Neugier und der kleinen, flackernden Hoffnung, dass er mir helfen konnte.
Als ich nachts im Bett lag, dachte ich an die Frauen in Marnies Gruppe: die vermeintliche Ritzerin, die Kriminelle, die Tochter des Drogenabhängigen. Ich dachte an Blake, der zu den Männern in seiner Gruppe enge Beziehungen aufgebaut hatte. Nach den Sitzungen waren die Geschichten geradezu aus ihm herausgeprudelt – von Ezra, dessen Freundin eine aufblasbare Puppe war, und von Todd, dessen Frau all seine Besitztümer auf dem Bürgersteig abgeladen hatte, als sie die Scheidung wollte. War ich wirklich schlechter dran als diese Typen? War mein Leiden, was auch immer es war, so unmöglich zu heilen? Einem Psychiater hatte ich noch nie eine Chance gegeben. Aber Psychiater hatten einen medizinischen Abschluss – vielleicht bedurfte ich, was auch immer mit mir nicht stimmte, der Behandlung durch jemanden, der während seiner Ausbildung ein menschliches Herz seziert hatte. Vielleicht würde Dr. Rosen einen Rat für mich haben. Einen, den er in einer oder zwei Sitzungen weitergeben konnte. Vielleicht konnte er mir irgendeine Pille verschreiben, die meine Verzweiflung etwas mildern und mein Herz etwas verletzlicher machen würde.
3
Zwei Stunden nach meinem Essen mit Marnie suchte ich Dr. Rosens Nummer im Telefonbuch heraus und hinterließ eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter. Er rief mich am nächsten Tag zurück. Unser Gespräch dauerte keine drei Minuten. Ich fragte nach einem Termin, er schlug einen vor, ich sagte zu. Als ich auflegte, stand ich am ganzen Körper zitternd im Büro. Zweimal setzte ich mich hin, um weiterzuarbeiten, und sprang nach 30 Sekunden wieder auf, um hin und her zu laufen. Mein Verstand sagte mir, dass es keine große Sache war, einen Arzttermin zu vereinbaren, aber das Adrenalin, das durch meine Adern jagte, hinterließ einen anderen Eindruck. An diesem Abend notierte ich: Ich legte auf & brach in Tränen aus. Ich hatte das Gefühl, das Falsche gesagt zu haben & er mag mich nicht & ich fühle mich ausgeliefert und verletzlich. Es war mir egal, ob er mir helfen würde. Mir war wichtig, ob er mich leiden konnte.
Das Wartezimmer enthielt das übliche nichtssagende Inventar einer Arztpraxis: eine weiße Lilie, eine große Schwarz-Weiß-Fotografie eines Mannes, der die Arme ausbreitet und sein Gesicht der Sonne entgegenstreckt. Im Bücherregal standen Titel wie Die Sucht, gebraucht zu werden und Zerstörte Liebeskarten sowie ein Dutzend Flyer der Anonymen Alkoholiker. Neben der Tür, die weiter in die Praxis hineinführte, waren zwei Klingeln. Auf einer stand »Gruppe«, auf der anderen »Dr. Rosen«. Ich drückte auf den Knopf für Dr. Rosen, um mich bemerkbar zu machen, und setzte mich auf einen der Stühle an der gegenüberliegenden Wand. Um meine Nerven zu beruhigen, griff ich nach einem National Geographic-Heft und sah mir Fotos eines majestätischen Polarwolfs an, der über eine baumlose Ebene galoppierte. Am Telefon hatte Dr. Rosen ernst geklungen. Aus seiner Art zu sprechen hatte ich einen leichten Ostküsteneinschlag herausgehört. Ich hatte eine Würde herausgehört, ohne Lächeln. Einen strengen, humorlosen Priester. Ein Teil von mir hatte gehofft, er wäre für die nächsten Wochen oder gar Monate ausgebucht, aber der Termin, den er mir anbot, war schon zwei Tage später.
Um exakt 13 Uhr 30 ging die Tür des Wartezimmers auf. Ein schmaler Mann mittleren Alters in einem roten Tommy-Hilfiger-Golfhemd, Khakihosen und schwarzen Lederslippern blickte herein. In seinem Gesicht zeichnete sich ein leichtes Lächeln ab – freundlich, aber professionell. Das drahtige, gräuliche Haar war schon schütter, stand aber wild von seinem Kopf ab, ein bisschen wie bei Albert Einstein. Wäre ich ihm auf der Straße begegnet, hätte ich ihn keines zweiten Blickes gewürdigt. Der erste Eindruck sagte mir, dass er zu jung war, um mein Vater zu sein, aber zu alt, um mein sexuelles Interesse zu wecken – in diesem Zusammenhang also das ideale Alter. Ich folgte ihm den Gang hinunter zu einem Büro mit Fenstern zur Nordseite, durch die man das mehrstöckige Gebäude eines alteingesessenen Kaufhauses sehen konnte. Für Patienten gab es gleich mehrere Sitzmöglichkeiten: eine kratzig aussehende Polstercouch, einen Bürostuhl mit aufrechter Lehne und einen übergroßen schwarzen Sessel neben dem Schreibtisch. Eine ganze Sammlung gerahmter Harvard-Urkunden fiel mir ins Auge. Vor Harvard hatte ich Respekt. Ich hatte selbst von einer Ivy-League-Uni geträumt, aber die hohen Kosten und die Zulassungstests hatten mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit diesen Auszeichnungen musste dieser Arzt also absolute Oberklasse sein, Elite, die Crème de la Crème. Doch das hieß auch: Wenn nicht mal er mir helfen konnte, dann wäre ich einfach komplett aufgeschmissen.
Ich nahm Platz und sah mir sein Gesicht genauer an. Mein Herzschlag beschleunigte sich, als ich seine Nase, die Augen und den geradlinigen Mund betrachtete. Ich presste die Lippen aufeinander, als mir plötzlich klar wurde: Ich kannte ihn!
Dieser Dr. Rosen war derselbe Jonathan R., den ich vor drei Jahren bei einer Sitzung für Menschen mit Essstörungen getroffen hatte. Um die Anonymität zu wahren, gaben in Zwölf-Schritte-Treffen alle nur ihren Vornamen und den ersten Buchstaben ihres Nachnamens preis. Gruppentreffen für Leute mit Essstörungen sind wie Treffen der Anonymen Alkoholiker – die Teilnehmer kommen in irgendwelchen Gemeinderäumen zusammen, um darüber zu sprechen, wie Essen ihr Leben bestimmt. Wie unsere berühmteren Brüder von den AA, deren Treffen schon Teil von Fernsehserien und Meg-Ryan-Filmen waren, sammelten auch Esssüchtige Münzen für ihr Durchhaltevermögen und bekamen Sponsoren zugeteilt, die ihnen halfen, ohne Fressanfälle, Abführmittel, Hungern und Selbstverstümmelung zu leben. Anders als bei den Anonymen Alkoholikern waren die meisten Zwölf-Schritte-Treffen, die ich besucht hatte, nur mit Frauen besetzt. In zehn Jahren hatte ich dort nur eine Handvoll Männer gesehen. Einer von ihnen war der in Harvard ausgebildete Psychiater, der nun einen Meter von mir entfernt saß und darauf wartete, dass ich zu sprechen begann.
Ich wusste einiges über die Person Jonathan R. Über den Mann mit der Essstörung. Ich erinnerte mich an Dinge, die er über seine Mutter erzählt hatte, über sein chronisch krankes Kind, über die Gefühle, die er seinem Körper gegenüber verspürte.
Ein Therapeut sollte ein unbeschriebenes Blatt sein. Aber Dr. Rosen war für mich voller Flecken.
Ich drehte mich leicht, sodass er mich frontal ansehen konnte. Würde er mich rausschmeißen, sobald er mich erkannt hatte? Sein Gesichtsausdruck blieb aufgeschlossen, neugierig. Fünf Sekunden vergingen. Er schien mich nicht zu erkennen und wartete weiter darauf, dass ich das Wort ergriff. Nun machte mir die Harvard-Sache Angst. Wie konnte ich gleichzeitig geistreich und leidend wirken, wie Dorothy Parker oder David Letterman? Ich wollte, dass dieser Dr. Rosen meine neuerlichen Sterbefantasien ernst nahm, aber gleichzeitig sollte er mich charmant finden und vielleicht auch ein bisschen sexy. Ich nahm an, wenn er mich attraktiv fände, wäre er noch motivierter, mir zu helfen.
»Ich bin grottenschlecht in Beziehungen, und ich habe Angst davor, allein zu sterben.«
»Was genau meinen Sie damit?«
»Ich kann keine Nähe zu anderen Menschen aufbauen. Etwas hält mich zurück, wie ein unsichtbarer Zaun. Ich spüre, dass ich mich zurücknehme, immer. Und ich stehe ausnahmslos auf den Typ Mann, der trinkt, bis er sich übergibt oder ohnmächtig wird …«
»Alkoholiker.« Keine Frage, sondern eine Feststellung.
»Ja. Meine erste Liebe auf der Highschool rauchte jeden Tag Gras und betrog mich. Auf dem College hatte ich etwas mit einem kolumbianischen Verbindungsstudenten, der alkoholabhängig und vergeben war, und dann datete ich einen, der süchtig nach Marihuana war. Danach kam ein netter Kerl, aber mit dem habe ich Schluss gemacht …«
»Weil?«
»Weil er mich zu meinen Vorlesungen begleitete, mir Ausgaben seiner Lieblingsbücher kaufte und um Erlaubnis fragte, bevor er mich küsste. Da sträuben sich mir die Nackenhaare.«
Dr. Rosen lächelte. »Sie haben Angst vor emotional zugänglichen Männern. Vor Frauen vermutlich auch.« Weitere Feststellungen.
»Gefestigte Typen, die Interesse an mir zeigen, widern mich an. Das gilt wohl auch für Frauen, denke ich.« Vor meinem inneren Auge tauchte eine Szene von letztem Weihnachten auf, als ich meine Familie in Texas besucht und in einem Klamottenladen eine Freundin aus der Highschool getroffen hatte. Als Lia meinen Namen rief, stand ich gerade bei den Blazern und Hemden, und als sie mich herzlich umarmte, erstarrte ich einfach nur. Als sie sich wieder löste, huschte ein verletzter Blick über ihr Gesicht, als wollte sie sagen: Ich dachte, wir wären Freundinnen – und dann fragte sie nach Chicago und meinem Studium. Plaudernd standen wir zwischen all den Leuten, die nach den Feiertagen auf Schnäppchenjagd waren, und in meinem Kopf setzte sich der Gedanke fest, dass Lia eigentlich überhaupt nicht mit mir sprechen wollte. Schließlich war sie nun eine erfolgreiche Physiotherapeutin ohne Essstörung oder das merkwürdige Problem zu verkrampfen, wenn jemand aus ihrer Vergangenheit sie umarmen wollte. Lia und ich waren während der Highschool eng befreundet gewesen, doch in meinem Abschlussjahr hatte ich mich von ihr zurückgezogen, als meine Essstörung immer stärker wurde und ich damit beschäftigt war, meinen ersten Freund davon abzubringen, mich zu betrügen.
»Haben Sie Bulimie?«
»Ich bin in einem Selbsthilfeprogramm … Zwölf Schritte«, antwortete ich schnell, in der Hoffnung, er würde sich nicht daran erinnern, wie ich mich als Christie, genesende Bulimikerin vorgestellt hatte. »Die Schritte helfen mir mit der Bulimie, aber die Sache mit den Beziehungen kriege ich nicht in den Griff …«
»Nicht allein. Wer ist Teil Ihres Unterstützungsumfelds?«
Ich nannte meine Sponsorin Cady, eine Hausfrau und Mutter erwachsener Kinder, die in der gleichen texanischen Kleinstadt lebte, in der ich aufs College gegangen war. Ihr stand ich näher als sonst jemandem – ich rief sie alle drei Tage an, hatte sie aber seit fünf Jahren nicht gesehen. Dann gab es diesen willkürlichen Kreis an Frauen wie Marnie, mit denen ich während und manchmal auch nach den Gruppentreffen sprach. Freundinnen aus dem Studium, die nicht wussten, dass ich in Behandlung war. Freundinnen aus der Highschool- und Collegezeit, die sich Mühe gaben, mit mir in Kontakt zu bleiben, aber die ich nur selten zurückrief und deren Einladungen, sie zu besuchen, ich immer ausschlug.
»Ich habe neuerdings Sterbefantasien.« Ich presste meine Lippen aufeinander. »Seit ich herausgefunden habe, dass ich in meiner Fakultät die Jahrgangsbeste bin …«
»Masel tov, ich gratuliere.« Sein Lächeln schien so aufrichtig, dass ich den Blick abwandte und seine Urkunden betrachtete, um nicht in Tränen auszubrechen.
»Ist ja nicht Harvard oder so.« Er zog die Augenbrauen hoch. »Und was soll’s, dann werde ich eben Karriere machen, und dann? Ansonsten wird es nichts geben …«
»Darum haben Sie sich für Jura entschieden.« Seine selbstsicheren Diagnosen waren entwaffnend und tröstend zugleich. Er war keine Paula D., die Fragen über Schlangen stellte. »Was glauben Sie, wie sind Sie zu dem Menschen geworden, der Sie sind?«, fragte Dr. Rosen.
»In jeder Familie gibt es einen Versager.« Ich hatte keine Ahnung, warum ich das sagte.
»Sie sind Jahrgangsbeste an der juristischen Fakultät und bezeichnen sich als Versagerin?«
»Jahrgangsbeste zu sein, bedeutet einen Scheißdreck, wenn ich allein und einsam sterbe.«
»Was wollen Sie?«, fragte er.
Das Wort wollen wiederholte sich in meinem Kopf. Wollen, wollen, wollen. Ich suchte nach einem Weg, meine Sehnsucht in Worte zu fassen, ohne einfach nur herauszuplappern, dass ich nicht allein sterben wollte.
»Ich will …«, zögerte ich. »Ich möchte gerne …«, wieder hielt ich inne. »Ich will echt sein. Anderen Menschen gegenüber. Ich will ein echter Mensch sein.«
Er sah mich an, als wolle er fragen: Und was noch? Mir kamen noch weitere Wünsche in den Sinn: Ich wollte einen Freund, der nach frisch gewaschener Baumwolle roch und jeden Tag zur Arbeit ging. Ich wollte weniger als 50 Prozent meiner wachen Zeit damit verbringen, über meinen Körper nachzudenken. Ich wollte alle meine Mahlzeiten gemeinsam mit anderen Leuten einnehmen. Ich wollte so viel Freude an Sex haben wie die Frauen in Sex and the City. Ich wollte wieder Ballettstunden nehmen – eine Leidenschaft, die ich aufgegeben hatte, als ich Brüste und fleischige Oberschenkel bekam. Ich wollte Freunde haben, mit denen ich nach dem Staatsexamen in zwei Jahren die Welt bereisen konnte. Ich wollte meine ehemalige Mitbewohnerin aus Collegezeiten wieder kontaktieren, die in Houston lebte. Ich wollte Highschoolfreundinnen umarmen, wenn ich sie zufällig in der Mall traf. Aber ich sagte nichts davon, denn das schien mir alles zu spezifisch. Dumm von mir. Ich wusste noch nicht, dass Therapie, ebenso wie das Schreiben, von Details und Genauigkeit lebt.
Er sagte, er würde mich einer Gruppe zuteilen. Das hätte mich nicht überraschen sollen, aber das Wort Gruppe traf mich trotzdem wie ein Schlag. Eine Gruppe würde aus lauter Menschen bestehen, die mich vielleicht nicht mögen würden, die in meinen Angelegenheiten herumschnüffeln und damit die Anweisung meiner Mutter verletzen würden, meinen seelischen Kummer nicht dem Blick anderer preiszugeben.
»Eine Gruppe kann ich nicht.«
»Warum nicht?«
»Meine Mutter würde ausflippen. All diese Leute, die so viel über mich erfahren …«
»Dann erzählen Sie es ihr nicht.«
»Warum können wir nicht bei Einzelsitzungen bleiben?«
»Eine Gruppentherapie ist der einzige Weg, Sie an Ihr Ziel zu bringen.«
»Ich gebe Ihnen fünf Jahre.«
»Fünf Jahre?«
»Fünf Jahre, um mein Leben zu ändern, und wenn es nicht funktioniert, bin ich raus. Vielleicht bringe ich mich dann um.« Ich wollte dieses Schmunzeln aus seinem Gesicht vertreiben, und ich wollte, dass er wusste, dass ich nicht ewig wiederkommen, mich nicht ewig in die Innenstadt schleppen würde, um mit anderen kaputten Leuten über meine Gefühle zu sprechen. Nur, wenn sich etwas Grundlegendes in meinem Leben änderte. In fünf Jahren werde ich 32 sein. Wenn ich mit 32 immer noch so ein glattes, ungebundenes Herz habe, bringe ich mich um.
Er beugte sich vor. »Sie wollen innerhalb der nächsten fünf Jahre intime Beziehungen in Ihrem Leben?« Ich nickte und nahm den unangenehmen Augenkontakt in Kauf. »Das kriegen wir hin.«
Ich hatte Angst vor Dr. Rosen, aber würde ich den Psychiater mit Harvard-Abschluss hinterfragen?
Seine Eindringlichkeit machte mir Angst – dieses Lachen, die Feststellungen –, doch sie faszinierte mich auch. Was für ein Selbstbewusstsein! Das kriegen wir hin.
Sobald ich der Gruppentherapie zugestimmt hatte, bekam ich Angst, Dr. Rosen könnte etwas Schreckliches zustoßen. Ich stellte mir vor, wie ihn ein Bus der Linie 12 vor dem Starbucks niedermähte. Oder dass bösartige Tumoren seine Lungen durchlöcherten oder sein Körper nach und nach von ALS ausgeschaltet wurde.
»Triffst du Buddha unterwegs, so töte ihn«, sagte Dr. Rosen in unserer zweiten Sitzung, nachdem ich ihm von diesen Ängsten erzählt hatte.
»Sind Sie nicht jüdisch?« Der jüdische Nachname, das Masel tov, die Stickerei mit hebräischen Sprüchen an der Wand gegenüber der Urkunden.
»Dieser alte Zen-Spruch meint, dass Sie dafür beten sollten, dass ich sterbe.«
»Warum sollte ich das tun?«
»Der Spruch bedeutet: Wenn Altes stirbt, dann kommt etwas Besseres«, er lächelte wie ein verrückter Kobold, als glaubte er wirklich, dass alles nur besser werden konnte.
»Ich war mal in einen Unfall verwickelt an einem Strand auf Hawaii. Jemand, mit dem ich dort war, ist ertrunken.« Ich sah, wie sich seine Augen angesichts dieser geplatzten Bombe weiteten, und spürte, wie sich Anspannung in meiner Brust ausbreitete.
»Mein Gott. Wie alt waren Sie?«
»Es geschah drei Wochen vor meinem 14. Geburtstag.« Wie immer, wenn jemand von Hawaii sprach, durchzog meinen Körper eine Welle von Angst. In jenem Sommer lud mich meine Freundin Jenni ein, mit ihrer Familie Urlaub auf Hawaii zu machen. Drei Tage lang erkundeten wir die Hauptinsel – schwarze Sandstrände, Wasserfälle, ein traditionelles Lu’au. Am vierten Tag fuhren wir an einen abgelegenen Strand, und Jennis Vater ertrank in der Brandung. Ich hatte nie gelernt, über dieses Erlebnis zu sprechen. Meine Mutter nannte es »den Unfall«, andere sprachen von »dem Ertrinken«. An dem Abend, als es passiert war, rief Jennis Mutter ihre Verwandten in Dallas an und schluchzte ins Telefon: »David ist tot.« Ich hatte keine Worte für das, was passiert war, oder für die Last der Erinnerung daran, wie ich seinen schlaffen Körper aus dem Meer gezogen hatte. Also sprach ich nicht darüber.
»Möchten Sie noch etwas sagen?«
»Ich bete nicht dafür, dass Sie sterben.«
***
Googelt man Buddha töten, stößt man auf ein Buch von Sheldon B. Kopp mit dem Titel Triffst du Buddha unterwegs … Psychotherapie und Selbsterfahrung. Scheinbar müssen Patienten in Psychotherapie – also Leute wie ich – begreifen, dass auch Therapeuten nichts anderes sind als Menschen mit Problemen. Es war also ein früher Hinweis darauf, dass Dr. Rosen mir keine Antworten liefern würde, dass er vielleicht gar keine hatte. Ich fügte meinen geistigen Bildern von Dr. Rosens schrecklichem Ableben die Vorstellung hinzu, wie ich einen hölzernen Pflock in sein Herz rammte. Das war beunruhigend, nicht nur, weil ich Buddha mit Dracula verwechselt hatte.
Im ersten Jahr auf dem College luden mich ein paar lebensfrohe, beliebte Mädchen aus Austin zu einem Roadtrip nach New Orleans ein. Der Plan war, bei der Cousine eines der Mädchen zu übernachten und im Französischen Viertel zu feiern, bis es an der Zeit war, wieder zurückzufahren. Ich sagte ihnen, ich müsse darüber nachdenken, obwohl ich meine Antwort längst kannte. Als Ausrede berief ich mich auf Hausaufgaben, obwohl es erst die zweite Woche des Schuljahrs war und meine einzige Aufgabe darin bestand, die erste Hälfte des epischen Heldengedichts Beowulf zu lesen, das ich schon aus der Highschool kannte.
Gruppen schüchterten mich ein, auch noch all diese Jahre nach Bianca und ihren Kaubonbons. Wo würde ich in New Orleans schlafen? Was, wenn ich ihre Witze nicht verstand? Was, wenn ich nichts zu erzählen hatte? Was, wenn sie merkten, dass ich nicht so reich, cool oder glücklich war wie sie? Was, wenn sie herausfanden, dass ich keine Jungfrau mehr war? Was, wenn sie wüssten, dass ich bisher nur mit einem einzigen Typen geschlafen hatte? Was, wenn sie auf meine Geheimnisse rund ums Essen kamen?
Wie sollte ich es da jemals schaffen, jede Woche dieselbe Gruppe mit denselben Leuten zu treffen?
»Ich kenne Sie. Aus den Treffen«, platzte ich mitten in meiner zweiten Sitzung plötzlich hervor. Ich hatte Angst, dass er sich eines Tages doch noch erinnern würde und mich dann rausschmeißen müsste, weil wir schon gemeinsam in einem Selbsthilfetreffen gesessen hatten. »Es ist schon Jahre her, ich habe damals noch in Hyde Park gewohnt.«
Er neigte seinen Kopf und kniff die Augen zusammen. »Ah, richtig. Sie kamen mir bekannt vor.«
»Heißt das, dass Sie mich nicht weiter behandeln können?«
Seine Schultern bebten, als er in ein neckisches Lachen ausbrach. »Ich höre Ihren Wunsch heraus.«
»Wie bitte?« Ich starrte in sein vergnügtes Gesicht.
»Wenn Sie wirklich vorhaben, sich auf eine Therapie mit mir einzulassen, dann müssen Sie sich schon bessere Ausreden einfallen lassen, warum es nicht funktionieren sollte.«
»Das war eine berechtigte Sorge.« Mehr Lachen. »Was?«
»Wenn Sie Teil einer meiner Gruppen werden, dann möchte ich, dass Sie dort absolut alles über mich erzählen, an was Sie sich aus den Treffen von damals noch erinnern.«
»Und was ist mit Ihrer Anonymität?«
»Sie müssen mich nicht schützen. Das ist nicht Ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist es zu erzählen.«
Mein Tagebucheintrag nach dieser zweiten Sitzung war merkwürdig vorausschauend: Der Gedanke daran, mein Essverhalten in der Therapie offenzulegen, macht mich nervös … Ich habe viele Gefühle, wenn ich an Dr. Rosen & seine Rolle in meinem Leben denke. Angst, meine Geheimnisse könnten ans Licht kommen. Die Angst ist so groß.
Dr. Rosen sprach in Rätseln.
»Der hungernde Mensch verspürt keinen Hunger, bis er den ersten Bissen genommen hat«, sagte er.
»Ich bin nicht magersüchtig.« Nun, ich hatte mir die Magersucht definitiv herbeigesehnt, als ich während meiner gesamten Highschoolzeit nicht aufhören konnte, Pringles und Cookies in mich hineinzustopfen, aber es war nie mein Ding gewesen.
»Es ist eine Metapher. Wenn Sie sich der Gruppe öffnen – den ersten Bissen nehmen –, erst dann werden Sie merken, wie allein Sie zuvor waren.«
»Und wie öffne ich mich der Gruppe?«
»Sie teilen mit den anderen jeden einzelnen Aspekt Ihres Lebens, in dem es um Beziehungen geht – Freundschaft, Familie, Sex, Dating, Liebe. Alles.«
»Warum?«
»Weil Sie sich so der Gruppe öffnen.«
***
Bevor es mit der Gruppentherapie losgeht, hat jeder drei einzelne Sitzungen. In meiner letzten entspannten sich meine Schultern, als ich es mir auf Dr. Rosens schwarzem Ledersessel bequem machte. Ich zwirbelte mein Armband um meinen Zeigefinger und schlüpfte mit meinem Fuß immer wieder aus meinem Schuh heraus und wieder hinein. Ich hatte mich an Dr. Rosen gewöhnt, er war wie ein merkwürdiger alter Kumpel geworden. Nichts, wovor man sich fürchten müsste. Ich hatte ihm gesagt, dass ich ihn von den Treffen kannte, und er hatte gesagt, dass das kein Problem sei. Nun musste er nur noch die konkreten Details festklopfen, zum Beispiel, in welche Gruppe er mich stecken würde. Er schlug eine gemischtgeschlechtliche Runde am Dienstagmorgen vor, voller Ärzte und Anwälte, die sich von 7 Uhr 30 bis 9 Uhr traf. Eine »Berufstätigengruppe«. Eine Gruppe mit Männern hatte ich nicht erwartet. Auch keine Ärzte. Oder Anwälte.
»Und was passiert mit mir, wenn ich anfange, die Gruppe zu treffen?«
»Sie werden sich einsamer fühlen als jemals zuvor in Ihrem Leben.«
»Moment mal, Dr. Harvard.« Ich richtete mich sofort auf. »Ich werde mich schlechter fühlen?« Gerade hatte ich mich mit dem Studiendekan getroffen, um einen privaten Gesundheitskredit mit zehn Prozent Zinsen zu vereinbaren, mit dem ich meine neue Therapie bezahlen konnte. Und jetzt sagte er mir, dass es mir mit der Gruppe noch schlechter gehen würde als an jenem Morgen, als ich mit Pflaumensaft am Kinn durch die Gegend fuhr und hoffte, jemand würde mir eine Kugel ins Hirn schießen?
»Ganz genau.« Er nickte überdeutlich. »Wenn Sie ernsthaft vorhaben, intime Beziehungen aufzubauen – ein echter





























