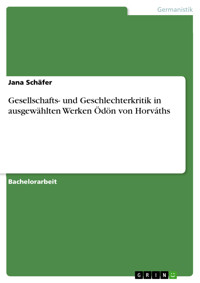11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Edinburgh-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Will you find me, if I lose myself? Stille. Nach dem tödlichen Unfall ihrer Eltern war Stille Maisies ständiger Begleiter, denn jahrelang hat sie kaum ein Wort gesprochen und nur langsam ihre Stimme wiedergefunden. Als Weston Campbell in dem Kindergarten, in dem sie jobbt, auftaucht, bringt er sie völlig durcheinander. Wann immer die beiden aufeinandertreffen, schlägt die Anziehung zwischen ihnen förmlich Funken. Bis Weston Maisie im Streit etwas an den Kopf wirft, das ihre Gefühle für ihn für immer zum Schweigen bringen könnte. Die Bücher der Edinburgh-Dilogie: "The Way We Fall" "The Hope We Find"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Ähnliche
TRIGGERWARNUNGDieses Buch enthält Themen, die potenziell triggern können. Hier befindet sich ein Hinweis zu den Themen.ACHTUNG: Dieser enthält Spoiler für die gesamte Handlung.OriginalausgabeAls Ravensburger E-Book erschienen 2022Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg© 2022, Ravensburger Verlag GmbHText © 2022, Jana SchäferLektorat: Tamara ReisingerDieses Werk wurde vermittelt durch die Literaturagentur Langenbuch & Weiß, Hamburg.Umschlaggestaltung: »das verlagsatelier« Romy Pohlunter Verwendung von Motiven von © ShustrikS, © Verbena, © sergio34, alle von ShutterstockAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-473-51110-5www.ravensburger.de
Für Sina, weil du Bücher genauso sehr liebst wie ich und von Anfang an dabei warst. Und für Nina, weil du an diese Geschichte geglaubt und sie auf ihrem Weg begleitet hast.
PLAYLIST
The Sound of Silence Simon & Garfunkel
If The World Was Ending JP Saxe, Julia Michaels
Still Learning Halsey
A Million Dreams The Greatest Showman
Make You Feel My Love Adele
If You Want Love NF
Lost Boy Ruth B.
Ocean Eyes Billie Eilish
Crashing Gersey
Older Than I Am Lennon Stella
Wildest Dreams Taylor Swift
Bad Habits Ed Sheeran
Circle of Life Elton John (The Lion King)
1. KAPITEL
Maisie
»Pass auf, Teddy. Die Autos fahren hier unglaublich schnell. Ich will, dass du meine Hand nicht mehr loslässt, okay?« Ernst drehte ich mich zu Teddy um, der mich aus murmelgroßen Augen erstaunt ansah. Wenn er diesen Blick aufsetzte, war es beinahe unmöglich, streng zu bleiben, und das wusste er. Er war gerade mal vier Jahre alt und erst seit wenigen Tagen bei uns im Kindergarten, doch er wusste genau, wie er die Erwachsenen um den Finger wickeln konnte. Inklusive mir.
»In zehn Jahren wird er die ersten Herzen brechen«, sagte Bree schmunzelnd.
»Ohne Zweifel.«
»Okay, Kinder, wir gehen jetzt los zum Park. Ihr kennt die Regeln. An der Straße bleiben wir stehen und warten, bis die Erwachsenen sagen, dass wir rübergehen können. Habt ihr alle eine Freundin oder einen Freund an der Hand?« Bree musterte die Kinder, die sich in Zweierreihen aufgestellt hatten, eingehend. »Gut, dann können wir los. Bildest du den Abschluss?«, fragte sie an mich gewandt.
»Klar.«
Wir setzten uns in Bewegung und ließen den Kindergarten hinter uns. Bree legte ein schnelles Tempo an den Tag, doch die Kinder hielten mühelos Schritt. Es war ein sonniger Vormittag, was wir unbedingt ausnutzen wollten. Ich hatte bereits aufgehört zu zählen, wie oft wir im Trockenraum nasse Jacken und Regenhosen auf die Wäscheleine hängten. Doch Regen gehörte genauso zu Edinburgh wie die alten Häuser und kleinen kopfsteingepflasterten Gassen dazwischen.
Ich mochte diese Stadt und nahm den Regen gern in Kauf. Zumindest wenn ich nicht gerade mit zehn Kindern unterwegs war, die es liebten, in Pfützen zu hüpfen – was mich nicht weiter kümmerte, bis die Eltern mit fragenden Mienen vor uns standen, weil ihre Kleinen von oben bis unten mit Schlamm bespritzt waren.
Als wir eine Kreuzung erreichten, blieb Bree stehen. Auf der anderen Straßenseite lag ein kleiner Park mit einem Spielplatz, auf dem wir die nächste Stunde verbringen würden. Bree und ich hatten heute die Leitung der Gruppe der Drei- bis Fünfjährigen übernommen, was meistens darin endete, dass wir auf der Parkbank sitzend über Filme und aktuelle Nachrichten quatschten, während die Kinder spielten. Ab und zu kam eines mit einem aufgeschlagenen Knie zu uns oder brauchte Trost, weil ein anderes Kind gemein gewesen war. Doch für gewöhnlich legte sich die Aufregung schnell wieder.
»Wir warten, bis es Grün wird, dann können wir rübergehen«, erklärte Bree den Kindern wie jedes Mal wenn wir die Kreuzung überquerten. Ich kannte keinen Menschen, der so geduldig und liebevoll mit Kindern umging wie sie.
Seit zwei Jahren arbeitete ich nun schon im Kindergarten. Was nach meinem Schulabschluss als Aushilfe und Krankheitsvertretung begonnen hatte, war zu einer Vier-Tage-Woche geworden. Anders als Bree hatte ich keine Ausbildung durchlaufen, weshalb ich mich mit einem geringeren Gehalt begnügen musste, doch die Arbeit gefiel mir. Kinder waren nicht so kompliziert wie Erwachsene. Sie zerbrachen sich nicht ständig den Kopf und sprachen aus, was sie dachten. Das machte sie zu deutlich angenehmeren Gesprächspartnern.
»Lässt du mich wieder ganz hoch schaukeln?«, fragte Teddy und lenkte mich damit von meinen Gedanken ab.
»Natürlich, aber nur wenn du dich gut festhältst.«
»Versprochen«, sagte er in einem beinahe feierlichen Ton. Ich lächelte und hielt seine kleine Hand, die warm in meiner lag, ein bisschen fester. Gerade als ich mich fragte, wie lange es noch dauern würde, bis die Ampel endlich auf Grün sprang, wurde ich von jemandem angerempelt. Verärgert drehte ich mich um.
Eine Gruppe von vier jungen Männern drängte sich an uns vorbei und trat auf die Straße.
»Warum gehen die schon rüber? Es ist doch noch gar nicht Grün«, sagte Teddy und klang ernsthaft empört.
»Wie wäre es mit ein bisschen mehr Rücksicht?«, rief Bree in diesem Moment, während ich Teddy erklärte, dass manche Leute glaubten, es wäre okay, einfach so über die Straße zu laufen. Was es natürlich nicht war. »Von Vorbildfunktion habt ihr wohl noch nie was gehört!«
Bree blieb im Umgang mit den Kindern immer sanftmütig und ruhig, doch wenn ihr etwas nicht in den Kram passte, regte sie sich leidenschaftlich gern auf. Ich konnte es ihr nicht verdenken. Innerlich warf ich den Idioten dieselben Worte an den Kopf, die sie mühelos über die Lippen gebracht hatte.
Einer der Männer – ich schätzte ihn auf Anfang zwanzig, also vielleicht ein, zwei Jahre älter als ich – blieb mitten auf der verlassenen Straße stehen und drehte sich grinsend zu uns um. »Und wer bist du? Die selbst ernannte Verkehrspolizei?«, fragte er mit einem amüsierten Blick auf Bree, bevor er sich wieder abwandte und den anderen folgte.
Bree erwiderte nichts, doch ich konnte sehen, dass sie die Zähne zusammenbiss. Garantiert kämpfte sie gerade gegen den Drang an, den Typen ein paar Dinge an den Kopf zu werfen, die ihre Pflicht als Vorbild verletzen würden.
In dem Moment wechselte die Ampel von Rot auf Grün, und kurz darauf erreichten wir den Spielplatz. Wie gewohnt scannte ich zuerst die Umgebung. Es war schon mehr als einmal vorgekommen, dass plötzlich ein Hund aus dem Gebüsch geschossen kam und die Kinder zu Tode erschreckte. Doch heute lag der Spielplatz verlassen vor uns.
Dachte ich zumindest. Bis ich jemanden auf der Bank liegen sah. Verdammt, das hatte gerade noch gefehlt. Normalerweise würde ich den Typen ignorieren, aber die Kinder würden sich wundern und Fragen stellen. Das wollte ich weder ihm noch mir zumuten.
»Der Spielplatz ist nicht leer«, sagte ich leise zu meiner Kollegin, nachdem sie die Kinder angewiesen hatte, einen Kreis zu bilden, um noch mal kurz die Regeln durchzugehen, die auf dem Spielplatz galten.
»Das habe ich auch schon bemerkt. Soll ich ihn loswerden?«, fragte sie, doch in dem Moment fing Jenny an zu weinen, weil ein anderes Kind sie gezwickt hatte. Bree nahm sie kurzerhand auf den Arm und murmelte ihr beruhigend zu.
Unschlüssig schaute ich von den Kindern zur Bank und wieder zurück. »Ich mach das schon«, sagte ich und klang zuversichtlicher, als ich mich fühlte.
Die Kinder schienen den Kerl bisher nicht bemerkt zu haben, was auch so bleiben sollte. Normalerweise überließ ich Bree solche Dinge, wo es darum ging, mit Fremden zu reden, aber sie war noch mit Jenny beschäftigt. Außerdem hatte ich nicht all die Therapiestunden und Fortschritte gemacht, um jetzt zu kneifen.
Während Bree mit der Gruppe ein Lied anstimmte, zu dem alle klatschten, betrat ich entschlossen den Spielplatz. »Entschuldigung«, rief ich, als ich mit etwas Abstand vor der Bank zum Stehen kam. »Sie müssen woanders hingehen. Das hier ist ein Spielplatz.«
Der junge Mann regte sich nicht.
Ich machte noch einen Schritt auf ihn zu und musterte ihn eingehend. Er trug Jeans und Lederjacke. Markenklamotten, wie ich bei näherem Hinsehen erkannte. Der Kerl war höchstens Mitte zwanzig und unverschämt attraktiv. Auch das noch. Mein Blick verharrte eine Spur zu lange auf seinen dunklen Haaren und den markanten Gesichtszügen.
»Hallo?«, versuchte ich es erneut, diesmal lauter.
Keine Reaktion.
Rasch schaute ich zu Bree, die immer noch mit den Kindern beschäftigt war. Von ihr konnte ich also keine Hilfe erwarten.
Nach einem kurzen Zögern setzte ich meinen Rucksack ab, in dem sich ein Erste-Hilfe-Set und eine Wasserflasche befanden. »Du hast es nicht anders gewollt«, murmelte ich, öffnete die Flasche und kippte den halben Inhalt über den Kerl. Das war zwar für gewöhnlich nicht meine Art, aber Not machte erfinderisch.
Ein Keuchen erklang, gefolgt von einem lautstarken Fluch, der mich instinktiv nach den Kindern sehen ließ, die zum Glück weit genug weg standen. »Scheiße! Was zur Hölle soll das?« Graublaue Augen bohrten sich in meine.
Ich öffnete den Mund, doch es kamen keine Worte heraus. Shit. »Das hier ist ein Spielplatz«, sagte ich, als ich die Sprache wiedergefunden hatte.
»Und?« Seine Augenbrauen wanderten herausfordernd nach oben.
Das war der Moment, in dem mein Geduldsfaden riss. »Und hier spielen Kinder, die sich nicht vor einem betrunkenen Kerl fürchten sollten.«
»Kinder lieben mich«, erwiderte er und fuhr sich durch die nassen Haare, die in alle Richtungen abstanden. Dafür, dass er aussah, als hätte er die ganze Nacht auf dieser Parkbank geschlafen, klang seine Stimme erstaunlich klar. »Außerdem bin ich nicht betrunken. Nicht mehr auf jeden Fall.«
»Na dann«, gab ich sarkastisch zurück. Himmel, was für ein Start in die Woche. »Hör zu, meine Kollegin kommt gleich mit einer Gruppe von Kindern, und wenn du bis dahin nicht verschwunden bist, rufe ich die Polizei.« Keine Ahnung, wo all die Worte herkamen, doch ich war verdammt froh, dass sie mich diesmal nicht im Stich ließen. Angetrieben von meiner Wut vergaß ich beinahe, dass ich Gespräche mit Fremden normalerweise vermied.
Ein leises Lachen durchbrach meine Gedanken.
Verwirrt schaute ich den Kerl an. Lachte er mich gerade aus? Aus seinen Haaren tropfte noch immer das Wasser, das ich über ihm ausgeleert hatte, und er besaß die Frechheit, mir ins Gesicht zu lachen. Was für ein Idiot. Ich holte Luft, um ihm die Meinung zu sagen, doch er kam mir zuvor.
»Keine Sorge, ich bin schon weg.« Er stand auf und klopfte sich die Hose ab, wobei er verstohlen die Rutsche und die Schaukel musterte, als sähe er sie gerade zum ersten Mal.
»Keine Erinnerung, wie du hier gelandet bist?«, fragte ich mit einem Anflug von Genugtuung.
»Vage.« Er zuckte mit den Schultern, als wäre es keine große Sache, morgens verkatert in einem Park aufzuwachen.
»Nicht deine erste Nacht auf einer Bank, was?« Wow, ich war richtig in Fahrt. Das würde ich in meiner nächsten Therapiesitzung als Erfolg verbuchen. Mehrere Sätze, ohne zu stocken, mit einem Fremden gesprochen. Meine Therapeutin würde begeistert sein.
»Ob du es glaubst oder nicht, doch. Ich bin an der Uni quasi für mein Verantwortungsbewusstsein bekannt.«
Ich schnaubte. Ja, klar.
Als Brees Stimme über den Platz wehte, machte ich eine ungeduldige Bewegung.
»Bin schon weg.« Er vergrub die Hände in den Hosentaschen und schlenderte in aller Seelenruhe vom Spielplatz. Nach ein paar Schritten drehte er sich noch mal zu mir um. »Wir sehen uns. Danke für die Dusche.«
Ganz sicher nicht. Sprachlos schaute ich ihm hinterher.
»Genau solche Kerle sind der Grund, warum ich nie mit einem Mann zusammen war«, meinte Bree, als wir auf der Parkbank saßen, die ich vorsichtshalber mit einem Tuch abgewischt hatte. Die Rucksäcke der Kinder hatten wir auf der Bank daneben abgelegt.
»Du meinst abgesehen davon, dass du Frauen schon immer attraktiver fandest?«, warf ich schmunzelnd ein. Ich hatte ihr detailliert von dem Gespräch berichtet, das mich immer noch ein bisschen fassungslos machte.
»Ich wette, er studiert Jura oder Medizin, verbrät das Geld seiner Eltern in zu teuren Clubs und hält sich für die Elite der Gesellschaft«, schimpfte Bree weiter. »Genau wie die Deppen, die vorhin einfach über die Straße gelaufen sind.«
»Kann schon sein.«
»Immerhin hast du ihm eine Flasche Wasser über den Kopf gekippt. Geschieht ihm recht. Aber so eine Aktion hätte ich dir gar nicht zugetraut«, sagte sie kichernd.
»Ich mir auch nicht«, murmelte ich und konnte ein Grinsen nicht verbergen. »Aber er war davon wenig beeindruckt. Anstatt sich zu entschuldigen und einfach zu gehen, hat er auch noch dumme Sprüche gerissen.«
»Sag ich ja, eingebildeter Mistkerl.«
Wir verstummten, und die nächsten Minuten konzentrierten wir uns auf die Kinder und passten auf, dass sie nichts anstellten. Gerade spielten sie recht friedlich, aber es dauerte meistens nicht lange, bis eines von ihnen weinte oder uns in das Spiel miteinbezog.
Ich lehnte mich zurück, beobachtete Teddy, wie er mit Jenny eine Sandburg baute, und genoss den kurzen Moment der Ruhe. Bree schien es ähnlich zu gehen. Sie war zwar einer der Menschen, die minutenlang reden konnten, ohne Luft zu holen, aber genauso gut konnte sie schweigen. Das mochte ich an ihr.
Vor zwei Jahren, zu Beginn unserer gemeinsamen Arbeit, hatte ich nur wenig geredet, doch Bree hatte mich deswegen nie anders behandelt oder komisch angeschaut. Sie wusste, dass ich vor allem früher Schwierigkeiten hatte, die Sätze herauszubringen, die mir auf der Zunge lagen. Dass ich zwar schon immer unglaublich viele Gedanken in meinem Kopf herumtrug, doch wenn es darum ging, sie laut auszusprechen, jahrelang gegen unsichtbare Barrieren angekämpft hatte. Und wenn ich dagegen verloren hatte, war ich still geblieben. Die Leute, die mich kannten, wussten das und hatten geduldig gewartet, bis ich so weit war, oder die Stille mit ihren Worten gefüllt. Die, die mich nicht kannten, hatten jedoch weniger Verständnis gezeigt. Inzwischen konnte ich mühelos ganze Konversationen führen, doch ein Teil von mir fühlte sich manchmal noch immer wie das stumme Mädchen von früher.
Ich schüttelte den Kopf, um die Gedanken zu vertreiben, die in eine Abwärtsspirale drifteten, aus der es keinen Ausweg gab.
»Maisie, kannst du mir helfen?« Amy, ein dunkelhaariges Mädchen, das sich meistens abseits von den anderen Kindern hielt, streckte mir seinen Fuß entgegen. Die Schnürsenkel waren aufgegangen.
»Aber natürlich.« Ich band die Schnürsenkel zu einer Schleife zusammen und musterte Amy eingehend. Sie wirkte irgendwie betrübt. »Ist ansonsten alles in Ordnung?«
Prompt füllten sich ihre Augen mit Tränen. »Die anderen lassen mich nicht mitspielen«, schniefte sie. »Jesse hat gesagt, dass ich viel zu langsam bin und darum nur zuschauen darf.«
»Soll ich mitkommen und mit Jesse reden?«
Amy nickte und streckte ihre Hand nach meiner aus. »Ich bin gleich wieder da«, sagte ich zu Bree, die mir dankbar zunickte.
Nachdem ich Jesse überzeugt hatte, dass alle Kinder mitspielen durften und Schnelligkeit nicht alles war, kehrte ich zu Bree zurück.
»Du kannst so was echt gut«, bemerkte sie.
»Was meinst du?«
»Na, das.« Sie zeigte in Richtung der spielenden Kinder. »Du verstehst sie.«
»Das sollte ich bei meinem Job ja auch«, erwiderte ich zwinkernd.
Bree lachte. »Stimmt, aber es gibt weiß Gott viele Erzieherinnen, die sehr viel weniger Verständnis für die Kleinen aufbringen.«
»Das stimmt vermutlich. Dabei sind Kinder so herrlich unkompliziert. Ich stelle es mir deutlich anstrengender vor, in einem Büro zu arbeiten, in dem ich jeden Tag von Erwachsenen umgeben bin.«
»Da sagst du was. Ich glaube, deshalb mag ich den Job auch so gern«, erwiderte Bree. »Hast du Lust, Freitagabend zu einem Musical-Marathon vorbeizukommen?«, fragte sie im selben Atemzug. Das Tempo, in dem sie Themen wechselte, hatte ich schon immer beeindruckend gefunden.
»Klar, ich habe noch nichts vor.« Wie meistens.
Meine Wochenenden bestanden normalerweise aus Leseabenden auf der Couch. Manchmal traf ich mich auch mit meiner Schwester Amelia zu einem Spieleabend oder besuchte mit ihr eine Bar, wenn sie darauf bestand, dass ich mal wieder ausgehen sollte. Seit sie mit Jasper, einem bekannten Autor, zusammen war, versuchten die beiden, mich ständig zu irgendwelchen Events zu schleppen. Bei Gitarrenkonzerten von Amelia oder Lesungen von Jasper war ich gern dabei, aber alles andere löste bei mir vor allem Stress aus. Menschenmengen waren nicht mein Ding, und ich hasste Small Talk. Dieses Gerede über nichtige Sachen wie das Wetter oder die Outfits irgendwelcher Leute ging mir auf die Nerven. Es fiel mir so schon schwer genug, zu sagen, was ich dachte, doch bei solchen Themen fehlte mir einfach der Gesprächsstoff.
Ein lautes Gebrüll riss mich aus meinen Gedanken. Jacob stand mit aufgeschlagenen Knien vor Bree, die ihn umgehend auf ihren Schoß setzte.
»Wir sollten zurück«, sagte sie an mich gewandt, bevor sie beruhigend auf Jacob einredete. »Ist ja gut, ich säubere die Wunde und klebe dir ein Pflaster auf, und im Kindergarten kannst du dich hinlegen.«
Während Bree sich um seine Verletzung kümmerte, versammelte ich die anderen Kinder um mich, und sobald Jacob verarztet, alle Nasen geputzt und Rucksäcke aufgesetzt waren, machten wir uns auf den Rückweg. Teddy ging wie vorhin an meiner Hand und umklammerte sie mit festem Griff. Immer wieder sah er zu mir hoch, als wollte er sich vergewissern, dass ich auch wirklich da war. Die Geste erinnerte mich irgendwie an mich selbst. Ich hatte mich früher ähnlich oft nach meiner Schwester umgeschaut, um sicherzustellen, dass sie nicht von meiner Seite wich.
Sobald wir zurück im Kindergarten waren, sorgten wir dafür, dass alle Hände sauber waren, bevor wir die Kinder wieder spielen ließen. Zum Glück verging die Zeit bis zum Arbeitsende relativ schnell und auch ereignislos. Wie jeden Tag schlossen wir mit einem Lied und einer kleinen Geschichte ab, die Bree vorlas, und dann wurden die Kinder auch schon abgeholt.
Sobald wir alles aufgeräumt hatten, umarmte ich Bree zum Abschied und verließ lächelnd den Kindergarten. Es war erst früh am Nachmittag, weshalb ich beschloss, das schöne Wetter für einen Spaziergang durch Edinburgh zu nutzen. Ich liebte die alten Gebäude, den Blick auf die Burg, die über der Stadt thronte, und diese besondere Atmosphäre, die die Altstadt ausstrahlte. Obwohl hier viele Touristen unterwegs waren, hatte es jedes Mal eine beruhigende Wirkung auf mich.
In meinem Lieblingscafé in der Altstadt legte ich einen Stopp ein. Ich bestellte ihren hausgemachten Eistee, der nach Pfirsich schmeckte, und setzte mich mit meinem Notizbuch an einen Tisch am Fenster. Doch anstatt zu schreiben, beobachtete ich die Menschen, die draußen vorbeieilten, zu beschäftigt, um das Wetter oder die Stadt zu genießen. Ihr Blick klebte entweder auf ihren Füßen oder auf ihrem Handy, und die Sorgenfalten zwischen ihren Augen erinnerten mich an die meiner Tante. Charlotte war eine Meisterin im Sich-Sorgen-Machen und Zu-viel-Arbeiten. Seit Amelias Auszug richtete sich all ihre Aufmerksamkeit auf mich. Während ihre Sorge früher zumindest auch meine Schwester getroffen hatte, kriegte ich jetzt alles allein ab. Ich wusste, dass sie es nur gut meinte und dass ihr das Loslassen schwerfiel, doch manchmal erdrückte mich ihre Sorge. Umso mehr genoss ich es, wenn ich ungestört meine Gedanken zu Papier bringen konnte, wie jetzt.
Im Hintergrund brummte eine Kaffeemaschine, und leise Jazzmusik plätscherte aus den Boxen über mir. Die perfekte Geräuschkulisse, um abzuschalten und meiner Kreativität freien Lauf zu lassen.
Ich setzte den Stift an und schrieb das Erste, was mir in den Sinn kam.
Und ja, es stimmt.
Ich denke und fühle oft ziemlich viel,
vertraue nicht leicht, doch wenn ich es tu, bin ich All In,
weil ich die goldene Mitte schnell mal verpass und meistens zu tief tauch, wenn ich mal spring.
Nachdenklich schaute ich auf die Buchstaben, die sich eng aneinanderreihten. Warum fiel es mir so viel leichter, meine Gedanken zu ordnen, wenn ich sie aufschrieb? Ich hatte so viel zu sagen, doch trotz unzähliger Therapiestunden blieb ich manchmal immer noch stumm, wenn es darauf ankam. Vielleicht würde ich übermorgen bei meiner nächsten Sitzung das Thema mal ansprechen können.
»Ist hier noch frei?«, erklang neben mir eine dunkle Stimme.
Ich schaute auf und sah einen älteren Herrn, der ein Stück Kuchen auf dem Tisch abstellte, als hätte ich seine Frage bereits bejaht. Nein, wollte ich sagen. Nein, hier ist nicht frei. Stattdessen nickte ich schwach, und nachdem er sich lächelnd hingesetzt hatte, versuchte ich, mich wieder auf mein Notizbuch zu konzentrieren.
Doch mein Blick huschte immer wieder zu ihm, und ich wurde zunehmend unruhiger. Er sagte nichts, schien auch nicht wie andere ältere Herren an einem Gespräch interessiert zu sein oder mein Schweigen seltsam zu finden. Trotzdem machte mich seine Anwesenheit nervös, und ich wusste nicht, wohin ich schauen sollte.
Es war nicht so, dass ich Angst hatte, mich mit fremden Menschen zu unterhalten oder den Mund aufzumachen und meine Meinung zu sagen. Ein Teil von mir wollte nichts sehnlicher als das, doch ein anderer, mächtigerer Teil stellte sich wie eine unüberwindbare Barriere zwischen meine gedachten Worte und meine Stimme. Es passierte nicht mehr so oft wie früher, doch es gab die Momente noch. Und jetzt war einer dieser Momente.
Seufzend packte ich das Notizbuch ein, trank meinen Eistee aus und schlüpfte in meine Jeansjacke. Vielleicht gelang es mir das nächste Mal. Meine Therapeutin wurde nicht müde zu betonen, dass es manchmal kleine Schritte brauchte. Ob sie wusste, dass ich seit dem Tag, der meine Welt für immer verändert hatte, nichts anderes als kleine Schritte machte?
Ich wollte keine kleinen Schritte mehr, sondern einen Sprung über die verdammte Schlucht.
Vielleicht nächstes Mal. Das sagte ich mir auf dem Weg nach Hause immer wieder.
2. KAPITEL
Maisie
»Ich halte das für eine sehr gute Übung für dich.«
Es war später Nachmittag, und ich war nach dem Kindergarten direkt zu einem Termin bei meiner Therapeutin gefahren.
»Ich soll vor einer Gruppe fremder Leute meine Texte vortragen?« Entgeistert schaute ich Dr. Rae an. Hatte sie jetzt völlig den Verstand verloren? Während ich noch überlegte, ob ich in hysterisches Gelächter oder hektische Schnappatmung ausbrechen sollte, erzählte sie in gelassenem Ton weiter von ihrer absurden Idee.
»Es ist ein geschützter Rahmen. Ein Freund von mir leitet die Schreibwerkstatt. Er unterrichtet Literaturwissenschaften an der Uni und weiß, wovon er redet. Außerdem kommen im Schnitt nur zehn bis fünfzehn Leute zu den Treffen, was eine überschaubare Größe ist.«
Zehn bis fünfzehn Fremde waren immer noch zehn bis fünfzehn zu viel. Natürlich hatte ich in der Schulzeit ebenfalls ab und zu ein Referat halten müssen, was mich jedes Mal eine immense Überwindung gekostet hatte. Aber die vertrauten Gesichter meiner Klassenkameraden hatten mich ermutigt, es zumindest zu versuchen. Einen persönlichen Text vor einem unbekannten Publikum vorzutragen, war aber eine ganz andere Nummer.
»Außerdem sind die Teilnehmer alle in deinem Alter. Die Schreibgruppe ist ausgeschrieben für Zwanzig- bis Fünfundzwanzigjährige. Das wäre also auch eine tolle Gelegenheit, neue Freunde zu finden, meinst du nicht?«
»Meinen Sie das ernst?« Bemüht, die Fassung nicht zu verlieren, suchte ich im Gesicht meiner Therapeutin nach Anzeichen, dass sie nur scherzte. Doch Fehlanzeige. »Es ist Ihr Ernst.« Verblüfft sank ich in das weiche Polster der Couch zurück. »Sie wissen schon, dass ich vor Fremden nicht sprechen kann? Dass ich seit sechzehn Jahren ein Problem damit habe und mich dort völlig zum Deppen machen werde?«
»Das wirst du nicht, Maisie. Ich begleite dich jetzt schon seit vier Jahren, und die Fortschritte, die du in der Zeit gemacht hast, sind enorm. Du bist so weit.« Dr. Raes Lippen verzogen sich zu einem zuversichtlichen Lächeln.
Kopfschüttelnd sah ich sie an. Eigentlich vertraute ich Dr. Raes Urteil. Sie war mir nach einem längeren Klinikaufenthalt, durch den ich mein Schweigen endlich hatte hinter mir lassen können, von einem der Ärzte dort empfohlen worden. Warum sie sich dafür entschieden hatte, Leuten wie mir zu helfen, wusste ich nicht. Aber sie machte ihren Job gut. Zumindest hatte sie das bis heute. »Ich fürchte, Sie irren sich.«
Dr. Rae schwieg einen Moment lang. Mit jeder weiteren Sekunde, die verging, wurde ich unruhiger. Ich hasste es, wenn sie das machte, was absolut ironisch war, wenn ich daran dachte, wie lange ich den Menschen nicht viel mehr als mein Schweigen entgegengebracht hatte. Ich versuchte, in ihrer Miene zu lesen. Vergeblich. Obwohl ich Dr. Rae inzwischen seit vier Jahren regelmäßig sah, konnte ich sie immer noch schwer einschätzen. Ich kannte lediglich ihre Vorliebe für knalligen Lippenstift. Die Wahl war heute auf ein tiefes Kirschrot gefallen, das an mir vermutlich albern aussehen würde, ihr aber einen edlen Touch verlieh. Ihre dunkelblonden Haare hatte sie wie so oft zu einer Frisur hochgesteckt, und sie trug einen blauen Blazer zu einer schwarzen Hose, womit sie genauso gut in einem Büro oder einer schicken Kanzlei hätte sitzen können.
»Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte?«, fragte sie ruhig und unterbrach damit meine Gedanken.
Ich kniff die Augen zusammen und unterdrückte ein Seufzen. Das machte sie immer, wenn ich mir etwas selbst nicht zutraute. Sie ging mit mir sämtliche Szenarien durch, bis ich zu dem Schluss kam, dass alles halb so wild war. Und obwohl ich genau wusste, was folgen würde, ließ ich mich darauf ein.
»Sie könnten über mich lachen, weil ich mit einem Blatt Papier vor ihnen stehe und kein Wort herausbringe. Ich könnte in Tränen ausbrechen und wie ein kleines Kind aus dem Raum rennen. Das wäre verdammt demütigend. Und ziemlich peinlich.«
»Ausgelacht zu werden oder eine Flucht wäre also das Schlimmste, was dir passieren könnte?«
»Das kam mir zumindest als Erstes in den Sinn, haben Sie vielleicht noch ein paar weitere Szenarien?«, fragte ich halb im Scherz, halb in Angst.
Sie lachte leise. »Natürlich nicht. Das wirst du jetzt vielleicht nicht hören wollen, aber wenn das deine schlimmsten Vorstellungen sind …«
»Ja?«, fragte ich und wusste nicht, worauf ich hoffte. Dass sie mir Mut machte oder dass sie einsah, dass dieser Schritt zu groß für mich war.
»Nun ja. Ich denke, dann wirst du’s überleben.«
Bitte was? Ich war mir ziemlich sicher, dass mir die Kinnlade herunterklappte und ich sie wie eine Idiotin anstarrte. »Dürfen Sie das überhaupt so sagen? Müssten sich mich nicht aufmuntern oder mich darin bestärken, dass ich meine Texte erst dann vortragen soll, wenn ich mich dafür bereit fühle?«
Therapeutinnen waren dafür da, zu helfen, oder nicht? Sie sollten einen Schritt für Schritt über die Schlucht führen und einen nicht einfach hineinstoßen, in der Hoffnung, dass einem plötzlich Flügel wuchsen, die einen vor dem freien Fall schützten. Andererseits hatte ich an Dr. Rae immer gemocht, dass sie auch mal unkonventionelle Wege ging. Obwohl sie meistens mit Fragen arbeitete, sagte sie mir manchmal auch ganz direkt ihre Meinung oder brachte einen Spruch, mit dem ich nicht rechnete. Sie war über die Sitzungen hinweg mehr so etwas wie eine weise Tante geworden, deren Rat ich suchte, wenn ich nicht weiterwusste oder das Chaos in meinem Kopf zu viel wurde, um es allein zu sortieren.
»Normalerweise würde ich das sagen, ja. Aber manchmal braucht es auch einen kleinen Schubs in die richtige Richtung, und ich habe keine Zweifel daran, dass du nur zu der Schreibwerkstatt gehen wirst, wenn du es auch willst. Sieh es als eine starke Empfehlung meinerseits, mehr nicht.«
»Okay.« Zögernd nahm ich den Flyer entgegen, den sie auf das Tischchen zwischen uns gelegt hatte.
Zugegeben, eine Schreibwerkstatt, in der die Leute sich über ihr Geschriebenes austauschten und Texte vortrugen, klang ziemlich cool. Wenn ich die Tatsache ausklammerte, dass ich dort sprechen musste, wäre ich sofort dabei. Ich atmete tief durch und erinnerte mich an mein eigenes Versprechen, mutiger zu sein. Ich wollte keine kleinen Schritte mehr? Dann würde ich mich Herausforderungen wie diesen stellen müssen.
»Ich denke darüber nach«, sagte ich daher, »aber dort mal vorbeizuschauen, kann ja nicht schaden.«
»Das denke ich auch«, erwiderte Dr. Rae mit einem zuversichtlichen Lächeln. »Wie läuft es mit den Zielen, die du dir bei unserer letzten Sitzung gesetzt hattest?«, wechselte sie dann das Thema. Dankbar steckte ich den Zettel ein und berichtete von meiner Woche.
Nach der Stunde bei Dr. Rae machte ich mich auf den Weg zu Amelia und Jasper. Die beiden waren vor zwei Jahren in eine Altbauwohnung am Stadtrand gezogen, nachdem Amelia zuvor zwei Jahre allein gewohnt hatte. Auch wenn ich mir nicht vorstellen konnte, zu Hause auszuziehen, um die Wohnung beneidete ich die beiden insgeheim. Sie war ruhig gelegen und stilvoll eingerichtet. Amelia hatte sie in ein gemütliches Zuhause verwandelt, in dem sich an den Wänden Bücherregale reihten, die perfekt mit den Vintage-Möbeln abgestimmt waren.
»Hey, Maisie. Schön, dass du da bist«, begrüßte mich Jasper. Ein erfreutes Lächeln lag auf seinen Lippen, was mir früher die Hitze in die Wangen getrieben hätte. Inzwischen hatte ich mich an seinen Anblick und die Tatsache, dass meine Schwester mit einem meiner absoluten Lieblingsschriftsteller zusammen war, gewöhnt. Es hatte zwar eine Weile gebraucht, und ein Teil von mir flippte immer noch heimlich aus, wenn wir über seine Ideen und Bücher redeten, aber zumindest äußerlich hatte ich mich im Griff.
»Hi.« Schnell schlüpfte ich an ihm vorbei ins Warme. Für Mitte März wehte heute ein ungewöhnlich kalter Wind durch die Stadt. »Ist Amelia nicht da?«, fügte ich hinzu, als ich das lichtdurchflutete Wohnzimmer betrat, das neben den Bücherregalen mit einer breiten Ledercouch und zwei Sesseln ausgestattet war.
Normalerweise saß Amelia hier mit der Gitarre auf dem Schoß und verlor sich in ihrer Musik. Oder sie ging eines ihrer Lehrbücher durch und machte sich Notizen für eine Hausarbeit. Ich kannte nur wenige Menschen, die mit so viel Leidenschaft studierten wie sie. Kein Wunder, dass sie ein Stipendium an der Uni erhalten hatte. Ihr Abschluss in Sozialer Arbeit stand kurz bevor, und sie hatte schon mehrmals betont, wie sehr sie sich auf die Praxis freute. Doch heute war das Wohnzimmer überraschend aufgeräumt.
»Sie hat noch einen Termin mit einem Dozenten, sollte aber jeden Moment da sein. Willst du was trinken? Kaffee? Tee? Saft?«
»Gern einen Tee, aber den kann ich mir auch selbst machen.« Ich ging an Jasper vorbei in die Küche.
»Klar, fühl dich wie Zuhause«, merkte er an, folgte mir aber trotzdem und lehnte sich an die Arbeitsfläche neben dem Herd, während ich Wasser aufsetzte und einen Teebeutel in die Tasse hängte.
Wie immer wenn ich hier war, musterte ich die vielen Postkarten, die mit Magneten am Kühlschrank befestigt waren. Vor einem Jahr waren Amelia und Jasper zu einer halbjährigen Reise quer durch Europa aufgebrochen. Aus jedem Ort, an dem sie mehrere Tage verbracht hatten, hatten sie eine Postkarte mitgenommen.
»Da kann einen schon mal die Reiselust packen, was?« Jasper war meinem Blick gefolgt.
»Ich mag es hier«, erwiderte ich. »Vielleicht besuche ich irgendwann all die Orte, die hier abgebildet sind, aber momentan fühle ich mich wohl, wo ich bin.«
»Das ist gut. Wie läuft’s im Kindergarten?«
»Gut.« Ich schenkte mir Wasser ein und ging mit der Tasse Tee zurück ins Wohnzimmer. »Wie läuft es mit deinem Buch?«
»Frag nicht.« Jasper ließ sich auf einen der Sessel fallen und seufzte laut. »Die Deadline rückt mal wieder zu schnell näher, und ich stecke in einer Szene fest, an der ich seit fünf Tagen schreibe.«
»Hast du nicht gesagt, dass dann nur Löschen und Abstand vom Manuskript nehmen hilft?«
Ein gequältes Lächeln huschte über sein Gesicht. »Das klingt nach mir. Nur lässt der Zeitdruck keine Pause zu.«
»Soll ich mal drüberlesen?« Ich war zwar keine Lektorin, aber ich hatte immerhin alle Bücher von Jasper gelesen und kannte mich mit dem Fantasy-Genre gut aus.
»Das wäre nett, ja. Wann höre ich eigentlich mal einen deiner Texte?«, fragte Jasper und überrumpelte mich damit völlig. Um nicht sofort antworten zu müssen, griff ich nach meinem Tee, während er hinzufügte: »Amelia hat erwähnt, dass du wieder mehr schreibst.«
»Das sind nur Wortschnipsel und Gedankenfetzen.«
Skeptisch schaute Jasper mich an. »Ich glaube dir kein Wort.«
»Du weißt, wie schwer mir das fällt.« Ich wich seinem Blick aus und musterte stattdessen die Kerze auf dem Couchtisch, die seit Ewigkeiten dort stand und einen leichten Vanillegeruch verströmte.
»Das tu ich. Aber glaub mir, es wird sich lohnen. Es ist natürlich nicht dasselbe, das ist mir bewusst, aber vor meiner ersten Lesung bin ich auch Tausend Tode gestorben.«
»Ehrlich?« Ungläubig hob ich die Augenbrauen. Jasper wirkte jedes Mal total entspannt, wenn er vorlas. Er schaffte es bereits nach wenigen Worten, seine Zuhörer zu verzaubern.
»Allerdings. Selbst jetzt bin ich manchmal noch nervös. Es kostet Überwindung, etwas vorzulesen, was man selbst geschrieben hat. Gleichzeitig ist es ein berauschendes Gefühl, endlich zu teilen, was man monatelang nur für sich selbst erarbeitet hat.«
»Das kann ich mir gut vorstellen.«
Einen Moment lang schwiegen wir. Jaspers Worte machten mich nachdenklich. Vermutlich hatte er recht, und Nervosität gehörte einfach dazu. Meine Texte vorzulesen, war ein Ziel, das ich nie aus den Augen verlor und das gleichzeitig unendlich weit weg erschien. Aber die Sache mit der Schreibwerkstatt könnte es möglich machen.
In Gedanken versunken nippte ich an meinem Tee, während Jasper sich lächelnd zurücklehnte. Ich warf ihm einen verstohlenen Blick zu. Er wirkte glücklich, und das gab mir Hoffnung. Er und Amelia hatten sich ein Leben aufgebaut, das nicht immer perfekt, aber das gut war. Sie hatten dafür viele innere Grenzen überschreiten müssen, und es wurde Zeit, dass ich das auch tat. Dass ich zumindest damit anfing.
Wieder sah ich mich in der gemütlich eingerichteten Wohnung um. »Falls ich es jemals schaffe, auszuziehen, wünsche ich mir auch so eine schöne Wohnung«, sagte ich leise.
»Dann musst du nur Amelia engagieren. Sie ist für all das verantwortlich.« Schmunzelnd sah Jasper sich um.
»Du hast verdammt großes Glück mit ihr, weißt du das?«
»Und wie ich das weiß. Ohne deine Schwester säße ich vermutlich immer noch in einem unpersönlichen Apartment, wo ich den ganzen Tag meinen Laptop anstarre.« Er zwinkerte mir zu. »Aber sag Amelia das bloß nicht.«
»Was soll sie mir nicht sagen?«, ertönte die Stimme meiner Schwester.
»Nichts«, sagten Jasper und ich im selben Moment.
»Aha. Ich frage lieber nicht weiter nach.« Sie begrüßte Jasper mit einem flüchtigen Kuss auf den Mund und setzte sich neben mich auf die Couch. »Schön, dich zu sehen, Süße.« Sie drückte mich an sich, und augenblicklich verschwand etwas von der Unruhe, die mich seit der Sitzung mit Dr. Rae gepackt hielt.
»Hi, Amelia«, sagte ich lächelnd und löste mich aus ihrer Umarmung.
»Erzähl, wie geht’s dir?«, fragte sie, während Jasper aufstand, um ihr ebenfalls eine Tasse Tee zu bringen. »Wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen.«
Ich schnaubte. »Wir haben vor ein paar Tagen telefoniert.«
»Sag ich ja. Das ist ewig her.«
Belustigt schüttelte ich den Kopf. »Wenn du meinst«, sagte ich, bevor ich dazu überging, ihr von der Arbeit im Kindergarten zu erzählen. Als ich die kurze Begegnung mit dem unverschämten Kerl auf dem Spielplatz erwähnte, lachte Amelia laut auf und gratulierte mir zu meiner Schlagfertigkeit, während Jasper etwas von unverschämtem Verhalten murmelte.
»Als wärst du dafür bekannt, höflich und kommunikativ zu sein«, zog Amelia ihn auf.
»Hey, ich habe mich gebessert«, protestierte Jasper. »Ich bestelle jetzt immer einen zweiten Cappuccino, wenn ich im Café arbeite.«
Schmunzelnd beobachtete ich, wie Amelia die Augen verdrehte und Jasper liebevoll gegen die Schulter stieß. »Ich meinte eigentlich die Sache mit Jamie.«
»Ich weiß. Aber auch da habe ich mich gebessert: Wir telefonieren inzwischen sogar regelmäßig.«
Es war schön, zu hören, dass Jasper wieder ein Verhältnis zu seinem kleinen Bruder hatte aufbauen können. Die beiden waren als Kinder in Pflegefamilien gekommen und hatten es nicht immer leicht gehabt. Ich wusste von Amelia, dass zwischen den beiden einiges vorgefallen war, dass Jasper seinem Bruder aber trotz allem dabei geholfen hatte, in Edinburgh ein neues Leben anzufangen. Das war etwas, was ich an Jasper von Anfang an gemocht hatte: Für die Menschen, die ihm wichtig waren, würde er alles tun. Ähnlich wie Amelia für mich.
Während der nächsten Stunden dachte ich weder an die Schreibwerkstatt noch an die Barriere in meinem Kopf. Ich dachte nicht daran, dass ich keine kleinen Schritte mehr wollte, sondern Sprünge, obwohl es mir riesige Angst einjagte. Ich dachte auch nicht an meine Eltern. Daran, wie sehr ich sie vermisste und dass ich bis heute nicht verstand, warum ich noch da war, während sie keine Chance gehabt hatten.
Ich blendete alle dunklen und zweifelnden Gedanken aus und konzentrierte mich stattdessen auf Amelias Lachen und Jaspers Strahlen, wenn er sie ansah. Bei ihnen war es leicht, zufrieden und ich selbst zu sein.
Als ich mich schließlich verabschiedete und Amelia versprach, mich bald wieder bei ihr zu melden, zog Jasper mich in seine Arme. »Ich weiß, dass du eine Menge zu sagen hast, und ich glaube fest daran, dass du und die Welt bereit sind, deine Texte zu hören.«
Ich nickte nur und winkte den beiden zu, während ich mich auf den Heimweg machte. Doch Jaspers Worte ließen mich nicht los, und als ich die Tür zu unserer Wohnung aufschloss, glaubte ich sie fast selbst. Zumindest genug, um den Entschluss zu fassen, mich morgen bei der Schreibwerkstatt anzumelden.
3. KAPITEL
Weston
Im Schnellschritt bog ich in die Straße ein, in der sich der Kindergarten befand. Ich war spät dran, und wenn mein Neffe eines hasste, dann warten.
Meine Schwester Rose hatte mir heute Morgen eine verzweifelte Voicemail hinterlassen. Auf der Arbeit war ein spontaner Termin eingegangen, an dem sie teilnehmen musste, und ob ich auf Teddy aufpassen könnte. Also ließ ich meine Rechtsvorlesung sausen und spielte stattdessen Babysitter. Den Stoff wieder aufzuholen, würde mich zwar mehrere Stunden kosten, aber wenn es um Teddy ging, konnte ich unmöglich Nein sagen. Ich liebte den Kleinen einfach abgöttisch.
Wenig später betätigte ich ungeduldig die Türklingel. Teddy ging erst seit Kurzem in den Kindergarten, doch bisher schien er sich sehr wohlzufühlen. Kein Wunder, der Kleine hatte die Erzieherinnen sicher längst um den Finger gewickelt. Das schaffte er bei allen. Mit seinen großen Augen und dem strahlenden Lächeln konnte ihm niemand etwas abschlagen oder ihm lange böse sein. Dabei hatte er es faustdick hinter den Ohren. Eine Eigenschaft, von der ich gern behauptete, dass er sie von mir geerbt hatte. Von meiner Schwester kam das manipulierende Lächeln jedenfalls nicht. Sie war immer die Mustertochter, die meine Eltern sich gewünscht hatten. Sie hatte getan, was von ihr verlangt wurde, und nur Bestnoten nach Hause gebracht. Bis sie mit einundzwanzig weinend auf der Couch meiner Eltern gesessen und ihnen gestanden hatte, dass sie schwanger war.
Mit aller Macht verdrängte ich den Gedanken an das Arschloch, das meine große Schwester einfach sitzen gelassen und ihr Leben unwiderruflich verändert hatte. Es würde mich nur wütend machen, und ich trug bereits genug Frust mit mir herum. Unruhig betätigte ich die Türklingel ein zweites Mal.
Keine Sekunde später wurde sie energisch aufgerissen. Verblüfft starrte ich die junge Frau an, die vor mir stand. Es war die Kleine aus dem Park. Die, die mich mit einem Schwall Wasser unsanft aus meinem komaähnlichen Schlaf geholt hatte.
Zugegeben, ich hatte es verdient. Normalerweise trank ich nicht so viel, dass ich es nicht einmal mehr bis nach Hause schaffte. Solche Fehltritte waren nicht geduldet. Weder von meinem Vater, der zwar nichts von der Aktion mitbekommen, für meine Fehlentscheidungen aber ein gruselig genaues Gespür hatte, noch von den Dozenten an der Uni, die vollen Einsatz erwarteten.
»Du.« Sie kniff die Augen zusammen. Ein wütendes Funkeln lag darin, was mich zum Lächeln brachte.
Sie sah hübsch aus. Rostrote Haare ergossen sich über ihre Schultern und erinnerten an die Farbe von Herbstblättern. Es passte zu ihren zarten Gesichtszügen, doch die schokoladenbraunen Augen, die mich böse musterten, widersprachen ihrer ansonsten sanften Ausstrahlung vollkommen. Irgendwie faszinierte mich dieser Gegensatz.
»Also?«, fragte sie, als ich nichts sagte.
»Also was?«
»Ich warte.« Auffordernd schaute sie mich an.
Mit Mühe unterdrückte ich ein Lachen. »Okay.« Ich machte einen Schritt auf die offene Tür zu, doch sie versperrte mir den Weg. »Ähm, ich muss da rein«, sagte ich.
»Ähm, ich glaube, du hast was vergessen.«
»Und was, wenn ich fragen darf?« Diese Unterhaltung wurde immer skurriler.
»Eine Entschuldigung.«
Einen Moment lang sah ich sie sprachlos an. Ich suchte in ihrem Gesicht nach einem Anzeichen, dass sie scherzte, doch sie blieb vollkommen ernst. »Du denkst, ich bin hier, um mich zu entschuldigen? Weil ich … Was? Auf einer Bank auf dem Spielplatz geschlafen habe? Dass das ein Verbrechen ist, ist mir neu.« Diesmal konnte ich mir das Grinsen nicht verkneifen.
»Du willst dich gar …? Oh«, sie brach ab und fuhr sich mit einer Hand durch die Haare.
»Ich bin hier, um meinen Neffen abzuholen.«
Sie trat einen Schritt zurück und räusperte sich. »Deinen Neffen?«
Bildete ich es mir nur ein oder breitete sich auf ihren Wangen eine zarte Röte aus?
»Jepp. Dachtest du wirklich, ich wäre extra zum Kindergarten gefahren, in der Hoffnung, dass es überhaupt der richtige ist, nur um mich zu entschuldigen? Davon abgesehen, soweit ich mich erinnere, schuldest du mir eine Entschuldigung. Du hast mich schließlich zu einer unfreiwilligen Dusche gezwungen.« Die ich nötig gehabt hatte, aber den Teil sprach ich wohlweislich nicht aus.
Sie verengte die Augen und öffnete den Mund, doch es kamen keine Worte heraus.
»Hat es dir die Sprache verschlagen?«, neckte ich sie.
Je länger ich hier stand, desto größer wurde die Neugier: Wer war diese junge Frau? Obwohl mir nicht entgangen war, dass sie mich eingehend gemustert hatte, reagierte sie zögerlich. Sie war offenbar nicht leicht zu beeindrucken. Beziehungsweise wenn, dann ließ sie es sich zumindest nicht anmerken.
Sie murmelte etwas, was wie Idiot klang und drehte sich in Richtung Flur, der ins Innere des Kindergartens führte.
»Maisie? Ist alles in Ordnung?« Ihre Kollegin, eine Frau mit blondem Sidecut und schwarz-gelb gepunktetem Pullover trat zu ihr und musterte mich neugierig.
Maisie nickte und deutete dann mit dem Kopf auf mich.
Offenbar verstand ihre Kollegin ihre nonverbale Kommunikation sofort, denn sie wandte sich prompt an mich. »Hi. Wie kann ich dir weiterhelfen?«
»Ich möchte Teddy abholen. Er ist mein Neffe«, erwiderte ich und versuchte, mich auf sie statt auf Maisie zu konzentrieren, die mit verschränkten Armen abwartete, was als Nächstes passierte. Doch so ganz wollte mir das nicht gelingen.
»Aha. Und du bist …?«
»Weston. Meiner Schwester Rose ist ein Termin dazwischengekommen.«
»Richtig, sie hat vorhin angerufen und Bescheid gegeben, dass du ihn heute abholst. Sorry für das Misstrauen, aber wir sind da etwas vorsichtig. Könnte ja sonst jeder behaupten. Komm rein. Teddy ist bereits fertig angezogen. Die anderen Kinder wurden vor einer halben Stunde abgeholt.« Ihr Blick wurde kurz streng, als wäre ich eines der Kinder, die sie maßregeln musste, doch dann lächelte sie wieder höflich.
Ich schaute unauffällig zu Maisie, die seit dem Auftauchen ihrer Kollegin kein Wort mehr gesagt hatte. Schade eigentlich. Ich mochte ihre Stimme. Sie war nicht so durchdringend wie die der blonden Frau, sondern angenehm ruhig. Selbst wenn sie wütend war, klang sie noch sanft. Keine Ahnung, wie das möglich war. Schnell schüttelte ich den Gedanken ab und wollte Maisies Kollegin folgen. Doch bevor ich den Flur betreten konnte, kam mir Teddy bereits entgegengerannt.
»Wesyyy!«, brüllte er und sprang direkt in meine Arme.
Lachend hob ich ihn hoch und wirbelte ihn durch die Luft. Er stieß ein begeistertes Jauchzen aus, was meine Laune schlagartig besserte. Es gab kein schöneres Geräusch als Teddys Lachen.
»Mummy hat gar nicht gesagt, dass du mich heute abholst«, sagte er, als ich ihn wieder absetzte.
»Weil es eine Überraschung sein sollte.« Ich ging vor ihm in die Hocke und wuschelte ihm durch die braunen Locken.
»Lass das.« Kichernd stieß er meine Hand weg. »Können wir dann wieder Pommes essen?«, fragte er hoffnungsvoll.
»Ich dachte da eher an Nudeln mit Soße.«
»Bitte, Wesy. Bitte, bitte, bitte.« Seine Augen wurden immer größer, und ich hielt seinem Blick ungefähr zwei Sekunden stand, bevor ich einknickte.
»Na schön. Aber erzähl deiner Mutter nichts davon. Sonst bekomm ich wieder Ärger.«
»Ich sag nix. Das bleibt unser Geheimnis«, versprach er feierlich.
»Auf dich ist Verlass.« Lächelnd stand ich auf und wandte mich zu Maisie und ihrer Kollegin um.
Die beiden starrten mich mit offenem Mund an. Erstaunen lag in ihrer Miene – und noch etwas anderes. Vor allem aus Maisies Gesicht war jeder Anflug von Wut verschwunden. Stattdessen betrachtete sie mich mit einem interessierten Ausdruck.
Ich schluckte schwer und versuchte, nicht in ihren tiefen Augen zu versinken, die wie zwei helle, bodenlose Seen schimmerten. Verflucht, sie musste aufhören, mich so anzusehen. Ich war diese Art von Blicken nicht gewohnt. Ich kannte Blicke, in denen sich Verlangen spiegelte. Genauso wie die neidischen oder neugierigen Blicke, die unweigerlich auf mir landeten, wenn ich erzählte, wo mein Dad arbeitete. Aber Maisies aufrichtiges Interesse? Das war neu – und es ging mir unter die Haut.
»Also dann«, durchbrach ihre Kollegin die Stille.
Ich versuchte, nicht ertappt zusammenzuzucken, und räusperte mich. »Sagst du noch Tschüss?«, fragte ich Teddy, der sich sofort zu Maisie umdrehte und ihr mit seiner kleinen Hand zuwinkte.
»Bis morgen, Missie.«
»Es heißt Maisie«, verbesserte ich schmunzelnd.
Teddy runzelte die Stirn. »Hab ich doch gesagt. Missie. Stimmt doch, oder?« Er riss die Augen auf und warf Maisie einen aufgeregten Blick zu.
»Es heißt tatsächlich Maisie. Aber du kannst auch Missie sagen«, versicherte sie ihm lächelnd, und für eine winzige Sekunde lang wünschte ich, ich wäre an seiner Stelle. Verdammt, der Kleine hatte es drauf. Mit seinen vier Jahren schaffte er es mühelos, die Herzen aller Anwesenden im Sturm zu erobern.
»Okay, dann bis zum nächsten Mal«, sagte ich an Maisie gewandt, ehe ich mit Teddy den Kindergarten verließ und hinaus in die Sonne trat.
»Missie ist meine Lieblingsbetreuerin«, erklärte er mir, während wir zur Wohnung meiner Schwester gingen.
»Das glaube ich dir sofort.«
Ihr irritierter Blick beim Abschied war köstlich gewesen. Die Worte waren mir herausgerutscht, ehe ich sie zurückhalten konnte. Dabei war sie überhaupt nicht mein Typ. Doch Maisie hatte etwas an sich, was mich herausforderte. Als wäre sie ein Rätsel, das es zu lösen galt. Was bescheuert war, weil ich weder Zeit für Rätselraten noch für neue Bekanntschaften hatte. Ganz abgesehen davon, dass sie nicht gerade den Eindruck gemacht hatte, mich unbedingt besser kennenlernen zu wollen.
Und trotzdem.
Vielleicht lag es an meinem übermüdeten Gehirn, das von dem vielen Büffeln keine klaren Gedanken mehr zustande brachte, aber mein Gefühl sagte mir, dass das nicht Maisies und mein letztes Aufeinandertreffen gewesen war.
Es würde ein nächstes Mal geben. Zumindest hoffte ich das.
4. KAPITEL
Maisie
Das erste Treffen in der Schreibwerkstatt stand kurz bevor. In den letzten Tagen hatte ich mehrmals auf die Adresse gestarrt, die auf dem Zettel stand, den Dr. Rae mir mitgegeben hatte. Bis zum Schluss war ich mir nicht hundertprozentig sicher gewesen, ob ich wirklich hingehen würde, doch hier war ich. Auf dem Weg zu einer Gruppe fremder Menschen, die über ihre Texte sprachen. In meinem Magen hatte sich ein mulmiges Gefühl breitgemacht, und ich war mehr als einmal kurz davor, wieder umzukehren.
Vor einem mehrstöckigen Gebäude, das auf den ersten Blick unscheinbar wirkte, blieb ich schließlich stehen. Hier im Erdgeschoss befand sich die Schreibwerkstatt. Ich atmete tief durch und wiederholte in Gedanken noch mal Dr. Raes Frage: Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Richtig, nicht viel. Ich würde diese Stunde ganz sicher lebend überstehen.
Nachdem ich das Gebäude ein paar weitere Atemzüge lang einfach nur angestarrt hatte, nahm ich meinen Mut zusammen und klingelte.
Ich musste nicht lange warten, bis ein Mann, den ich auf Ende dreißig schätzte, öffnete und mich freudig anlächelte. »Hi, du musst Maisie sein, oder?«
»Ja. Hallo.«
»Ich bin Brian und leite die Werkstatt. Komm rein.«
Etwas überrumpelt folgte ich ihm in einen kleinen Raum, der mit mehreren zusammengeschobenen Tischen und Stühlen ausgestattet war. An den Wänden reihten sich Bücherregale, was mein Herz automatisch schneller schlagen ließ. Für einen Moment lang vergaß ich sogar meine Aufregung.
»Schön, dass du hier bist, Maisie. Wir freuen uns immer über Zuwachs. Lucy Rae hat erzählt, dass du eventuell kommen wirst.« Er warf mir ein aufmunterndes Lächeln zu, das ich zögernd erwiderte. Scheinbar hatte meine Therapeutin ihn bereits vorgewarnt, ohne zu wissen, ob ich überhaupt kommen würde. Oder kannte sie mich inzwischen so gut, dass sie mir mehr Mut zutraute als ich mir selbst? Damit wusste ich zumindest, dass er mich nicht drängen würde, einen Text vorzutragen. Wobei Brian nicht den Eindruck machte, als würde er hier schulähnliche Regeln aufstellen. Mit dem lockeren Hemd und der ausgebleichten Jeans gab er ein völlig anderes Bild ab, als ich es von einem Dozenten erwartet hatte.
»Du darfst dir gern einfach einen Platz aussuchen.« Er deutete auf die freien Stühle an den Tischen. Bisher waren nur zwei andere Leute da. Ein Kerl, der mit finsterer Miene auf sein Handy starrte, und ein dunkelhaariges Mädchen mit blauen Augen, die es mit einem schwarzen Kajal umrundet hatte. Als unsere Blicke sich kreuzten, winkte sie mir zu.
Ich gab mir selbst einen Ruck und setzte mich zu ihr an den Tisch.
»Du bist neu hier, oder?«, fragte sie.
Ich nickte. Sie wirkte nett, trotzdem schaffte ich es nicht direkt, zu sprechen. Das gelang mir meistens erst, wenn ich die Leute ein bisschen kannte. Oder wenn ich starke Emotionen spürte, wie die spontane Empörung auf diesen Weston, weil er einfach auf dem Spielplatz geschlafen und dann auch noch unverschämt gegrinst hatte. Bei ihm waren die Worte und meine Stimme einfach da gewesen.
»Ich bin mir sicher, du wirst es lieben«, fuhr das Mädchen fort. »Die Gruppe ist wirklich cool. Manchmal geht es hier ein bisschen chaotisch zu, und die meisten von uns sind etwas durchgeknallt, aber du weißt ja, wie das mit kreativen Leuten ist.« Sie lachte hell auf und fuhr sich durch die Haare, die ihr in sanften Wellen über die Schultern fielen. »Aber es sind oft richtig gute Texte dabei. Und Brian ist ein super Typ. Er lässt uns viel ausprobieren, gibt gleichzeitig aber wirklich gute Impulse. Ach so, ich bin übrigens Emma, aber nenn mich ruhig Em, das tun alle.« Sie streckte mir die Hand entgegen, die ich überrumpelt ergriff.
Wow, das waren eine Menge Worte gewesen.
»Ich bin Maisie.« Nach ihrer schwallartigen, kurzen Rede fiel es mir leichter, mein Schweigen zu durchbrechen. Bestimmt war ihre Art für manche Menschen im ersten Moment überfordernd, mir kam sie jedoch zugute.
»Ein schöner Name.« Ihre blauen Augen blitzten hell auf, als sie lächelte.
»Danke.« Ich konnte nicht anders, als sie anzustarren. Emma strahlte pure Energie aus. Sie war quirlig und fröhlich, redete wie ein Wasserfall und hatte für jeden ein Lächeln.
Nach und nach trudelten auch die anderen ein, und sobald alle da waren, begann Brian den Kurs mit einer kurzen Befindlichkeitsrunde, in der jeder erzählen sollte, wo ihm heute der Kopf stand und was er in den Kurs miteinbringen wollte. Als ich an der Reihe war, hielt ich mich so kurz wie möglich, sagte meinen Namen und dass ich gespannt auf die Gruppe sei, was ich bereits als Erfolg verbuchte.
Während im Anschluss zwei Teilnehmer aus der Gruppe ihre Texte zum Thema Glücksmomente vortrugen – was wohl das Thema der letzten Wochen und so was wie eine Hausaufgabe gewesen war –, sah ich aus dem Augenwinkel immer wieder zu Emma. Obwohl sie aufmerksam zuhörte, schaffte sie es kaum, eine Minute lang still zu sitzen. Entweder spielte sie mit einem Stift oder wippte mit ihrem Fuß. Was normalerweise ausreichen würde, um mich in den Wahnsinn zu treiben, hatte bei Emma seltsamerweise eine entspannende Wirkung auf mich. Vielleicht lag es aber auch an den Texten, die heute vorgetragen wurden – ein kurzes Gedicht über das Meer und ein längerer Text über die kleinen Augenblicke im Alltag, die einen glücklich machten. Während die anderen begeistert applaudierten, brauchte ich kurz, um das Gehörte sacken zu lassen. Die beiden hatten nicht nur mit der Sprache gespielt, sondern auch geschickt Metaphern eingebaut und die Gruppe während des Vortragens in ihren Bann gezogen. Ich war dabei völlig zwischen den Zeilen versunken und hatte an mein eigenes Glück gedacht. An Charlotte und Amelia, und dass ich für mein Leben, wie es war, insgesamt wahnsinnig dankbar sein konnte. Selbst wenn ich es nicht schaffen würde, etwas vorzutragen, lohnte sich die Schreibwerkstatt allein schon für die Beiträge der anderen.
Ich richtete meine Aufmerksamkeit zurück auf Brian, der gerade die neue Aufgabe erklärte. Scheinbar brachte er alle zwei Wochen ein neues Thema mit, zu dem dann ein Text erarbeitet werden sollte. Dabei wurde die erste Stunde zum Sammeln der Ideen oder für erste Entwürfe genutzt, den eigentlichen Text sollten wir dann allerdings zu Hause schreiben. Ich schaute auf das Notizbuch, das vor mir lag und in dem sich unzählige angefangene, aber auch ein paar beendete Texte von mir befanden. Ob ich irgendwann so weit war, mich ebenfalls vor die Gruppe zu stellen und einen davon zu teilen?
»Heute gibt es als Impuls ein Zitat von Ernest Hemingway«, sagte Brian, und ein Kichern ging durch die Runde.
»Hemingway ist sein Lieblingsautor, und er zitiert ihn bei wirklich jeder Gelegenheit«, flüsterte Emma mir zu.
»Das habe ich gehört, Emma.« Brian warf ihr einen gespielt strengen Blick zu. »Also, das wird das Motto für die nächsten Stunden sein.« Er trat an die Tafel hinter sich und schrieb mit geschwungenen Buchstaben einen Satz auf den schwarzen Hintergrund. Als er zur Seite trat, runzelte ich die Stirn.
Write hard and clear about what hurts. – Ernest Hemingway
Wir sollten darüber schreiben, was uns schmerzte? Wow! Nicht gerade eine einfache Übung.
»Ich weiß, dass ich viel verlange. Aber schreiben ist immer persönlich. Mit jedem Text, den ihr verfasst, zeigt ihr einen Teil eurer Seele. Das kann beängstigend sein, aber auch sehr befreiend. Es ist euch überlassen, was ihr mit dem Zitat macht und wie ihr es in eure Texte einfließen lasst. Wie immer gilt: Nichts muss und alles kann. Selbstverständlich ist das Vortragen der Ergebnisse freiwillig, auch wenn diese Gruppe davon lebt, dass ihr eure Texte teilt und wir sie gemeinsam besprechen. Fürs Erste findet euch bitte in Zweiergruppen zusammen und brainstormt ein bisschen, was euch zu dem Zitat einfällt.«
Auf Brians Worte folgte geschäftiges Gemurmel. Tische wurden zusammengeschoben und Stühle gerückt.
»Okay, das ist vermutlich kein einfacher Einstieg für dich, aber ich bin mir sicher, wir kriegen das hin«, sagte Emma und wandte sich mir erwartungsvoll zu.
Erleichtert, dass sie mich nicht allein ließ, drängte ich meine Angst zurück und nickte. Ich konnte das schaffen.
»Was hältst du davon, wenn jede von uns erst mal auf einem Zettel Wörter und Sätze sammelt, die uns zu dem Zitat einfallen?«, schlug Emma vor.
»Das klingt super«, erwiderte ich. Ob sie das Rumpeln der Steine hörte, die mir gerade vom Herzen fielen?
In den nächsten Minuten saßen wir schweigend an unserem Tisch und schrieben alles auf, was uns zu dem Zitat einfiel. Meine Liste zu den Dingen, die schmerzten, war schnell gefüllt:
Schweigen. Das Wort war mir als Erstes in den Sinn gekommen. So viele Jahre lang hatte ich das Schweigen mit mir herumgetragen. Wenn ich vor vier Jahren nicht von einem Arzt in eine Klinik geschickt worden wäre, in der mehrere Therapeuten mit mir gearbeitet hatten, würde ich vermutlich heute noch überwiegend schweigen. Die Erinnerungen an diese Zeit schmerzte, womit ich bei meinem nächsten Begriff war.
Erinnerungen. Manchmal schreckte ich nachts aus einem Albtraum hoch, an den ich mich nicht mehr erinnerte. Doch das Gefühl von namenlosem Entsetzen und einem tief sitzenden Schock war jedes Mal dasselbe. Ich wusste nicht mehr viel über den Tag, an dem ich meine Eltern bei einem Unfall verloren hatte, doch die wenigen, verschwommenen Erinnerungen, die geblieben waren, taten weh. Sie begleiteten mich, seit ich denken konnte, und ich wusste nicht, ob sie je weniger schmerzen würden.
Nachdenklich blickte ich auf den nächsten Punkt. Die Welt und was mit ihr passiert. Ich hatte schon immer viel nachgedacht. Wenn ich mit Charlotte die Nachrichten ansah, gelang es ihr meist mühelos, danach einen Spielfilm zu beginnen und in die Handlung einzutauchen. Während mich die Bilder von Armut, Ungerechtigkeiten, Gewalt, brennenden Wäldern und anderen Folgen des Klimawandels noch stundenlang verfolgten, schaffte sie es, die Realität auszublenden. Mein Leben wäre einfacher, wenn ich nicht so viel nachdenken würde. Mich nicht so viel kümmern würde. Doch mein Alltag war nie laut genug, um mich den Weltschmerz vergessen zu lassen. Deshalb hatte ich mich in der Schule auch in einer Umwelt-AG engagiert. Ich vermisste das. Neben der Arbeit im Kindergarten schaffte ich es allerdings kaum noch, zu Demonstrationen oder anderen Aktionen zu gehen, bei denen es um einen nachhaltigeren Umgang mit dem Planeten und unseren Ressourcen ging. Aber vielleicht konnte ich hier in der Gruppe zumindest darüber schreiben und mich austauschen. Das würde immerhin ein bisschen helfen, den Weltschmerz zu lindern.
»Bist du fertig?« Emmas leise Stimme riss mich aus meinen Gedanken.
»Ja«, murmelte ich und kämpfte gegen den Drang an, die Liste zu verstecken.
»Du musst es mir nicht zeigen.«
Ich atmete tief durch und schüttelte den Kopf. »Ich will es aber.« Genau darum ging es bei dieser Schreibwerkstatt schließlich: Ich wollte über meinen Schatten springen.
Emma nahm die Liste vorsichtig entgegen, als ich sie zu ihr rüberschob. Sie überflog meine Notizen und warf mir einen langen Blick zu, den ich jedoch nicht recht deuten konnte.
»Das sind Punkte, die ich gut verstehen kann. Vor allem das mit dem Weltschmerz«, sagte sie schließlich.
Nach einem kurzen Zögern schob sie mir ihren Zettel zu.
Das Gefühl, nicht frei zu sein stand ganz oben auf dem Blatt. Es passte zu ihr. Die Frage, warum sie sich überhaupt so fühlte, lag mir auf der Zunge, doch ich sprach sie nicht aus. Wir kannten uns zu kurz, um über so persönliche Dinge zu reden. Mein Blick fiel auf die restlichen Punkte: Verlust, ein gebrochenes Herz, enttäuscht zu werden und andere zu enttäuschen. Ich hätte jeden einzelnen davon auch auf meine Liste setzen können.
»So, die Zeit ist um. Wir sehen uns nächste Woche wieder.« Brians Stimme ließ mich kurz zusammenzucken. Ich hatte gar nicht bemerkt, wie die Zeit vergangen war. An unserem Tisch blieb er kurz stehen. »Hat es dir gefallen, Maisie?«
Ich nickte begeistert. »Sehr! Die Texte waren wahnsinnig gut.«
»Das freut mich, zu hören. Dann sehen wir dich ab jetzt hier ja sicher öfter.« Er nickte mir lächelnd zu und ging dann nach vorn.
»Das war wirklich eine schöne Einheit«, sagte Emma. »Wirst du nächste Woche wiederkommen?«
»Ich denke, ja«, erwiderte ich. Die Leute hier waren zwar völlig unterschiedlich, hatten aber alle eins gemeinsam: die Liebe zur Literatur. Das machte die Gruppe aus, und obwohl ich sie noch nicht kannte und die meisten Namen direkt wieder vergessen hatte, war ich mir sicher, dass ich mich hier wohlfühlen würde.
Ich verabschiedete mich von Emma und winkte ihr noch mal kurz zu, ehe ich mich auf den Heimweg machte. Da es schon wieder nieselte, beschloss ich, den Bus zu nehmen. In Gedanken arbeitete ich bereits an einem Text zum Thema Erinnerungen. Die Beiträge der anderen hatten mich inspiriert, und in meinen Fingern kribbelte es erwartungsvoll. Vielleicht hatte Dr. Rae tatsächlich recht, und die Sache mit der Schreibwerkstatt war genau das Richtige für mich.
Der Rest der Woche verging wie im Flug. Die Begriffe, die Emma und ich gesammelt hatten, hatten mich die letzten Tage ständig begleitet, und obwohl ich den Text für die Schreibwerkstatt gestern Abend fast fertig geschrieben hatte, ertappte ich mich immer wieder dabei, wie ich in Gedanken weiterhin mit ihnen spielte. Selbst jetzt, wo ich mit Charlotte am Frühstückstisch saß.
»Kaffee?« Sie hob fragend eine Kanne mit dampfendem Kaffee in die Höhe.
»Nein, danke.« Ich zeigte auf mein Glas Orangensaft, das wie jeden Morgen vor mir stand.
Man sollte meinen, dass Charlotte nach sechzehn Jahren Zusammenleben wusste, dass ich keinen Kaffee mochte, schließlich war ich ein kleines Kind gewesen, als Amelia und ich zu ihr gekommen waren. Andererseits, meine Tante verließ das Haus morgens meistens vor mir oder setzte sich gar nicht erst zum Frühstücken an den Tisch. Die einzige Ausnahme bildete das Wochenende, was auch der Grund für das entspannte Lächeln im Gesicht meiner Tante war.
»Wie war deine Woche?«, fragte sie, nachdem sie einen großen Schluck Kaffee getrunken hatte.
»Ganz gut«, antwortete ich ausweichend und griff nach einem Brötchen, wohl wissend, dass sie eigentlich hören wollte, wie es in der Schreibgruppe gelaufen war. Bisher hatte sie sich mit Fragen erstaunlich gut zurückgehalten. Allerdings hatte sie Mittwoch auch einen Elternabend an ihrer Schule gehabt, weshalb die Gelegenheit, mich direkt auszufragen, nicht da gewesen war.
Sosehr ich ihre Neugier auch verstand, ich wollte noch nicht darüber sprechen. Es hatte sich gut angefühlt, mit Emma zu reden, und die Gruppe wirkte nett, aber wenn ich mit Charlotte darüber sprach, war sie gleich wieder aus dem Häuschen, und den Druck konnte ich nicht gebrauchen. Die Schreibwerkstatt war etwas, was ich nur für mich tat. Auch wenn ich den Schubs von Dr. Rae dafür gebraucht hatte, hatte die Entscheidung letztendlich bei mir gelegen, und ich war froh, sie getroffen zu haben. Wenn ich wollte, dass sich etwas in meinem Leben veränderte, dass ich mich mehr mit anderen austauschte, dann musste ich solche Chancen ergreifen. So viel hatte ich inzwischen kapiert.