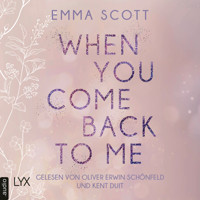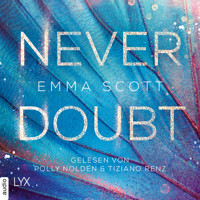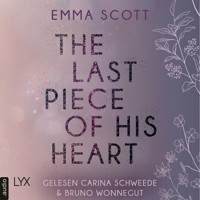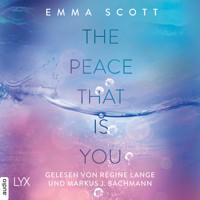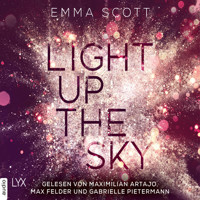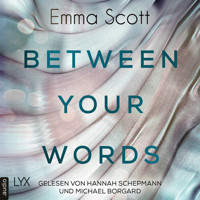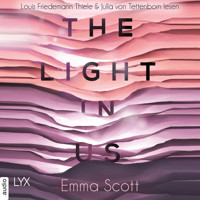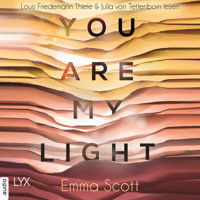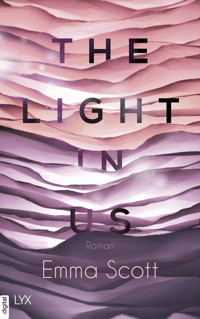
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Light-in-us-Reihe
- Sprache: Deutsch
Du bist das Licht in meiner Dunkelheit, Charlotte ...
Charlotte Conroy stand am Anfang einer großen Karriere als Violinistin, als die Musik in ihr verstummte. Aus Geldnot nimmt sie den Job als Assistentin für einen blinden jungen Mann an. Noah Lake war Extremsportler und Fotograf, bis er bei einem Unfall sein Augenlicht verlor und sich von der Welt zurückzog. Mit jedem gescheiterten Versuch, Charlotte zu vergraulen, schleicht sich die junge Frau mehr in Noahs Herz und reißt die Mauern ein, die er um sich errichtet hat. Doch um wirklich zu leben - und zu lieben - müssen sie sich gemeinsam ihren inneren Dämonen stellen ...
"Atemberaubend, wunderschön, einzigartig" MARYSE'S BOOK BLOG
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Hörvorschläge
Zitate
ERSTER AKT: ADAGIO
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
ZWEITER AKT: ALLEGRO
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
DRITTER AKT: KADENZ
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Emma Scott bei LYX
Impressum
EMMA SCOTT
THE LIGHT IN US
Roman
Ins Deutsche übertragen von Inka Marter
Zu diesem Buch
Charlotte Conroy stand am Anfang einer großen Karriere als Geigerin, als ihr Leben zerbrach und die Musik in ihr verstummte. Nun hat sie die Hoffnung schon fast aufgegeben, diesen Funken jemals wiederzuerwecken. Aus Geldnot nimmt sie den Job als Assistentin für einen jungen Mann an, der sein Augenlicht bei einem schrecklichen Unfall verloren hat. Noah Lake war stets vom Glück geküsst – Extremsportler, Journalist und Fotograf, immer auf der Jagd nach dem nächsten Adrenalinrausch, dem nächsten Kick, den spektakulärsten Bildern. All das hat ihm ein einziger, riskanter Sprung von den Klippen Acapulcos in nur einem Moment geraubt. Traumatisiert von seinen Verletzungen, konfrontiert mit all seinen zerstörten Träumen und Hoffnungen, stößt er die Menschen um sich herum von sich. Doch Charlotte sieht hinter seine Fassade aus Zorn und Schmerz. Sie ist entschlossen, Noah zu zeigen, dass sein Leben nicht vorbei ist, dass es noch Freude geben kann und in ihm so viel mehr steckt als das, was sein altes Ich ausmachte. Mit jedem gescheiterten Versuch, Charlotte wie alle anderen zu vergraulen, schleicht sich die junge Musikerin weiter in Noahs Herz und reißt die Mauern ein, die er um sich errichtet hat. Doch ihre Liebe hat nur eine Chance, wenn auch Charlotte sich ihren Dämonen stellt und dafür kämpft, die Flamme in sich wieder zu entfachen …
Dies ist ein Roman. Namen, Figuren, Begebenheiten, Orte und Ereignisse entspringen der Vorstellungskraft der Autorin oder werden auf fiktive Weise gebraucht. Jede Ähnlichkeit mit realen Ereignissen oder Personen – tot oder lebend – ist rein zufällig. Der Geschichte zuliebe habe ich mir ein paar Freiheiten erlaubt. Das gilt vor allem für einen gewissen Ballsaal in einem gewissen New Yorker Gebäude, aber ansonsten habe ich versucht, New York so realistisch zu zeichnen, wie ich es in Erinnerung habe, wobei es ein größeres Talent erfordert als das meine, diese Stadt in ihrer einzigartigen Pracht einzufangen.
Für Erin Thomasson Cannon, ohne deren Unterstützung, Freundschaft und Rat in den vielen Stunden der Not dieses Buch wahrscheinlich nie die Festplatte meines Computers verlassen hätte. Von ganzem Herzen: Danke.
Hörvorschläge
Wolfgang Amadeus Mozart: Violinkonzert Nr. 5
Green Day: »Good Riddance (Time of Your Life)«
[New York] hält einen Mann bei den Eingeweiden; er wird trunken vor Ekstase; er wird jung und wunderbar,er fühlt, dass er nie sterben kann. – Walt Whitman
Es ist kein Unglück, blind zu sein; es ist nur ein Unglück, die Blindheit nicht ertragen zu können. – John Milton
ERSTER AKT: ADAGIO
Prolog
Noah
Ich jage den Grand Couloir in Courchevel, Frankreich, hinab. Der eiskalte Wind schlägt mir ins Gesicht. Im Slalom rase ich zwischen zerklüfteten Felsen hindurch. Seitlich spritzt der Schnee weg. Dann werde ich schneller, die Abfahrt wird steiler, irgendwann fast senkrecht. Mein Herz klopft, mein Atem geht keuchend wie der eines angreifenden Keilers. Statt Blut fließt Adrenalin durch meine Adern.
Der Hang steigt an. Eine Schanze. Ich gehe in die Hocke, um Fahrt aufzunehmen, und plötzlich ist kein Schnee mehr unter meinen Skiern, und ich fliege …
… ich fliege, gleite, das Nylonsegel flattert über mir, und ich halte die Stange fest gepackt. Die Luft ist warm und der Himmel golden und blau – die Dämmerung ist über Kahului hereingebrochen. Mein Hängegleiter sinkt und steigt wieder auf, ich spüre jede Veränderung im Wind und bewege mich mit ihm. Höher und höher steige ich, die Inseln sind nur noch Sandhäufchen mit fransigen, grünen Rändern.
Ich sause hinab, lenke den Gleiter abrupt wieder nach oben, überschlage mich fast dabei. Ich stoße einen Triumphschrei aus und nutze den Aufwind, um wieder zu steigen, immer höher, bis ich fast die Sonne berühre. Wie Ikarus, nur dass ich nicht verbrenne. Ich nicht, ich steige noch höher.
Sobald ich hoch genug bin, stoße ich im Sturzflug hinab. Das Gurtzeug ist so straff gespannt, dass es reißt. Auch das Nylonsegel reißt ab, und dann sind da nur noch ich und der Ozean – und ich gebe mich sicher nicht geschlagen. Ich strecke die Arme aus, um ins Wasser zu stechen wie ein Dolch. Ich tauche …
… Ich springe von La Quebrada, Acapulco, aus einer Höhe von 40 Metern. Nur fünf Sekunden lang ist das Wasser tief genug, bevor die Wellen sich wieder zurückziehen. Ich stehe vor Anspannung geradezu hörbar unter Strom. Es ist ein perfektes Gefühl, fast ekstatisch, unerträglich. Ich springe und schreie voller Hochmut meinen Triumph heraus, weil ich unbesiegbar bin.
Rauschend schlägt das Wasser mir entgegen und ich tauche im perfekten Winkel ein, schieße wie ein Pfeil in die tiefe, blaugrüne Kälte, wo goldene Lichtpunkte im grünen Nass aufblitzen. Ich komme zu keinem Halt, ich werde nicht einmal langsamer. Ich kann nicht. Ich gelange immer tiefer, und mein Triumph nimmt mir den Atem. Meine Lungen ziehen sich zusammen, meine Trommelfelle explodieren und ich tauche immer noch tiefer. Das Wasser ist dunkelgrün, dann bloß noch dunkel, dann schwarz. Ich kriege keine Luft. Ich kann nichts sehen. Mein Kopf prallt auf die zerklüfteten Felsen am Meeresboden, und da ist nur noch Schmerz …
Ein Schrei entringt sich meiner Kehle – ein letzter Schrei, bevor ich in dem schwarzen Abgrund ertrinke.
Aber nein, wenn ich schreien kann, kann ich auch atmen. Ich bin nicht unter Wasser, nicht in der Tiefe. Ich liege in einem Bett in New York, mein Körper ist schweißnass, und meine Hände umklammern die Bettdecke.
Erleichterung durchflutet mich wie früher das Adrenalin, und ich öffne die Augen. Doch meine Augen sind schon offen. Ich bin nicht länger in der schwarzen Tiefe, aber ich kann trotzdem nichts sehen.
Ich bin blind.
Kapitel 1
Charlotte (damals)
Er war sanft wie immer. Ich wollte ihm sagen, er solle ruhig aufhören, sich zurückzunehmen, es sei in Ordnung. Es war das achte Mal – ja, ich zählte mit – und tat längst nicht mehr weh. Er war rücksichtsvoll, dachte ich. Rücksichtsvoll, aber mit ziemlichem Eifer dabei. Vielleicht etwas zu viel Eifer. Wieder war alles vorbei, bevor ich überhaupt richtig in Stimmung kam. Nach ein paar Minuten brach er über mir zusammen. Doch auch wenn mein Körper unbefriedigt war, wärmte es mir das Herz, als Keith den Kopf hob und mich müde und zufrieden anlächelte.
Das mit dem Sex war noch neu für mich, aber es gefiel mir. Sogar sehr, wenn ich ehrlich war. Zugegeben, einen Orgasmus hatte ich noch nicht gehabt, aber ich war 21 und Anfängerin. Mit etwas Übung würde ich schon noch dahin kommen. Und ich war mehr als bereit, mit meinem gut aussehenden neuen Freund zu üben. Meinem ersten Freund. Meiner ersten Liebe.
Ich wollte Keith gerade umarmen, da rollte er sich von mir hinunter, auf den Rücken, und küsste mir die Hand. »Ich habe einen Kurs«, sagte er. »Und du, meine Liebe, hast heute Abend ein Probespiel. Das wichtigste deines Lebens.«
»Meines bisherigen Lebens«, sagte ich und grinste. »Nach dem Studium werde ich mich bei den New Yorker Philharmonikern bewerben. Oder vielleicht beim Symphonieorchester in Boston.«
Damit mein kleiner Bruder stolz auf mich ist. Chris’ Worte hallten in meinem Kopf: »Zuerst die Juilliard, dann die Philharmoniker.« Das hatte er zum Abschied gesagt, als ich aufs College ging. Ich hielt daran fest wie an einem Mantra und hatte mir geschworen, die Worte wahr werden zu lassen. Falls man mich bei den Spring Strings nahm, dem Streichquartett, das Keith als Examensprojekt ins Leben gerufen hatte, wäre es ein Schritt in die richtige Richtung, ein hübscher Eintrag in meinem Lebenslauf.
Ein plötzlicher Gedanke ließ mein Lächeln verblassen. »Wenn ich den Platz kriege, werden alle glauben, es läge nur daran, dass wir zusammen sind.«
Keith war aufgestanden und zog sich mit dem Rücken zu mir die Hose an. Sein blondes Haar glänzte in dem Licht, das durch das kleine Schlafzimmerfenster fiel. »Gut möglich«, sagte er. Er drehte sich um, beugte sich über das Bett und gab mir einen Kuss, bevor er sich wieder aufrichtete und dieses einnehmende Lächeln zeigte, bei dem mein Herz selbst noch nach einem Monat flatterte wie ein Vogel im Käfig. »Du solltest ihnen also beweisen, dass es nicht stimmt.«
Um zwanzig vor sechs ging ich mit dem Geigenkasten in der Hand den Broadway hoch. In dem schwarzen, leicht ausgestellten Rock, der weißen Bluse und dem schwarzen Jackett war ich für das Wetter etwas zu warm angezogen, aber ein Luftzug milderte die noch verbliebene Hitze des Tages. Wir hatten einen wunderbaren Frühlingstag gehabt, doch selbst wenn über New York ein Hurrikan gewütet hätte, hätte ich mich unbesiegbar gefühlt.
Ich würde als einer von zwei Geigern ins Spring-Strings-Quartett aufgenommen werden. Ich wusste es, und das hatte nichts mit Arroganz oder Selbstgefälligkeit zu tun. Seit ich vor drei Jahren an die Juilliard gekommen war – eine der bedeutendsten amerikanischen Hochschulen für Musik, Schauspiel und Tanz –, war die Musik in meinem Herzen auf eine Weise erblüht, wie ich es mir niemals hatte träumen lassen. Ich spielte mehr als nur die Noten, die ich vor mir sah. Ich schuf perfekte Harmonien und erfüllte sie mit Liebe. Liebe zur Musik. Liebe zum Leben.
Und jetzt mit meiner Liebe zu Keith. Von allen Frauen, die ihn umflatterten wie Tauben ein Reiterstandbild, hatte er mich gewählt. Mein Herz war zum Bersten gefüllt, aber ich würde ehrlich gewinnen. Ich würde alles geben.
Und natürlich würde ich Mozart spielen. Mozart, der mich führte und dessen Musik mich über die Jahrhunderte hinweg berührte. Seine Musik war einfach perfekt, und ich fühlte sie in Herz und Seele. Ich zeigte sowieso meine Emotionen, wenn ich spielte, aber bei Mozart war ich praktisch nackt.
Die ersten drei Sitzreihen der Alice Tully Hall waren nur mit Bewerbern besetzt. Manche murmelten leise, manche warfen mir böse Blicke zu. Alle wussten, dass ich mit Keith zusammen war. Aber es war nicht wichtig. Die Musik war in mir, und ich würde sie von der Leine lassen.
Ich spielte die technisch anspruchsvolle Kadenz aus Mozarts Violinkonzert Nr. 5 für Keith und die beiden Studentinnen, mit denen zusammen er das Projekt leitete. Beide waren wie Keith im letzten Jahr, und beide beäugten mich zweifelnd. Aber ich war viel zu vertieft in die Musik, um zu sehen, wie ihre verkniffenen Mienen sich lösten und der mürrische Zweifel Staunen und Freude wich. Ich war zu konzentriert, um zu bemerken, dass die anderen Bewerber mich nicht länger geringschätzig anschauten, während sie mir zuhörten. Ich spielte den Teil bis zum Ende. Dann kam der Applaus. Er war nicht laut in dem fast leeren Saal, aber für mich klang er ohrenbetäubend, und ich erwachte wie aus einem Traum.
Die Leute strömten von allen Seiten auf mich zu und gratulierten mir, obwohl die Hälfte von ihnen noch spielen musste. Ein paar wischten sich Tränen aus den Augen, ein paar schüttelten nur den Kopf, während sie mich mit Komplimenten überschütteten.
»Wahnsinn. Ich konnte es tief in mir fühlen.«
»Ich bin total neidisch, aber auf die gute Art, echt.«
»Und ich dachte, du wärst einfach nur Keiths neueste Flamme …«
Ich stockte. »Seine neueste …«
Aber dann war Keith schon da, umarmte mich und wirbelte mich herum. »Da haben wir wohl einen Superstar!« Er lachte und küsste mich und flüsterte mir ins Ohr: »Ich glaube, ich liebe dich, Charlotte.«
Tränen traten mir in die Augen. Mehr Glück könnte ich einfach nicht aushalten. Aus tiefster Seele erwiderte ich seinen Kuss. »Ich liebe dich auch.«
Eine Woche bis zur Premiere.
Ich hing in meinem Wohnheimzimmer mit Melanie Parker ab. Sie spielte das Cello bei den Spring Strings, und wir waren noch vor Ende der ersten Probe vor einem Monat beste Freundinnen geworden. Ihre praktische Art – ebenso wie ihr dunkler Pagenschnitt – erinnerte mich an Velma aus den alten Scooby-Doo-Folgen, die Chris und ich als Kinder immer geguckt hatten. Jetzt unterhielten wir uns und lachten über schlechte Witze, die ich aus dem Internet vorlas.
»Warte, der hier ist gut. Was ist der Unterschied zwischen einem Pianisten und Gott?«
»Wirklich, Char…«
»Gott weiß, dass er kein Pianist ist.« Ich zog die Augenbrauen hoch. »Verstehst du?«
»Ja, versteh ich. Es ist mir wirklich ein Rätsel, wie jemand so talentiert und zugleich so bescheuert sein kann.«
Lachend zuckte ich mit den Schultern. »Warum müssen Musiker immer ernst und langweilig sein?«
»War das auch ein Witz?«
»Vielleicht sind gar nicht alle so«, überlegte ich. »Mozart zum Beispiel hat seiner Mutter in Briefen beschrieben, wie befriedigend sein Stuhlgang war.«
»Wirklich, nur du kannst so etwas bewundernswert finden.« Melanie blickte durch ihre Cateye-Brille auf die Uhr. »Mist, wir sind spät dran.«
Wir packten unsere Sachen und waren schon aus der Tür, als mein Handy klingelte, das noch auf dem Schreibtisch lag.
Melanie hob den Cello-Kasten. »Die Uhr tickt …«
»Ich weiß, warte kurz …« Ich lief zum Schreibtisch und blickte auf das Display. »Es ist eine Nummer aus Bozeman. Jemand ruft aus meiner Heimatstadt an.« Aber weder meine Eltern noch Chris – die waren gespeichert.
»Du weißt, was ich von Verspätungen halte«, sagte Melanie und klopfte mit dem Fuß auf den Boden.
Ich wünschte, ich hätte auf sie gehört. Ich wünschte, ich hätte das Telefon einfach liegen lassen und wäre zur Probe gegangen. Dann hätte ich ein paar Stunden mehr in glücklicher Ahnungslosigkeit gehabt, bevor das Messer wie eine Guillotine auf mich niedersauste und mein Leben für immer in Damals und Jetzt teilte. Das Damals war voller Licht und Liebe und Musik. Das Jetzt war dunkel, kalt und still.
»Hallo?«
»Charlotte?« Ein Mann. Weinerlich. Zitternd. Die Stimme erstickt vor Tränen.
»Onkel Stan?«
»Hallo Liebes.« Ein schwerer Atemzug und ein Schluchzen. »Ich habe schlechte Nachrichten. Du solltest dich vielleicht hinsetzen.«
Die Brust wurde mir eng, und mein Herz setzte einen Schlag aus und fing dann an zu galoppieren, um ihn aufzuholen. Aber ich rührte mich nicht. Ich war wie erstarrt. »Was ist?«
»Es geht um Chris, Liebes. Es tut mir leid. Es tut mir so leid …«
Onkel Stan erzählte mir, was passiert war, aber ich erfasste es nur bruchstückhaft, und am Ende zählte nur ein Bruchstück. Chris war tot.
Er war tot.
Mein Leben geteilt in Damals und Jetzt. Einfach so.
»Du willst die Premiere versäumen?« Keiths Augen, eigentlich blau wie ein wolkenloser Sommerhimmel, waren eisig. »Charlotte, das ist noch eine Woche hin.«
Ungläubig hob ich den Blick. Meine Augen waren rot und geschwollen, und ich hatte kaum die Kraft zu murmeln: »Aber die Beerdigung ist in vier Tagen …«
»Ich weiß ja, ich weiß.« Er seufzte, beugte sich vor und fuhr mir mit der Hand über die Schulter. »Gott, es ist schrecklich. Arme Kleine.«
Ich nahm an, dass er mich meinte, obwohl er mich vorher nie so genannt hatte.
»Ich denk mir was aus«, sagte Keith. »Aber die Spring Strings … Ich muss dich ersetzen, Char. Das weißt du, oder?«
Ich nickte und putzte mir die Nase mit einem zerfledderten Papiertaschentuch, das ich schon den ganzen Vormittag in der Hand hielt. »Ich weiß«, sagte ich, leicht überrascht, wie wenig mir das ausmachte. Ich erfasste es gar nicht wirklich. Keiths Worte kamen aus weiter Ferne wie eine Übertragung aus dem Weltraum.
Er drückte mich mit einem Arm an sich. »Alles wird gut werden, Char. Fahr einfach und verbring die Zeit mit deiner Familie. Ich wünschte, ich könnte mitkommen.«
Ich sah auf. Seine Worte waren wie ein schwaches Leuchten in der Dunkelheit. »Wirklich?«
»Das geht natürlich nicht.«
Ich sackte in mich zusammen. »Natürlich nicht.«
»Ich kann hier jetzt nicht weg, aber es wird schon, Kleine.« Er boxte mir freundschaftlich gegen die Schulter, als wäre er mein Trainer und ich eine Zehnjährige in der Schulmannschaft, die den entscheidenden Elfmeter verschossen hat. »Ganz bestimmt, alles wird gut.«
Bozeman, Montana. Was mich betraf, gab es keinen schöneren Flecken auf Erden. Bis zu dieser Fahrt nach Hause. Ich kam gegen Mittag am Flughafen an, aber das Gallatin Valley sah so dunkel aus, als wäre es immer noch Nacht.
Der Flug war in meiner Wahrnehmung verschwommen, die Fahrt vom Flughafen mit Onkel Stan ein Albtraum. Er hatte Angst, etwas zu sagen, als könnte ich beim geringsten Geräusch zerbrechen. Wir fuhren in seinem glänzenden SUV zu meinem Elternhaus, und ich fühlte mich wie eine zum Tode Verurteilte. Nicht zu meinem Tod. Zu Chris’ Tod. Chris ist tot.
Chris war tot.
Dieser Gedanke oder Abwandlungen desselben tanzten in meinem Gehirn herum wie die gemalten Skelette, die ich einmal im Herbst bei einem Festival zum mexikanischen Día de los Muertos gesehen hatte. Aber ich hatte die ganze Tragweite noch nicht begriffen. Nicht in New York, nicht im Flugzeug, nicht in Onkel Stans Auto. Das würde erst passieren, wenn ich zu Hause ankam. Ich hatte noch nie solche Angst gehabt, meine Eltern zu sehen.
Seit dem »Vorfall« lief eine Art Totenwache. Ich betrat das gemütliche, mit Nussbaum getäfelte und mit Wandteppichen der amerikanischen Ureinwohner geschmückte Wohnzimmer. Aus der Küche wehte der Duft von acht verschiedenen Aufläufen herein.
Sofort wurde ich von alten Freunden und Familie belagert. Ich musste an unendlich vielen traurigen Gesichtern und tröstenden Worten vorbei, um bis zu meiner Mutter vorzudringen, Elaine Conroy, Grundschullehrerin. Sie lief mit einem Papiertaschentuch in der Hand im Zimmer herum und sah sich panisch um, als hätte sie etwas verloren und wüsste nicht, wo sie danach suchen sollte. Sie hatte ja auch etwas verloren, ihren Sohn, aber sie würde ihn niemals wiederfinden.
Sie sah mich, nahm mich in die Arme und drückte mich immer wieder, als wollte sie sichergehen, dass ich wirklich da war und mich nicht plötzlich in Luft auflösen würde.
Gerald Conroy, mein Vater, Mathematikprofessor, war stumm wie eine Statue. Seine Stirn war ununterbrochen gerunzelt, als müsste er eine enorme, schreckliche Gleichung lösen – eine Gleichung, für die es keine Lösung gab.
Das Pferd war gestiegen und hatte Chris abgeworfen. Er war auf die schlimmstmögliche Weise gefallen.
Es gab nichts zu überlegen. Höchstens, wie diese simple Tatsache zu der gähnenden, schwarzen Leere geführt hatte, die sich in unserem Leben auftat.
Zwei Tage später stand ich in der First Morning Presbyterian Church und starrte auf meinen schlafenden Bruder im Sarg. Er schlief doch bestimmt nur, oder? Er sah so gut aus. Er trug einen hohen Kragen, damit man die gebrochenen Knochen im Hals nicht sah, aber sonst … Mein Bruder. Mein Vorbild. Mein bester Freund.
»Zuerst die Juilliard, dann die Philharmoniker!«
Nein, Chris. Zuerst Schmerz. Und dann noch mehr Schmerz, bis meine Zukunft so verzerrt und von Tränen überflutet war, dass ich sie nicht mehr sehen konnte.
In der dämmrigen Kirche sank ich auf die Knie, legte die Stirn an das dunkle Holz des Sargs und blieb dort kauern, bis die Kirche sich irgendwie in mein Zimmer zu Hause verwandelte.
Zwei Tage lag ich im Bett, bis meine Eltern – aus Angst, ich würde meinen Abschluss gefährden – mich drängten, ans Konservatorium zurückzukehren. Sie sagten, es ginge ihnen gut und ich solle mir keine Sorgen machen, aber das war natürlich gelogen. Keinem von uns würde es je wieder gut gehen, und das wussten wir.
Ich flog nach New York und hatte das Gefühl, in Eiswasser getaucht zu werden. Ich erwartete nicht, noch bei den Spring Strings dabei zu sein. Es war mir egal. Ich schaffte kaum den Weg in mein Zimmer, wie sollte ich da spielen?
Allerdings hatte ich durchaus erwartet, dass der Mann, den ich liebte, auf mich warten und mir über die schlimmste Trauer hinweghelfen würde. Dass er in diesem Moment, da ich ihn so sehr brauchte, für mich da wäre. Aber Keith beantwortete keinen einzigen meiner Anrufe, und als ich ihn das nächste Mal im Lincoln Center sah, hatte er den Arm um Molly Kirkpatrick gelegt, die Bratschistin der Spring Strings. Er hatte mich ersetzt, und das Leben war weitergegangen.
Zerfallen in Damals und Jetzt.
Freude, Liebe, Glück … Ich war so hoch geflogen. Höher, als ich je für möglich gehalten hatte. Aber dann hatte der Wind sich gedreht, und plötzlich befand ich mich in freiem Fall und konnte nichts tun, außer zuzusehen, wie der Boden immer näher kam.
Ich kehrte in mein Zimmer im Wohnheim zurück, legte die Geige in den Kasten und klappte ihn zu.
Die Zeit flog nicht nur so dahin. Sie kroch, und das tat ich auch. So am Boden hatte man keinen guten Ausblick, die Farben waren nicht so strahlend, und es fiel mir sehr viel schwerer, meine Zukunft zu sehen. Aber dafür war es sicherer. Viel sicherer.
Kapitel 2
Charlotte (jetzt)
Ein Jahr später
Es ging schon wieder los. Ich presste mir das Kissen auf den Kopf, aber die Wände waren zu dünn. Ich hörte Reyas verzückte Schreie und Collins tiefes Grunzen wie eine Hintergrundmusik. Eine sinnliche Symphonie, die mir schon viel zu oft als Wecker gedient hatte. Kurz hob ich das Kissen an und riskierte einen Blick auf meinen eigentlichen Wecker. Halb sieben. Ich musste sowieso in einer Viertelstunde aufstehen, vielleicht sollte ich mich also bei meinen Mitbewohnern bedanken. Durch ihren unersättlichen Geschlechtstrieb würde ich ausnahmsweise mal die Erste unter der Dusche sein.
Ich schlug die Decke zurück und rannte über den Flur zu dem einzigen Bad unserer Wohnung, nur um festzustellen, dass Emily schneller gewesen war. Ich hörte sie unter dem Wasserstrahl summen.
»Mist.«
Genervt ging ich in die Küche und dachte, dass ich wenigstens in Ruhe allein eine Tasse Kaffee trinken könnte, aber da saß schon Forrest, der vierte Mitbewohner, an der Frühstückstheke und löffelte Müsli. In seinen Brillengläsern spiegelte sich das Licht des Laptops, und als ich hereinkam, sah er auf.
»Morgen.«
»Morgen«, murmelte ich, dankbar, dass er Kaffee gemacht hatte. »Emily ist früh auf.« Ich bemühte mich, nicht gereizt zu klingen.
»Sie geht mit den Kindern in den Zoo im Central Park«, sagte Forrest. »Die Mutter der beiden hat Leute zum Mittagessen oder so eingeladen und will alle aus dem Weg haben.«
Alle aus dem Weg haben. Was würde ich dafür geben …
Emily arbeitete als Nanny und war die Hauptverdienerin in unserer kleinen WG. Deshalb bewohnten sie und Forrest das größte Zimmer, Reya und Collin das zweitgrößte und ich, die Einzelgängerin, ein winziges Zimmer nach hinten raus – mit einem atemberaubenden Blick auf die Mauer des Nachbargebäudes. Aber das kleinste Zimmer bedeutete auch die geringste Miete – 1200 $ –, wobei auch das schon fast mein Budget sprengte.
Ich rief mir ins Gedächtnis, dass es schlimmer sein könnte. Viel schlimmer. Ich könnte in einem rattenverseuchten Mietshaus in einem heruntergekommenen Viertel wohnen statt in Greenwich Village. Ich schaffte es, mich in Manhattan über Wasser zu halten, zwar nur mit Ach und Krach, aber ich schaffte es. Und nur das zählte ja wohl.
Ich gähnte so herzhaft, dass mein Kiefergelenk knackte und Forrest aufsah. »Hat Collins improvisierter Poetry Slam dich gestern wach gehalten?« Er deutete mit dem Kinn auf das Wohnzimmer, in dem die Spuren der Zusammenkunft noch nicht beseitigt waren: volle Aschenbecher, leere Flaschen und überall herumliegende Zettel. Selbst der Rauch – von Zigaretten und Gras – hing noch in der Luft.
»Frag nicht«, sagte ich und schenkte mir Kaffee ein.
»Du hättest spielen müssen, um sie von ihren Qualen zu erlösen.« Forrest grinste. »Das Wimmern einer einsamen Geige hätte sie wahrscheinlich vollends um den Verstand gebracht und in den dunklen Abgrund ihres Schmerzes gestoßen.«
Ich zwang mich, zu lächeln. In meiner Bewerbung für das Zimmer stand, dass ich gerade einen Bachelor in Musik an der Juilliard gemacht hatte, aber nur selten übte und niemals zu Hause. Sofern es sie überhaupt interessierte, warum ich nie zu einem Probespiel ging, fragten sie jedenfalls nicht.
Emily kam im Bademantel aus der Dusche, ihr kurzes blondes Haar noch feucht. »Arbeitest du heute Morgen?«, fragte sie und gab Forrest einen Kuss auf die Wange.
»Natürlich«, sagte ich und ging den Flur hinunter. Ich hatte seit neun Monaten denselben Schichtplan, doch anscheinend machte sich niemand die Mühe, das zu bemerken.
Gott, hör auf, dich zu bemitleiden! Nach ein paar Nächten ohne richtigen Schlaf wurde ich unleidlich. Eine heiße Dusche und eine gemächliche U-Bahn-Fahrt nach Uptown würden das ändern.
Allerdings war die Badezimmertür schon wieder abgeschlossen, als ich dort ankam, und die Dusche lief. Ich klopfte. »Ich komme zu spät zur Arbeit!«
»Zwei Minuten, ehrlich!«, rief Reya.
Vielleicht hätte ich ihr sogar geglaubt, wenn ich nicht auch Collins tiefe Stimme hinter der Tür gehört hätte und dann Reyas Lachen.
Ich lehnte den Kopf gegen die Tür und schloss die Augen. Ich beneidete Reya und Collin genauso sehr, wie ich sie hasste. Sie schienen so verliebt zu sein, dass sie kaum die Hände voneinander lassen konnten. Oder war es nur körperliches Verlangen? Manchmal, so wie jetzt zum Beispiel, wünschte ich mir, dass sie in einer Wolke ihrer eigenen Leidenschaft verpuffen würden. Und Emily und Forrest gleich mit dazu – mit ihrer unveränderlichen Zuneigung zueinander, die zwar keine Glut und kein Feuerwerk war, aber liebevoll und beständig.
Der tiefe Schmerz in meinem Herzen pochte, sobald ich mich daran erinnerte, was ich verloren hatte, und er pochte jetzt, als ich im Flur unserer kleinen, überfüllten Wohnung stand.
Es war verrückt, wie allein man sich fühlen konnte, ohne jemals allein zu sein.
Eine halbe Stunde später war ich endlich geduscht und angezogen. Ich schnappte mir meine Tasche und einen Pulli und zog mir an der Tür hektisch die Schuhe an, während meine Mitbewohner sich ohne Eile in der Küche versammelten.
»Denk an die Miete«, rief Emily zum Abschied. »Montag.«
Die Anspannung in meinem Rücken nahm um einiges zu. Fast hätte ich zurückgerufen, dass es sehr viel leichter wäre, die Miete aufzubringen, wenn ich nicht zu spät käme und Angst haben müsste, meinen Job zu verlieren, aber wozu? Ich eilte durch das nette Treiben im Viertel und nahm mir eine winzige Sekunde lang Zeit, die roten Backsteingebäude und die von Bäumen gesäumte Straße zu betrachten. Es hob meine Stimmung ein bisschen … bis die Bahn mir quietschend vor der Nase wegfuhr, als ich endlich auf dem Bahnsteig angelangt war.
Als der Luftzug meinen Mantel erfasste und mir das Haar zerzauste, ließ ich die Schultern sinken. Der Sog reichte nicht, um mich zu gefährden, aber ich wich trotzdem ein paar Schritte zurück. Meine Muskeln waren so steif und verkrampft, als wären sie verklebt.
Ich fragte mich ernsthaft, wie viel Zeit mir noch blieb, bevor ich unter all dem Druck nachgeben und endlich zerbrechen würde.
»Viertel nach acht«, sagte Maxine und tippte mit einem blutroten Acrylnagel auf ihre Armbanduhr. Das stahlgraue Haar der Geschäftsführerin war zu einem so festen Knoten zurückgenommen, dass ich fast Mitleid mit ihrer Kopfhaut hatte.
»Ich weiß. Tut mir leid«, sagte ich, während ich meinen Spind öffnete und die Schürze herausholte. »Sie wissen ja, die Bahn …« Ich steckte mir das Namensschild an die weiße Bluse mit verdeckter Knopfleiste und stach mir bei der Gelegenheit in den Daumen.
Maxine, die einen strengen, schwarzen Rollkragenpullover trug, verschränkte die Arme vor der Brust. »Die Bahn ist pünktlich. Was man von Ihnen nicht behaupten kann …«
Ich band das Haar zu einem Pferdeschwanz. »Es kommt bestimmt nicht wieder vor.«
»Hoffentlich.«
Die Geschäftsführerin verließ den Raum, und Anthony Washington – Grafiker und mein Lieblingskollege – steckte den Kopf herein. Seine Augen waren das Freundlichste, was ich bisher an diesem Tag gesehen hatte. So braun wie seine Haut und warm vor Güte.
»Ist ziemlich was los«, sagte er. »Vierertisch in deinem Bereich. Soll ich denen schon mal Getränke bringen?«
»Du bist viel zu nett zu mir«, sagte ich und schob den Notizblock in die Schürzentasche. »Danke, aber ich schaff’s jetzt.«
Anthony überragte mich ziemlich, aber das taten eigentlich alle – ich bin gerade mal 1,60 m groß. Er zupfte an der blassgelben Krawatte, die wir alle tragen mussten. »Kein guter Tag, um zu spät zu kommen, meine Liebe«, sagte er. »Skeletor hat angedeutet, dass heute irgendwas abgeht.«
Eiskalte Angst strömte durch meine Adern. »Ach ja?«
Aber zum Reden blieb keine Zeit. Das Restaurant füllte sich.
Das Annabelle’s war ein Bistro mit Frühstücks- und Mittagskarte, ausgerichtet auf Gäste ohne Eile – es öffnete nicht einmal vor acht Uhr. Allerdings waren die Gäste inzwischen eher ungeduldig statt ohne Eile, und ich hinkte die ganze Schicht über ein bisschen hinterher, während ich mich angestrengt bemühte, ununterbrochen zu lächeln. Maxine – für Anthony nur Skeletor – beobachtete mich wie ein Habicht. Eine einzige Beschwerde wegen einer kalten Spinatlasagne oder weil ich den Kaffee zu spät nachgeschenkt hatte, und ich wäre geliefert.
Zwar schaffte ich es ohne Beschwerden durch die Phase des Hochbetriebs, aber ich war eindeutig nicht in Form. Und ich konnte rechnen, auch wenn wir erst am Ende der Schicht bezahlt wurden. Der März war ohnehin ziemlich lau gewesen, und um die Miete bezahlen zu können, würde ich in meinem zweiten Job als Barkeeperin an den Wochenenden zwei richtig gute Nächte brauchen – und damit meine ich: wirklich richtig gut.
Ich strich mir übers Haar und holte tief Luft. Die Mittagszeit musste ich besser gewuppt kriegen als das Frühstück … Aber dann schien mein Tag gerettet. In meinem Bereich wurden Tische zusammengeschoben.
»Ein Zehnertisch«, frohlockte Anthony, während eine Gruppe gut gekleideter Leute hereinkam. Dann packte er meinen Arm. »Hey, das ist Neil Patrick Harris.«
»Was? Quatsch …«
Ich sah hin und – tatsächlich, in der Mitte der Gruppe saß der gut aussehende Schauspieler und plauderte lachend mit seinen Freunden.
Anthony stieß mich an und setzte ein strahlendes Lächeln auf. »Dein Ritter in schimmernder Rüstung.«
»Da hast du absolut recht.«
Neil Patrick Harris’ Zehnertisch würde den Monat retten. Ich holte tief Luft und zückte meinen Block, entschlossen, vor dem Promi und seinen Freunden nicht dumm dazustehen.
Hinter mir an der Kasse stand ein junger Typ mit verkehrt herum aufgesetzter Basecap und tippte wütend einen Text in sein Telefon. »Dieser Scheißtyp!«
Das ganze Restaurant blickte auf – das Annabelle’s war kein Lokal, in dem man laut wurde. Aber wir waren in New York, und schon nahmen die Gäste unbeeindruckt ihre Gesprächen wieder auf, und der Typ zuckte genervt mit den Achseln.
»Sagen Sie diesem Idioten, dass er sich sein Essen gefälligst selbst holen soll«, sagte er zu Maxine und stürmte hinaus.
Ich wollte mich gerade meinem Zehnertisch widmen, als Maxines kalte, präzise Stimme mich zurückhielt.
»Charlotte, könnten Sie bitte kurz?«
Ich eilte zur Kasse. »Ja?«
Sie schob mir eine Plastiktüte mit einem kleinen Stapel Takeaway-Boxen zu. »Sie müssen diese Auslieferung erledigen.«
Mein Herz sank. »Aber … ein Tisch ist gerade …«
»Den kann Anthony übernehmen. Das hier ist wichtig.« Sie deutete mit ihrem spitzen Kinn auf Anthony.
Der zögerte, aber Maxine wedelte mit der Hand. Anthony sah mich hilflos an, formte stumm mit den Lippen die Worte »Tut mir leid« und ging zu meinem Tisch in meinem Bereich, um meinen Neil Patrick Harris zu bedienen.
Maxine verzog die dick bemalten Lippen. »Das ist die Lieferung für Lake. Es ist nicht dasselbe wie ein Broadway-Star, aber unsere Kunden sind alle gleich wichtig, nicht wahr?«
»Aber die große Gesellschaft … Sie sitzen in meinem Bereich. Warum kann Anthony nicht ausliefern? Oder Clara?«
Hinter uns sagte Anthony etwas, und der ganze NPH-Tisch brach in Gelächter aus. Maxine zog wissend eine Augenbraue hoch. Ich seufzte und nickte. Anthony war herzlich und umgänglich und brachte einen Zehnertisch – samt einem berühmten Entertainer – im Handumdrehen zum Lachen. Ich hätte es zwar hingekriegt, aber ich war »angespannt« und manchmal »ein bisschen langsam«. Was auch immer das heißen sollte.
»Beeilen Sie sich«, sagte Maxine jetzt und gab mir einen Zettel mit einer Adresse. »Mr Lake hat zwar anscheinend einen weiteren Assistenten verloren, aber wir möchten ihn als Kunden behalten, nicht wahr?«
Ich nickte benommen. Mr Lake, wer auch immer das war, bestellte wenigstens einmal pro Woche im Annabelle’s, und ein säuerlich oder gelangweilt aussehender Assistent – der häufig zu wechseln schien – holte die Bestellung ab. Dem Ausbruch des wütenden jungen Mannes nach zu urteilen würde es erneut einen Wechsel geben.
Ich nahm die Tüte, warf einen letzten, wehmütigen Blick auf den Tisch von Neil Patrick Harris und ging. Ich versuchte das Ganze positiv zu sehen: Vielleicht gab dieser Lake irrsinnig hohe Trinkgelder.
Träum weiter.
Nach allem, was ich gehört hatte, war er launisch und ging nie aus dem Haus. Selbst wenn er zu den Leuten gehörte, die zwanzig Prozent gaben, würde das Trinkgeld für eine Lieferung niemals an das eines Zehnertischs herankommen. Ich konnte nur hoffen, dass ich die Lieferung erledigt hatte, bevor der Mittagsbetrieb vorbei war.
Die Adresse war die eines Hauses in der 78th West, etwa zehn Minuten zu Fuß. Ich ging schnell. Wenn der Typ Eier bestellt hatte, waren sie jetzt schon kalt, und es hätte mir gerade noch gefehlt, dass dieser Lake bei Maxine anrief und meckerte, dass ich zu langsam war.
Ich lief die Amsterdam Avenue entlang und bog dann rechts in die 78th ein. Es war ein herrlicher Frühlingstag. Es war warm, aber noch nicht sommerlich schwül, und der Himmel war voller Sonnenschein. Die 78th Street war eine sorgfältig gekehrte Straße mit Bäumen und diesen typischen New Yorker Häusern, die eng nebeneinander standen. Das von Lake war ein zweistöckiges Haus aus rotem Backstein zwischen zwei Brownstones. Ich ging die drei Stufen zur Eingangstür hinauf und klingelte.
Keine Antwort.
Ich klingelte noch einmal und war fast schon beim dritten Mal, als eine harte, jung klingende Männerstimme aus der Gegensprechanlage kam, der Tonfall kühl und ironisch. »Was? Sind Sie etwa zurückgekommen, weil Sie ein Empfehlungsschreiben wollen?«
Ich fragte mich, ob das Lakes Sohn war, räusperte mich und drückte auf den Sprechknopf. »Ich bin nicht er. Ihr Assistent? Ich glaube, er hat gekündigt.«
»Das ist mir klar«, gab die Stimme zurück. »Und wer sind Sie dann, zur Hölle?«
Ich verzog das Gesicht. Ich hatte nicht nur Neil Patrick Harris’ Tisch verloren, sondern musste mich auch noch mit dem unhöflichen Sohn – falls er das war – eines wahrscheinlich ebenso unhöflichen Einsiedlers herumschlagen.
»Ich bin vom Annabelle’s«, erwiderte ich schnippisch und gab mir dann Mühe, einen neutralen Tonfall zu finden. »Ich habe Ihre Bestellung, wenn Sie sie wollen.«
Es folgte noch eine Pause, und als ich schon dachte, dass niemand mehr antworten würde, summte der Türöffner.
Ich kam in einen hübschen Eingangsbereich mit einem kleinen Kronleuchter, der über mir glitzerte. Direkt vor mir ging ein schmaler Flur zu einem kleinen Wohnbereich ab – er war dunkel und mit Kartons und Möbeln vollgestellt. Obwohl der Raum offensichtlich als Lager diente, war er sauber, vom teuren Hartholzboden bis zur stuckverzierten Decke.
Ich ging links eine Treppe hoch und kam an ein paar teuer aussehenden Gemälden vorbei. Im ersten Stock war ein Wohnzimmer, elegant in Beige mit blauen Akzenten eingerichtet. Geschmackvolle Kunst hing an den Wänden, und Kristallvasen ohne Blumen standen auf stilvollen Beistelltischen aus Mahagoni. Auf einem gläsernen Wohnzimmertisch vor dem Kamin befanden sich die Reste einer Riesencola, eine angebrochene Chipstüte und ein paar Lakritzschlangen.
»Das Frühstück der Champions«, murmelte ich und nahm an, dass die Schweinerei dem Ex-Assistenten gehörte, dessen Job ich gerade erledigte, während mir das Geld für die Miete durch die Lappen ging.
Rechts vom Wohnzimmer lag die geräumige Küche – elegante Arbeitsplatten aus Granit und modernste Geräte. Allerdings war die Spüle mit schmutzigem Geschirr vollgestellt, und leere Takeaway-Boxen von Restaurants der Gegend – keins davon billig – stapelten sich auf der Frühstückstheke. Trotz allem war es offensichtlich das Zuhause einer wohlhabenden Person. Und in Uptown Manhattan, nur einen Steinwurf vom Central Park entfernt, musste das auch so sein. Obwohl der erste Stock zu weitläufig war, als dass ich ihn ganz einsehen konnte, wusste ich, dass niemand dort war.
»Hallo?«, rief ich. »Mr Lake?«
Wieder eine Pause, und dann kam aus dem zweiten Stock, wo wahrscheinlich die Schlafzimmer lagen, erneut diese Stimme, hart und kalt: »Stellen Sie es einfach in die Küche.«
Wenn Verbitterung einen Klang hatte, dann klang sie wie diese Stimme.
Ich stellte den Stapel Boxen neben die bereits leeren Behälter. Ich wusste, dass die Rechnung schon bezahlt war, aber war Trinkgeld inklusive? Normalerweise hätte ich es dem Zufall überlassen, doch ich brauchte wirklich jeden Dollar.
»Okay«, rief ich. »Ähm, kann ich sonst noch etwas für Sie tun?«
»Ja, Sie können sich endlich verpissen.«
Ich spürte, wie mir das Blut in die Wangen stieg – vor Zorn und weil ich mich so gedemütigt fühlte. Ich sollte mir das nicht zu Herzen nehmen, schließlich arbeitete ich in der Gastronomie, aber es versetzte mir einen Stich. Davon abgesehen war es irgendwie erschreckend, jemanden in einem derart eleganten Haus so reden zu hören.
»Arschloch«, murmelte ich leise. Dann polterte ich die Treppe hinunter, riss die Tür auf und ließ sie mit einem Knall hinter mir zufallen.
Ich lief zum Annabelle’s zurück. Der Mittagsbetrieb war noch nicht vorbei. Ich konnte versuchen, etwas von dem verlorenen Verdienst aufzuholen, und vielleicht hatte der unhöfliche Mistkerl schon Trinkgeld bezahlt.
Ich irrte mich in beidem.
Das, wovon Anthony morgens gesprochen hatte, ging genau jetzt ab. Annabelle Pratt – die gleichnamige Besitzerin des Restaurants – hatte einen Neffen, der gerade nach New York gezogen war, um sich an einer Schauspielkarriere zu versuchen, und er brauchte einen Job. Harris Pratt war eingewiesen worden, während ich ausgeliefert hatte. Maxine zog mich beiseite, um mir mitzuteilen, dass alle sechs Kellnerinnen und Kellner eine Schicht abgeben mussten, damit dieser Typ vollbeschäftigt war.
Diese dreiste Vetternwirtschaft hätte jeden anderen in den Augen des bisherigen Personals sofort zum Feind gemacht – oder mir wäre es jedenfalls so ergangen. Aber Harris war nett, attraktiv und besaß in geradezu unglaublichem Überfluss gutmütigen Charme. Ich sah entsetzt zu, wie Clara, die eine lukrative Frühstücksschicht an ihn abgeben musste, schamlos mit ihm flirtete, während sie ihm das computergesteuerte Bestellsystem erklärte. Sie schaufelte sich ihr eigenes Grab mit einem Lächeln auf den Lippen.
Meine Schicht war vorüber. Mittags hatte nicht genug Betrieb geherrscht, als dass ich meinen Schnitt hätte machen können. Ich nahm das Namensschild im Hinterzimmer ab und zwang mich, nicht zu heulen. Maxine kam, um das mit Kreditkarte gezahlte Trinkgeld auszuzahlen.
»Hat dieser Lake nichts gegeben? Wegen der Lieferung?«
Sie zog die Augenbraue fast bis zum Haaransatz hoch.
»Ich frage nur, weil er total unhöflich war.«
»Kaum eine Überraschung.« Maxine zählte mir das Geld vor. »Er verbraucht Assistenten wie andere Menschen Toilettenpapier. Und anscheinend behandelt er sie auch so.«
»Was ist mit ihm passiert?«, fragte ich. Heute war wirklich der mieseste Tag aller Zeiten. Was kümmerte mich da dieser Typ. Aber er war offenbar jung, obwohl ich einen alten Mann erwartet hatte, und das sagte ich auch zu Maxine.
Die zuckte mit den Schultern. »Jung. Alt. Er ist ein guter Kunde.« Sie sah mich streng an. »Ich hoffe, Sie waren nicht ebenfalls unhöflich.«
Ich schüttelte den Kopf. Der Typ konnte unmöglich gehört haben, dass ich ihn ein Arschloch genannt hatte, es sei denn, er hatte ein übernatürliches Gehör.
»Gut.« Maxine gab mir vierzig Dollar. »Bis Montag.«
Ich seufzte. Diese vierzig plus die fünfunddreißig Trinkgeld in bar waren nicht mal die Hälfte von dem, was ich brauchte. Die Hälfte.
Anthony, dessen Schicht noch länger ging, kam ins Hinterzimmer und wollte mir etwas Geld in die Hand drücken. »NPH war großzügig, und es war ja eigentlich dein Tisch.«
Ich musste fast heulen vor Rührung über die Güte meines Freundes und wandte schnell das Gesicht ab. Wenn Anthony mich erst weinen sah, würde er mich das nie ablehnen lassen.
»Auf gar keinen Fall, Anthony. Du hast das verdient.« Ich stand so eilig auf, um den Spind zuzumachen, dass ich sogar vergaß, meine Schürze abzunehmen. Ich umarmte ihn und verbarg mein Gesicht an seiner Schulter. »Ich hab dich lieb. Hab ein schönes Wochenende.«
Ich rannte raus, bevor er protestieren konnte. Auf der Straße auf dem Weg zur U-Bahn fand ich einen Zwanziger in meiner Schürzentasche, und jetzt musste ich wirklich heulen.
Kapitel 3
Charlotte
Im Lucky 7 in Greenwich war zum Glück ziemlich viel los an diesem Freitag. Vor einer Geräuschkulisse aus lauter Musik, Leuten, die sich beim Reden anschreien mussten, und klirrenden Gläsern schuftete ich immer freitags und samstags zusammen mit zwei weiteren Barkeepern hinter der Theke. Die beiden hießen Sam und Eric und waren keine Zwillinge und nicht einmal Brüder, aber das hinderte mich nicht daran, von ihnen wie von einer einzigen Person zu reden, nämlich als Samneric, wie in Der Herr der Fliegen. Ich fand das total witzig und machte sie gleich darauf aufmerksam, nachdem man mich vor drei Monaten eingestellt hatte, aber keiner von beiden verstand, wovon ich redete.
Im Moment wuselten Samneric geschäftig um mich herum und plauderten mit den Gästen, während ich mich mühsam durch den Small Talk hangelte. Ich war nicht dafür gemacht, hinter einer Theke zu stehen. Ich war »zu verbissen« und »etwas trottelig«, was auch immer das heißen sollte. Aber als ich mich beworben hatte, hatte Janson, der Eigentümer des Lucky 7, verzweifelt Personal gesucht, und ich hatte mir die Rezepte für die Cocktails fehlerfrei merken können. Seitdem redete er mir gut zu, selbst mal einen zu trinken und ein bisschen lockerer zu werden.
»Meine Güte, es wird dich doch nicht umbringen, mal ein bisschen zu flirten!«
Ich wusste, was er meinte, aber ich hatte einfach kein Talent dazu. Natürlich versuchte ich es, aber irgendwie fehlte mir der dafür notwendige Filter. Die Worte drangen aus meinem Mund hervor, bevor ich sie zurückhalten konnte, und ungefilterte Ehrlichkeit war nicht unbedingt das, was ein angetrunkener Typ in einer Bar suchte.
Manchmal dachte ich, dass Janson mich nur behielt, weil er Mitleid mit mir hatte. Samneric sagten, es läge daran, dass ich wie ein Manic Pixie Dream Girl aus irgendwelchen Indie-Filmen aussah.
»Typen stehen total darauf. Echt«, sagten sie.
»Auf was?«, fragte ich.
Woraufhin Sam und/oder Eric erklärten: »Du bist auf eine traurige, intelligente Art süß.«
Auch damit konnte ich nichts anfangen, aber ich gab mir Mühe, die Rolle des Barmädchens in einem dunklen, spelunkenmäßigen Laden auszufüllen. Im Annabelle’s sah ich adrett und konservativ aus. Im Lucky 7 zog ich ein schwarzes Tank-Top an, das meine nicht unbedeutende Oberweite betonte, trug dunklen Eyeliner auf und ließ die Haare offen. Beides waren Verkleidungen. Ich war weder adrett noch ein Partygirl.
Ich wusste nicht, was ich war.
Um etwa zehn Uhr schob sich Melanie Parker durch die Menge der Künstler und wohlhabenden Hipster, die Greenwich Village mit enormer Geschwindigkeit gentrifizierten. Das erklärte mir jedenfalls meine beste Freundin so. Genervt starrte sie auf die Typen in zu teuren Pullovern und hob zum Gruß das Kinn.
»Guter Abend?«, fragte sie. Das blaue Neonlicht hinter mir spiegelte sich in ihrer Cateye-Brille. Sie sah selbst ziemlich gentrifiziert aus in der weißen Strickjacke und dem braunen Wildlederrock, aber das war ihr Outfit für die Arbeit – Melanie erteilte dem Nachwuchs von Manhattans Elite Cellounterricht, wenn sie nicht bei irgendeinem experimentellen Off-Off-Broadway-Stück im Orchestergraben saß. Sie schob sich die schwarzen Ponyfransen aus der Stirn. »Wie sieht’s mit der Miete aus?«
Ich mixte ihr den üblichen Drink – einen Old Fashioned – und zuckte mit den Schultern. »Frag mich morgen noch mal. Ich brauche zwei Wahnsinnsschichten, um das Geld zusammenzukriegen.«
»Scheißjob«, sagte Melanie und spießte die Kirsche in ihrem Drink mit einem kleinen Plastikschwert auf. »Genau wie meiner.«
Ich war froh, dass ein Gast meine Aufmerksamkeit verlangte. Fast hätte ich gesagt, dass Melanie leicht reden hatte in ihrer mietpreisgebundenen Wohnung, die sie sich mit ihrer Freundin teilte, mit der sie seit zwei Jahren felsenfest zusammen war. Aber ich wusste schon, worauf sie hinauswollte, noch bevor sie dann den Arm ausstreckte und meine Hand berührte.
»Du weißt, was du tun musst«, sagte sie in weicherem Ton. »Wann hast du das letzte Mal geübt?«
»Mittwoch«, sagte ich, und das stimmte sogar. »Und ich habe dreißig Dollar für einen Übungsraum im Kaufman Music Center bezahlt. Dreißig Dollar, die ich eigentlich nicht habe.«
Ich fand das ziemlich gewagt von mir in Anbetracht meiner kläglichen finanziellen Situation. Umso mehr, weil es Zeitverschwendung gewesen war. Fast immer, wenn ich übte, war es Zeitverschwendung. Ich spielte die Noten, konnte aber die Musik nicht fühlen.
»Denkst du an ein Probespiel?«
Ich wischte die Theke ab. »Vielleicht.«
»Char. Es ist ein Jahr her.«
»Jetzt nicht, Mel. Ich hatte eine ätzende Woche, okay?«
Melanie spitzte die Lippen, aber ihre Augen waren weich. Sie sagte etwas, doch ich hörte sie nicht mehr. Das Herz rutschte mir in die Hose, als die Tür der Bar aufging und drei Typen und eine hinreißende Brünette hereinkamen. Einer der Männer hatte den Arm um die Frau gelegt.
Melanie verstummte und zog ein Gesicht. »Ich muss mich nicht mal umdrehen. Es ist dieser Mistkerl Keith, oder?«
Ich nickte und riss den Blick von ihm los, als die vier sich an einen Ecktisch setzten. »Mir geht’s gut. Kein Problem.«
»Wirklich? Deine Hände zittern.«
Ich blickte hinab auf die Eisschaufel in der einen Hand und das Glas in der anderen. Sie hatte recht. Ich stellte beides weg und wischte mir die Hände an der Schütze ab. »Was will er hier? Es gibt acht Milliarden Kneipen in der Stadt …«
Meine Stimme erstarb, weil Keith es anscheinend übernommen hatte, die erste Runde zu holen, und sich auf den Weg zur Theke machte. Keith Johnston war groß, blond und muskulös und sah eher aus, als gehörte er an einen Strand zum Surfen als in eine düstere Bar in Greenwich Village. Ich ärgerte mich, dass ich nicht rechtzeitig in die Pause verschwunden war, als er mich entdeckte.
»Charlotte?« Keith stellte sich an die Bar, ohne Melanie auch nur eines Blickes zu würdigen. »Ich hätte dich in so einer Kaschemme nie erwartet, und dann noch als Barkeeperin! Wie geht’s? Ist ’ne Weile her. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe …« Plötzlich verzog sich sein Gesicht zu einer Miene, die halb Sympathie, halb Mitleid ausdrückte, was ihm wirklich niemand abnahm. »Oh, Mist, ich erinnere mich. Dein Bruder …«
»Was kann ich für dich tun?«, fragte ich laut.
Keith ignorierte meine Frage, beugte sich vor und redete mit mir auf eine so freundliche, intensive Art, als wäre ich nicht nur in diesem Raum, sondern auf der ganzen Welt die einzige Frau. Das war ein patentierter Keith-Johnston-Trick – nur einer unter vielen, derentwegen ich mich in ihn verliebt, ihm vertraut und geglaubt hatte, er meinte es ernst, als er behauptete, mich zu lieben.
»Charlotte, bitte. Ich kann mit Trauer nicht gut umgehen. Das weißt du. Ich meine, ich fühle alles so stark, so tief, dass deine Trauer … Es war einfach zu viel für mich. Deshalb bin ich abgehauen. Es war feige, und ich bin nicht stolz darauf, aber ich konnte nicht anders. Deine Augen … Du weißt, es waren deine Augen, die mich angezogen haben – deine großen Rehaugen …«
Meine großen Rehaugen füllten sich beinahe mit Tränen, als er über meine Trauer redete, als hätte ich sie ihm angetan. Ihm auferlegt.
»Und als du von der Beerdigung zurückkamst, waren diese wundervollen Augen so voller Schmerz. Es war sonst nichts mehr übrig. Die Charlotte, die ich kannte, war fort, und jemand, den ich nicht kannte, hatte ihren Platz eingenommen. Jemand, zu dem ich nicht durchdringen konnte. Ich hätte dir das damals sagen müssen, aber ich hatte nicht die Kraft dazu. Es tut mir leid. Es tut mir so leid.«
Melanie starrte ihn mit offenem Mund an. »Machst du Witze? Glaubst du, sie kauft dir diesen Blödsinn ab?«
Unerschütterlich drehte Keith sich zu ihr um, ein aufgesetztes, höfliches Lächeln auf den Lippen. »Hallo Melanie, ich freue mich, auch dich wiederzusehen. Ich rede gerade mit Charlotte, wenn es dir nichts ausmacht.«
Ich sah Melanie an und schüttelte schwach den Kopf, und sie kniff die Augen zusammen. »Ich muss kurz zur Toilette. Bin gleich zurück.«
»Sie hat recht«, sagte ich, als Melanie weg war. »Du redest Blödsinn, und selbst wenn es anders wäre, hättest du vor einem Jahr mit mir sprechen müssen. Vor einem Jahr, Keith. Aber stattdessen kam ich von der Beerdi… aus Montana zurück, mein Freund war mit einer anderen zusammen, und bei den Spring Strings war ich auch rausgeflogen.«
Er legte den Kopf schief, ein überraschtes Lächeln auf den Lippen. »Ärgerst du dich deswegen? Wegen der Spring Strings? Charlotte, du warst bei der Premiere nicht da. Ich musste etwas unternehmen. The show must go on, oder?«
Ich rieb mit dem Lappen über einen Fleck auf der Theke. »Und was war mit uns, Keith?«, fragte ich leise und konnte kaum ertragen, wie erbärmlich ich klang. Warum ging ich auf seine Entschuldigungen ein, statt ihm einfach einen Drink ins Gesicht zu schütten? Aber ein Teil von mir brauchte Antworten, selbst nach all dieser Zeit. Um einen Abschluss zu finden. Vielleicht würde es weniger wehtun, wenn er einen guten Grund gehabt hatte. Etwas, was ich glauben könnte. Etwas mehr als das, womit ich jetzt lebte – nämlich, dass unsere Beziehung nur eine Lüge gewesen war.
Aber sein albernes, erstauntes Lächeln war wieder da. »Uns? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir offiziell ein Paar gewesen wären, Charlotte. Wir waren für ein paar Wochen ›zusammen‹.« Er malte tatsächlich Anführungszeichen in die Luft.
Zwei Monate, eine Woche und vier Tage, dachte ich und hätte wahrscheinlich sogar die Stunden hinzufügen können, wenn ich ernsthaft darüber nachgedacht hätte.
»Ich hatte viel mit den Spring Strings zu tun, dann kam das Examen …« Keith zuckte mit den Achseln, sein Lächeln wurde breiter. »Echt schön, dich zu sehen, aber auch wenn ich wahnsinnig gern hören würde, wie es dir so ergangen ist, fürchte ich, meine Freunde schicken einen Suchtrupp los, wenn ich nicht gleich mit was zu trinken zurückkomme.«
Er stützte den Arm wie in einem Saloon auf der Theke ab und zwinkerte mir zu wie ein Cowboy in einem schlechten Western. Plötzlich war es mir peinlich, dass dieser verlogene Mistkerl zum Teil der Grund dafür war, dass mein angeschlagenes Herz die Musik nicht mehr fand.
»Sorry«, sagte ich und ließ den Lappen auf die Theke fallen. »Ich hab Pause.«
Ich schob mich an Samneric vorbei durch die Hintertür und setzte mich in dem Durchgang hinter der Bar auf einen umgedrehten Eimer, den wir benutzten, um Eis zu holen. Dann brach ich in Tränen aus. Nicht nur wegen Keith, sondern weil ich plötzlich wieder an die schrecklichen Monate nach Chris’ Tod denken musste. Keiths glattes, angenehmes Gesicht hatte mir alles wieder in Erinnerung gerufen.
Ich weinte um das, wovon ich geglaubt hatte, es mit Keith zu haben, was – wie sich nun herausgestellt hatte – gar nichts war. Aber am meisten weinte ich um Chris. Ich weinte um meinen Bruder, und der Schmerz in meinem Herzen pochte. Ich hätte die ganze Nacht heulen können, als gäbe es da eine Quelle, die niemals versiegte.
Zehn Minuten später unterdrückte ich die Tränen und ging wieder rein. Zum Glück saß Keith wieder an seinem Tisch. Melanie war zurück, und ein paar Freunde von der Juilliard waren gekommen: Mike Hammond, Felicia Strickland und Regina Chen. Alle hatten Keith erkannt, und sie stellten sich vor mich an die Bar wie ein Schutzwall. Fast fing ich wieder an zu flennen, weil sie so nett waren.
»Du hast etwas verpasst, Char«, sagte Regina bei einem Martini. »Es war eine Wahnsinnsparty – selbst für meine Ansprüche –, aber es hätte noch großartiger sein können, wenn du gekommen wärst.«
»Ich hab versucht, sie mitzuschleppen«, sagte Melanie, »aber …«
»Aber ich hatte keine Zeit«, sagte ich schnell. »Tut mir leid, Regina. Beim nächsten Mal bin ich bestimmt dabei.«
»Ich nehme dich beim Wort«, sagte Regina. »Ich dachte an Ende Mai. Merk dir den Termin, Conroy, oder es setzt was.«
Regina Chens Partys waren unter Juilliard-Studenten eine Legende. Alle mussten ihre Instrumente mitbringen, und ein paar Leute spielten Soundtracks beliebter TV-Serien. Vor Chris’ Tod war ich ein paarmal dabei gewesen, aber danach nie wieder.
Regina und meine anderen Freunde aus der Studienzeit glaubten, ich würde mir eine Auszeit von den Probespielen gönnen. Nur Melanie kannte die Wahrheit. Dass ich nicht mehr gern vor Publikum spielte. Weil meine Musik jetzt bedeutungslos klang. Nur Routine war. Noten von einem Blatt und nichts weiter.
Meine Freunde lenkten mich mit anderen Dingen ab, und ohne dass ich es richtig merkte, war meine Schicht vorbei.
Am Ende hatte ich neunzig Dollar Trinkgeld. Ziemlich gut, aber nicht genug.
Ziemlich gut, aber nicht genug.
Es war erstaunlich und deprimierend zugleich, was man in meinem Leben alles mit diesem Satz beschreiben konnte.
Kapitel 4
Noah
Ich saß aufrecht im Bett, als ich wieder aus demselben verfluchten Albtraum erwachte, dem Traum, der so gnadenlos schön war und zugleich so abgrundtief fürchterlich. Ich schnappte keuchend nach Luft, da ich grundlos erstickte, und versuchte die Bilder festzuhalten, die meine Dunkelheit mit leuchtenden Farben füllten. Da waren weißer Schnee und blauer Himmel, ein goldener Sonnenuntergang und blaugrünes Wasser. Im Traum konnte ich wieder sehen.
Manchmal war es die Todesangst wert.
Manchmal wünschte ich, ich wäre nicht wieder aufgewacht.
Ich fragte mich, wie spät es wohl war. Vielleicht war es Morgen. Vielleicht war es drei Uhr nachmittags. Seit dem Unfall war mein Tag-und-Nacht-Rhythmus völlig im Eimer, aber was machte es schon für einen Unterschied? Morgen- oder Abenddämmerung – für mich war alles dasselbe schwarze Nichts.
Ich schlug die schweißgetränkten Decken zur Seite. Sie stanken genau wie ich. Ich musste duschen, und Lucien sollte sich verdammt noch mal beeilen und einen neuen Assistenten einstellen. Es war zwei oder drei Tage her, dass dieses Mädchen aus dem Restaurant das Essen gebracht hatte, zusammen mit der Nachricht, dass Trevor – der unfähige Idiot – gekündigt hatte. Gut, dass ich ihn los war. Trevor war langsam und dumm, und es wäre wirklich erstaunlich, wenn er nichts geklaut hätte.
Nicht, dass ich es bemerken würde.
Seufzend legte ich mich wieder hin und lauschte. Auf der Straße war es ruhig. Keine Stimmen. Keine Autos. Wahrscheinlich war es drei Uhr nachts, und ich beschloss, das mit der hübschen kleinen Armbanduhr zu überprüfen, die sie mir in der Reha gegeben hatten. Sie war speziell für blinde Trottel wie mich entworfen worden und sagte die Zeit an, wenn man auf einen Knopf drückte.
Es ist 3:22 Uhr, Sonntag, der 31. März.
Nicht schlecht geraten. Ich drückte wieder. Und wieder. Die Automatenstimme füllte die Stille. Ich kam mit Stille nicht zurecht. Wenn ich ganz ruhig dalag, den Atem anhielt und mich nicht bewegte, konnte ich so tun, als wäre ich in einer Höhle tief unter der Erde, wo das Sonnenlicht nie hinkam. Wie der alte Bergwerksstollen in Colorado, den ich einmal besichtigt hatte. Ich hatte damals nicht geglaubt, dass es eine so völlige Dunkelheit geben konnte. Es gab immer Licht, selbst in der schwärzesten Nacht. Es gab immer Schatten und Schattierungen, nie einfach nur … gar nichts.
Tja. Das Leben – hinterhältiges Miststück – hatte mich eines Besseren belehrt.
Ganz still dazuliegen war sowieso keine gute Idee. Dann fühlte ich mich wie lebendig begraben oder wie ein Bewusstsein, das im schwarzen Äther schwebte. Körperlos. Ohne Gewicht. Und völlig allein.
Ich drückte wieder auf den Knopf für die Zeitansage. Wieder und wieder, aber es war nicht genug.
»Anlage ein«, sagte ich zu der stimmgesteuerten Stereoanlage, die Lucien vor drei Monaten hier aufgestellt hatte, als ich aus der Reha kam. »Spiel Rage Against the Machine.«
Aus den Boxen ertönte »Killing in the Name Of«, und ich befahl der Anlage, lauter zu werden, bis der Bass wie ein zweiter Herzschlag in meinem Bauch dröhnte. Nur ein paar Sekunden. Wenn es zu laut war, würden die Nachbarn die Cops rufen. Die würden klingeln, und ich würde mich ungeschickt, wie ich jetzt war, zwei Treppen nach unten tasten müssen. Ich würde völlig Unbekannten die Tür öffnen, die zwar behaupteten, Polizisten zu sein, aber woher sollte ich bitte wissen, ob das stimmte?
Ich regelte die Musik auf Zimmerlautstärke runter und ließ den Songtext für mich schreien und wüten. Ich wollte auch schreien, aber manchmal hatte ich Angst, dass ich nie wieder aufhören würde, wenn ich einmal damit anfing.
Ich biss die Zähne zusammen und kniff auch die Augen so fest zu, dass mir der Kopf wehtat. Ich musste vorsichtig sein. Zu viel davon würde das Monster wecken, und das war wirklich das Letzte, was ich jetzt brauchte. Aber ich musste spüren, dass meine Augen geschlossen waren.
Dann war es wenigstens logisch, dass es dunkel war.
Irgendwann konnte ich meinen eigenen Gestank nicht mehr ertragen. Noch so ein Fluch. Alle Sinne funktionierten übertrieben gut, um die nutzlosen Augen wettzumachen. Zum Beispiel hatte ich gehört, wie das Mädchen aus dem Restaurant mich Arschloch genannt hatte. Sie dachte garantiert, ich hätte sie nicht gehört, aber das hatte ich. Und ich erinnerte mich an sie. Es war die letzte Stimme – abgesehen von Luciens Predigt –, die ich seit drei Tagen gehört hatte. Eine schöne Stimme. Nett. Auf jeden Fall besser als Trevors nasales Genörgel.
Ich befahl der Stereoanlage, die Klappe zu halten, setzte mich auf, stellte die Beine auf den Boden und berührte den Nachtschrank mit der linken Hand. Ich kam gegen ein kleines Plastikdöschen – in meiner Erinnerung war es orangefarben mit einem weißen Deckel – und hörte es herunterfallen. Es fiel in der Nähe meiner Füße zu Boden und rollte ein Stück weiter.
»Verfluchter Mist«, murmelte ich und bekam jetzt fast Panik. Ich durfte diese Medikamente nicht verschlampen. Sie waren das Einzige, was das Monster in Schlaf versetzen konnte.
Langsam kniete ich mich auf den Boden, versuchte, mich an Bett und Nachtschrank zu orientieren, und tastete nach dem Döschen. Ich fand es am Bettpfosten und nahm es fest in die Hand. Dann stellte ich es vorsichtig auf den Nachtschrank neben die blöde, nutzlose Nachttischlampe und schob es direkt an den Lampenfuß, damit ich genau wusste, wo es war.
Als ich aufstand, ließ ich den Nachtschrank los und war mitten im schwarzen Nichts.
Es war nicht mein Haus. Vor dem Unfall war der ganze Planet mein Zuhause gewesen: Wohnungen, Häuser, Hotels … Ich hatte in schicken Ferienresorts übernachtet, bei Freunden auf Sofas gepennt, in Dorfhütten oder unter freiem Himmel geschlafen. Egal auf welchem Kontinent.
Das hier war das ›kleine Stadthaus‹ meiner Eltern, und vor dem Unfall war ich nur wenige Male hier gewesen. Meine Mutter hatte so oft renoviert, dass ich keine Ahnung hatte, wie es aussah, und obwohl ich mich hier seit drei Monaten verkroch, hatte ich immer noch keine Vorstellung von dem genauen Grundriss. Es war wie ein fremdes Land, von dem ich keine Karte besaß.
Aber die Route vom Bett zum Bad war mir vertraut, da ich sie am häufigsten ging. Sechs Schritte bis zur Badezimmertür, dann wurde das kühle Hartholz unter meinen Füßen zu kalten Porzellanfliesen. Vier Schritte zu den beiden Waschbecken rechts, dann noch drei, und meine lächerlich tastenden Hände berührten die gläserne Wand der Dusche. Das Bad war riesig. Jedes Geräusch hallte.
Ich fand die Armatur der Dusche und begann mit den jämmerlichen Versuchen, die Temperatur einzustellen. Normalerweise war eine Dreißig-Grad-Drehung gegen den Uhrzeigersinn gerade richtig, aber manchmal landete ich darunter oder darüber, und es regnete entweder kochendes oder eiskaltes Wasser auf mich hinab. Es war immer wieder erstaunlich, wie verflucht kompliziert selbst die einfachsten Handgriffe geworden waren.
Ich zog Hose und Boxershorts aus, dann das T-Shirt, das nach altem Schweiß roch. Ich schaffte es zu duschen, ohne etwas fallen zu lassen oder eine Pflegespülung anstelle von Duschgel zu benutzen, und trat vorsichtig, wirklich vorsichtig, aus der Dusche und tastete nach dem Handtuchhalter.
Leer.
Klar. Weil beide Handtücher irgendwo auf dem Boden lagen, entweder in dem riesigen Bad oder irgendwo im Zimmer. Und seit Trevor gekündigt hatte, hatte sich niemand mehr um die Wäsche gekümmert. Nicht, dass Trevor besonders engagiert gewesen wäre. Nicht, dass ich gewollt hätte, dass dieses Arschloch meine Sachen wusch.
Ich stand auf der Badematte, tropfte, und mir wurde kalt. Und jetzt?
Und. Was. Jetzt?