
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Jeder Tag im Loop ist die Hölle. Seit zwei Jahren sitzt Luka im Hightech-Jugendgefängnis und wartet auf seine Exekution. Eingesperrt in einer dunklen Zelle, lässt er einmal am Tag die schmerzhafte Energie-Ernte über sich ergehen, die ihm jegliche Kraft raubt. Die immergleiche Routine zerrt an seinen Nerven – bis sich alles ändert. Wachen verschwinden, Insassen nehmen sich das Leben, ein Ausbruch aus dem Loop scheint nun möglich. Doch Gerüchten zufolge kursiert draußen ein Virus, das Menschen in Killermaschinen verwandelt. Und plötzlich ist ungewiss, wo die größere Gefahr lauert … Düster, brutal und spannend von der ersten bis zur letzten Seite - ein dystopischer Thriller, der nicht mehr aus der Hand zu legen ist. Band 1: The Loop Band 2: The Block Band 3: The Arc
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
The Loop. Das Ende der Menschlichkeit
Jeder Tag im Loop ist die Hölle. Seit zwei Jahren sitzt Luke im Jugendgefängnis und wartet auf seine Exekution. Eingesperrt in einer dunklen Zelle, lässt er einmal am Tag die schmerzhafte Energie-Ernte über sich ergehen, die ihm jegliche Kraft raubt. Die immergleiche Routine zerrt an seinen Nerven – bis sich alles ändert. Wachen verschwinden, Insassen nehmen sich das Leben, ein Ausbruch aus dem Loop scheint nun möglich. Doch Gerüchten zufolge kursiert draußen ein Virus, das Menschen in Killermaschinen verwandelt. Und plötzlich ist ungewiss, wo die größere Gefahr lauert …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Viten
Danksagung
Für Sarah
Sorry, dass in diesem Buch keine Drachen auftauchen …
Er wurde von einer Flut reinen Lebens, von der Brandung des Daseins, der vollkommenen Lust jedes einzelnen Muskels, jeder Sehne und jedes Gelenks überwältigt. Sie war das Gegenteil des Todes, sie glühte und raste, sie war Bewegung, die jauchzend unter den Sternen und über das Gesicht der toten, erstarrten Materie dahinflog.
Der Ruf der Wildnis, JACK LONDON
Die Energieernte beginnt. Und ich bestehe nur noch aus Angst, purer Angst.
Die Prozedur läuft immer gleich ab, jeden Abend zur selben Zeit. Ob sie Minuten dauert oder Stunden, kann ich nicht sagen, denn jedes Mal fange ich nach einer Weile an zu halluzinieren. Auch jetzt. Mein Verstand zieht sich vor Schmerz und Angst zurück, verlässt meine Gefängniszelle. Ich stehe wieder auf dem Dach des Black Road Vertical, des kilometerhohen Wolkenkratzers, in dem ich früher gewohnt habe. Der blonde Junge schreit. Er versucht eine Waffe aus seiner Tasche zu zerren und weicht Richtung Dachkante zurück, während das Mädchen mit der Hexenmaske immer näher kommt. Wenn ich nicht eingreife, wird er sie umbringen.
»Bleib stehen!«, brüllt er. Seine Stimme überschlägt sich vor Panik und Wut.
Jetzt hält er die Pistole in der Hand. Er geht noch einen Schritt zurück, weg von dem Mädchen mit der Gummimaske. Dann richtet er die Waffe auf ihren Kopf.
Als die Energieernte endlich vorbei ist, öffne ich benommen die Augen. Ausgelaugt hocke ich auf dem Betonboden meiner kleinen grauen Zelle. Mein Herz trommelt so laut, dass es in der durchsichtigen Glasröhre widerhallt, die von oben über mich gestülpt ist.
Ich versuche mich zu wappnen für das, was als Nächstes kommt, halte die Luft an, aber da donnert das eisige Wasser schon auf mich herab. Der Strahl ist so hart und so erbarmungslos, dass ich Angst habe zu ersticken. Die Röhre füllt sich mit chemisch aufbereitetem Wasser, während meine brennende Lunge und mein erschöpfter Körper nach Sauerstoff lechzen. Doch ich darf nicht atmen, sonst ertrinke ich.
Nach einer gefühlten Ewigkeit öffnet sich das Gitter unter mir und ich werde zu Boden gesaugt. Das Wasser fließt ab und ich liege nackt und keuchend da.
Dann strömt ein endloser Schwall unerträglich heißer Luft auf mich ein. Sie brennt auf meiner Haut.
Sobald ich trocken bin, stoppt das Gebläse und die Glasröhre zieht sich bis zum nächsten Abend in die Zimmerdecke zurück. Endlose Minuten liege ich einfach nur platt auf dem kalten Boden, zu etwas anderem reicht meine Kraft nicht.
Das Ganze kommt einer Dusche hier im Loop noch am nächsten. Aber eigentlich ist es Folter – auf Anordnung der Regierung.
Kurz darauf ist es Zeit für den Regen. Trotz der Schmerzen von der Energieernte zwinge ich mich jeden Abend wach zu bleiben und mir den Regen anzusehen. Punkt Mitternacht geht es los. Eine halbe Stunde nach dem Ende der Energieernte. Es schüttet wie aus Eimern, exakt eine halbe Stunde lang.
»Happy … melde dich«, keuche ich.
Der Monitor an der Wand leuchtet auf.
»Ja, Insasse?«, tönt es aus dem Bildschirm. Die weibliche Stimme klingt ruhig, fast tröstend.
»Die Vitalfunktionen«, verlange ich.
»Puls: 201, abfallend. Blutdruck: 140 zu 90. Temperatur: 37,2. Atemfrequenz: 41 …«
»Okay, okay, reicht, danke«, unterbreche ich.
Ich stemme mich hoch. Eigentlich keine anstrengende Bewegung, aber meine Beine zittern und meine Muskeln brennen. Ich sehe mich in der Zelle um. Der vertraute Anblick beruhigt mich. Die immergleichen vier Wände, grau und vollkommen kahl. In die eine ist eine dreißig Zentimeter dicke Tür eingelassen, in die daneben der Monitor und in die gegenüberliegende ein kleines Fenster. Dann gibt es noch ein schmales Bett mit einer dünnen Decke und einem flachen Kopfkissen und in der Ecke eine Toilette aus nicht rostendem Stahl mit einem winzigen Waschbecken daneben. Und einen Tisch, der im Fußboden verschweißt ist. Sonst nichts, von meinem Bücherstapel mal abgesehen.
Ich blicke auf den runtergedimmten Monitor. Es ist fünf Sekunden vor Mitternacht und ich fühle mich immer noch wie gerädert. Kraftlos schleppe ich mich zu dem kleinen rechteckigen Fenster und starre zum Himmel hinauf.
Mein Atem pfeift. Ich muss einen Schritt zurücktreten, damit die Scheibe nicht beschlägt.
Tausende von kleinen Explosionen zucken durch die schwarze Nacht. Ich kann sie nicht hören, weil die Zelle schalldicht ist, aber ich kenne das Prasseln noch aus meiner Kindheit. Meine Erinnerung daran ist so intensiv, dass ich das Geräusch fast wieder im Ohr habe. Die Tropfen springen vom Betonboden hoch und als sie zerplatzen, hinterlassen sie dunkle Nebelwölkchen, die miteinander verschmelzen. Ein Tuch aus Schatten hängt über dem Himmel. Binnen Sekunden bilden sich tiefe Pfützen und der Geruch steigt mir in die Nase. Natürlich nicht wirklich. Aber ich weiß noch von früher, wie nasser Boden riecht. Frisch und rein. Ich schließe die Augen und spüre den Duft in meiner Nase. Und wie jedes Mal wünsche ich, ich könnte rausgehen und die Nässe auf meiner Haut spüren. Aber das ist unmöglich.
Regen bedeutet, dass ein neuer Tag angebrochen ist. Es ist der 2. Juni. Mein sechzehnter Geburtstag. Seit mehr als zwei Jahren bin ich jetzt schon hier. Heute ist mein 737. Tag im Loop.
»Herzlichen Glückwünsch«, flüstere ich.
»Herzlichen Glückwünsch, Insasse 9–70–981«, tönt es fast gleichzeitig aus dem Bildschirm.
»Danke, Happy«, murmele ich.
Ich lege mich hin und versuche nicht zu weinen. Weil es sowieso nichts bringt und auch nichts ändern würde. Gar nichts. Aber ich bekomme trotzdem feuchte Augen.
Ich fühle mich wie zermalmt von den engen Wänden und der dicken Stahltür, die ich niemals werde öffnen können. Es ist alles so aussichtslos, so vergeblich. Ich sage mir, dass ich bei den Aufschüben ja nicht mitmachen muss. Dass ich ablehnen und mein Todesurteil annehmen kann. Ich muss nicht weiter dagegen ankämpfen. Ich müsste einfach nur akzeptieren, dass der Tod der einzige Ausweg aus dieser Hölle ist.
Es ist alles so sinnlos, so hoffnungslos. Aber nichts anderes ist zu erwarten von einem System, in dem die politische Führung kein Mitleid kennt, Barmherzigkeit in der Rechtsprechung nicht existiert und Algorithmen und Computer über menschliche Schicksale entscheiden.
Ich bin vor dem Weckruf wach und beobachte, wie der Bildschirm aus dem gedimmten Schlafmodus hochfährt und aufleuchtet.
Die Zeitanzeige springt von 7:29 auf 7:30 Uhr. Ich spreche den Weckruf mit.
»Insasse 9–70–981. Heute ist Donnerstag, der 2. Juni. Tag 737 im Loop. Die Temperatur in deiner Zelle beträgt neunzehn …«
»Weiter«, brumme ich, während ich die Beine aus dem Bett schwinge und aufstehe.
»Wie du wünschst. Bitte wähle dein Frühstück aus«, fordert mich Happy auf.
Ich entscheide mich für Orangensaft und Toast und drehe mich zum Bildschirm. In der linken oberen Ecke wird ein Foto von mir angezeigt. Es stammt vom Tag meiner Inhaftierung und ist einfach nur schrecklich: Ich sehe total benebelt aus und auf meiner dunklen Haut zeichnen sich diverse hellere Narben ab. Meine Nase wirkt noch größer als sonst und meine Ohren stehen ab wie die Henkel einer Tasse. Hätte ich reiche Eltern, wären diese normwidrigen Merkmale noch vor der Geburt korrigiert worden. Aber weil ich nur ein Regulärer bin, sitze ich jetzt da mit meinem Riesenzinken, den Segelohren und den Narben, die ich mir im Laufe der Jahre zugezogen habe. Doch es ist mir egal. Mum hat immer gesagt, dass mir mein Aussehen Charakter verleiht. Unterhalb des Fotos stehen die Informationen, die mir der Monitor jeden Morgen präsentiert: Außentemperatur, Raumtemperatur, Datum und Uhrzeit und die Zahl meiner bereits abgesessenen Tage in Haft. Und dann gibt es noch zwei Countdowns: Der eine zählt die Tage bis zu meiner Hinrichtung, der andere die Tage bis zu meinem nächsten Aufschub (sie liegen vierundzwanzig Stunden auseinander).
Die Klappe unter dem Monitor öffnet sich und mein Frühstückstablett gleitet auf den kleinen Metalltisch.
Der Toast ist so trocken, dass ich ihn kaum hinunterbekomme. Als ich fertig bin, stelle ich das Tablett in das Fach, aus dem es herausgekommen ist, und sofort wird es auf einem Fließband fortgeschafft.
Wieder meldet sich Happy. »Insasse 9–70–981, heute ist Donnerstag, du bekommst eine frische Uniform.«
»Okay«, murmele ich, öffne den Klettverschluss meines weißen Gefängnis-Overalls und streife die Schuhe ab. Dann ziehe ich die fürchterlich steifen und kratzigen Knast-Boxershorts aus und lege das Kleiderbündel auf das Tablett, das auf dem Fließband vorbeisirrt. Die Schmutzwäsche verschwindet und ich stehe nackt in meiner Zelle und warte. Sekunden später gleiten die frischen Klamotten herbei – sauber gefaltet, aber genauso steif und kratzig wie die alten.
Ich lege die Sachen aufs Bett und ziehe nur die Extra-Shorts an, um die ich gebeten hatte und die mir bewilligt worden waren, weil sie zur Gefängnisuniform gehören. Dann beginne ich mit meinem Work-out. Liegestütz, Sit-ups, Kniebeugen, Klimmzüge im Türrahmen und diverse Variationen davon, bis mir der Schweiß herunterläuft und ich völlig außer Atem bin. Normalerweise höre ich nach einer Stunde auf, aber heute mache ich wie besessen weiter. Ich will dem Schmerz entkommen, der hartnäckig versucht, mich zu packen. Noch eine Runde. Und noch eine. Liegestütz, Sit-ups, Kniebeugen, Klimmzüge. Ich treibe mich an, bis einfach nichts mehr geht und meine Muskeln brennen wie Feuer.
Erst als ich keuchend auf dem Boden liege, lasse ich mich vom Schmerz mitreißen.
Maddox ist weg.
Allmählich akzeptiere ich diese Tatsache. Lasse sie erst wie eine riesige Welle über mich hinwegschwappen und dann sacken.
Schließlich schleppe ich mich zu meinem kleinen Waschbecken, wasche mich und trockne mich ab. Dann steige ich in die frische Gefängnisuniform.
»Insasse 9–70–981«, meldet sich Happy, »mach dich bereit für die tägliche Ansprache von Mr Galen Rye, Oberwächter der Region 86.«
»Kanns gar nicht erwarten«, knurre ich, setze mich auf mein Bett und starre den Monitor an.
Überall in der Stadt und in den angrenzenden Siedlungen werden die Werbespots auf den Holo-Projektoren jetzt unterbrochen. Und auf den Linsen – einem Hightech-Feature für die Augen der Modifizierten, das die optische Wahrnehmung mit einer zusätzlichen Schicht virtueller Realität unterlegt – werden alle Spiele, Augmented-Reality- und Social-Media-Anwendungen beendet. Galens tägliche Ansprache wird live auf sämtlichen TV- und VR-Modulen übertragen, ansehen ist Pflicht.
Sein Gesicht erscheint auf meinem kleinen Zellen-Bildschirm. Freundlich, warm und zuversichtlich.
»Guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger«, beginnt er und setzt sein einstudiertes Lächeln auf. »Da ich weiß, wie beschäftigt ihr alle seid, werde ich mich kurzfassen.«
Dieser tägliche politische Erguss interessiert mich nicht die Bohne, aber wenn ich meinen Blick vom Monitor abwende, stoppt die Aufnahme so lange, bis ich wieder hinschaue. Besser also, ich bringe es hinter mich.
»Mein Versprechen, die Zahl der technischen Jobs auszubauen, wird zurzeit erfolgreich umgesetzt, und ich werde mich persönlich dafür starkmachen, dass die Hälfte dieser nicht automatisierten Arbeitsplätze an Reguläre vergeben wird. Denn wir sind keine geteilte Nation, egal, was die Medien uns weismachen wollen. Wir lassen unsere Gesellschaft nicht spalten! Nicht, solange ich euer Wächter bin.«
Ich verdrehe die Augen. Für den Bruchteil einer Sekunde schweift mein Blick ab und sofort friert Galen auf dem Bildschirm ein, den Zeigefinger in die Luft gestreckt. Erst als ich den Monitor wieder fokussiere, redet er weiter: über seine Politik und darüber, dass die Region 86 so erfolgreich ist wie seit fünfzig Jahren nicht mehr – was garantiert umstritten ist.
Galen beendet seine Ansprache mit dem üblichen »Wir sind eins!«-Appell. Puh. Jetzt habe ich zwei Stunden Zeit zum Lesen. Was das angeht, bin ich ein echter Glückspilz. Ungefähr ein Jahr nach meiner Inhaftierung habe ich mich mit Wren Salter angefreundet, der einzigen menschlichen Wärterin im Loop. Sie sammelt alte Bücher – keine elektronischen, die einem auf die Linse gespielt werden –, sondern Bücher aus echtem Papier. Die ursprünglichen. Im Loop werden die Zellen alle drei Sekunden gescannt. Sie wollen sichergehen, dass die Häftlinge nicht ausbrechen und dass nichts Elektronisches hineingeschmuggelt wird. Deshalb sind altmodische Bücher aus Papier das Einzige, was man gefahrlos hineinbekommt. Am Fußende meines Bettes stapeln sich 189 Bücher. Es ist alles dabei: vom modrig riechenden Western, 300 Jahre alt, mit vergilbten Seiten und ausgebleichter Schrift, bis zu den letzten gedruckten Bestsellern aus der Zeit rund um meine Geburt.
Wenn mich ein Roman wirklich packt, dann lese ich ihn an einem Tag durch. Manche Bücher lese ich sogar mehrmals. Kindred zum Beispiel. Oder Harry Potter. Oder Schiffbruch mit Tiger. Und Die linke Hand der Dunkelheit. Die Geschichten sind dermaßen spannend und die Figuren so lebendig, dass sie mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ich frage mich, ob die Bücher damals, als sie erschienen sind, genauso beliebt waren.
Gerade stecke ich mitten in einer Story über eine Familie, die in einem Geisterhaus festsitzt. Der Roman stammt von einem Autor, den ich sehr mag. Ich habe schon mindestens fünf Bücher von ihm gelesen und fand sie alle großartig, aber dieses gefällt mir bislang am besten.
Das Tolle an Büchern: Ich kann mit ihnen entfliehen. An einen Ort, den jemand anderes erschaffen hat. Wenn ich lese, muss ich für eine Weile nicht ich selbst sein. Dann tauche ich in eine andere Welt ab. Das brauche ich manchmal. Wahrscheinlich unterscheide ich mich gar nicht so sehr von den Drogenabhängigen, die in den Hochhäusern und Slums am Stadtrand abhängen.
Um 11:30 Uhr gleitet die Rückwand meiner Zelle langsam nach oben. Das geschieht völlig geräuschlos, aber ich merke es trotzdem, denn ich höre plötzlich Vogelgezwitscher und spüre den Wind und die Sonne. Ich lege das Buch aufs Bett und stelle mich vor die hochgleitende Wand.
Uns steht jeden Tag eine Stunde Bewegungszeit im Freien zur Verfügung. Fünfundvierzig Minuten davon sprinte ich an den Trennwänden meines dreieckigen Hofs entlang, Runde um Runde.
Wenn die Zellenrückwand ganz hochgefahren ist, bekommt man einen Überblick über die Form des Gefängnisgebäudes: Wie der Name vermuten lässt, sieht es aus wie ein gigantischer Ring … oder wie eine Schlinge. Das Loop hat einen Umfang von einem Kilometer. Hundertfünfundfünfzig Zellen sind darin untergebracht, eine neben der anderen. Zwischen zwei der Zellen befindet sich eine Sicherheitsschleuse, die direkt in den Tunnel führt, in dem der Dark Train verkehrt – die einzige Verbindung zur Außenwelt. Die Zellen sind auf der Ringaußenseite drei Meter breit und auf der Ringinnenseite – zum Hof hin – zweieinhalb Meter. Die Seitenwände selbst sind einen Meter und die Decke einen halben Meter dick – was die Räume absolut schalldicht, ausbruchssicher und nahezu bombenfest macht. Auf der Ringinnenseite schließt sich an jede Zelle ein schmales, sechzig Meter langes Tortenstückchen Hof an. Sämtliche Höfe laufen auf die gewaltige Betonsäule zu, das Zentrum der gesamten Anlage und Stützpunkt der gefürchteten Drohnen.
Die Hofstunde ist die einzige Möglichkeit für uns Häftlinge, miteinander zu kommunizieren. Sehen können wir uns nicht – wegen der fünf Meter hohen Metallwände, die die Höfe voneinander trennen. Aber wir können uns unterhalten.
Die Zellenwand ist erst zur Hälfte hochgeglitten, da höre ich schon die Rufe meiner Mithäftlinge. Und ich höre Pander Banks eines der sieben Lieder singen, an die sie sich aus ihrem früheren Leben erinnert. Sie singt ununterbrochen und wenn sie ihr Repertoire durchhat, beginnt sie wieder von vorne.
Außerdem höre ich, wie die Drohnen abheben und Malachai Bannister am anderen Ende des Hofes verwarnen. Malachai liebt es, seine Hofwand hochzuklettern und oben zu warten, bis die fliegenden Security-Roboter ihren 3-Sekunden-Countdown starten. Dann lässt er sich runterfallen und lacht sich kaputt. Im vierten und fünften Hof rechts höre ich, wie Pod und Igby, zwei der ruhigeren Häftlinge, ihr merkwürdiges Abenteuerspiel weiterspielen. Dafür benutzen sie jeweils fünf Würfel, die Wren ihnen in die Zellen geschmuggelt hat. Sie sehen nicht, welche Zahl der Spielpartner würfelt, also müssen sie entweder extrem ehrlich oder extrem leichtgläubig sein.
Zu beiden Seiten meines Hofs diskutieren die Planer verschiedene Ausbruchsmöglichkeiten. Die Gruppe besteht aus vier Häftlingen: Adam Casswell, Fulton Conway und Winchester Shore links und Woods Rafka rechts. Manche ihrer Ideen sind einfach nur absurd (sich an eine Drohne ranzuhängen und über die Trennwände zu fliegen), andere sind ziemlich ausgetüftelt (das Kapern des Dark Train während einer Fahrt zum Aufschub). Aber letztlich wissen die vier so gut wie wir alle, dass es völlig unmöglich ist, aus dem Loop rauszukommen. Sie wissen auch, dass jedes ihrer Worte aufgezeichnet wird und dass die Regierung – auch wenn es gesetzwidrig ist – auf die Mikrokameras zugreifen kann, die jedem von uns in die Stirn implantiert sind. Doch das hindert die vier nicht daran, ständig neue Fluchtpläne zu schmieden.
Trotz all dem Geschrei, Gesang und Gequatsche höre ich die raue Stimme, die in Dauerschleife Morddrohungen zu mir herüberruft. Ich kenne das schon: Sobald die Rückwand hochgleitet, brüllt einer der Insassen meinen Namen – eine ganze Stunde lang, jeden Tag.
»Luka Kane«, krächzt er. »Luka Kane, ich bring dich um! Ich bring dich um, Luka Kane!«
Der Typ ist einen Tag nach mir hergebracht worden. Er droht mir also seit 736 Tagen. Ich muss gestehen, dass es mir am Anfang echt Angst gemacht hat. Ich habe meine Zelle nie länger als eine Sekunde verlassen. Ich habe nur einen Fuß in den Hof gesetzt und sofort wieder einen Schritt zurück gemacht. So habe ich Happy signalisiert, dass ich nicht länger draußen sein wollte. Daraufhin hat sie die Rückwand wieder runtergefahren und ich hatte meine Ruhe. Nach drei Tagen habe ich dann selbst gemerkt, wie albern das war. Die Chance, dass der Typ es in meinen Hof schafft, ist gleich null. Die Metallwände sind einfach zu hoch. Abgesehen davon, dass ihm die Drohnen beim kleinsten Versuch sofort Giftpfeile in die Haut jagen würden.
Wren hat mir erzählt, dass er Tyco Roth heißt. Das Schlimmste an seinen Drohungen ist, dass ich nicht den leisesten Schimmer habe, wer er ist und warum er es auf mich abgesehen hat.
Jetzt ist die Zellenwand endlich komplett in der Decke verschwunden und ich stürze in den Hof, sprinte sofort los, volles Tempo, treibe mich selbst bis an meine Grenze. Die Betonsäule wird größer und größer, je näher ich der Mitte der Anlage komme. Ich verlangsame das Tempo, lege die Handflächen einmal kurz auf die kalte Säule und renne zurück in Richtung der Zelle. Beide Strecken dauern nicht einmal zwanzig Sekunden. Ich mache kehrt und laufe wieder los, eine Bahn nach der anderen, so lange, bis mein Atem pfeift und meine Muskeln brennen, aber ich blende den Schmerz aus und laufe weiter. Das ist meine Art der Rebellion. Meine Art, der Regierung mitzuteilen, was ich von ihrer Folterkammer halte.
Ich bin schon wieder auf dem Weg zur Säule. Die Wände, die mich von den beiden Nachbarhöfen trennen, sind so nah, dass ich sie berühren kann. Meine Gedanken wandern zu dem Hof rechts. Die Zelle dort steht seit zwei Tagen leer. Sie gehörte Maddox Fairfax, meinem besten Freund, einem Regulären, der nur noch drei Monate bis zu seiner Verlegung in den Block gehabt hätte. Wie durch ein Wunder hatte Maddox ganze elf Aufschübe unbeschadet überstanden. Und dann kam der zwölfte, eine Operation. Ihm wurden die Augen herausgenommen und durch neuartige Prothesen ersetzt, eine Mischung aus Hightech und laborgezüchtetem Gewebe. Eine Zeit lang haben diese neuen Augen auch tatsächlich funktioniert. Zwar litt Maddox Höllenqualen, als er ins Loop zurückkehrte – seine Augen waren total geschwollen –, aber dafür konnte er mir die exakten Maße seines Hofs durchgeben, nachdem sein Blick nur einmal kurz die Trennwände gescannt hatte. Er wusste plötzlich auch, welches Wasservolumen die Energieernte-Röhre fasst. Und wenn ein Flugzeug über uns hinwegflog, konnte er mir die Flughöhe, die Geschwindigkeit und die präzisen Koordinaten sagen.
Doch von einem Tag auf den anderen war Maddox plötzlich nicht mehr derselbe. Sein Körper stieß die Prothesen ab, das Gewebe entzündete sich. Daraufhin wurde er für irgendwelche Untersuchungen mit dem Dark Train abtransportiert – und ist nicht mehr zurückgekehrt.
Dieses Risiko gehört dazu, wenn man sich auf einen Aufschub einlässt. Man hofft auf irgendeinen kleinen nanotechnologischen Test, eine Impfung oder eine kosmetische Spritze, die die Körperhaare entfernt oder die Augenfarbe verändert. Aber hin und wieder kommt es eben auch vor, dass ein Häftling nach einem Aufschub zurückkehrt und man ihn, sobald die Rückwand hochfährt, vor Schmerzen brüllen hört, weil die Ärzte ihm ein Bein abgenommen oder die Lunge und das Herz durch ein Roboterteil ersetzt haben.
Die Aufschübe dienen ausschließlich dem Wohlergehen der Modifizierten. Mit den Experimenten und chirurgischen Eingriffen werden neue Produkte an uns getestet, die das Leben der Reichen verbessern sollen. Wir Loop-Insassen sind deren Versuchskaninchen.
Ich muss daran denken, wie Maddox mich in den ersten Wochen nach meinem Gerichtsprozess wieder aufgebaut hatte. Dem Prozess, in dem Happy befunden hatte, dass ich mir über mein Handeln voll und ganz bewusst gewesen sei und deshalb die Verantwortung für mein Verbrechen tragen müsse.
Maddox hatte mich an meinem vierten Tag im Loop angesprochen, als ich mich getraut hatte, den Hof länger als eine Sekunde zu betreten. Wir hatten über die Aufschübe geredet. Darüber, dass es eigentlich vernünftiger wäre, sie abzulehnen und stattdessen das Todesurteil anzunehmen. Lieber sterben, als sich der Willkür des Regimes zu beugen, hatten wir damals gesagt – obwohl wir beide wussten, dass es eigentlich unmöglich ist, abzulehnen. Denn den Tod zu wählen ist ein Schlag ins Gesicht der Hoffnung. Und egal, wie verzweifelt deine Lage ist: Ein Fünkchen Hoffnung hast du immer.
Nachdem man mir gleich zu Beginn bei dem obligatorischen Eingriff die Anti-Flucht-Technologie implantiert hatte, stand sechs Monate später der erste richtige Aufschub an. Bevor sie mich abholten, hatte ich minutenlang auf den Bildschirm gestarrt und mir ausgemalt, wie viele Aufschübe mir wohl noch bevorstünden. Ich wusste, dass sie mir irgendwann mal Gliedmaßen amputieren, Knochen austauschen oder synthetisches Blut spritzen würden. Dass es nur eine Frage der Zeit war, bis ein Eingriff fehlschlagen und ich tagelang vor Schmerzen brüllen würde. Denn die Forscher im Labor geben einem keine Gnadenspritze. Sie bringen den Patienten zur Beobachtung zurück in seine Zelle und filmen ihn rund um die Uhr, bis er stirbt. Sie geben ihm nicht mal Schmerzmittel, sie hängen einfach nur vor ihren Bildschirmen und verfolgen jede einzelne Sekunde des Todeskampfs. Sie beobachten, wie die neue Bauchspeicheldrüse versagt, die ultraverstärkten Adern platzen oder der Körper das künstliche Bein abstößt. Sie zeichnen den Schmerzlevel auf und jede noch so kleine Körperreaktion auf den missglückten Eingriff. Und dann passen sie ihre Experimente an und wiederholen sie an anderen Häftlingen.
Im Block ist es angeblich noch schlimmer. Dort müssen die Häftlinge alle sechs Wochen statt alle sechs Monate entscheiden, ob sie einen Aufschub wollen. Der Block ist ein neuerer Gebäudekomplex, er wurde erst vor sieben Jahren fertiggestellt. Was dort drinnen abgeht, weiß keiner so genau, aber es gibt natürlich Gerüchte. Grauenhafte Gerüchte über Folter und Schmerz und entsetzliche Haftbedingungen. Viel entsetzlicher als im Loop. Sobald ein Häftling im Loop achtzehn wird, kommt er in den Block. Mir bleiben noch 730 Tage, bis ich an der Reihe bin.
Aber jetzt schiebe ich alle Gedanken an Aufschübe, den Block, Todesurteile und Maddox beiseite und renne. Renne mir die Seele aus dem Leib.
Schließlich sacke ich an der Trennwand zu Maddox’ Hof zusammen und hole keuchend Luft. Wie sich das Atmen wohl für die Modifizierten anfühlt? Ein vollautomatischer O2-Exchanger gibt siebenmal mehr Sauerstoff ins Blut als eine menschliche Lunge. Und der Power-Cardio-Modulator pumpt – anstelle des Herzens – das sauerstoffangereicherte Blut kraftvoll und geräuschlos durch den Körper.
Die Übermenschen, die Cyborgs, die Modifizierten – die auf uns Reguläre herabschauen, als wären wir der letzte Dreck.
Mein Atem hat sich gerade einigermaßen beruhigt, als ich von links, ein paar Höfe weiter, Gesprächsfetzen aufschnappe. Zwischen all dem Gesinge und Gerufe und den heiseren Morddrohungen von Tyco Roth höre ich, wie sich ein Junge und ein Mädchen darüber unterhalten, was draußen in der Welt vor sich geht. Ich erkenne ihre Stimmen. Es sind Alistair George und Emery Faith.
»Irgendwie scheint es Unruhen zu geben. Es klang so, als ob die Regulären rebellieren würden …«, sagt Alistair. Sein irischer Akzent ist bei all dem Lärm kaum zu verstehen.
»Wie wollen sie das machen?«, fragt Emery. »Den Kampf können sie doch nur verlieren.«
»Es ist sogar die Rede von Krieg. Es heißt, dass …« Wieder verschwimmt Alistairs Stimme.
»Alistair, es gab seit hundert Jahren keinen Krieg mehr!«
»Und was ist mit all den Leuten, die aus der Stadt verschwunden sind? Ich hab gehört, dass sie sich in den Roten Zonen verstecken. Was, wenn sie …?«
Ich lausche angestrengt, doch in dem Moment heult die Sirene über die Höfe und schneidet das Gespräch ab. Happys Stimme informiert uns, dass wir in einer Minute in unsere Zellen zurückkehren müssen. Um uns daran zu erinnern, was passiert, wenn wir nicht gehorchen, heben die Drohnen von der Mittelsäule ab und kreisen mit schussbereiten Pfeilen am Himmel. Ich höre, wie sich die Insassen voneinander verabschieden, wie Pander schnell ihr Lied zu Ende singt, Tyco mir eine letzte Morddrohung zubrüllt und die restlichen Häftlinge zurück zu ihren Zellen laufen – wo sie weitere dreiundzwanzig Stunden Stille und Einsamkeit erwarten.
Ich grübele über das Gespräch zwischen Emery und Alistair nach. Draußen soll Krieg herrschen? Das können nur falsche Gerüchte sein. Die Welt wird schließlich nur von einer einzigen Regierung beherrscht und die vertraut voll und ganz auf Happys unanfechtbare Logik. Außerdem: Wie wollen die beiden überhaupt davon erfahren haben? Es gibt keine Besuchszeiten im Loop, kein Fernsehen, keine Linsen, keine LucidVision, nicht mal VR. Und obwohl Happy das Betriebssystem ist, das auf all diesen Geräten läuft, können wir nicht auf deren Informationen zugreifen, nicht einmal über den Monitor. Unser einziger Kontakt zur Außenwelt ist Wren, unsere Wärterin. Einmal täglich kommt sie im Auftrag der Regierung vorbei und bringt uns unser Mittagessen. Das wird nach außen hin als Akt der Barmherzigkeit verkauft, schließlich sollen die Leute nicht denken, wir Kriminellen würden wie Tiere behandelt. Und wer hat diese werbewirksame Maßnahme empfohlen? Natürlich, Happy.
Die letzte Person, die ich draußen gesehen habe (abgesehen von den Wachen und Ärzten bei den Aufschüben), war meine Schwester Molly. Sie hat geweint, gefleht und gebettelt, damit ich nicht gehen muss, aber die Sicherheitsbeamten hat das völlig kaltgelassen. Sie haben mich brutal aus unserer Wohnung gezerrt.
Das war mein letzter Tag in Freiheit gewesen. Man hat mich auf die Wache gebracht, wo ich mich zu meiner Tat bekannte. Danach wurde ich vor Gericht gestellt und von Happy verurteilt. Die nächste Station war der Laborkomplex, wo sie mir einen kobaltbeschichteten Magnetkern ins Handgelenk implantiert und danach die Brust aufgeschnitten haben, um die innere Handschelle mit meinem Herzen zu verbinden. Das war mein erster Aufschub gewesen. Jeder Häftling im Loop muss diesen Eingriff über sich ergehen lassen. So haben sie uns ständig unter Kontrolle und wir können weder Aufstände anzetteln noch Ausbruchsversuche unternehmen.
Ich schüttele die Erinnerungen an das Ende meines echten Lebens und den Beginn meines Häftlingsdaseins ab – dieser grauenhaften Monotonie, wo sich ein Tag an den nächsten reiht und sich niemals etwas ändern wird. Jedenfalls nicht, solange die Weltregierung an der Macht ist.
»Happy«, sage ich und starre auf den Bildschirm.
»Ja, Insasse 9–70–981?«, tönt es zurück.
»Wiedergabe Tag 733 im Loop. Zeit: 11:45 Uhr.«
»Kommt sofort.« Die Zahlen und Statistiken werden ersetzt durch Bilder aus meiner Stirnkamera. Ich höre meinen keuchenden Atem, als ich den letzten Sprint von der Säule zu meiner Zelle einlege. Das Kameraauge schweift zu der angrenzenden Wand und sackt zu Boden.
»Hey, Maddox!« Meine Stimme übertönt Tycos Gebrüll und Panders Gesang. Keine Antwort. »Maddox, bist du da?«
Während ich die Aufzeichnung ansehe, kriecht der Schmerz erneut in mir hoch, aber ich kämpfe gegen die Tränen an.
Und endlich höre ich Maddox’ Stimme. Sie klingt ganz schwach und gebrochen.
»Ich glaube, jetzt haben sie mich, Luke«, zittern seine Worte über die Trennwand.
»Wovon redest du?«, höre ich meine eigene Stimme. Sie klingt belustigt, weil ich gedacht habe, mein Freund würde mich verarschen.
»Ich glaube nicht, dass ich den Block noch erleben werde. Aber ist wahrscheinlich auch besser so.«
Ich starre das Video an und weiß noch, wie mein Herz plötzlich raste, als seine Worte endlich zu mir durchdrangen.
»Maddox, was ist los?«
»Diese Augen, Luke. Mein Körper nimmt sie nicht an.«
Maddox war der einzige Mensch, der mich Luke nennen durfte – und dieses »Luke« jetzt noch einmal zu hören, ist einfach zu viel für mich.
»Stopp die Aufnahme, Happy!«, sage ich mit bebender Stimme. »Wiedergabe Tag 4 im Loop. Zeit: 11:30 Uhr.«
»Gerne«, antwortet der Monitor.
Ich starre auf die neu eingespielte Aufnahme, sehe mich, wie ich zögernd auf den Hof hinaustrete und zusammenzucke, als ich Tyco Roths Morddrohung höre.
»Meint er dich, Neuer?«, ruft Maddox von nebenan.
Ich blicke auf die nackte Wand, die uns trennt. Schweigend.
»Ich heiße Maddox und ich schätze, du bist dieser Luka Kane, dessen Namen der Psychopath die ganze Zeit brüllt? Beachte ihn nicht, der hat definitiv ein Rad ab.«
Ich laufe zu der Wand und presse eine Hand auf das Metall. »Ja, ich … ich bin Luka Kane.«
»Luka Kane«, wiederholt Maddox. »Schön, dich endlich kennenzulernen, neuer Nachbar.«
»Warum will der Typ mich umbringen?« Meine Videostimme klingt hohl und verängstigt. Und so jung.
»Weiß der Teufel«, höre ich Maddox antworten, fröhlich und selbstsicher. »Ist doch auch egal. Er kriegt dich ja eh nicht.«
»Insasse 9–70–981«, reißt mich Happys Stimme aus der Versenkung. »Dein tägliches Kontingent an erlaubten Erinnerungen beträgt noch zwei Minuten.«
»Wiedergabe Tag 6 im Loop«, verlange ich. »Zeit: 11:39 Uhr.«
»Gerne«, schnarrt Happy.
Die neue Videosequenz wird abgespielt: der Hof, die Trennwand, Maddox’ Stimme, die zu mir herüberschallt.
»Das Ding ist, Kumpel: Du solltest dich besser an den Ort hier gewöhnen. Entspann dich und machs dir gemütlich. Denn wenn du Pech hast, wirst du noch sehr lange hierbleiben.«
»Wenn ich Pech habe?«, höre ich mich fragen. Meine Stimme klingt jetzt schon mehr nach mir. Nicht mehr ganz so verschreckt und zittrig wie an Tag vier.
»Ganz genau«, antwortet Maddox. »Wir sind Versuchskaninchen, Mann. Und das, was uns am Ende erwartet, ist garantiert auch kein Zuckerschlecken.«
»Und was bringt es einem dann, die Aufschübe mitzumachen?«
Maddox lacht schnaubend. »Das frage ich mich auch jedes Mal. Weißt du, wie sie es machen? Wie sie uns umbringen?«
»Mit dem Herz-Trigger, diesem Impulsauslöser, dachte ich immer«, antworte ich.
»Sie benutzen sogenannte Auslöscher. Hast du jemals einen gesehen? Die Dinger ähneln Sicheln, du weißt schon, diese gebogenen Mähmesser. Wenn sie irgendeinen Teil von dir durch die Ausbuchtung stecken, wird er zu mikroskopisch kleinen Flocken zerschreddert. Wer bitte hat den Mumm, einen Aufschub abzulehnen, wenn am Ende ein großer Schredder wartet?«
Der Bildschirm wird dunkel. »Du hast die erlaubte Tagesdosis an Erinnerungen ausgeschöpft.«
»Okay«, antworte ich. »Kann ich jetzt bitte etwas Privatsphäre haben?«
»Natürlich«, sagt Happy und der Bildschirm geht in den Stand-by-Modus.
Ich versuche, nicht mehr an Maddox zu denken. Die Erinnerungen an ihn tun mir nicht gut. Und zurück bringen sie ihn auch nicht.
Ich lasse mich aufs Bett fallen und ziehe mein Buch unter dem Kopfkissen hervor. Nach den ersten fünf Wörtern bin ich vollkommen abgetaucht. Lesen ist besser als alle Linsen der Welt. Sogar besser als LucidVision mit ihrer traummanipulierenden Technologie.
Zwei Stunden verstreichen, bevor sich die Luke in der Zellentür öffnet und ich Wrens Stimme höre.
»Alles Liebe zum Geburtstag, Luka.«
Obwohl ich ziemlich abrupt aus meiner Lektüre gerissen werde, muss ich lächeln.
Wren hat vor etwas über einem Jahr im Loop angefangen. Der Wärter vor ihr war ein verbitterter Alter gewesen, Forrest Hamlet. Bevor er mir das Essen durch die Luke schob, bombardierte er mich erst mal mit Fragen. Dann knallte er die Klappe zu und verschwand wortlos – bis zum nächsten Mittag. Das Bittere dabei: Ich habe mich trotzdem jedes Mal gefreut, Forrest zu sehen. Was die Einsamkeit mit dir macht, ist echt nicht zu unterschätzen, das habe ich im Loop gelernt. Wenn du dich einsam fühlst, sehnst du manchmal die furchtbarsten Situationen herbei.
Zum Glück ist Wren ganz anders. Okay, sie ist eine Modifizierte, aber eine völlig untypische. Sie bemüht sich ehrlich um uns Häftlinge, tut alles Menschenmögliche, damit wir nicht durchdrehen.
»Danke.« Ich setze mich auf und drehe mich zu ihr.
»Wie findest du das Buch?«, fragt sie. Ihr blondes Haar fällt ihr in einer perfekten Welle über die grünen Augen.
»Super!« Ich reiße ein Stück vom Kopfkissenbezug ab und lege es als Lesezeichen zwischen die Seiten. »Eines der besten, die ich bisher gelesen habe.«
»Ich liebe es auch«, sagt Wren. Ihr Lächeln ist einfach atemberaubend. Natürlich ist es das – ihre Eltern haben sich die Schönheit und genetische Makellosigkeit ihrer Tochter sicher schon vor deren Geburt einiges kosten lassen. Und dann wurden garantiert noch ein Dutzend weiterer technologischer Verbesserungen eingebaut. Trotzdem wirkt Wrens Lächeln total authentisch und natürlich.
»Du musst unbedingt die Fantasy-Reihe des Autors lesen, die ist am allerbesten.«
»Ich bin gespannt«, sage ich.
Wren streckt ihren Arm durch die Luke, was streng verboten ist. Sofort leuchtet der Monitor an der Wand rot auf und Happy schreitet ein: »Sicherheitsverletzung. Abriegelung in fünf Sekunden, vier, drei …«
Ich springe auf und sehe das Päckchen in Wrens Hand, eingewickelt in rot-silbernes Geschenkpapier. Hastig nehme ich es entgegen, während Wren ihren Arm zurückzieht. Happys warnender Countdown bricht ab.
»Ein Geschenk?« Ich spähe durch die Luke.
»Na ja, schließlich hast du Geburtstag«, antwortet sie achselzuckend.
»Oh, ich hätte nicht gedacht …« Mir fehlen die Worte und ich reiße verlegen das Papier auf.
»Wieder nur ein Buch«, sagt sie. »Aber ein gutes.«
Ich drehe den Roman in den Händen. Er hat ein grünes Cover und trägt den Titel: Der Herr der Ringe – Die Gefährten.
»Das ist der erste von drei Bänden«, erklärt sie. »Ich glaube, er wird dir gefallen.«
»Toll, danke!«
»Gern geschehen.«
»Ich lese ihn, sobald ich damit fertig bin.« Ich nicke in Richtung des Buches auf meinem Bett. »Möchtest du das und die anderen eigentlich zurückhaben?« Ich deute auf den Bücherstapel am Fußende.
Wren schüttelt den Kopf. »Das fragst du mich jeden Tag«, lacht sie. »Behalte sie. Im Antiquariat bekomme ich zehn Stück für einen Coin.«
»Bist du sicher?«
Wren nickt. Es ist wirklich irre, wie viel mir diese Bücher bedeuten, und wie wertlos sie für die Menschen dort draußen sind. Aber klar, die lenken sich ja auch mit Unterhaltungselektronik ab.
»Ganz sicher«, sagt sie. »Und? Wie gehts dir?«
In den nächsten zehn Minuten unterhalten wir uns über mein Lieblings-Skate-Team, die letzten Filme, die sie gesehen hat, ihren Wunsch, Virtuelle Architektin zu werden, und die Programmierversuche in ihrer Freizeit. Und dann muss sie auch schon weiter. Sie reicht mir ein Sandwich und verabschiedet sich.
Das ist der traurigste Teil des Tages: der Moment, in dem sich die Luke schließt und ich weiß, dass ich Wren die nächsten vierundzwanzig Stunden nicht sehen werde. Es ist noch nicht einmal 15 Uhr und ich habe nichts zu tun. Nichts, außer zu lesen und auf die Energieernte zu warten.
Wieder allein in der Totenstille denke ich darüber nach, wie unerträglich das Gefängnisleben ohne Wren wäre. In dem Jahr bis zu Forrests Pensionierung hat mich das Loop fast erdrückt. Jede einzelne Sekunde hat sich endlos hingezogen. Ich glaube, ich war wirklich kurz davor, den Verstand zu verlieren.
Doch eines Tages hat sich die Luke geöffnet, und während ich auf dem Bett lag und darauf wartete, dass mich Forrest Hamlet mit Fragen zur Regierung löchert (wobei sein barscher Ton so gar nicht zu seinem attraktiven Modifizierten-Gesicht passte), sagte eine vollkommen andere Stimme: »Hi, ich bin Wren, die neue Wärterin.«
Als ich mich verblüfft aufsetzte, habe ich in ein lächelndes Gesicht mit leuchtend grünen Augen geblickt – und ich glaube, ich habe damals wirklich einen Funken Hoffnung verspürt. Es war ein Lächeln mit absolut perfekten weißen Zähnen, wie nur die Modifizierten es zustande bringen. Ich sagte ebenfalls »Hi« und dann unterhielten wir uns ein bisschen – nicht besonders tiefgründig, eher netter Small Talk. Wie gehts dir? Wie heißt du? Wie lange bist du schon hier? Aber egal, ich hatte das Gefühl, als würde es sie wirklich interessieren. Als würde ich ihr am Herzen liegen.
Verliebt habe ich mich in sie, als sie mir zum ersten Mal ein Buch mitgebracht hat. Es war einfach nur eine Geste. »Um die Zeit totzuschlagen«, sagte sie und lachte, als ich völlig perplex das schwarze Cover anstarrte, auf dem ein heulender roter Wolf abgebildet war. Sie fand, ich würde aussehen wie ein Verdurstender in der Wüste, dem man ein Glas Wasser in die Hand drückt, und ich sagte ihr, dass ich mich haargenau so fühlte. Eine ziemlich lahme Antwort, aber Wren lächelte trotzdem. Es war ein uraltes Buch, Ruf der Wildnis, von einem Autor namens Jack London. Es handelt von einem Hund, der sich einem Wolfsrudel anschließt. Ich habe es geliebt und kenne es immer noch auswendig, Satz für Satz. Ich hatte es bereits zweimal durchgelesen, als Wren mir am nächsten Tag ein weiteres Buch durch die Luke schob.
Seitdem versorgt sie mich fast täglich mit neuem Lesestoff. Sie opfert kostbare Lebenszeit, um online zu gehen und mit ihrer Linse durch die Mall zu streifen, ein gigantisches virtuelles Einkaufszentrum mit über vier Millionen Online-Shops. In einem Antiquitätenladen wählt sie die Bücher für mich aus und lässt sie per Drohne zu sich nach Hause liefern. Binnen einer Stunde sind sie da. Wren ist vollkommen selbstlos. Einfach nur hilfsbereit und nett. Eben ganz untypisch für eine Modifizierte.
Ihr habe ich es zu verdanken, dass ich noch nicht verrückt geworden bin – wie viele meiner Mithäftlinge. Das höre ich an dem Schwachsinn, den sie während der einstündigen Bewegungszeit vor sich hin brabbeln. Nach ihrem überstimulierten und superanimierten Leben draußen schaffen es einige einfach nicht, sich an die lähmende Einsamkeit und Stille im Loop zu gewöhnen.
Ich starre immer noch auf die Luke, hinter der Wren vor fünf Minuten verschwunden ist, und lächele vor mich hin, beseelt von ihrem Besuch. Dann beiße ich in mein Sandwich und versuche das Glücksgefühl so lange wie möglich festzuhalten.
Um 17 Uhr zeigt mir der Bildschirm meine Optionen für das Abendessen an. Ich wähle Suppe und Brot. Beides taucht nach wenigen Sekunden aus dem Fach in der Wand auf. Ich esse und um 17:25 Uhr weist mich der Bildschirm an, mich in den Lichtkreis zu stellen, der auf dem Fußboden aufleuchtet. Ich seufze. Die Energieernte steht bevor.
Kurz vor der Ernte wird Happys Monitorstimme immer durch die von Galen Rye abgelöst.
»Bitte lege alle Kleidungsstücke ab«, sagt er und klingt nicht mehr annähernd so nahbar und zugänglich wie in seiner morgendlichen Ansprache.
Klar, man könnte sich weigern. Aber dann wird man mit Drohnengift bestraft. Ich löse die Klettverschlüsse meiner Schuhe (Schnürsenkel sind im Loop verboten) und kicke sie aufs Bett. Dann reiße ich die Verschlüsse meines weißen Overalls auf, streife ihn ab und werfe ihn zu den Schuhen. Nackt stehe ich da.
»Beine zusammen, Hände seitlich auf die Oberschenkel. Wie du weißt, Insasse, ist die Energieernte Teil deiner Bestrafung. Wir tolerieren keine Kriminalität. Dein Leiden wird all den Menschen dort draußen als Abschreckung dienen, die im Begriff sind, eine kriminelle Laufbahn einzuschlagen.«
»Halt die Klappe!«, knurre ich.
Die große Glasröhre senkt sich von der Decke. Die Ernte beginnt um 17:30 Uhr.
Es geht direkt zur Sache.
Adrenalin schießt durch meine Adern. Binnen einer Sekunde jagt mein Puls von null auf hundert. Jeder einzelne Muskel ist so steinhart und angespannt, dass ich das Gefühl habe, gleich in Stücke zu zerreißen. Ich bekomme meine Zuckungen nicht unter Kontrolle und kippe nach vorne. Mein Gesicht knallt gegen die Glasröhre. Ich hätte vor Schmerz laut geschrien, wäre mein Hals nicht wie zugeschnürt. Als Nächstes werden mikroskopisch kleine Nanobots in die Röhre geblasen. Sie bohren sich durch die Haut meiner Schläfen, von wo aus sie im Blutstrom zu meinem Gehirn schwimmen, sich duplizieren und ins Angstzentrum des Neocortex und der Amygdala eindringen. Von dort aus gaukeln die Bots mir vor, dass ich in Lebensgefahr schwebe und gleich sterben werde – und ich bin vollkommen machtlos gegen diese Todesangst. Ich kann mir noch so oft sagen, dass es die Energieernte ist, die das alles mit mir macht; dass auf diese Weise die Energie gewonnen wird, die das Loop am Laufen hält – ganz ohne Steuergelder. Ich winde mich, zucke und hämmere gegen das Glas. Will einfach nur raus.
Nach einer Weile sacke ich auf dem Boden zusammen, und als ich endlich meine Stimme wiederfinde, schreie ich wie am Spieß.
Die Ernte dauert insgesamt sechs Stunden. Aber es fühlt sich an wie mehrere Tage.
Schließlich ist es vorbei und ich bin körperlich und geistig am Ende. Vollkommen leer und ausgelaugt. Ich liege noch schweißnass auf dem Betonboden, da kommt schon das Wasser. Es ätzt sich in meine Haut, denn es ist mit Entlausungsmittel, Triglycerid und bleichenden Substanzen versetzt. Als Nächstes wird heiße Luft hineingepustet, um das Wasser und den Schweiß zu trocknen. Auf der Haut bleibt ein körniger Film zurück. Dann hebt sich die Glasröhre endlich und verschwindet in der Decke.
Ich liege immer noch da – und muss plötzlich grinsen. Denn morgen werde ich wieder rennen. Wie ein Besessener werde ich sprinten, um all meine Energie zu verbrauchen, damit fürs Loop nichts übrig bleibt.
Ich krieche zu meinem Bett, werfe einen Blick auf die Uhr und zähle die Minuten bis Mitternacht.
Als es endlich so weit ist, stelle ich mich ans Fenster und beobachte den von der Regierung ausgegebenen Regen, der Punkt zwölf beginnt. Er dauert exakt dreißig Minuten und ist so berechnet, dass er die Bäume und Kulturpflanzen auf den Feldern gerade genug wässert – bevor morgen dann eine genau kalkulierte Wolkenmenge ausreichend Schatten spenden wird und eine ebenso exakt geplante Sonneneinstrahlung für Gesundheit und gute Laune bei den Bewohnern dieses Erd-Viertelkreises sorgt.
Nach einer halben Stunde endet der Regen wie auf Knopfdruck und ich kann schlafen gehen.
Ich liege im Bett und mache mit meinen Händen Schattenspiele im Mondlicht vor der Wand – eine Zeichensprache, die meine Mutter mir beigebracht hat, als ich klein war. Ich buchstabiere den Namen meiner Schwester: Molly. Dann meine alte Adresse: Tür 44, Stockwerk 177, Black Road Vertical. Ich buchstabiere Wrens Namen. Ich gehe das ganze Alphabet durch.
Morgen werde ich das Gleiche tun und übermorgen und überübermorgen auch. Jeden Tag werde ich mit meinen Händen buchstabieren, bis ich achtzehn bin und in den Block muss. Es sei denn, ich habe vorher Pech mit einem Aufschub. Oder werde von einer neuartigen Krankheit aus den Roten Zonen dahingerafft.
Tja, so sieht es aus, unser Leben im Loop.
Ich wache vor dem Weckruf auf, würge das Frühstück herunter und beginne mit meinem Workout.
Um 9:00 Uhr folgt Galens tägliche Ansprache.
Danach lese ich, bis um 11:30 Uhr die Zellenrückwand lautlos hochgleitet.
Ich stürze nach draußen und renne bis zur Mittelsäule und zurück, hin und her, immer wieder. Fünfundvierzig Minuten treibe ich mich an, die letzte Viertelstunde verschnaufe ich, genieße die warme Sonne, lausche Panders Gesang und Tycos Morddrohungen und kehre schließlich in meine Zelle zurück.
Wieder lese ich und als Wren kommt, habe ich das Buch fast durch.
Wir plaudern zehn Minuten. Zum Lunch hat mir Wren heute ein Schälchen Salat mitgebracht. Sie geht weg und ich bleibe traurig in der Stille zurück, bis etwas mehr als drei Stunden später die Energieernte beginnt.
Sechs Stunden lang leide ich Todesangst und Höllenqualen. Die Glasröhre hebt sich endlich, ich krieche zum Fenster, um den Regen zu beobachten, bevor ich mich ins Bett schleppe und in einen ruhelosen Schlaf falle.
Ich wache vor dem Weckruf auf.
Wähle Müsli zum Frühstück.
Workout.
Höre mir Galens tägliche Ansprache an.
Lese.
Renne.
Wren bringt mir Lunch. Einen Gemüse-Wrap.
Ich sitze in der Stille da.
Wähle das Abendessen aus.
Lasse die Energieernte über mich ergehen.
Beobachte den Regen.
Schlafe.
Das Gleich von vorne.
Und noch einmal.
Es nimmt einfach kein Ende.



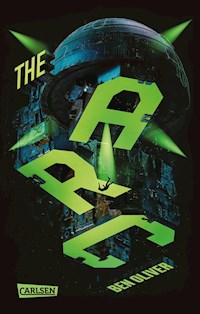














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










