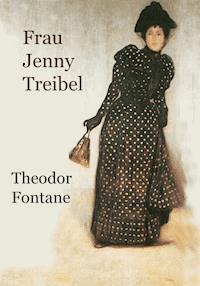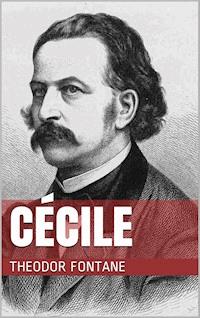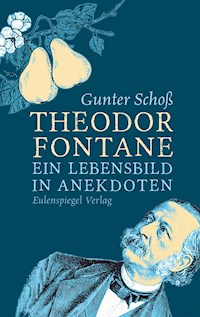
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eulenspiegel Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Erhellend und heiter – zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane Die in diesem Buch gesammelten Anekdoten über Theodor Fontane erzählen Heiteres vor ernstem Hintergrund; sie nehmen den biografischen Faden auf, begleiten den Apothekengehilfen und werdenden Schriftsteller, den Londonkorrespondenten und märkischen Wandersmann, den von Geldnot Geplagten, den Verliebt-Verlobt-Verheirateten, den überforderten Familienvater, rastlos Reisenden und geselligen Plauderer in vertrauter Freundesrunde bis hin an seinen Schreibtisch in der Wohnung Potsdamer Straße. Dort hatte er, fast sechzigjährig, beschlossen, "die Feder noch einmal recht fest in die Hand zu nehmen" und seinen ersten, seit Jahren in der Schublade liegenden Roman zu vollenden. "Meine Arbeit muss zum Mindesten so gut sein, dass ich auf sie hin einen kleinen Romanschriftsteller-Laden aufmachen kann." Und so beleuchtet dieser Anekdotenband auch den mühsamen Weg des heute weltberühmten Schriftstellers, dem die Anerkennung als Autor und Dichter nicht wie selbstverständich in den Schoß fiel, sondern für die er bis zuletzt gekämpft hat. Die großen Romane wie "Effi Briest", "Irrungen und Wirrungen" oder "Der Stechlin" entstanden gar erst wenige Jahre vor seinem Tod. Anlässlich des 200. Geburtstages von Theodor Fontane präsentiert Gunter Schoß das kurzweilige Buch "Theodor Fontane – Ein Lebensbild in Anekdoten". Ein amüsantes und spannungsreiches Bändchen zum großen Dichter des alten Preußens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten.
Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet,
dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.
Eulenspiegel Verlag – eine Marke der Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage
ISBN E-Book: 978-3-359-50087-2
ISBN Buch: 978-3-359-01397-6
1. Auflage 2019
© Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: Verlag, Karoline Grunske
www.eulenspiegel.com
Zum Geleit
Als ich im Schulunterricht »Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland« vortragen musste – wir Schüler sagten dazu »Gedicht aufsagen«, und mehr als auswendig Sprechen war es ja nicht –, entdeckte ich dieses Stakkato beim »Rib-beck auf Rib-beck«. Das gefiel mir, das knackte und klang schön. In einer höheren Klasse dann »John Maynard« – wenn »die ›Schwalbe‹ fliegt über den Erie-See« und »Gischt schäumt um den Bug wie Flocken vom Schnee« und Steuermann John Maynard auf das »Wo sind wir? Wo?« der Passagiere antworten muss –, da setzte sich die Emotion durch: Den »Strand von Buffalo« erreichte ich nur mit einem halberstickten »Gerettet alle. Nur einer fehlt!«
So sahen die ersten Begegnungen mit dem Dichter aus.
In der Oberschule dann »Effi Briest«. An meinen damaligen Leseeindruck habe ich kaum eine Erinnerung, wohl aber an die Fragen zu Konzeption der Figuren und klassentypischem Verhalten des Barons von Instetten. Wie es so ist: Man meint den Esel und schlägt den Sack. Fontane blieb bei mir erst einmal im Regal.
Es dauerte, bis ich die Bekanntschaft erneuerte. Dann aber auf ewig. Ich darf mich zur großen Fontane-Leserschaft zählen. Warum es so kam und kommen musste, das ist »ein weites Feld«. Eine Erklärung fand ich bei dem Kritiker und Theaterleiter Otto Brahm: »Zu uns spricht einer der liebenswürdigsten Erzähler, der den ererbten Gaben der französischen Emigrantenfamilie jenen graziösen Plauderton verdankt, welcher in Deutschland eine so große Rarität ist.« Wer diese literarische Erfahrung macht, der wird sich an trüben Tagen erhoben, an lichtvolleren Tagen geerdet fühlen.
Das Glück meines Berufes brachte es mit sich, dass ich die »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« für eine Hörbuchproduktion einlas. Man begleitet den Wanderer Fontane und erlebt dabei einen Landstrich und seine Leute, die sonst dem Vergessen anheimgefallen wären.
Dass ich nun mit diesem Buch meiner persönlichen Fontane-Erfahrung ein weiteres Kapitel hinzufügen und Sie, liebe Leser, zur Lektüre einladen kann, freut mich.
Heiter sind die hier gesammelten Geschichten; die Lebensumstände und -stationen des Dichters sind es meist weniger. Zu klagen war Fontanes Sache nicht, aber vermutlich hat der hugenottische Preuße sich selber zugesprochen, als er derb und mit dem Apodiktischen eines Kalenderspruchs reimte: »Sei heiter! Es ist gescheiter …«
Der Erzähler Fontane sagte: »Ich behandle das Kleine mit derselben Liebe wie das Große.« Wie sich das eine zum anderen verhält und zum Ganzen verwebt, ist in seinen Novellen und Romanen zu lesen. Es sei mir gestattet, bei diesem Fontaneschen Wort Anleihe zu nehmen: mit dem Detail, der Facette kleiner anekdotischer Begebenheiten möchte dieses Buch ein Ganzes zeichnen, ein Lebensbild des großen Dichters.
Die am biografischen Faden aufgereihten Anekdoten speisen sich aus Lesefrüchten, zuallererst aus Fontanes Briefen, Tagebüchern und Lebenszeugnissen; sie greifen auf Erinnerungen seiner Zeitgenossen zurück und bedienen sich der Fakten, die seine fleißigen Biografen herausgefunden haben.
Gunter Schoß
Ankunft 1819
Am 24. März 1819 heirateten in Berlin der dreiundzwanzigjährige Louis Henri Fontane und die einundzwanzigjährige Emilie Labry. Das junge Ehepaar traf drei Tage später in Neuruppin ein, wo Louis Henri mit einem Kredit des Vaters die Löwen-Apotheke übernahm.
Der Vater trug in sein Tagebuch den frommen Wunsch für seinen Sohn ein: »Gott der Allmächtige mache ihn zum Gegenstand seines Segens.«
Kindersegen zumindest stellte sich bereits am 30. Dezember ein. Nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr wurde dem Paar das erste Kind geboren: Henri Théodore. Im Neuruppiner Kirchenbuch eingetragen als: Heinrich Theodor Fontane.
Für Emilie Fontane war die Geburt des Sohns eine Sache auf Leben und Sterben. Warf man ihr später, als schon die Brüder Rudolph und Max und die Schwester Jenny geboren waren, vor, sie bevorzuge Theodor, dachte sie an seinen Eintritt ins Leben und antwortete einfach: »Er ist mir auch am schwersten geworden.«
Ankunft 1694
Hundertzwanzig Jahre zuvor, im Jahr 1694, war der aus Nîmes stammende Strumpfwirker Jacques François Fontaine nach Brandenburg-Preußen gekommen. Einer von fünfzehntausend, die sich nach dem Edikt von Fontainebleau, mit dem der Sonnenkönig die Toleranzprivilegien der Hugenotten kassierte, an Leib und Leben bedroht, durch das Potsdamer Edikt des Großen Kurfürsten im Brandenburgischen aber willkommen sahen. Jeder fünfte Berliner um 1700 war Hugenotte. In Berlin brachte es der tüchtige Handwerksmeister zu Wohlstand, den sein Sohn Pierre François Fontaine als Zinngießer vermehrte. Dessen Sohn, der Maler Pierre Barthélemy und Großvater des Dichters, trat 1780 als Zeichenlehrer in den Dienst des friderizianischen Hofes. »Er malt schlecht, aber er spricht gut Französisch!« Der redegewandte Mann gefiel Königin Luise so sehr, dass sie ihn zu ihrem persönlichen Kabinettssekretär beförderte. Das weckte Missgunst und veranlasste den jungen Bildhauer Johann Gottfried Schadow zu eben jener abfälligen Äußerung. Die glanzvolle Stellung war passé, als das Königspaar 1806 nach Königsberg floh. Für Peter Fontane fand sich ein Amt als Kastellan von Schloss Niederschönhausen.
»Peter Fontane«? Richtig. Pierre Barthélemy hatte eine Neuerung eingeführt: Er ließ das »i« im Namen fallen. Die amtlichen Urkunden führten ihn als »Peter Fontane«.
Fontane oder Fongtang?
»Die Familie Fontane sprach ihren Namen natürlich französisch aus«, so schwarz auf weiß festgehalten von Gertrud Mengel, Patenkind der Fontane-Tochter Martha. Wie es mit der Aussprache zu halten sei, das scheint den Dichter ein Leben lang begleitet, aber nicht die Bohne interessiert zu haben. Die Chance, es zwar spät, aber aus erster Hand zu klären, sah der Vorsitzende des »Touristenclubs der Mark Brandenburg« – einer von Fontanes »Wanderungen« inspirierten Gründung – gekommen, als er dem Dichter im Februar 1895 die Ehrenmitgliedschaft antrug. Fontane stand Ehrungen und Vereinen reserviert gegenüber. Ohne Vermittlung von Fontanes Sohn, dem Verlagsbuchhändler Friedrich Fontane, wäre der häusliche Besuch kaum zustande gekommen, doch nun folgte eine freundliche Einladung zum Frühstück. Der Vorsitzende richtete das Wort an Fontane: »Welche ist die richtige Aussprache Ihres Namens? Man hört ihn französisch, deutsch und auch zugleich in beiden Sprachen.«
»Mein Lieber, sprechen Sie ihn aus, wie Sie wollen«, erwiderte Fontane, »es ist alles richtig. Ich habe einen Freund, Urgermane, wenn der mich anredet, wird jede Silbe langgezogen Fon–ta–ne! Dann habe ich eine gute, dicke Tante – alle dicken Tanten sind gut – in der Kolonie*, die sagt nie anders als Fontan! Nasalton bis hierher!« Dabei drückte er mit Daumen und Zeigefinder die Nase hinauf bis zur Stirn.
* die französische Kolonie in Berlin
Vater-Sohn-Gespräche
I
Wie der Niederschönhausener Schlosskastellan allmorgendlich seinen Sohn Louis Henri auf den weiten Weg ins Gymnasium zum Grauen Kloster schickte, wie der Junge fror und es erst besser wurde, als er und sein älterer Bruder »blaue, mit postorangefarbenem Kattun gefütterte Mäntel als Weihnachtsgeschenk« erhielten, und wie die Straßenjungen spotteten, wenn »der Wind die postorangenen Kragen wie Heiligenscheine um die Häupter« aufstellte, das war lebenslang eine der Lieblingsgeschichten des Vaters. Konterte Sohn Theodor mit der Geschichte aus eigenen Kindertagen, als »Mama« ihm »Rock, Weste und Beinkleid aus einem milchfarbenen Tuchstoff machen« ließ und er »dann ein ganzes Jahr lang der Antiquar aus der alten Post« gerufen wurde, bestand der Vater darauf, das schlechtere Los gezogen zu haben: »Ja, so was ist mitunter erblich, aber Postorange war doch schlimmer, dabei muss ich bleiben.«
II
Nach der Schule wurde Louis Henri Lehrling in der Berliner Elefanten-Apotheke. Als sich Fontane in seinem Buch »Meine Kinderjahre« diese Zeit vor Augen führte, schrieb er, womöglich seine eigenen Apotheker-Lehrjahre resümierend: »Er verlebte die Zeit mutmaßlich nicht gut und nicht schlecht, was ich daraus schließe, dass er über diesen Lebensabschnitt nie sprach.«
III
Auskunftsfreudig wurde der Vater erst wieder, wenn die Kriegszeit aufs Tapet kam. Der Apothekerlehrling war 1813 als Freiwilliger Jäger zu Fuß in das preußische Kriegsaufgebot gegen Napoleon eingetreten und ein Dreivierteljahr später als Feldlazarett-Apotheker nach Berlin zurückgekehrt.
»Du warst also wohl sehr patriotisch, lieber Papa?«, fragte der kleine Theodor.
»Aber nein«, sagte der Papa und ließ alles Flunkern und alle Großspurigkeit fahren: »Offen gestanden, ich machte nur so mit.« Theodor müsse wissen: Man hat im Leben nicht immer die Wahl.
IV
Sohn Theodor konnte nicht genug über die Kriegsjahre hören. Er bestaunte die Flinte, die der Vater mitgebracht hatte und die in den Flurecken der wechselnden Familienwohnungen verstaubte. Gern zeigte der Vater auch eine Brieftasche samt Kugel darin, mit der es folgende Bewandtnis hatte: Die Kugel war bei der Schlacht von Großgörschen in den Tornister Louis Henris eingeschlagen, durchbohrte den Wäschevorrat und blieb in den Pergamentblättern einer dicken Brieftasche stecken.
Tornister trägt man gewöhnlich auf dem Rücken.
Vater Louis Henri erklärte Sohn Theodor die Angelegenheit so: »Mein lieber Sohn, es war kein Schuss von hinten; wir stürmten einen Hohlweg, auf dessen Rändern, rechts und links, französische Voltigeurs standen. Also Seitenschuss.«
Louis Henri hatte eine Reihe weiterer Gefechte mitgemacht. Der Sohn fragte: »Die waren dir nun wohl vollkommen gleichgültig?«
»Kann ich durchaus nicht sagen.«
»Ich dachte, die Macht der Gewohnheit …«
»Die Macht der Gewohnheit ist im Kriege, wenigstens nach meiner persönlichen Erfahrung, von keinerlei Trost und Bedeutung. Eher das Gegenteil. Man sagt sich, wer drei- oder viermal heil durchgekommen ist, hat Anspruch, das fünfte Mal dran glauben zu müssen. Eine Karte, die viermal gewonnen, hat immer Chance, das fünfte Mal zu verlieren.«
Am Spieltisch hielt sich der Neuruppiner Apotheker nicht an diese Erkenntnis. Er zückte regelmäßig auch noch die fünfte Karte und verspielte Löwen-Apotheke und Vermögen.
Der Spieler
Sieben Jahre brauchte Louis Henri Fontane, um sein Geld beim Whist zu verspielen. Der Hauptgewinner war ein benachbarter Rittergutsbesitzer in Kränzlin. Als dreißig Jahre später der Sohn des Rittergutsbesitzers dem Sohn des Apothekers eine kleine Summe Geld lieh, sagte Louis Henri: »Das stecke nur ruhig ein, sein Vater hat mir ganz allmählich zehntausend Taler in Whist en trois abgenommen.« Im Jahr 1826 blieb als Ausweg nur der Verkauf der Apotheke. Geschäftsmann Fontane erhielt dabei beinahe das Doppelte von dem, was er einmal angelegt hatte. Er beglich seine Spielschulden. Was übrig blieb, reichte, um anderenorts eine kleinere Apotheke zu erwerben.
Anderenorts
Apotheker Fontane spannte seinen Schimmel vor den Wagen und suchte ein Dreivierteljahr nach einer geeigneten Apotheke. Er suchte in Brandenburg, Sachsen, Thüringen und zum Ende des Jahres 1826 auch in Pommern. Solch ein Geschäft wollte ja überlegt sein! »Je kritischer er verfuhr, je länger konnte er seine Fahrten fortsetzen«, sagte der Sohn später. »Sein Lebelang in der Welt umherzukutschieren, immer auf der Suche nach einer Apotheke, ohne diese je finden zu können, wäre wohl sein Ideal gewesen.«
Im Dezember erreichte Louis Henri Swinemünde und wurde fündig. Mit der Witwe Geißler vereinbarte er den Kauf der Adler-Apotheke und schickte einen Brief an die Familie nach Neuruppin, wo die Geburt seines vierten Kindes anstand: »Wir haben nun eine neue Heimat, die Provinz Pommern, Pommern, von dem man vielfach falsche Vorstellungen hat; denn es ist eigentlich eine Prachtprovinz und viel reicher als die Mark. Und wo die Leute reich sind, lebt es sich auch am besten. Swinemünde ist zwar ungepflastert, aber Sand ist besser als schlechtes Pflaster, wo die Pferde ewig etwas am Spann haben. Freilich ist noch ein halbes Jahr bis zur Übergabe, was ich beklage. Man muss doch wieder etwas zu tun haben.«
Jungs in Holzpantinen
Zu tun bekam auch Theodor in Swinemünde. Als das neue Heim bezogen war, erhob sich die Frage: »Was wird nun aus den Kindern? In welche Schule schicken wir sie?« Die Antwort hatte der Vater parat: »Die Stadt hat nur eine Schule, die Stadtschule, und da die Stadtschule die einzige ist, so ist sie auch die beste.«
Diese Einschätzung traf Louis Henri allein; Emilie hielt sich in Berlin zu einer Nervenkur auf. Als sie im Herbst 1827 in Swinemünde eintraf und ihren Theodor in Gesellschaft der wilden, ungekämmten »Holzpantinenjungens« aus der Schule kommen sah, war sie außer sich. Am gleichen Tag wurde er abgemeldet.
Die Mutter entschied, dass der Sohn bei ihr Lesen, beim Vater »einige lateinische und französische Vokabeln, dazu Geografie und Geschichte« lernen sollte.
Von der Rigorosität ihres Entschlusses selber erschrocken, vergewisserte sie sich bei ihrem Mann, ob er das auch könne.
»Können? Was heißt Können!«, warf sich Louis Henri in die Brust: »Du weißt, dass ich da zehn Studierte in den Sack stecke.«
Lehrstoffe
Es wurden lebhafte Unterrichtsstunden, gefüllt mit historischen Anekdoten, gar mit Rollenspielen, die der Mutter aber besser verborgen blieben. Fontane sagte rückblickend: »Nicht bloß gesellschaftlich sind mir, in einem langen Leben, diese Geschichten hundertfach zugute gekommen, auch bei meinen Schreibereien waren sie mir wie ein Schatzkästlein zu Hand. Und wenn ich gefragt würde, welchem Lehrer ich mich so eigentlich zu Dank verpflichtet fühle, so würde ich antworten müssen: meinem Vater, meinem Vater, der sozusagen gar nichts wusste, mich aber mit dem aus Zeitungen und Journalen Aufgepickten und über alle möglichen Themata sich verbreitenden Anekdotenreichtum unendlich viel mehr unterstützt hat als alle meine Gymnasial- und Realschullehrer zusammengenommen.«
Anekdotenerzähler
Louis Henri Fontane hatte in den Befreiungskriegen die großen Schlachten von Großgörschen und Bautzen mitgemacht, doch wusste er auch über Napoleon und seine Marschälle von Marengo bis zu den Sankt-Helena-Tagen Anekdoten zum Besten zu geben, gerade so, als habe er zum Gefolge des Kaisers gehört. Die Honoratioren der kleinen Seestadt Swinemünde fühlten sich im Haus des geschichtsfesten Besitzers der Adler-Apotheke gut unterhalten. Seine Napoleon-Anekdoten gab Louis Henri in französischer Sprache wieder. Wurden gelegentlich Satzbau und Grammatik beanstandet, antwortete er: »Mein französisches Gefühl lehrt mich, dass es so heißen muss!« Was die allgemeine Heiterkeit nur steigerte. Ob er denn nicht merke, dass die Leute sich einen Spaß mit ihm machten, wies ihn Frau Emilie zurecht. Ja, gab der Apotheker zu, aber er sei ein freundlicher Wirt, und dann kultiviere er auch das Historische, um nützliche Kenntnisse zu verbreiten. Mochte die Mutter der ewig gleichen Geschichten überdrüssig sein, Sohn Theodor war gepackt vom Historischen. Auf die Frage, was er werden wolle, antwortete der Zehnjährige ohne Zaudern: »Professor der Geschichte.«
Fontanes erstes Werk
Bei einer Versteigerung in Hamburg 1963 tauchte ein schmales Heft des Swinemünder Knaben auf. Das erste Manuskript Fontanes! In einzelnen Aufsätzen gibt der Elfjährige eine fortlaufende Darstellung der deutschen Geschichte von Ludwig dem Frommen bis zum Spanischen Erbfolgekrieg. »Heinrich vermählte sich mit der Berta nach her vertrieb er sie sahe aber zuletzt ein das es ohne einem Weibe nicht ginge und nahm sie sich wieder.« In einer Schlussbemerkung sagte der junge Mann ohne Punkt und Komma selbstbewusst: »Theodor Fontane hat es aus geschrieben gans allein es ist gewiss war ihr könnt es mir glauben alle samt und sonders denn ich lüge nicht das könnt ihr glauben er ist ein ehrlicher Neuruppiner.«
Prosa der Verhältnisse