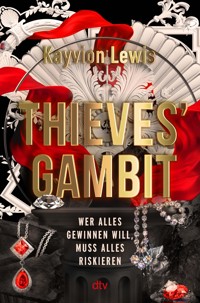
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Thieves' Gambit-Reihe
- Sprache: Deutsch
Liebe. Lüge. Überlebe. ›The Inheritance Games‹ meets ›Squid Game‹: Ein Battle Royal quer über den Erdball Rosalyn Quest ist die Tochter einer legendären Diebesfamilie. Ihr ganzes Leben wurde sie darauf trainiert, weltweit die größten Coups durchzuziehen. Doch gerade als sie ihren Ausstieg aus dem Familienbusiness plant, wird ihre Mutter gefangen genommen. Rosalyns einzige Chance, ihre Mutter zu retten: die Einladung zum Thieves' Gambit, einem Wettbewerb für Nachwuchsdiebe, die sie eigentlich abgelehnt hatte. Wer den Wettbewerb gewinnt, erhält einen Wunsch, der sich durch Macht, Geld oder Einfluss erfüllen lässt. Ohne zu wissen, worauf sie sich einlässt, nimmt Ross die Einladung zum Thieves' Gambit an. Ihre Gegner sind unberechenbar. Und der Wettkampf ist brandgefährlich – auch für ihr Herz. Perfekt für Enemies-To-Lovers-Fans! Atemberaubende Spannung wie es sie seit ›Die Tribute von Panem‹ nicht mehr gab
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Nur die Elite darf teilnehmen. Nur einer kann gewinnen.
Rosalyn Quest ist die Tochter einer legendären Diebesfamilie und sehr geschickt darin, die Regeln zu brechen – außer wenn es um die Regeln ihrer eigenen Familie geht. Doch gerade als sie ihren Ausstieg aus dem Familienbusiness plant, wird ihre Mutter geschnappt. Rosalyns einzige Chance, ihre Mutter zu retten: die Einladung zum Thieves’ Gambit, einem Wettbewerb für Nachwuchsdiebe, die sie eigentlich abgelehnt hatte. Wer den Wettbewerb gewinnt, erhält einen Wunsch, der sich durch Macht, Geld oder Einfluss erfüllen lässt. Ohne zu wissen, worauf sie sich einlässt, nimmt Ross die Einladung zum Thieves’ Gambit an. Ihre Gegner sind unberechenbar. Und der Wettkampf ist brandgefährlich – auch für ihr Herz.
Kayvion Lewis
Thieves’ Gambit
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Christa Prummer-Lehmair und Heide Horn
Für Keithen, meinen größten Fan
Kapitel 1
Eine Quest kann niemandem auf der Welt trauen – außer einer anderen Quest.
Wenn also eine Quest, speziell Mama Quest, mir sagt, ich solle mich wie eine Fruchtschnur verbiegen und in ein winziges Schränkchen quetschen – nicht einmal einen Hund würde man in eine Transportbox dieser Größe stecken –, so vertraue ich natürlich darauf, dass sie einen guten Grund dafür hat. Oder dass zumindest die Sache, die ich stehlen soll, es wert ist.
Wäre ich ein x-beliebiges Mädchen, wären mir schon längst die Beine eingeschlafen. Aber bei Jobs wie diesem kam mir wohl Moms intensives Beweglichkeitstraining zugute.
Seit geschlagenen drei Stunden war ich nun schon hier, im abgeschiedenen Teil der Villa, eingepfercht, und hatte mich durch meinen Fake-Instagram-Account gescrollt. In den letzten Monaten war ich süchtig danach, Insta-Accounts über das Leben in Studentenwohnheimen zu stalken, noch süchtiger als nach K-Dramen auf Netflix.
Da der Ladezustand meines Akkus um Mitternacht auf zwanzig Prozent abgesunken war, musste ich aufhören. Mom hatte mich ermahnt, die Batterie nicht für unwichtige Sachen aufzubrauchen. Wenn ich ihre Nachricht verpassen würde, wäre ich aufgeschmissen. Und so trommelte ich ungeduldig mit meinen behandschuhten Fingern, bis plötzlich das Display aufleuchtete.
An: Rosalyn Quest, Einladung zum Gambit
Das war nicht Moms SMS, sondern – eine E-Mail? Hatte endlich ein College auf meine Bewerbungen zum Sommersportprogramm reagiert? Vielleicht die Leute vom Cheerleading-Kurs? Kürzlich hatte ich mich mitten in der Nacht, als ich mich in der Stille unseres Hauses besonders einsam fühlte, spontan bei College-Ferienprogrammen für Highschool-Schüler eingeschrieben. Die Vorstellung, ein paar Wochen auf einem trubeligen Campus mit anderen Jugendlichen zu verbringen, hatte etwas Erfrischendes. Bisher war jedoch noch keine Antwort gekommen. Allmählich machte ich mir Sorgen, sie könnten meine hastig gefälschten Zeugnisse überprüft haben.
Eine Textnachricht traf ein, bevor ich den Bildschirm entsperren konnte. Diesmal war sie tatsächlich von Mom. Als hätte sie erraten, was ich mir gerade ansehen wollte, und beschlossen, mir einen virtuellen Klaps auf die Hand zu geben.
Du bist dran.
Die E-Mail musste warten.
Vorsichtig öffnete ich die Schranktür einen Spalt, wobei ich die Unterkante mit der Hand abstützte, um ein Knarren zu verhindern. Ein einfacher Trick, den ich gelernt hatte, bevor ich meinen Namen schreiben konnte. Ich spähte hinaus.
Der Gang war verlassen. Mom hatte ausgekundschaftet, dass dieser Flügel des Gebäudes normalerweise nicht genutzt wurde; sie und die anderen Hausmädchen verbrachten einen Großteil ihrer Zeit damit, in der Privatgalerie im anderen Flügel Vasen zu polieren. Hier jedoch waren die Sicherheitsvorkehrungen laxer.
Ich schlich vorbei an Zimmern mit unberührten Himmelbetten, dürftig bestückten Bücherregalen und leeren Beistelltischchen. Die durchdringende Stille hätte unheimlich sein können, aber leere Häuser waren mir vertraut. Fast fühlte es sich an, als wäre ich wieder in unserem Zuhause auf Andros.
Dem Grundriss folgend, den ich mir eingeprägt hatte, lief ich durch den Wohnbereich im Erdgeschoss. Dort fiel mir eine dekorative, mit Schnitzereien verzierte Kommode ins Auge, auf der gerahmte Fotos standen. Keiner der anderen Räume hatte etwas so Persönliches enthalten.
Ich griff nach dem ganz hinten stehenden Bild. Eine Gruppe strahlender Collegestudenten posierte auf der Treppe eines Backsteingebäudes. In der unteren Ecke war in ordentlicher schwarzer Schrift zu lesen: Erstes Semester.
Erinnerungen. Beziehungen. Das Bild konnte ich stehlen, aber das andere nicht. Wenn ich so etwas wollte, musste ich es mir selbst verdienen. Fern von zu Hause. Von Mom.
Ein leises Geräusch ließ mich erstarren.
Ich stellte das Foto wieder hin und duckte mich hinter ein Sofa. Dort entrollte ich die Waffe meiner Wahl. Die Familie Quest mag keine Schusswaffen – sie sind zu laut. Mom trägt ein Messer bei sich, und wie sie mir erzählt hat, arbeitete Granny früher mit einer Sammlung von Spritzen, die rasch wirkende Schlafmittel enthielten. Sie konnte so meisterlich damit umgehen wie ein Fünfsternekoch mit Gewürzen.
Ich hätte wahrscheinlich nicht den Mumm, jemandem eine Klinge – oder Nadel – reinzujagen. Daher habe ich mich für ein Meteorarmband entschieden. Die lange Gliederkette lässt sich problemlos ums Handgelenk winden und das schwere kirschgroße Metallgewicht am Ende fügt sich passgenau in einen magnetisch wirkenden Ring an meinem Mittelfinger ein. Man kann das Armband leichter als ein Messer an Sicherheitskontrollen vorbeischmuggeln und in meinen Händen ist es genauso wirkungsvoll, wenn auch nicht so todbringend.
Das leise Tappen kam näher.
Von wegen laxe Sicherheitsvorkehrungen.
Ich holte schon aus, um die Gliederkette jemandem um den Hals zu schlingen – und musste ein Lachen unterdrücken. Eine bildhübsche Katze sprang aufs Sofa. Eine Siamkatze mit cremefarbenem Fell, die aussah, als hätte sie Pfoten und Gesicht in Asche gestupst. Sie blinzelte mit ihren leuchtend blauen Augen, sprang auf den Teppich und schmiegte sich schnurrend an meine Beine.
Ich wickelte das Armband wieder ums Handgelenk und kraulte die Katze hinter den Ohren. Miauend rollte sie sich auf den Rücken. Ich hatte ihr das Highlight des Monats beschert.
Als Kind hatte ich exzessiv Vlogs über Haustieradoption gestreamt, wenn Mom länger beruflich unterwegs war. Aber das war, bevor mir klar wurde, dass niemand, der nicht zur Familie gehörte, einen Fuß in unser Haus setzen durfte – Tiere eingeschlossen.
Siamkatzen sind wegen ihrer Schönheit beliebt, doch sie fühlen sich schnell einsam. Ohne Gefährten sterben sie recht früh. Der Besitzer dieses abgelegenen Hauses hatte anscheinend keinen Gedanken an dieses Bedürfnis seiner Katze verschwendet.
Als ich weiterging, folgte mir die Katze mit aufgerichtetem, glücklich zuckendem Schwanz. Ich schob sie behutsam weg. So süß sie war, mein Plan sah keinen schnurrenden Gehilfen vor. Abrupt drehte ich mich um und spurtete los. Zwischen diesem und dem nächsten Flur befand sich eine Glastür. Ich zog sie rasch hinter mir zu, bevor die Katze hindurchschlüpfen konnte. Sie miaute so kläglich, dass es mir fast das Herz zerriss, und flitzte davon.
Nachdem sie fort war, öffnete ich die Tür wieder, damit das Sicherheitspersonal bei einem Rundgang keinen Verdacht schöpfte.
Schließlich kam ich zu dem im Grundriss markierten Ziel. Die Vorhänge an den Fenstern waren offen und die Sterne und der Mond am kenianischen Himmel spendeten gerade genug Licht, um mich erkennen zu lassen, dass an dem Raum nichts besonders bemerkenswert war. Gepflegtes Mobiliar. Geschmackvolle Gemälde an den Wänden. Ein Bett, in dem noch nie jemand geschlafen hatte. Noch so ein Geisterzimmer.
Auf einem Nachttisch stand eine einsame Vase.
Chinesisches Porzellan aus der Qianlong-Zeit, circa 1740. Schätzwert: irrelevant. Für uns zählte nur der Preis, den unser Kunde geboten hatte, damit wir die Vase aus der Sammlung des Konkurrenten stahlen und er sie seiner eigenen hinzufügen konnte. Vor einer Woche noch hatte sich diese Vase in der Privatgalerie auf der anderen Seite der Villa befunden.
Bis Mom hier als Hausmädchen angefangen hatte.
Sie nannte es einen Puzzle-Job. Stück für Stück schmuggelte sie Scherben einer Kopie der Vase herein und setzte sie zusammen. Für jemanden, der so geschickt ist wie Mom, war es ein Kinderspiel, die echte Vase gegen die gefälschte auszutauschen. Leider hatte der Besitzer – berechtigterweise – Angst vor Diebstahl. Die Hausangestellten wurden jeden Tag beim Verlassen des Hauses vom Sicherheitspersonal gefilzt. Mom konnte zwar die Vase an einen anderen Platz im Haus schaffen, doch sie würde sie nicht rausbekommen.
Das war meine Aufgabe.
Ich zog das Kästchen heraus, das Mom unter dem Bett versteckt hatte. Es war zum Schutz gegen Erschütterungen gepolstert. Profi-Tipp: Hast du keine Möglichkeit, die Ware unbeschädigt rauszubringen, lass es lieber ganz sein.
Beim Hochheben der Vase klapperte etwas. Als ich sie umkippte, fiel mir ein diamantenbesetztes Armband in die Hand. Ich verdrehte die Augen. Mom hatte schon so viele solcher Tennisarmbänder, dass sie mit allen zusammen wie ein Weihnachtsbaum funkeln würde. Wenn ich sie fragen würde, warum sie auch noch das hier wollte, würde sie nur erwidern: Warum nicht?
In der Polsterung der Kiste steckte ein Laserpointer, mit dem man den Empfangssensor der Lichtschranke am Fenster überlisten konnte. Funfact: Die meisten dieser Bewegungssensoren kann man mit einem Fünf-Dollar-Laserpointer aus dem Internet austricksen. Sie erkennen Bewegung an der Unterbrechung des Laserstrahls zwischen Laserquelle und Sensor. Ich hielt den Laserstrahl direkt auf den Sensor gerichtet, der dachte, es wäre der Originalstrahl, und schlüpfte hinaus. Die einfachsten Dinge sind doch immer die besten. Es wäre schwieriger gewesen, wenn der Hausbesitzer das Fenster zugenagelt hätte. Einen Tick schwieriger.
Nach einer Minute war ich wie Spider-Girl hinaus aufs Fensterbrett geklettert. Ich klemmte das Kästchen zwischen meine Oberschenkel und wollte leise das Fenster schließen, als etwas ins Zimmer sauste.
Etwas, das unbedingt rauswollte.
Die Katze sprang mit einem Riesensatz an mir vorbei und landete geschmeidig auf dem Rasen. Gut, dass der Laserpointer immer noch auf den Sensor gerichtet war, sonst hätte ich ein Problem gehabt.
Sie miaute unentwegt, bettelte mich an, herunterzukommen und mit ihr zu spielen. Ganz schön hartnäckig.
Nachdem ich das Fenster geschlossen hatte, kletterte ich an der Fassade hinauf zur Kamera, die auf die Rasenfläche gerichtet war. Ich hatte zehn Sekunden, bis sie in meine Richtung schwenken würde. Für Feinheiten blieb keine Zeit. Mit einem Ruck riss ich das dickere der beiden in die Mauer führenden Kabel heraus. Die Kamera stoppte mitten in der Bewegung und würde in dieser Stellung bleiben, bis jemand kam, um sie zu reparieren. Hoffentlich erst, lange nachdem ich weg war.
Die Katze maunzte sich immer noch die Seele aus dem Leib.
»Ja, ja, ich komme ja schon«, beschwichtigte ich sie.
Jetzt redete ich schon mit Katzen. Zum Glück war es eine Überwachungskamera ohne Mikrofon – Mom hatte die Seriennummern aller Kameras besorgt, sodass wir die technischen Daten im Voraus checken konnten.
Ich sprang ins Gras. Wieder rieb sich die Katze genüsslich an meinen Beinen. Wie hätte ich ihr widerstehen können? Ich hob sie mit der freien Hand hoch und drückte sie an meine Brust.
Rasch rannte ich zu den in Reih und Glied aufgestellten Rasentraktoren, die auf ihren Einsatz am nächsten Morgen warteten. In dem engen Fach unter der Fahrerbank, direkt über dem Motor und hinter den Düngerbeuteln, würde ich in den nächsten Stunden Unterschlupf finden.
Ich blickte zum Horizont, wo wogendes Teppichgras und Butterbäume den sternenübersäten Himmel berührten. In solchen Augenblicken verstand ich, warum meine Familie seit drei Generationen diesen Beruf so liebte, der sie um den ganzen Erdball führte.
Doch es ist nicht immer die reine Idylle.
»Du weißt, dass ich dich nicht mitnehmen kann.« Die Katze schnurrte leise, als ich sie am Schwanzansatz kraulte. »Aber zumindest hast du hier einen fantastischen Ausblick, oder?«
Sie miaute und vielleicht drehte ich langsam durch, aber es klang wie »Echt jetzt?« in Katzensprache. Ich setzte sie ab, schob die Düngerbeutel beiseite und zwängte mich in das Fach, das Kästchen fest an die Brust gedrückt. Hier drin roch es durchdringend nach Benzin und Schimmel. Aber sei’s drum. Mom würde mir raten, an einen neuen Laptop zu denken. An 500-Dollar-Braids. An Custom Sneakers, die ja doch nur sie und meine Tante zu sehen bekämen.
Ich schob die Düngerbeutel wieder an ihren Platz, doch die Katze schlängelte sich durch eine schmale Lücke zu mir herein. Immer noch schnurrend und miauend machte sie es sich auf dem Kästchen an meiner Brust bequem.
»Dich soll ich wohl auch noch stehlen, hm?«
Sie fuhr mir mit ihrer rauen Zunge über die Wange. Okay, sie durfte bleiben. Eine Weile zumindest. Ich fragte mich, wie lange es dauern würde, bis ihr Besitzer ihr Fehlen bemerkte, falls ich sie tatsächlich klauen würde.
Von meinem Versteck aus sah ich ein flackerndes Licht. Nein, zwei Lichter. Sicherheitsleute auf Kontrollgang. Sie waren früh dran … Hatte irgendetwas Alarm ausgelöst? Hatten sie das mit der Kamera bemerkt?
Die Katze schnurrte wie ein Elektromotor. Ich wollte, dass sie still war, aber wie stellt man eine Katze auf lautlos?
Ich begann mein Armband abzuwickeln. Anscheinend kamen die Typen in meine Richtung. Wie zum Teufel sollte ich mich hier schnell genug rauswinden, um anzugreifen?
Mist.
»Nala …« Ein Mann schnalzte mit der Zunge. Katzenleckerli klapperten in einem Gefäß. »Wo bist du, kleines Biest?«
Doppelter Mist.
Ich versuchte, Nala hinauszuschieben, aber sie sprang immer wieder auf das Kästchen, unentwegt schnurrend und miauend.
Da fiel mir noch etwas über Siamkatzen ein. Sie sind auch die »gesprächigste« und lauteste Katzenrasse.
»Ich höre sie«, sagte ein anderer Mann. »Wie ist sie bloß entwischt?«
Der erste schnaubte höhnisch. »Keine Ahnung. Dieses blöde Vieh versucht doch dauernd wegzulaufen. Am besten sperren wir sie in einen Wandschrank, bis der Boss zurückkommt.«
Stumm beschwor ich Nala, endlich leise zu sein. Warum war sie nicht davongelaufen, nachdem sie aus dem Fenster geschlüpft war? Sie könnte schon längst über alle Berge sein. Beim Gedanken daran, wie sehr es sie in Panik versetzen würde, Tage oder Wochen in einem Wandschrank eingesperrt zu sein, überkamen mich Gewissensbisse. Wenn sie doch nur still wäre, dann würde ich sie mitnehmen. Zum Teufel mit Moms Vorschriften.
Aber sie gab einfach keine Ruhe.
Und die Männer kamen näher.
Sorry, Nala. Ich angelte den Laserpointer aus der Gesäßtasche und bewegte den kleinen roten Punkt auf eine Stelle oberhalb des Kästchens. Augenblicklich weiteten sich Nalas Augen, und ihre Muskeln spannten sich an. Ihr Jagdreflex war aktiviert. Kurz schwenkten die Lichtkegel der Taschenlampen von den Rasentraktoren weg und ich fühlte mich noch schrecklicher als erwartet, als ich den Laserstrahl auf die Fassade der Villa richtete. Mit einem Satz sprang Nala nach draußen, raste über das Gras auf den Lichtpunkt zu – und direkt ins Blickfeld ihrer Verfolger.
»Ich hab sie!«
Nalas verzweifeltes Fauchen drang durch die Dunkelheit. Sie wehrte sich wie besessen, doch sie hatte bereits verloren.
Die Lichter der Taschenlampen erloschen. Nichts war mehr zu hören außer meinem eigenen leisen Atem.
Ich hasste mich für das, was ich dieser Katze angetan hatte. Aber sie musste eines lernen: Man kann wirklich niemandem trauen.
Kapitel 2
Moms erste Worte nach einem Job lauten nie: »Bist du okay, Ross?« Sondern: »Hast du’s?«
Ich rollte mich aus dem Rasentraktor und landete direkt vor Moms Füßen. Egal, dass ich in der letzten halben Stunde, seit der Rasentraktor sich in Bewegung gesetzt hatte, nahe am Hitzekollaps gewesen und fast an den Abgasen erstickt war. Mir ging es gut. Wenn ich am Leben und bei Mom war, war doch alles in Ordnung. Das Zielobjekt war das Entscheidende.
»Schau dir meine Kleine an, wirklich vorbildlich«, sagte Mom, während sie das Kästchen aufschnappen ließ und ihre Beute begutachtete. In den Arbeitsklamotten einer Landschaftsgärtnerin war sie kaum wiederzuerkennen. Ein starker Kontrast zu ihrem üblichen durchgestylten Look als Bad Bitch unserer Insel. Woran auch das Tennisarmband nichts änderte, das sie aus der Vase fischte und anlegte.
Mit einem entzückten Seufzer betrachtete Mom die in der Morgensonne funkelnden Diamanten. Sie standen ihr gut, das musste ich zugeben. Mom war eine glamouröse Schönheit. Haar-Extensions und elegante künstliche Wimpern. Breite Hüften und eine Wespentaille, die sie gern betonte – das komplette Gegenteil zu meiner eher schmächtigen Statur. Ihr Stil war dramatisch, nicht die Pelzmantel-und-Stiletto-Schiene, aber so auffallend, dass die Leute gleich zweimal hinsahen, wenn sie sich beim Ausgehen in Schale geworfen hatte.
Daher ihre Liebe zu Diamanten. Zu allem, was sie noch mehr erstrahlen ließ.
Mom drückte mir einen flüchtigen Kuss auf die Stirn. Sie roch nach gemähtem Gras und Benzin, aber ich roch vermutlich schlimmer.
»Genauso vorbildlich wie meine Mama«, sagte ich, weil ich wusste, dass sie das hören wollte, schwang mich auf das Fahrerbänkchen und rutschte für sie zur Seite. Mit einem zufriedenen Lächeln, das wahrscheinlich eher dem Kompliment galt als dem erfolgreich erledigten Job, startete sie den Traktor und fuhr uns zum Rand des Anwesens, wo ein Geländewagen mit Wasser und einer Klimaanlage wartete. Dafür war ich so dankbar, dass mir fast die Tränen kamen.
Ich drückte die Stirn an die Lüftungsschlitze des Fahrzeugs.
»Nächstes Mal können wir irgendwo arbeiten, wo es kühler ist.« Mom beobachtete vom Fahrersitz aus, mit welcher Hingabe ich mein Gesicht in den kalten Luftstrom hielt. »Vielleicht im Süden von Argentinien. Oder in den Alpen.«
»Wir kommen doch gerade erst von einem Job. Und vergiss die Boscherts nicht.« Offenbar waren ihnen unsere letzten Jobs in Dänemark und Italien ein Dorn im Auge gewesen, denn damit hatten wir ihren inoffiziellen Anspruch infrage gestellt, Top-Dienstleister für Diebstähle in Europa zu sein. In einer Welt von familiengeführten Diebesimperien konnte es nur eine Nummer eins geben, oder zumindest nur eine pro Kontinent.
Widerstrebend lehnte ich mich endlich zurück, schnappte mir das Ladegerät und stöpselte mein Handy ein. Ein Seitenblick von Mom sagte mir, dass sie das missbilligte. Wenn wir miteinander redeten, erwartete sie meine ungeteilte Aufmerksamkeit.
»Gut, dass wir eher Modeschmuck stehlen würden, als einen Gedanken an die Wünsche der Boscherts zu verschwenden.« Sie zog eine ihrer perfekt gezupften Augenbrauen hoch und ich nickte pflichtschuldig.
In meinem Kopf nahm eine Idee Gestalt an. »Also, wenn du möchtest, dass wir mehr Jobs in Europa übernehmen, dann wäre es doch sinnvoll, wenn eine von uns dort ein Netzwerk aufbaut. Vielleicht könnte ich dort für eine Weile zur Schule gehen, als Tarnung. Das wäre doch eine gute Möglichkeit, oder?«
Ich hielt den Atem an. Wahrscheinlich hätte ich das Thema meines Auszugs auf subtilere Weise anschneiden sollen. Bisher war ich noch nie ohne Mom oder Auntie verreist und wir waren schon viel herumgekommen. Als ich vor ein paar Monaten siebzehn wurde, ein Alter, in dem andere Jugendliche auf den Bahamas die Highschool abschließen, hatte ich gedacht, sie würde mich jetzt nicht mehr so … ihr wisst schon.
»Hm … eher nicht.« Mom blickt stur geradeaus auf die leere, von Teppichgras gesäumte Straße. Ich wartete auf eine Erklärung. Einen Grund, irgendwas. Stattdessen meinte sie: »Weißt du was, wenn wir wieder zu Hause sind, lassen wir es mal ein bisschen ruhiger angehen und gucken uns eine ganze Woche lang Low-Budget-Filme an. Was sagst du dazu?«
Ich brachte ein Lächeln zustande. »Klingt cool.«
Zufrieden wählte sie eine Playlist auf ihrem Handy aus und drehte die Lautstärke hoch. Mein Display leuchtete auf. Eine E-Mail. Von einem der Ferienprogramme.
Ich hielt das Handy so, dass Mom nicht mitlesen konnte.
Liebe Rosalyn,
vielen Dank für deine Bewerbung zu unserem Sommersportprogramm. Hiermit laden wir dich zu unserem zweiten Kurs (1.–28. Juli) ein; für den Fall, dass du es kurzfristig einrichten kannst, könnten wir dir auch den letzten freien Platz im ersten Kurs anbieten (2.–29. Juni). Unser landesweit renommiertes Programm zieht jeden Sommer Dutzende von jungen Sporttalenten an, die sich auf einen Austausch mit Gleichgesinnten freuen. Wir hoffen, auch du entscheidest dich dafür, diese einzigartige Erfahrung mit uns zu teilen.
Danach folgten Informationen zu Unterkunft und Kosten sowie die Kontaktadresse. Je mehr ich las, desto schwieriger wurde es, einen neutralen Gesichtsausdruck zu bewahren. Meine gefälschten Unterlagen und Wettkampfbewertungen hatten tatsächlich funktioniert. Wenn ich wollte, konnte ich bereits in einer Woche dort sein. Heute war der 26. Mai.
Nala hätte vor den Security-Typen fliehen sollen, als sie die Gelegenheit hatte. Jetzt saß sie fest. Diesen Fehler würde ich nicht machen.
Ich komme gern!, schrieb ich zurück.
Aus den Lautsprechern dröhnte ›Ice on My Wrist‹. Mom rappte mit und stupste mich auffordernd an der Schulter. Wie üblich zog ich eine Grimasse und tat, als würde ich mich weigern, bevor ich dann doch mitmachte. Bei The ice on my wrist shine like a light schüttelte sie ihr neues Armband, dass es glitzerte, und ich lachte. Äußerlich betrachtet war alles wie immer. Das Hochgefühl nach einem Job, sie und ich zusammen. Aber es konnte nicht ewig so weitergehen. Ich hatte das Gefühl, meinem Leben soeben eine neue Richtung gegeben zu haben, direkt vor ihrer Nase, und sie hatte es nicht bemerkt.
Ich scrollte durch meinen Posteingang. Wo war die E-Mail geblieben, die ich kurz vor Moms Nachricht bekommen hatte? Seltsam. Es sei denn, sie war nicht in meinem privaten Ordner gelandet …
Der Blackbox-E-Mail-Account, über den unsere Familie Jobs vereinbarte. Nur erreichbar über das Deep Web, sicher vor Hackern und vor Nachverfolgung – so hatte Mom es mir erklärt, als ich acht Jahre alt war. Zum Abrufen von Nachrichten brauchte man einen Sicherheitscode. Noch nie hatte ich eine Benachrichtigung vom Blackbox-Server bekommen. Es konnte eigentlich nicht sein.
Ich gab die fünf Zahlenblöcke des Sicherheitscodes ein.
Die Nachricht war immer noch da. Ungeöffnet. Mom hatte sie noch nicht gelesen.
Mein Herz schlug bis zum Hals. Jemand schrieb mir eine Nachricht an die Blackbox?
Hallo, Rosalyn Quest,
wir möchten Ihnen gratulieren – Sie haben unser Interesse geweckt. Hiermit laden wir Sie zur Teilnahme am diesjährigen Thieves’ Gambit ein.
Beginn des Wettkampfs ist in einer Woche. Wir rechnen mit einer Dauer von zwei Wochen. Bitte nehmen Sie wegen der Vorabsprachen Kontakt mit uns auf.
Die Organisation
Kapitel 3
Thieves’ Gambit. Ein Wettkampf. Tage später, zurück auf den Bahamas, während ich mich eigentlich mit meiner Auszeit im Sommercamp befassen sollte, purzelten die Worte aus der Einladung durch meinen Kopf wie Würfel im Kniffelbecher.
So kam es mir jedenfalls vor – ich hatte noch nie Kniffel gespielt. Die Spieleabende hatten ihren Reiz verloren, als Mom sich weigerte, mit dem Schummeln aufzuhören.
Jedenfalls reichte es aus, um mich von meinem Beweglichkeitstraining abzulenken. Nun war ich schon über eine Stunde im Trainingsraum – eine gute Möglichkeit, um Stress abzubauen – und versuchte, von einem dreißig mal dreißig Zentimeter großen Podest auf ein anderes in zwei Meter zehn Entfernung zu springen. Letzten Monat hatte ich meine persönliche Bestmarke von zwei Metern erreicht. Danach hatte Mom mir erzählt, dass sie in meinem Alter bereits zwei Meter dreißig geschafft hatte.
Ich balancierte auf dem Podest, beugte die Knie und versuchte es noch einmal. In dem Moment, als ich absprang, wusste ich schon, dass ich es vermasselt hatte. Nicht genug Schwung. Mein Fußballen streifte die Kante, und bevor ich mich fangen konnte, trickste mich die Schwerkraft aus. Ich knallte auf die Matte.
Wütend pustete ich einen meiner Zöpfe aus dem Gesicht. Ein Schatten fiel auf mich. Tante Jaya sah auf mich herunter, die Hände in die ausladenden Hüften gestemmt. Obwohl sie sieben Jahre jünger war, sah sie genauso aus wie Mom. Wenn ich die Augen zusammenkniff, hätte ich meinen können, dass Mom sich mit gerunzelter Stirn und zusammengepressten Lippen – dem typischen Quest-Mund – über mich beugte.
»Was ist los mit dir?« Sie half mir nicht auf. In der Familie Quest war so was nicht üblich. »Es liegt an deinen albernen Schuhen. Mit denen kann man ja nicht richtig trainieren.«
Ich sah hinunter auf die Turnschuhe, die ich heute trug. Von mir selbst entworfene weiße Chucks mit Hunderten kleinen goldenen Blättern, die auf den Stoff gestickt, auf den Gummirand gedruckt und in die Sohle geprägt waren. Dazu passend glitzernde goldene Schnürsenkel. Meine Schuhe waren einfach der Hit. Tante Jaya musste an Geschmacksverirrung leiden.
»Ich fühle mich persönlich beleidigt, Auntie. Und noch mehr beleidigt es mich, dass du glaubst, ich würde Schuhe kaufen, in denen ich nicht richtig laufen kann.« Schließlich sammelte ich keine Pumps oder Plateaustiefel. Meine bestickten Chucks waren ideal fürs Training.
»Also, woran liegt es dann? Komm schon, erzähl deiner Tante, was dich so ablenkt.« Sie klang, als wäre sie genervt, mich überhaupt fragen zu müssen, doch dieses distanzierte Getue entsprach einfach ihrer Art. Sie war immer da, wenn ich sie brauchte. Und sie kannte mich gut genug, um zu wissen, dass die Nachricht Was machst du so bedeutete: Ich muss über etwas reden. Und in diesem Haus auf einer Insel, die so dünn besiedelt war, dass die Lebensmittelläden in Wohnzimmern untergebracht waren und man den ganzen Tag auf einer Schotterstraße sitzen konnte und mehr Wildschweine als Autos sah, gab es nun mal außer meiner Mom nur noch sie zum Reden.
Meine Tante hatte bereits auf uns gewartet, als unser Privatflugzeug zu Hause gelandet war.
»Hast du schon mal von einem Thieves’ Gambit gehört?« Zum ersten Mal hatte ich die Worte laut ausgesprochen und sie klangen genauso bizarr wie vorher in Gedanken. Diebe im Plural? Das war ein Widerspruch in sich. Diebe verabreden sich nicht miteinander.
Auntie saß stocksteif da, als wappnete sie sich gegen einen Schlag in die Magengrube.
Also hatte sie davon gehört.
Ich setzte mich auf.
»Die Organisation hat dir eine Einladung geschickt?«
»Ja, vor einer Woche. Wer hat gesagt, dass es eine Organisation ist? Weißt du, was das für Leute sind?«
»Was wirst du antworten? Oder hast du schon geantwortet?« Auntie ignorierte meine Fragen.
Ich zog die Nase kraus. »So dumm bin ich nicht, dass ich auf komische Nachrichten in der Blackbox antworte. Ich hab die E-Mail gleich gelöscht.«
Sie wirkte erleichtert. Kein Schlag in die Magengrube. »Gut.«
»Jetzt bin ich dran. Was zum Teufel ist das für eine Organisation und warum kennst du sie und ich nicht?«
Ich sprang mit einem Kip-up auf die Füße. Auntie, Mom und ich waren etwa gleich groß, sodass ich ihr in die Augen sehen konnte. Vorher war ich nur ein bisschen neugierig gewesen, jetzt wollte ich es unbedingt wissen. In dieser Familie sollte es keine Geheimnisse geben.
Meine Tante schnalzte mit der Zunge, spielte auf Zeit. »Das ist bloß ein Haufen reicher Schwachköpfe mit einem Machtkomplex. Sie veranstalten das Gambit einmal im Jahr oder so. Und das ist alles, was ich von ihnen weiß.«
Alles, was sie wusste. Hieß das, Mom wusste vielleicht mehr?
Die Art, wie sie meinem Blick auswich, weckte in mir den Verdacht, dass dieses Thema bisher bewusst vermieden worden war. Es würde unglaublich mühsam sein, ihr weitere Informationen über diese Organisation aus der Nase zu ziehen. Ich änderte meine Taktik.
»Und das Gambit ist …?«
Einen Moment fürchtete ich, sie würde stumm bleiben.
»Es ist ein Wettkampf, ein Wettkampf der Diebe. So was wie eine private … illegale Gameshow.« Sie schob ihre Zöpfe über die Schulter, schlenderte lässig zu einer Materialkiste mit unterschiedlichen Übungsschlössern hinüber und fischte ein Paar Handschellen heraus.
Ich folgte ihr. »Und du würdest mich nicht an einer illegalen Gameshow teilnehmen lassen, die ein geheimer Klub von Superreichen veranstaltet?«
»Ich habe gesagt, so was wie eine Gameshow. Das darfst du nicht verwechseln, es ist keine Diebes-Version von Der Preis ist heiß.« Sie zog eine Nadel aus ihrem Haar und stocherte damit in den Handschellen herum. »Nach allem, was ich gehört habe, kann es für manche blutig werden. Oder sogar tödlich enden.« Die Handschellen sprangen auf. Sie deutete auf meine Hände. Automatisch streckte ich sie ihr entgegen und sie befestigte eine der Handschellen an meinem Handgelenk.
»Warum sollte dann überhaupt jemand daran teilnehmen wollen, hm? Kann man ordentlich Preisgeld absahnen?« Diebe machen nie etwas umsonst.
»Sagen wir mal so, es gibt einen Siegespreis.« Auntie drehte mich um und fesselte meine Hände auf dem Rücken. Mit einer geübten Bewegung stieg ich zwischen meinen Armen hindurch und zog eine Haarnadel aus dem Arsenal in meinen eigenen Zöpfen. »Es heißt, der Gewinner … hat einen Wunsch frei.«
Ich legte den Kopf schief. »Einen Wunsch frei? Wie bei einer Sternschnuppe?«
»Sternschnuppen erfüllen keine Wünsche. Geld schon.« Sie schnippte mit den Fingern vor meinem Gesicht. »Konzentrier dich.«
Richtig. Die Handschellen. Ich steckte die Spitze der Haarnadel in das Schloss und tastete nach dem Schließmechanismus.
Auntie runzelte die Stirn. »Du würdest leichter ohne die Nadel rauskommen …«
»Ich mache mir wegen dir doch nicht den Daumen kaputt, Auntie.« Mit einem Klicken öffnete sich die erste Handschelle – na also, es ging auch ohne gebrochene Knochen. Schon seit Jahren wollte meine Tante mit mir trainieren, das Daumengelenk aus der Gelenkpfanne springen zu lassen. Aber da war bei mir Schluss mit lustig.
»Es tut nur die ersten paar Male weh«, beharrte sie. Ich öffnete das zweite Schloss und ließ die Handschellen in die Kiste fallen. Prüfend sah Auntie mich an. »Du hast deiner Mama nichts von der Einladung erzählt, oder?«
In ihrer Frage schwang ein »Warum?« mit. Ich versuchte es zu ignorieren und verschob eines der Podeste für den nächsten Sprungversuch.
»Sie hat so viel zu tun«, sagte ich. »Die Vorbereitungen für den nächsten Coup. Du weißt schon.«
Und außerdem bin ich in ein paar Tagen sowieso hier weg … So interessant das mit dem Gambit auch klang, weder das noch irgendein Vorhaben von Mom durften mich von meinem eigenen Plan ablenken. Ein illegaler Wettkampf in unserer Szene würde mir kaum dabei helfen, Freunde zu finden; schließlich nähmen nur Leute teil, denen das Täuschen und Betrügen zur zweiten Natur geworden war.
»Hm-hmm.« Das bedeutete übersetzt: Probier’s noch mal. Auntie mochte mich gut kennen, doch das beruhte auf Gegenseitigkeit.
Anstatt wieder aufs Podest zu klettern, setzte ich mich hin und seufzte. Der Trainingsraum enthielt noch mehr Übungsmaterial: Safes, Dartscheiben, Dummys, an denen man Armhebel und Schwitzkasten trainierte, Kisten mit Seilen, an denen man das Lösen unterschiedlicher Knoten üben konnte. Es war nicht der einzige Raum, der etwas über unser Gewerbe verriet. Im Laufe der Jahrzehnte hatten sich im ganzen Haus Trophäen von Jobs auf den verschiedenen Kontinenten angesammelt. Schon als ich fünf Jahre alt war, kannte ich deren Geschichten. Da war das Buch, das Grandpa in der Kongressbibliothek in Washington hatte mitgehen lassen. Das Stillleben? Hatte sich im Depot des Louvre befunden, bis Großtante Sara sich dort Zutritt verschaffte. Die Münzen in der Schale, in der wir unsere Schlüssel aufbewahrten? Hatte Auntie dem Stabschef des ugandischen Präsidenten abgeknöpft. Viele dieser Erinnerungsstücke stammten noch aus der Zeit, als auch der Rest meiner Familie hier lebte. Das war, bevor es zwischen ihnen und Mom zu diesem berühmt-berüchtigten Zerwürfnis kam, für das mir bis heute niemand eine Erklärung geliefert hatte. Danach wollten sogar ihre Eltern nichts mehr mit ihr zu tun haben, außer um sicherzustellen, dass man einander bei Jobs nicht in die Quere kam. Die Trophäen standen für jeden sichtbar herum und waren gerade deswegen gut versteckt – wenn es denn jemanden gäbe, vor dem man sie hätte verstecken müssen.
Unser ganzes Haus war ein verdammtes Diebesparadies. Eine Erinnerung daran, wozu ich geboren war. Der Job und die Familie sollten das Einzige sein, wofür ich lebte.
Aber es gab nicht nur Erinnerungsstücke und Trophäen.
Jede Woche musste ich neue Schlösser am Kühlschrank oder an den Schränken knacken. Autoschlüssel verschwanden spurlos, sodass ich einen Wagen kurzschließen musste, um irgendwohin zu kommen. Nicht zu vergessen die vielen Male, bei denen mir Mom den Zugriff zu meinen digitalen Geräten sperrte und ich ihr das neue Passwort aus der Tasche stehlen musste. Ohne Handy und Computer auf dieser Insel zu leben war eine ganz eigene Art von Hölle. Laut Mom führte unsere Familie dieses Leben, weil es Freiheit bedeutete. Keine Beschränkungen. Spaß. Sicher, für manche Jobs galt das. Aber für den Rest der Zeit …
Ich konnte nicht noch ein Jahr allein und isoliert verbringen. In dieser Branche kam es nicht infrage, Leuten außerhalb der Familie zu vertrauen. Es gab nur zwei Möglichkeiten: Ich konnte entweder hier eingesperrt bleiben oder dieses Leben aufgeben und mir ganz normale Freunde suchen. Dafür würde ich liebend gern auf den Kick von wöchentlichen Raubzügen verzichten.
Aunties Frage hing noch im Raum. Warum hatte ich Mom nichts davon erzählt?
Ich zuckte die Schultern und spielte mit dem Ende eines Zopfes. »Was wäre, wenn ich mal eine Auszeit vom Diebesalltag bräuchte?«
»Vielleicht möchtest du ja in dieser Auszeit etwas ganz anderes machen.« Ihre Stimme klang sanft. Mit dem richtigen Ton, so dachte sie wohl, würde sie mir schon die Wahrheit entlocken.
Ich verschränkte die Arme. Auch wenn ich ihre Taktik durchschaute, sie funktionierte. Auntie wirkte nicht so einschüchternd wie Mom, wahrscheinlich weil sie jünger war. Vielleicht konnte ich ihr von meinem Fluchtplan erzählen. Ich konnte es so verkaufen, dass ich auf dem College etwas lernen wollte, was der Familie zugutekam. Damit es nicht so aussah, als wäre ich eine undankbare Göre, die dieses sorgenfreie, hyperdynamische Leben freiwillig aufgab, in das sie Glückspilz hineingeboren worden war. Auntie könnte mir dabei helfen, Mom das Thema schmackhaft zu machen.
Das Klappern von Sandalen im Flur riss mich aus meinen Gedanken. Es war eine Mahnung, dass Mom immer mithörte. Zumindest solange wir uns im selben Haus aufhielten. Ich sagte das Nächstbeste, was mir durch den Kopf schoss. »Ich will nichts außer meiner Familie. Was wäre ich ohne euch?«
»Du würdest bestimmt nicht in diesem Paradies auf einer der schönsten Inseln der Welt leben.« Mom rauschte herein, ganz karibischer Schick in High-Waist-Jeans und leuchtend rotem schulterfreiem Top. Sie tippte noch etwas in ihr Smartphone, bevor sie uns ihre volle Aufmerksamkeit schenkte. »Worüber unterhalten sich meine Babys? Albträume?«
Ich hielt den Atem an. Zum Glück sah es nicht so aus, als würde Auntie meine Gambit-Einladung ausplaudern. So wie sie eine Faust gegen die Hüfte stemmte und Mom mit dem Blick durchbohrte, war mir klar, dass sie gerade etwas ganz anderes im Sinn hatte, als mich zu verpfeifen. »Nenn mich nicht immer Baby! Du hast nur eine Tochter, ich bin nicht dein Baby Girl.«
»Oh …«, gurrte Mom. »Mein Püppchen hat einen Trotzanfall.« Sie kniff ihre Schwester in die Wangen, doch Auntie schlug ihre Hand weg. In ihrer Kindheit hatte Mom Auntie wie ihre lebendige Babypuppe behandelt. Als Auntie fünf war und Mom zwölf, redete ihr Mom ungefähr einen Monat lang ein, dass sie kein wirkliches Mädchen war, sondern nur eine Puppe. Und auch siebenundzwanzig Jahre später konnte Mom es immer noch nicht lassen.
Auntie presste die Lippen aufeinander und stürmte hinaus.
»Du solltest sie nicht immer aufziehen«, sagte ich. »Es tut ihr wirklich weh.«
Mom schnaubte verächtlich und schnippte ein wenig Schmutz unter einem Fingernagel weg. »Du hast keine Schwester. Das verstehst du nicht.«
Autsch. Keine Freunde, keinen Dad und auch keine Geschwister. Und an mindestens zwei dieser Dinge war sie schuld.
Sofort bereute ich den Gedanken. Es war nicht fair von mir, Mom für die Dad-Problematik die Schuld zu geben. Sie hatte es nicht so mit Beziehungen – das war das Äußerste, was sie über ihr Sexleben preisgab –, daher entschied sie sich für eine Samenspende. Und von allen Männern auf der Welt musste sie sich ausgerechnet einen aussuchen, der, einige Wochen nachdem er seine erste, äh, Probe abgegeben hatte, starb. Nie würde ich ihn kennenlernen können, nie würde er nach seinem eventuellen Nachwuchs suchen. Mom schwor, dass sie erst im letzten Drittel der Schwangerschaft von seinem Tod erfahren hatte, und ich wusste, bei so etwas würde sie nicht lügen. Und doch war es eine Sache, die immer aufploppte, wenn ich nach einem Grund suchte, um mich über sie aufzuregen.
Mom beäugte die Podeste hinter mir. »Zwei Meter zehn?«
Ich wand mich. »Fast.«
Sie nickte, dann stellte sie sich dicht vor mich hin. Auch wenn wir inzwischen gleich groß waren, kam sie mir immer noch größer vor. Groß genug, um mich in einer stürmischen Umarmung hochzuheben und herumzuwirbeln, wie sie es früher getan hatte. Sie duftete nach Kokoslotion und für eine Sekunde fühlte ich mich wieder wie ein Kind. Vielleicht reagierte ich nur wie der Pawlow’sche Hund, aber ihr Geruch und die Art, wie sie mir einen meiner Zöpfe hinters Ohr strich, schenkten mir Trost. Selbstvertrauen. Das war Mom. Wenn ich mir etwas von ganzem Herzen wünschte, sollte ich es doch schaffen, sie einfach danach zu fragen, oder?
Mein Mund war wie ausgedörrt. Und trotzdem setzte ich an: »Hast du gewusst, dass die Louisiana State University eines der besten Sportprogramme in ganz Amerika hat? Ich wette, die Studenten dort schaffen locker zwei Meter zehn.«
Mom erstarrte. Langsam wandte sie sich von mir ab.
Der warmherzige Mama-liebt-dich-Blick war wie weggewischt.
Ich hätte nichts sagen sollen.
»Ach komm, Rossie!«, stöhnte sie ärgerlich.
»Ich verstehe nicht, warum du so ein Problem damit hast!«, beharrte ich. »Ich bin siebzehn. Alle anderen Siebzehnjährigen auf der Insel werden bald aufs College gehen.«
»Und woher willst du das wissen?«
»Du hast recht. Ich weiß es nicht, weil ich niemanden kenne!« In meinem Kopf spulten sich die Sätze ab, die mir jahrelang eingetrichtert worden waren. Nein, du kannst nicht einfach zu den Nachbarn rübergehen. Nein, die Highschool von Andros ist nichts für dich. Anderen Familien kann man nicht trauen.
Schon klar, ich hatte es kapiert. Es wäre äußerst unklug, sich mit Leuten auf der Insel anzufreunden oder gar zu offenbaren, dass wir eine Familie von Dieben waren. Und darüber hinaus hatte ich schon vor langer Zeit gelernt, niemals, wirklich niemals jemandem aus unserer Branche zu vertrauen. Aber wenn ich im Ausland wäre, in der Masse verborgen, wenn ich wachsam bliebe, wäre es dann wirklich so riskant, andere Leute kennenzulernen?
»Du kennst jede Menge Leute«, behauptete Mom. »Mich und Jaya und Granny und Grandpa kannst du jederzeit anrufen. Und meine Tante Sara auch.«
Merkte sie denn gar nicht, wie jämmerlich wenige das waren? Ganz abgesehen davon, dass ich die Einzige unter dreißig war. Ich verschränkte die Arme. »Die zählen nicht. Sie sind Familie. Das genügt nicht …«
Ich brach ab, aber da war es mir schon herausgerutscht. Ich warf einen raschen Blick auf Mom. Die Art, wie sie die Lippen schürzte, verriet mir, was sie herausgehört hatte. Du genügst nicht.
»Ich wollte nicht …«
Sie legte einen Finger auf die Lippen. »Rosalyn«, begann sie, »die Familie lässt dich nicht im Stich. Die Familie belügt dich nicht. Der Familie kannst du trauen. Gerade in unserem Metier. Jeder hat doch Wünsche – oft sind das Dinge, die jemand anders gehören. Menschen manipulieren dich, um zu bekommen, was sie von dir haben wollen. Leute, die du für deine Freunde hältst, Leute, die du als vertrauenswürdig erachtest, brechen dir das Herz und überlassen dich deinem Schicksal. Du bist viel zu klug, um das mit dir machen zu lassen, Baby Girl. Und für den Fall, dass du noch nicht zu dieser Erkenntnis gelangt bist, treffe eben ich für dich eine Entscheidung. Weil ich dich liebe. Also nein, du gehst nirgendwohin. Nicht ohne mich. Und das ist mein letztes Wort.«
Ihr letztes Wort. In Stein gemeißelt. Das Urteil war gefällt. Ohne Kreuzverhör, ohne sich meine Aussage auch nur anzuhören. Ich biss die Zähne zusammen, bis es wehtat. In meiner Brust brodelte es. Aber ich wusste nicht, wohin mit dieser Wut – jedenfalls würde ich nicht anfangen, mit irgendetwas um mich zu werfen.
Und wenn ich Plan B folgen wollte – Mir doch egal, ich tue, was ich will –, dann musste ich ruhig bleiben. Durfte nichts verraten.
Unsere Blicke trafen sich. Sie wartete auf eine Antwort. Ich zwang mich zu einem Nicken und ihre Miene hellte sich auf. Sie klatschte die Hände unter dem Kinn zusammen und lächelte, als wäre das, was sie gerade verkündet hatte, keine große Sache.
»Braves Mädchen. Wo ist denn eigentlich der hübsche schwarze Rucksack mit den goldenen Reißverschlüssen, den ich dir geschenkt habe?«
Ich erstarrte. Es war der Rucksack, in den ich bereits heimlich Sachen für das Sommercamp gepackt hatte. War sie mir etwa auf die Schliche gekommen?
»Keine Ahnung. Warum?«
Sie zögerte. »Nicht sauer werden, aber du musst packen. Ich brauche dich bei einem Last-Minute-Job. Heute Abend geht es los.«
»Heute Abend! Wir sind doch gerade erst zurückgekommen!« Zwar war ich erleichtert, dass sie meinen Rucksack nicht gefunden hatte, aber das hier war auch ziemlich schlimm. Ein neuer Einsatz gefährdete meinen Plan.
»Entspann dich, meine Kleine. Ich verschleppe dich nicht auf einen anderen Kontinent. Nur rüber nach Paradise Island. In maximal zwei Tagen ist alles erledigt. Ich schicke dir die Details über AirDrop, okay?« Mom wandte sich ab, als hätte ich bereits zugestimmt.
»Aber ich …«, begann ich. Sie drehte sich zu mir um. »Und wenn ich etwas anderes vorhabe?«
Moms Miene verdüsterte sich. »Was könnte wichtiger sein als deine Familie, Ross?«
Neue Erfahrungen?
Freundschaften?
Die Chance herauszufinden, ob es etwas Wichtigeres gab?
Nichts davon wäre die korrekte Antwort gewesen. Mom hatte mir ja schon gesagt, wie es lief. Sie, meine Familie, war alles, auf das ich mich verlassen konnte. Alles andere zählte nicht.
Ich verstand, warum Auntie es hasste, wenn Mom sie als ihr Püppchen bezeichnete. Manchmal wirkte es nämlich nicht so, als würde Mom scherzen. Sie behandelte uns, wie es ihr passte. Sie spielte mit uns und wusste bereits im Voraus, dass sie gewinnen würde.
Vielleicht würde ich diesmal den Spieß umdrehen. In meinem Kopf nahm ein Plan Gestalt an. Wenn ich schon bei diesem Job dabei sein musste, wie wäre es, wenn ich mich mittendrin absetzen würde? Mit so etwas würde sie doch gewiss nicht rechnen.
Ich lächelte. Ein echtes, strahlendes Lächeln. Und schlang meine Arme um Moms Taille.
»Nichts ist wichtiger als wir.« Ich drückte sie.
Sie musterte mich kurz, bevor sie mich mit besitzergreifender Geste umarmte. »Braves Mädchen.« Sie drückte mich ein bisschen fester. »Denk immer daran, da draußen ist nichts und niemand. Jedenfalls niemand, dem du trauen kannst.«
Kapitel 4
»Alles fertig geplant und eingezeichnet.« Ich drehte Mom, die auf der anderen Seite des Tisches saß, das Tablet zu. Sie riss sich vom Anblick ihrer frisch manikürten Fingernägel los, einer kleinen Aufmerksamkeit des hoteleigenen Wellness-Centers.
Wir befanden uns auf Paradise Island – für die meisten Menschen der Inbegriff der Bahamas. Riesige Hotelanlagen, weiße Sandstrände mit Hütten, an denen Conch Fritters verkauft wurden, und eine Reihe von Marinas mit schnittigen, eleganten Jachten, die mehr wert waren, als die meisten Inselbesucher in einem Dutzend Leben verdienen würden. Unser Zielobjekt befand sich im Innern einer dieser Luxusjachten und unser Hotelzimmer im zehnten Stock war der perfekte Beobachtungsposten.
Mom hatte mich damit beauftragt, die Zugangs- und Ausstiegsstrategie zu erarbeiten. Obwohl sie das auch selbst geschafft hätte. Aber seit ich vierzehn war, ließ sie das immer wieder mal mich übernehmen. Um zu testen, ob ich in meiner Ausbildung was gelernt hatte oder so. Ich denke mal, sie wusste einfach, dass ich die Beste darin bin. Wenn es jemanden gibt, der rauskriegt, wie man sich aus einem engen Raum befreit, dann die sich aus den Armen ihrer Mutter windende Ross Quest.
Sie konnte nicht ahnen, dass der Plan zwei Teile hatte. Auf dem Bildschirm sah sie nur den Weg auf die Jacht und von der Jacht, den sie nehmen würde, aber nicht meine Route zurück zum Strand, um zum internationalen Flughafen von Nassau zu gelangen, wo ich in ein Flugzeug steigen und zu neuen Zielen aufbrechen würde.
Es fiel mir schwer, mein Triumphgefühl zu verbergen. Mom hatte mich hierhergeschleppt, weil ich so genial Exit-Strategien ersinnen konnte, und ich nutzte die Gelegenheit zum Davonlaufen. Eines Tages, wenn sie darüber hinweggekommen war, würde sie vielleicht mit Stolz darauf zurückblicken, wie raffiniert ich vorgegangen war.
»Die Jacht misst vom Bug bis zum Heck fünfundneunzig Meter. Sie hat vier Decks plus Maschinenraum.«
Mom fiel mir ins Wort. »Laut Logbuch befinden sich fünf Gäste und fünfzehn Crewmitglieder an Bord, also gehen wir davon aus, dass es doppelt so viele sind, richtig, Baby Girl?«
»Ja, klar.« Als hätte ich das nicht bereits miteinkalkuliert. Eine der Quest-Regeln lautet: Mit wem du es auch zu tun hast, verdopple die geschätzte Personenzahl. »Ich habe die beste Route ausgearbeitet, um die Kabinen und Gästebereiche zu umgehen. Im Heck befindet sich eine Garagenklappe für die bordeigenen Speedboote. Wir fahren mit unserem Zodiac in den Bereich zwischen der Beibootgarage und der Steuerbordseite des Bugs, da in der Nähe keine Bullaugen liegen, und steigen dann durch ein Mannloch auf dem ersten Deck und durch den Maschinenraum in den Frachtraum hinunter. Die Route ist so optimiert, dass wir in der Lage sein dürften, eine Fuhre in weniger als dreißig Minuten von dort auf unser Boot zu schaffen.«
Der Plan war wirklich astrein … zumindest fast.
Mom schürzte die Lippen. »Und was ist mit einem Plan B? Hast du keine Alternative für Notfälle vorgesehen?«
Mein Herzschlag beschleunigte sich, doch ich versuchte es mir nicht anmerken zu lassen. Ich beugte mich vor und wischte zu einem anderen Lageplan, der eine sehr viel kompliziertere Route zeigte. Sie schlängelte sich um die Mannschaftsquartiere herum zum Bug des Schiffes. »Die hier, aber die ist vertrackt. Mit der ersten müsste es klappen«, sagte ich.
»Bist du ganz sicher, dass es keinen anderen Weg nach draußen gibt?« Mom suchte auf dem Lageplan nach einem Ausweg, der nicht existierte. Oder besser gesagt nicht eingezeichnet war.
»Bei Ausgängen täusche ich mich nie.«
Das konnte sie nicht bestreiten.
»Perfekt.« Mom stand auf und wieder hatte ich den Eindruck, als würde sie auf mich herabblicken. »Wir starten bei Sonnenuntergang.«
Das Wasser war tintenschwarz.
Darüber zu flitzen fühlte sich an, wie über einen Schatten zu gleiten, direkt auf den sternenübersäten Horizont zu.
Na ja, ich war auf dem Weg zum Horizont, aber erst musste ich noch diesen Job hinter mich bringen.
Die Jacht war nahezu unsichtbar, ein schnittiges schwarzes Schiff, das mit dem ebenso schwarzen Hintergrund verschmolz. Während unser Schlauchboot über die Wellen hüpfte, ging ich im Kopf noch einmal alles durch. Wenn wir Glück hatten, würden an Bord bereits alle schlafen. Mom würde einen Teil der Beute in einer der Sporttaschen raustragen, während ich schon die nächste vollpackte. Kein sonderlich anspruchsvoller Job, aber es war ein Last-Minute-Auftrag und es muss ja nicht immer alles ein Riesenevent sein, wie Auntie zu sagen pflegt.
Es war leicht verdientes Geld. Schwieriger würde der Teil danach werden.
Meine Hände kribbelten vor Erwartung. Ich trommelte mit meinen Sneakers – die mit abstrakten schaumgekrönten Wellen in diversen Schattierungen von Meerblau, kombiniert mit korallengrünen Schnürsenkeln – gegen den Boden des Bootes. Ich streckte und krümmte die Finger. Als Mom es bemerkte, löste sie den Blick vom Wasser.
»Sag bloß nicht, dass du nervös bist, Baby Girl«, neckte sie mich. Selbst ganz in Schwarz und mit den zu einem praktischen Pferdeschwanz nach hinten gebundenen Haaren, halb verschmolzen mit der Dunkelheit, sah sie zehnmal glamouröser aus, als ich jemals sein würde.
Ich lächelte. »Aufgeregt.«
Sie grinste ihrerseits und zwickte mich in den Oberschenkel. »Gewinnen ist aufregend.«
Sie hatte ja keine Ahnung, wie recht sie hatte.
Nach etwa dreißig Metern schaltete Mom den Motor aus. Die restliche Strecke zum Heck der Jacht paddelten wir, wobei wir einen großen Bogen um Fenster, Bullaugen und Lichter machten. Der Großteil des Schiffes war unbeleuchtet. Lag im Schlaf.
Mom kletterte hinauf zum ersten Deck, ich direkt dahinter. Dann übernahm ich die Führung, folgte einem unsichtbaren Pfad. Ich blieb wachsam, das Meteorarmband einsatzbereit. Doch auf dem Schiff war es fast unnatürlich still. Es wirkte wie ausgestorben, auch wenn ich wusste, dass dies nicht der Fall war.
Geräuschlos sprangen wir hinunter in den Frachtraum. Durch ein winziges Bullauge fiel Mondlicht auf Holzkisten. Mom öffnete einen der Deckel. Im Innern der Kiste befanden sich jahrhundertealte Schätze, die aus den Tiefen des Meeres geborgen worden waren. Golddublonen, Teile eines Steuerrades von einem uralten Schiff, Keramikscherben, Silberbesteck, Armbänder, ein verrosteter Dolch. Unsere bedauernswerten Gastgeber heute Abend kamen aus einem anderen Bereich unserer Branche – Schatzsucher. Sie plünderten Schiffswracks auf der Suche nach antiken Stücken, manchmal nur wenige Tage nach ihrer Entdeckung. Dabei spielte es keine Rolle, dass diese Schätze eigentlich demjenigen gehörten, der das Wrack aufgespürt hatte, oder der Regierung, je nachdem, wo und wie nah vor der Küste es lag. Es war ein lukratives Geschäft, wie man an dieser schicken Jacht erkennen konnte, und genauso illegal wie das, was wir taten.
Zu ihrem Pech gab es ein Team rivalisierender Schatzjäger, die alles andere als glücklich darüber waren, dass ihnen bei diesem Fund jemand zuvorgekommen war. Sie engagierten uns kurzfristig, um das Diebesgut für sie zu stehlen. Angesichts unseres Honorars und der Mühe, das Ganze auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie viel Profit damit machen würden, aber es ging wohl mehr darum, ihren Rivalen eins auszuwischen.
Mom presste ihre Hände zusammen und deutete hinter sich, unser stummes Signal für »einpacken und gehen«. Ich nickte und fing an, vorsichtig Silberbesteck und Dublonen in eine der mitgebrachten gepolsterten Sporttaschen zu räumen. Mom half mir. Als die Tasche voll war, hängte sie sich den Riemen über die Schulter und machte sich auf den Rückweg zu unserem Boot, während ich die nächste füllte. Wenn ich das Packen und sie den Transport übernahm, waren wir nicht nur doppelt so schnell, sondern auch doppelt so leise.
Mit jeder Ladung schlug mein Herz schneller. Je weiter wir bei unserem Raubzug vorankamen, desto näher rückte auch meine Flucht. Die Aussicht, dass mein Traum bald Realität werden würde, ließ meine Haut kribbeln. Es juckte mir in den Fingern wie immer, wenn ich kurz davor war, etwas zu stehlen. Nur dass es diesmal nicht wegen eines Schatzes war, sondern wegen meiner Zukunft. Ich würde mir meine Zukunft zurückholen.
Bald waren wir bei der letzten Kiste angelangt. Meiner Schätzung nach würden wir dafür drei Taschen brauchen.
Jetzt war es so weit.
Mom kehrte zum x-ten Mal zurück und wieder tauschte ich eine gefüllte Tasche gegen eine leere ein. Bei der Übergabe konnte ich nicht anders, als Mom ein letztes Mal zu betrachten, auch wenn ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen. Was ich vorhatte, war nichts anderes als ein Verrat an ihr. Selbst wenn ich eine Woche, einen Tag, eine Stunde später zurückkäme, selbst wenn sie versuchte, mich zurückzuschleifen, würde das immer zwischen uns stehen. Ross ist weggelaufen. Ross hat die Familie verlassen. Wir haben Ross nicht genügt. Ich war im Begriff, mein Leben in zwei Hälften zu teilen, in ein Vorher und ein Nachher. Welche würde ich im Rückblick für die bessere halten?
Mom sah mir in die Augen und ich wandte ruckartig den Blick ab. Hatte sie es gemerkt? Konnte sie tatsächlich meine Gedanken lesen? Würde sie mich aufhalten?
Nein. Wie all die anderen Male nahm sie die Tasche und verließ wortlos den Frachtraum. So verpasste sie ihre letzte Chance, mich zu stoppen.
Sobald sie außer Sicht war, legte ich los. Ich öffnete eine gespeicherte Mail und gab ein, dass sie in fünfzehn Minuten gesendet werden sollte, also ungefähr dann, wenn Mom zurückkommen würde. Meine Botschaft war simpel: Ich brauche eine Pause. Bin in ein paar Monaten zurück, versprochen. Kurz und bündig, aber nichts, was ich ihr ins Gesicht hätte sagen können. Dann verließ ich den dunklen Frachtraum und lief, meiner ausgeklügelten Route folgend, zu einer Nische, die von Metallregalen und Dingis eingerahmt war. Zwischen ordentlich gestapelten Rettungswesten, Erste-Hilfe-Kästen und Notvorräten entdeckte ich es, genau wie auf der Online-Pinnwand der Jacht-Crew beschrieben. Ein aufblasbares Rettungsfloß für den Notfall, inklusive batteriebetriebenem Motor.
Vor mir lag die luftdichte Tür, die vom Schifffahrtssicherheitsausschuss als zu schmal und unsicher für Evakuierungszwecke eingestuft und daher aus allen Flucht- und Rettungsplänen gestrichen worden war. Ich zerrte das Rettungsfloß vom Regal und drehte das Metallrad in der Mitte der Tür, um sie zu öffnen. Quietschend schwang sie auf. Draußen schwappte knapp zwei Meter unter mir dunkles Wasser an den Schiffsrumpf. Mein Herz klopfte wild. Von hier aus war es nur ein Katzensprung. Der Notmotor würde genug Saft haben, um mich zurück an Land zu bringen. Diese versteckte Tür war von Moms Schlauchboot aus nicht zu sehen. In zehn Minuten, wenn sie mein Verschwinden bemerken würde, wäre ich weit weg, von der Dunkelheit verschluckt.
Ich warf das Rettungsfloß ins Wasser. Jetzt musste ich nur noch springen.
Ein Schuss zerriss die Stille. Ich erstarrte. Eine Sekunde später und ich wäre gesprungen. Eilige Schritte polterten über die Decks. Lichtschein tanzte auf den Wellen. Die Leute auf diesem Schiff waren wach und sie schossen.
Mom. War sie entdeckt worden?
Ich rannte zurück Richtung Frachtraum, den Schritten und der Gefahr entgegen, und sah gerade noch, wie Mom eine Leiter hinabkletterte, die ins unterste Deck führte.
Nein! Was zum Teufel tat sie da? Dort gab es keinen Ausstieg, sie lief in eine Sackgasse. Sie sollte lieber hierherkommen …
Aber das wusste sie nicht.
Ich hatte ihr gesagt, auf dieser Ebene gebe es keinen anderen Ausgang.
Ich öffnete den Mund, um sie zu rufen, doch dann fiel mir ein, was ich in meiner Ausbildung gelernt hatte. Das würde den Verfolgern nur unsere Position verraten, Moms Position. Sofern sie sie nicht ohnehin bereits kannten, was ziemlich wahrscheinlich war.
Stattdessen folgte ich ihr. Ich würde ihr den richtigen Weg zeigen.
Doch gleichzeitig mit mir stürzten zwei Männer von der anderen Seite in den Frachtraum, die ziemlich angepisst waren – und bewaffnet. Sie hielten sich nicht mit Fragen auf. Ein Blick auf die offensichtlich leeren Schatzkisten genügte.
Einer hob seine Pistole. Ich machte auf dem Absatz kehrt und sprintete los. Hinter mir pfiff ein Schuss. Zurück am offenen Notausstieg tat ich das Einzige, was mir blieb: Ich sprang.
Das Wasser umfing mich. Mit kräftigen Zügen schwamm ich auf das Heck der Jacht zu. Gedämpfte Schüsse durchschnitten die Wasseroberfläche. Über mir schaukelte das noch unaufgeblasene Rettungsfloß. Ich hielt mich in einem Meter Tiefe, bis mir die Luft ausging. Als ich auftauchte, um verzweifelt Atem zu holen, brannte das Salz in meinen Augen. Kurz sah ich den Rand unseres Zodiacs, bevor mir eine Welle die Sicht raubte. Einen tiefen Atemzug und einige Brustzüge später war ich am Boot. Gerade als ich mich hineinhieven wollte, fiel ein Lichtstrahl aufs Wasser. Zwei Männer mit Gewehren standen an der Reling und schwenkten einen Suchscheinwerfer. Der Lichtkegel kam auf das Schlauchboot zu. Schnell. Da drin von einem Licht erfasst zu werden wäre … nicht gut für mich.
Weil mir nichts Besseres einfiel, ließ ich los und glitt zurück ins Wasser. Ich schwamm weg vom Boot und tauchte dicht neben der Jacht wieder auf, gerade als der Suchscheinwerfer das mit den Schätzen beladene Zodiac gefunden hatte. »Ich sehe es!«, rief eine Stimme von oben. An den Schiffsrumpf gedrückt und mit den Wellen kämpfend strengte ich mich an, zur Reling hochzublicken, wo die beiden Männer inzwischen die Leiter hinabkletterten, um sich zu holen, was sie schon verloren geglaubt hatten. Oben stöhnte jemand, eine Frau. Auch ohne sie zu sehen, wusste ich, dass es Mom war.
»Das hast du alles alleine geschleppt?«, wollte eine andere Stimme wissen.
Mom gab keine Antwort. Und wenn doch, konnte ich es wegen des immer stärker werdenden Dröhnens in meinen Ohren nicht hören. Ich klammerte mich an die Seite der Jacht und versuchte verzweifelt, mich im Dunkeln über Wasser zu halten. Es kostete mich meine ganze Kraft, ein Husten zu unterdrücken, das meine Position verraten hätte. Aber Mom … ich musste ihr helfen.
Die beiden Männer mit den definierten, aber schlanken Muskeln von trainierten Schwimmern und der sonnenverbrannten Haut von Matrosen hatten das Zodiac bereits auf der Jacht verstaut. Es war so schnell gegangen, dass ich die Gelegenheit verpasst hatte, unbemerkt zurück an Bord zu gelangen.
»Wer hat dich engagiert, hä?«, fragte einer der Männer mit rauer Stimme.
»Deine Frau«, hörte ich Mom in amüsiertem Ton antworten. »Sie meinte, wenn sie es schon mit dir aushalten muss, dann hat sie sich eine Belohnung verdient.«
Ein klatschendes Geräusch. Metall auf Haut.















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













