
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Thrones-and-Curses-Reihe
- Sprache: Deutsch
Verführung. Eroberung. Die Krone.
Die Prinzessinnen Daphne, Beatriz und Sophronia wurden in die benachbarten Königreiche geschickt, um die Länder ihrer Verlobten zu Fall zu bringen. Doch die Prinzessinnen haben ihre eigenen Wege gefunden und die Pläne ihrer machthungrigen Mutter dabei völlig durchkreuzt – auf teils tragische Weise. Sophronia hat sich für die Liebe entschieden, und dafür ihr Leben gelassen. Daphne und Beatriz können kaum glauben, dass ihre Schwester tot ist, aber beide sind wild entschlossen, sie zu rächen. Und nun, durch einen Kontinent – und die Lügen ihrer Mutter – getrennt, erkennen sie mit jedem Tag deutlicher, dass sie vielleicht nicht auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Die Sterne flüstern von Tod, aber Daphne und Beatriz beginnen gerade erst, die wahre Macht zu verstehen, die durch ihre Adern fließt. Und ihre Mutter tut alles, um sie weiter unter ihrer Kontrolle zu halten – selbst wenn das bedeutet, sie alle zu töten.
Die fesselnde Fortsetzung der »Thrones and Curses«-Reihe über drei Prinzessinnen und das Schicksal, für das sie geboren wurden: Verführung, Eroberung und die Krone.
Die Thrones-and-Curses-Reihe:
Thrones and Curses – Von den Sternen berührt (Band 1)
Thrones and Curses – Für die Krone geboren (Band 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 780
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
LAURA SEBASTIAN
FÜR DIE KRONE GEBOREN
Aus dem Englischen von Petra Koob-Pawis
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2024 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Text copyright © 2023 by Laura Sebastian
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Stardust in Their Veins« bei Delacorte Press,
an imprint of Random House Children’s Books,
a division of Penguin Random House LLC, New York.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Übersetzung: Petra Koob-Pawis
Lektorat: Christina Neiske
Umschlaggestaltung und Illustration: Isabelle Hirtz, Hamburg
Karte: © 2023 by Virginia Allyn
sh · Herstellung: ang
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28319-3V001
www.cbj-verlag.de
Für alle schwierigen Mädchen
Beatriz
In der cellarischen Schwesternschaft, hoch oben im Alder-Gebirge, geht Beatriz in ihrer Zelle auf und ab – immer zehn Schritte, von Wand zu Wand. Fünf Tage ist es her, dass sie weggesperrt wurde, in dieser kargen Kammer, mit nichts als einem schmalen Bett, einer verschlissenen Decke und einem Krug Wasser auf einem kleinen Holzschemel. Fünf Tage ist es her, dass sie die Stimmen ihrer Schwestern in ihrem Kopf hörte, so klar und deutlich, als stünden sie im Zimmer neben ihr. Fünf Tage, seit sie hörte, wie Sophronia starb.
Nein. Nein, das weiß sie doch gar nicht, jedenfalls nicht mit Sicherheit. Beatriz fallen ein Dutzend möglicher Erklärungen ein, ein Dutzend möglicher Auswege, um sich einzureden, dass ihre Schwester noch da ist – noch amLeben ist. Immer wenn sie die Augen schließt, sieht sie Sophronia vor sich. In der Stille ihrer Zelle hört sie ihr Lachen. Und wenn es ihr doch einmal gelingt, für ein paar Stunden zu schlafen, wird sie in ihren Albträumen von Sophronias letzten Worten heimgesucht.
Sie jubeln über meine Hinrichtung … Es steht so viel mehr auf dem Spiel, als wir ahnten. Ich verstehe immer noch nicht alles, aber bitte seid vorsichtig. Ich liebe euch beide so sehr. Ich liebe euch bis zu den Sternen. Und ich …
Das war alles.
Es ist ihr immer noch ein Rätsel, durch welches magische Wirken dieser letzte Kontakt zustande gekommen ist, auch wenn es Daphne zuvor schon einmal gelungen war, auf diese Weise mit Beatriz allein in Verbindung zu treten. Auch damals war die Magie abrupt versiegt. Doch diesmal ist es anders gewesen, Beatriz hat Daphnes Anwesenheit noch ein paar Sekunden länger wahrgenommen, ihr fassungsloses Schweigen hat sich in Beatriz’ Kopf ausgebreitet, bis die Verbindung endgültig abriss.
Aber Sophronia kann nicht tot sein. Allein die Vorstellung ist unbegreiflich. Sie sind gemeinsam auf die Welt gekommen: Beatriz, Daphne, dann Sophronia. Undenkbar, dass eine von ihnen die beiden anderen einfach so zurücklassen könnte.
Wie oft Beatriz sich das auch sagt, ein letzter Zweifel bleibt. Sie hat es schließlich gespürt. Es war, als hätte man ihr das Herz aus der Brust gerissen. Als wäre etwas Lebenswichtiges verloren gegangen.
Das Geräusch eines Riegels, der zurückgeschoben wird, lässt Beatriz aufschrecken, und sie dreht sich um, in der Erwartung, eine der Schwestern mit ihrer nächsten Mahlzeit in der Tür zu sehen. Aber die Frau, die nun ihre Zelle betritt, kommt mit leeren Händen.
»Mutter Ellaria«, sagt Beatriz. Ihre Stimme ist rau, in den letzten Tagen hat sie kaum ein Wort gesprochen.
Mutter Ellaria hat Beatriz bei ihrer Ankunft in der Schwesternschaft begrüßt, sie zu ihrer Zelle geführt und ihr Kleidung zum Wechseln ausgehändigt, die genauso aussieht wie jene, die die ältere Frau selbst trägt. Bisher hat Beatriz nur das graue Wollkleid angezogen. Die Schwesternhaube liegt immer noch am Fußende ihres Bettes.
In Bessemia galt es als große Ehre für eine Novizin, die Haube zum ersten Mal anzulegen, es gab eigens eine Zeremonie, um diesen Anlass zu begehen – Beatriz selbst hat an mehreren solcher Rituale teilgenommen. Es war eine Feier zu Ehren einer Frau, die sich entschied, ihr Leben ganz den Sternen zu widmen.
Aber Beatriz hat sich für nichts entschieden, also wird sie auch keine Haube tragen.
Mutter Ellaria scheint das nicht zu entgehen – ihr Blick wandert von Beatriz’ nachlässig geflochtenen rotbraunen Haaren zu der Haube auf dem Bett. Sie reagiert mit einem Stirnrunzeln, ehe sie Beatriz erneut anschaut.
»Du hast Besuch«, sagt sie mit unverhohlener Missbilligung in der Stimme.
»Wer ist es?«, fragt Beatriz, aber Mutter Ellaria dreht sich nur wortlos um und geht hinaus, sodass Beatriz nichts anderes übrig bleibt, als ihr in den dunklen Korridor zu folgen. Ihre Gedanken überschlagen sich.
Einen Moment lang stellt Beatriz sich vor, dass es Sophronia ist – dass ihre Schwester aus Temarin angereist ist, um ihr zu versichern, dass sie lebt und es ihr gut geht. Doch vermutlich ist es nur ihre einstige Freundin Gisella, die gekommen ist, um ihre Schadenfreude auszukosten, oder deren Zwillingsbruder Nico, der wissen will, ob ein paar Tage in der Schwesternschaft schon ausgereicht haben, damit Beatriz ihre Haltung zu seinem Heiratsantrag ändert.
Wenn das so ist, wird er enttäuscht wieder abziehen müssen. Sosehr Beatriz ihren erzwungenen Aufenthalt hier auch verabscheut – besser, als in den Palast von Cellaria zurückzukehren, ist es allemal. Denn auch Pasquale wird wohl den Rest seines Lebens in der Bruderschaft auf der anderen Seite des Flusses Azina verbringen.
Ihre Brust zieht sich zusammen bei dem Gedanken an Pasquale und daran, dass er nur deshalb enterbt und eingesperrt wurde, weil er auf ihr Anraten hin den falschen Menschen vertraut hat.
Wir sind noch nicht fertig mit ihnen, hat Pasquale gesagt, nachdem sie beide wegen Hochverrats verurteilt worden waren. Und schon bald werden sie sich wünschen, sie hätten uns getötet, als sie die Chance dazu hatten.
Beatriz lässt seine Worte in ihrem Kopf nachhallen, während sie Mutter Ellaria den spärlich beleuchteten Korridor hinunter folgt und im Geiste verschiedene Möglichkeiten durchgeht, wie sie die gebrechliche ältere Frau überwältigen und fliehen könnte … Die Frage ist nur: wohin? Das Alder-Gebirge ist ein tückisches Terrain, selbst für diejenigen, die mutig genug sind, es zu erklimmen. Wenn Beatriz dieses Wagnis eingehen würde, ganz allein, mit nichts als ihrer Kutte und den Baumwollpantoffeln, würde sie die nächste Nacht nicht überleben, so viel steht fest.
Ihre Mutter hat sie stets zur Geduld ermahnt, und auch wenn es nie Beatriz’ Stärke gewesen ist, sich in Geduld zu üben, weiß sie, dass genau das jetzt notwendig ist. Also lässt sie die Arme locker an ihren Seiten herabhängen und folgt Mutter Ellaria um eine Ecke, dann um eine weitere, bis die Vorsteherin schließlich vor einer hohen Holztür stehen bleibt und Beatriz mit einem abschätzigen Blick mustert, als wäre ihr der Geruch von etwas Verdorbenem in die Nase gestiegen. Diese Frau kann sie nicht leiden, das weiß Beatriz, und dennoch beschleicht sie das Gefühl, dass nicht sie selbst es ist, die diesen Blick hervorruft.
»Aufgrund des … besonderen Ranges, den dein Besucher innehat, stelle ich mein eigenes Arbeitszimmer für ein Gespräch zur Verfügung, werde jedoch in zehn Minuten zurückkehren, und keine Sekunde später.«
Beatriz nickt, nun vollends überzeugt, dass es sich entweder um Gisella oder Nicolo handelt. Immerhin ist Nicolo jetzt König von Cellaria und Gisella nimmt als seine Schwester nun ebenfalls eine höhere Stellung ein. Was nicht heißt, dass Mutter Ellaria den beiden mehr Achtung zollen würde als Beatriz.
Beatriz schiebt ihre Gedanken beiseite, stößt die Tür auf und tritt ein. Abrupt bleibt sie stehen und kneift die Augen zusammen, als könnte die Gestalt vor ihr sich allein durch ein Blinzeln in Luft auflösen.
Doch egal wie oft sie blinzelt, Nigellus ist immer noch da. Der Himmelsdeuter ihrer Mutter hat es sich auf Mutter Ellarias Stuhl gemütlich gemacht und beobachtet Beatriz über die zusammengelegten Fingerspitzen seiner erhobenen Hände hinweg. Da Beatriz’ Zelle fensterlos ist, hat sie bereits kurz nach ihrer Ankunft jedes Zeitgefühl verloren, aber jetzt kann sie sehen, dass es Nacht ist: Der Vollmond scheint durch das Fenster hinter Nigellus, die Sterne leuchten heller und kühner als sonst.
Es ist das erste Mal seit fünf Tagen, dass sie den Nachthimmel sieht, das erste Mal, dass sie wieder das Licht der Sterne über ihre Haut tanzen spürt. Ihr wird schwindelig und sie ballt die Hände zu Fäusten. Magie, denkt sie, obwohl sie es immer noch nicht so recht glauben kann, auch nachdem sie ihre besonderen Kräfte jetzt schon zweimal eingesetzt hat, um die Sterne zu Hilfe zu rufen, wenn auch versehentlich.
Nigellus entgeht nicht, dass sie ihre Finger so fest in die Handballen gräbt, dass ihre Knöchel weiß werden, aber er sagt nichts. Die Tür schließt sich hinter Beatriz und die beiden bleiben allein in dem Raum zurück. Einen Moment lang sehen sie sich nur an, keiner ergreift das Wort.
»Sophronia ist tot, nicht wahr?«, bricht Beatriz schließlich das Schweigen.
Nigellus antwortet nicht sofort. Nach einer gefühlten Ewigkeit nickt er.
»Königin Sophronia wurde vor fünf Tagen hingerichtet«, bestätigt er mit einer ausdruckslosen Stimme, die nichts von seinen Gedanken verrät. »Zusammen mit einem Großteil des Adels von Temarin. Eure Mutter hatte Soldaten an der Grenze aufmarschieren lassen und inmitten der entstandenen Unruhen sind sie bis zur Hauptstadt vorgedrungen und haben sie eingenommen. Da sie keinen Regenten vorfanden, der sich hätte ergeben können, hat die Kaiserin den Thron kurzerhand für sich beansprucht.«
Beatriz sinkt vor dem Schreibtisch auf einen Stuhl. Alles Leben scheint in diesem Moment aus ihr zu weichen. Sophronia ist tot. Damit hätte sie rechnen müssen, nichts anderes war zu erwarten gewesen. Hat ihre Mutter nicht immer gesagt, sie solle nie eine Frage stellen, auf die sie die Antwort nicht bereits kennt? Aber zu hören, dass ihre größte Angst bestätigt wird, raubt ihr jede Kraft. Von einem Moment auf den anderen fühlt es sich an, als sei von ihr nur noch ein Schatten übrig.
»Sophie ist tot«, wiederholt sie. Alles andere kümmert sie wenig, weder ihre Mutter noch deren Armee oder die neue Krone, die die Kaiserin ihrer beträchtlichen Sammlung hinzugefügt hat.
»Es ist pures Glück, dass Ihr und Daphne noch am Leben seid«, reißt Nigellus sie aus ihrer Erstarrung.
Sie sieht zu ihm auf und fragt sich, was er wohl tun würde, wenn sie sich über den Schreibtisch hinweg auf ihn stürzte. Doch bevor sie den Gedanken in die Tat umsetzen kann, fährt er bereits fort.
»Das ist kein Zufall, Beatriz. Die Rebellionen, die Verschwörungen, die toten Könige. Das Chaos.«
»Natürlich nicht«, erwidert Beatriz und hebt ihr Kinn. »Mutter hat uns dazu erzogen, Chaos zu stiften, Intrigen zu schmieden, das Feuer der Rebellion zu schüren.«
»Sie hat Euch zum Sterben erzogen«, korrigiert Nigellus sie.
Für einen Moment verschlägt es Beatriz den Atem, doch dann nickt sie. »Ja, das hat sie wohl«, stimmt sie ihm zu, denn es ergibt Sinn. »Sie wird furchtbar enttäuscht sein, dass sie nur eine von dreien erledigen konnte.«
Nigellus schüttelt den Kopf. »Die Kaiserin spielt auf Zeit. Sie hat siebzehn Jahre gewartet. Da kann sie sich auch noch ein bisschen länger in Geduld üben.«
Beatriz schluckt. »Warum erzählt Ihr mir das? Um mich zu verhöhnen? Ich bin an diesem elenden Ort eingesperrt. Ist das nicht Strafe genug?«
Nigellus wählt seine nächsten Worte sorgfältig. »Wisst Ihr, wie es mir gelungen ist, so lange am Leben zu bleiben, Beatriz?«, fragt er, wartet ihre Antwort aber gar nicht erst ab. »Ich habe niemanden unterschätzt. Und diesen Fehler werde ich auch bei Euch nicht machen.«
Beatriz lacht. »Ich bin zwar noch nicht tot, aber ich liege am Boden, dafür hat meine Mutter gesorgt.«
Beatriz spricht die Worte aus, ohne selbst daran zu glauben. Sie hat Pasquale versprochen, einen Ausweg zu finden, und genau das wird sie tun. Aber es ist klüger, Nigellus – und damit auch die Kaiserin – glauben zu lassen, sie würde sich geschlagen geben.
Zu ihrer Verwunderung schüttelt Nigellus den Kopf, ein schiefes Lächeln umspielt seine Lippen. »Ihr seid nicht besiegt, Beatriz. Ich denke, das wissen wir beide. Ihr wartet nur auf den richtigen Zeitpunkt, um zurückzuschlagen.« Beatriz schürzt die Lippen, streitet es aber nicht ab. »Ich würde Euch gerne helfen«, fügt er hinzu.
Beatriz denkt einen Moment lang nach. Sie traut Nigellus nicht, hat ihn nie gemocht, und ein Teil von ihr fühlt sich in seiner Gegenwart immer noch wie ein Kind, klein und ängstlich. Aber jetzt sitzt sie in einem tiefen Loch fest – und er bietet ihr ein Seil an. Sie hat nichts zu verlieren, wenn sie es ergreift.
»Warum?«, fragt sie ihn.
Nigellus beugt sich vor und stützt seine Ellbogen auf den Schreibtisch. »Wir haben die gleichen Augen, wie Ihr wisst«, sagt er. »Ich bin sicher, Ihr kennt die Gerüchte in Bessemia, dass ich es war, der Euch und Eure Schwestern gezeugt hat.«
Sollte in Bessemia tatsächlich dieses Gerücht umgehen, so ist es Beatriz nie zu Ohren gekommen. Aber er hat recht – seine Augen sind wie ihre, wie die von Daphne, wie die von Sophronia: reines, klares Silber. Wie bei allen sternenberührten Kindern, die auf die Welt gekommen sind, weil sich ihre Eltern die Geburt mit Sternenstaub herbeigewünscht hatten oder – was sehr viel seltener vorkam – weil ein Himmelsdeuter selbst einen Wunsch ausgesprochen und damit einen Stern vom Himmel geholt hatte. Als Beatriz nach Cellaria geschickt wurde, hat ihre Mutter ihr Augentropfen mitgegeben, um die Farbe ihrer Augen zu kaschieren, eine Farbe, die sie in einem Land, wo Sternenmagie als Sakrileg gilt, als Ketzerin brandmarken würde. Als sie zur Schwesternschaft geschickt wurde, durfte sie keine Besitztümer mitnehmen, nicht einmal die Tropfen, sodass ihre Augen nun wieder ihr natürliches Silber angenommen haben. Aber da sie inzwischen einen Wunsch ausgesprochen und damit einen Mann aus dem Gefängnis befreit hat, sind ihre sternensilbrigen Augen wohl ihr geringstes Problem.
Als hätte er ihre Gedanken gelesen, nickt Nigellus. »Wir sind von den Sternen berührt, Ihr und ich, man könnte sogar sagen, von den Sternen geschaffen. Eure Mutter hat sich Euch und Eure Schwestern gewünscht, und ich habe Sterne vom Himmel geholt, damit ihr Wunsch in Erfüllung geht. Ich nehme an, dass auch meine eigene Mutter Sternenstaub benutzt hat, um mich herbeizuwünschen. Leider starb sie, bevor ich sie fragen konnte.«
Eure Mutter hat sich Euch gewünscht. Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass Beatriz diese Worte hört, dieses Gerücht geht schon lange um – aber im Gegensatz zu Wünschen mit Sternenstaub, wie sie überall im Land üblich sind, bringen die Wünsche der Himmelsdeuter, mit denen Sterne vom Himmel geholt werden, eine Magie hervor, die mächtig genug ist, um Wunder zu bewirken. Wunder wie jenes, als ihre Mutter mit Drillingen schwanger wurde, obwohl ihr damals achtzigjähriger Ehemann noch nie ein Kind gezeugt hatte, ob ehelich oder nicht und egal wie viel Sternenstaub zum Einsatz gekommen war. Von Himmelsdeutern ausgesprochene Wünsche sind selten, allein schon, weil die Zahl der Sterne begrenzt ist; dennoch überrascht es Beatriz nicht sonderlich, dass ihre Mutter diese Grenze überschritten hat. Im Grunde genommen war es nicht einmal eine ihrer größeren Grenzüberschreitungen.
»Und wenn man sternenberührt ist«, fährt Nigellus fort, ohne sie aus den Augen zu lassen, »geht das manchmal mit einem Geschenk der Sterne einher.«
Beatriz zwingt sich zu einer ausdruckslosen Miene, die ihre Gedanken nicht verrät. Zweimal hat sie einen Wunsch an die Sterne gerichtet, zweimal sind diese Wünsche in Erfüllung gegangen und haben Sternenstaub hinterlassen. Nur einer von zehntausend Menschen kann mithilfe von Magie Sterne vom Himmel holen – Beatriz hätte nie gedacht, dass sie zu diesen Auserwählten gehören würde, doch jetzt ist sie sich sicher. Allerdings ist sie in Cellaria, wo das Wirken von Magie mit dem Tod bestraft wird, und Nigellus hat bereits zugegeben, dass Beatriz’ Mutter ihr genau das wünscht. Sie wird ihm nicht auch noch den Dolch in die Hand geben, den er dann gegen sie richten kann.
»Wenn alle silberäugig geborenen Kinder zu Himmelsdeutern heranwachsen würden, wäre die Welt ein verrückter Ort«, sagt sie nach einem Moment.
»Nicht alle«, entgegnet er und schüttelt den Kopf. »Nicht bei allen sternenberührten Kindern kommt es so weit. In den meisten schlummert das Talent, ohne dass es je geweckt werden würde. Das gilt auch für Eure beiden Schwestern. Aber in Euch schlummert es nicht.«
Als Beatriz immer noch keine Miene verzieht, mustert Nigellus sie mit hochgezogenen Augenbrauen. »Sagt mir …« Er lehnt sich in seinem Stuhl zurück und betrachtet sie aufmerksam. »Wie oft habt Ihr es schon getan?«
»Zweimal«, gibt sie zu. »Beide Male aus Versehen.«
»So ist es anfangs immer«, bestätigt er. »Die Magie kommt in Schüben, oft ausgelöst durch extreme Gefühlsausbrüche.«
Beatriz denkt an das erste Mal, als sie die Sterne gerufen hat, damals, als sie so sehr von Heimweh geplagt wurde, dass sie es nicht mehr aushielt. Und an das zweite Mal, als sie sich sehnlichst einen Kuss von Nicolo gewünscht hat. So schmerzlich es auch ist, sich das nun einzugestehen, angesichts seines Verrats – Beatriz weiß nur zu gut, dass sie auch damals von ihren Gefühlen überwältigt war. Sie war eine solche Närrin.
»Es spielt keine Rolle, welche Talente ich habe oder nicht.« Sie steht entschlossen auf. »Die anderen ahnen, was ich kann, deshalb sitze ich hier Nacht für Nacht in einem fensterlosen Raum fest. Es sei denn, Ihr habt eine Idee, wie Ihr mich hier rausbekommt …«
»Die habe ich in der Tat«, unterbricht er sie und neigt leicht den Kopf. »Wenn Ihr auf mein Angebot eingeht, werden wir morgen Abend von hier verschwinden. Schon in wenigen Tagen könntet Ihr wieder in Bessemia sein.«
Beatriz legt den Kopf schief und sieht ihn einen Moment lang nachdenklich an, während sie sein Angebot abwägt. Es ist zwar bedenkenswert, aber sie ahnt, dass sie ihn zu weiteren Zugeständnissen bewegen kann, wenn sie es richtig anstellt. »Nein.«
Nigellus schnaubt. »Ihr wisst doch gar nicht, was ich will.«
»Das spielt keine Rolle. Wenn wir hier ausbrechen, nur Ihr und ich, dann reicht mir das nicht. Wenn schon, dann müsst Ihr auch Pasquale befreien.«
Beatriz weiß nicht, ob sie Nigellus jemals überrascht gesehen hat, aber jetzt ist er es zweifellos. »Den Prinzen von Cellaria?«, fragt er und runzelt die Stirn.
»Meinen Ehemann«, bestätigt sie, denn obwohl die Ehe nie vollzogen wurde – und auch nie vollzogen werden wird –, haben sie sich bei und nach ihrer Hochzeit gegenseitig ein Versprechen gegeben. Und dieses Versprechen will Beatriz halten. »Er wird in der Bruderschaft auf der anderen Uferseite des Azina festgehalten, genau wie ich hier, und zu Unrecht des Verrats beschuldigt.«
Nigellus wirft ihr einen wissenden Blick zu. »Nach allem, was ich gehört habe, sind die Anschuldigungen durchaus gerechtfertigt.«
Beatriz presst die Zähne zusammen, leugnet es aber nicht. Ja, sie hatten sich verschworen, Pasquales wahnsinnig gewordenen Vater zu stürzen. Im Grunde genommen ist Verrat fast eine verharmlosende Umschreibung – sie haben auch einem weiteren Verräter zum Gefängnisausbruch verholfen und Beatriz hat mit dem Einsatz von Magie gegen die religiösen Gesetze Cellarias verstoßen. »Wie dem auch sei. Wenn Ihr uns beide befreit, können wir vielleicht über Eure Bedingungen sprechen.«
Nigellus zögert einen Moment, dann nickt er. »Nun gut. Ich werde Euch und Euren Prinzen raus aus Cellaria und in Sicherheit bringen.«
Nachdenklich betrachtet sie Nigellus und versucht, ihn einzuschätzen. Vergeblich. Nigellus ist undurchschaubar, und sie wäre eine Närrin, wenn sie nicht davon ausginge, dass er ihr stets zwei Schritte voraus ist – in einem Spiel, dessen Regeln sie nicht kennt. Sie stehen nicht auf derselben Seite, sie haben nicht dieselben Ziele.
Sie darf ihm nicht trauen. Und doch hat sie keine andere Wahl.
»Dann haben wir eine Abmachung.«
Daphne
Daphne wird morgen heiraten, und es gibt ungefähr tausend Dinge, die noch erledigt werden müssen. Die Hochzeit wurde verschoben, nachdem sie im Wald vor dem Schloss angeschossen worden war, aber jetzt ist ihre Wunde verheilt – nicht zuletzt dank der Himmelsdeuterin Aurelia und ihrer Sternenmagie –, und alle fiebern ihrer Hochzeit mit Bairre entgegen. Am meisten vielleicht sie selbst.
Gleich nach ihrer Rückkehr ins Schloss hat Daphne ihrer Mutter geschrieben und ihr von Bairres und Aurelias Enthüllungen berichtet, nicht jedoch davon, dass sie mit Beatriz und Sophronia über die Ferne eine Verbindung eingegangen ist, um Gedanken mit ihren Schwestern auszutauschen. Auch die quälende Vermutung, Sophronias Tod sowohl gehört als auch gespürt zu haben, hat sie der Kaiserin verschwiegen. Sie weiß, wie unlogisch das ist, aber solange sie nicht in Worte fasst, was sie gefühlt hat, wird es nicht vollends zur Realität.
Außerdem muss die Sitzordnung endgültig festgelegt werden, und es stehen letzte Ankleideproben an, ganz zu schweigen von den vielen Gästen aus ganz Friv, die gebührend empfangen werden müssen. Daphne hat einfach keine Zeit, um über ihre Schwester nachzudenken, die vielleicht oder vielleicht auch nicht tot ist.
Und doch schleicht sich Sophronia ständig in ihre Gedanken. Die Blumenfrau schlägt vor, noch ein paar Gänseblümchen in den Brautstrauß zu binden – Sophronias Lieblingsblumen –, ein Lord aus dem Hochland erzählt ihr eine Geistergeschichte, die Sophronia in Angst und Schrecken versetzt hätte, und ihre Zofe sucht die zierliche Opalhalskette heraus, die Daphne von Sophronia zu ihrem fünfzehnten Geburtstag geschenkt bekommen hat. Mindestens ein Dutzend Mal am Tag ertappt sich Daphne dabei, wie sie im Geiste einen Brief an ihre Schwester verfasst, bevor die Erinnerung an ihr letztes Gespräch über sie hereinbricht.
Und überhaupt: Wie soll sie denn wissen, ob Sophronia wirklich tot ist? Das hat Bairre zu ihr gesagt, als die Verbindung zu ihren Schwestern plötzlich abbrach und sie sich mit ihm und Aurelia in Aurelias Hütte wiederfand. Er bemühte sich so sehr, sie zu beruhigen, und sie ließ ihn gewähren, aber als sie Aurelias Blick begegnete, wusste sie, dass sie die Wahrheit genauso klar sehen konnte wie sie selbst.
Das Blut der Sterne und der Majestät wird vergossen. Sophronia, in deren Adern das Blut einer Kaiserin und das der Sterne floss, war tot, genau wie die Sterne es vorausgesagt hatten.
Aber daran darf Daphne jetzt nicht denken. Genauso wenig wie sie daran denken darf, dass Attentäter bereits dreimal versucht haben, sie zu töten. Genauso wenig wie sie an Bairre denken darf, der selbst viele Geheimnisse hat, einige von ihren kennt und sie trotzdem will. Sie darf nicht an Beatriz denken, die in Cellaria knietief in ihren eigenen Problemen steckt. Würde sie auch nur einen dieser Gedanken zulassen, wäre es um ihre Selbstbeherrschung geschehen. Stattdessen konzentriert sie sich auf den morgigen Tag und darauf, endlich das zu erreichen, wofür sie erzogen wurde und worüber sie die Kontrolle hat – den Kronprinzen von Friv zu heiraten.
»Ich habe noch nie eine Braut gesehen, die derartig durch den Wind ist«, bemerkt Cliona.
Sie hat Daphne mehr oder weniger zu einem Spaziergang durch die verschneiten Gärten von Schloss Eldevale gezwungen – Daphne wäre lieber drinnen geblieben, um jedes Detail des morgigen Tages durchzugehen und sorgenvoll auf eine Nachricht aus Temarin, Cellaria oder Bessemia zu warten. Es ist seltsam, bereits zu wissen, dass die eigene Schwester tot ist, aber noch nicht um sie trauern zu können.
»Nein?«, fragt Daphne und blickt ihre Begleiterin mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Ich habe noch nie eine Braut gesehen, die nicht beunruhigt war.«
Sie kann nicht umhin, einen Blick über die Schulter zu werfen. Hinter ihnen verfolgen sechs Wachen jeden ihrer Schritte. Das letzte Mal, als sie und Cliona in diesem Garten spazieren gingen, waren es zwei Wachen, und davor hat es überhaupt keine gegeben, aber nun, da die Hochzeit so kurz bevorsteht und jemand ganz offensichtlich fest entschlossen ist, Daphne zu töten, hat König Bartholomew Verstärkung für ihre Leibgarde angeordnet.
Daphne weiß, dass sie dafür dankbar sein sollte, aber die ständige Anwesenheit von Aufpassern geht ihr auf die Nerven. Außerdem hat Cliona nicht weniger Gründe, ihren Tod zu wollen, als jeder andere auch, und es wäre ihr ein Leichtes, Daphne einen Dolch zwischen die Rippen zu rammen, bevor auch nur eine der sechs Wachen eingreifen könnte – falls diese sich überhaupt die Mühe machen würden. Daphne geht davon aus, dass mindestens die Hälfte der Wachen in Wahrheit für Clionas Vater arbeitet, für Lord Panlington, den Anführer der Rebellen.
Dieser Gedanke müsste Daphne eigentlich beunruhigen, aber das tut er nicht. Ihre Feinde lauern überall, daher ist es sogar ein gewisser Trost, Cliona als diejenige zu erkennen, die sie ist: die Tochter des Rebellenanführers, genauso gefährlich und manipulativ wie sie selbst.
Vielleicht ist das der Grund, warum Daphne sie mag.
Außerdem weiß Daphne, dass die Rebellen sie nicht umbringen wollen – zumindest noch nicht. Nicht, solange sie Bairre auf ihrer Seite haben. Nicht, solange sie glauben, dass auch Daphne auf ihrer Seite steht.
»Mag sein, dass auch andere Bräute so kurz vor der Hochzeit flatternde Nerven bekommen«, räumt Cliona ein. »Aber sie sind nicht krank vor Sorge – und du bist blass wie ein Geist.«
»Daran ist das frivianische Wetter schuld«, entgegnet Daphne und blickt hinauf zum grauen Himmel. Jetzt, wo der Winter vollends seinen Siegeszug angetreten hat, ist dort nicht einmal mehr ein Hauch von Blau zu sehen. »Es ist schon so lange her, dass ich die Sonne auf meiner Haut gespürt habe – ich weiß gar nicht mehr, wie sie sich anfühlt.«
Clionas Lachen klingt leicht und unbekümmert, obwohl sie die Stimme senkt und Daphnes Arm drückt. »Nun ja, du wirst bald wieder nach Bessemia zurückkehren können.«
Daphne wirft ihr einen Seitenblick zu – wie leichtsinnig von Cliona, in Gegenwart der Wachen so freimütig zu sprechen. Aber Cliona ist nicht leichtsinnig. Und das wiederum bestätigt ihren Verdacht, dass die allermeisten der Wachen auf Clionas Seite sind.
»Gehe ich recht in der Annahme«, raunt Daphne und passt Tonfall und Lautstärke Clionas Bemerkung an, »dass es morgen doch keine Hochzeit geben wird?«
»Oh, je weniger du darüber weißt, Prinzessin, desto besser«, erwidert Cliona lächelnd. »Es wäre allerdings gut, wenn du dich ein wenig mehr wie die errötende Braut gäbest, die man morgen zu sehen erwartet. Wobei dir das nicht allzu schwerfallen dürfte, wenn man bedenkt, wie gut es zwischen dir und Bairre läuft.«
Bei Clionas Worten spürt Daphne tatsächlich, wie ihr die Röte in die Wangen steigt, aber sie redet sich ein, dass es nur der beißende frivianische Winterwind ist. Es hat nichts mit der Erinnerung an Bairres Lippen zu tun, die sanft über ihre streichen, oder mit der Art und Weise, wie er ihren Namen sagt, voller Respekt und mit einem Hauch von Angst in der Stimme.
In den letzten Tagen hat sich nie die Zeit dafür gefunden, über den Kuss oder irgendetwas anderes zu sprechen, zumal im Beisein der Wachen, in deren Gegenwart weder er noch sie ein solches Gespräch führen wollen.
Es überrascht Daphne, dass Cliona offenbar eine Veränderung in ihrem Verhalten bemerkt hat, und sie fragt sich mit wachsendem Entsetzen, ob Cliona bereits mit Bairre darüber gesprochen hat. Bairre unterstützt die Rebellen, er und Cliona haben sich sicher schon oft über sie unterhalten. Wahrscheinlich kann sie von Glück reden, wenn dieser Kuss das Brisanteste ist, was dabei zur Sprache kam.
»Ach, kein Grund, so finster dreinzuschauen.« Cliona verdreht die Augen. »Lächle einfach ein bisschen. Glaub mir, es wird dich nicht umbringen.«
Daphne verzieht den Mund zu einem sardonischen Lächeln. »Eine fragwürdige Wortwahl, Cliona. In Anbetracht der Umstände.«
Cliona zuckt mit den Schultern. »Oh, seit ich dich im Wald gesehen habe, habe ich Mitleid mit jedem, der es auf dein Leben abgesehen hat. Wer versucht, dich zu töten, dem kann ich nur raten, sich einen weniger riskanten Zeitvertreib zu suchen.«
»Entschuldige mal, wer von uns beiden hat denn einem Angreifer die Kehle aufgeschlitzt?«, entgegnet ihr Daphne.
»Ich sage ja nur, dass ich dich falsch eingeschätzt habe«, erwidert Cliona. »Ich hätte nicht gedacht, dass du auch nur eine Woche in Friv überleben würdest, aber du bist immer noch da und schlägst dich ganz gut.«
Es ist beinahe ein Kompliment – und löst zwiespältige Gefühle in Daphne aus. »Nun, wie du schon sagtest, ich werde bald weg sein.«
»Ja«, stimmt Cliona zu. »Und ich glaube, ich werde dich vermissen.«
Sie sagt die Worte leichthin, aber Daphne sieht ihr an, dass sie es ernst meint. Plötzlich ist da ein seltsames Ziehen in ihrer Brust, und ihr wird klar, dass auch sie Cliona vermissen wird. Sie hatte noch nie eine richtige Freundin, nur Schwestern.
Bevor Daphne etwas erwidern kann, stößt der Anführer ihrer Leibgarde einen Warnruf aus, woraufhin die Wachen ihre Waffen ziehen und auf eine vermummte Gestalt richten, die sich ihnen nähert. Daphne wird sofort abgeschirmt, kann aber einen kurzen Blick auf die Person erhaschen und erkennt auf einen Blick, wer es ist.
»Es ist der Prinz«, ruft sie, als Bairre auch schon seine Kapuze zurückschlägt und spätestens jetzt an seinem zerzausten dunkelbraunen Haar und seinen markanten Zügen zu erkennen ist. Die Wachen treten beiseite, und Bairre geht auf Daphne zu, den Blick unverwandt auf sie gerichtet, selbst während er Cliona kurz zunickt.
»Daphne«, sagt er, und etwas in seiner Stimme macht sie sofort nervös. »Da ist ein Brief für dich.«
Ihr Herz wird schwer. »Aus Temarin?«, fragt sie. »Geht es um Sophronia?«
Sie kann den Brief nicht öffnen, nicht die Worte lesen, die darin auf sie warten. Ihr Verstand weiß, dass ihre Schwester tot ist, aber es auch noch in elegant geschwungener Handschrift mit aufgesetzter Anteilnahme geschrieben zu sehen? Das erträgt sie nicht.
Bairre schüttelt den Kopf, doch die Falte auf seiner Stirn bleibt. »Von deiner Mutter«, sagt er, und das sollte sie eigentlich beruhigen, aber so wie er es sagt, weiß sie, dass er das Schreiben bereits gelesen hat. Und sie weiß, dass es viel schlimmer ist als befürchtet.
»Wo ist er?«, hört sie sich fragen.
»In deinem Zimmer«, antwortet er ihr mit einem vielsagenden Blick auf die Wachen. »Ich dachte, du willst ihn lieber in Ruhe lesen.«
Meine liebste Daphne,
schweren Herzens muss ich dir mitteilen, dass unsere liebe Sophronia von Rebellen in Temarin hingerichtet wurde. Aber dieses unsägliche Verbrechen ist bereits gerächt worden – ich habe Temarins Herrschaft übernommen und dafür gesorgt, dass jeder, der für diese abscheuliche Tat verantwortlich ist, mit dem Tod bestraft wird. Ich weiß, dass dir das wenig Trost spenden wird, doch mir wurde gesagt, dass deine Schwester nicht lange leiden musste und einen schnellen Tod gefunden hat.
Für eine Mutter gibt es keinen größeren Schmerz als den, ein Kind begraben zu müssen, und ich weiß, dass deine Trauer der meinen gleicht. Umso mehr zähle ich darauf, in dir und Beatriz Trost zu finden.
König Leopold ist es offenbar gelungen, aus dem Palast zu fliehen, bevor die Rebellen ihn zusammen mit Sophronia hinrichten konnten, aber seither gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Wenn du etwas von ihm hörst, lass es mich bitte wissen, denn ich bin sicher, dass er seinen Thron zurückhaben möchte.
Deine dich liebende Mama
Kaiserin Margaraux
Daphne liest den Brief dreimal und ist sich währenddessen nur allzu bewusst, dass die Blicke von Bairre und Cliona auf sie gerichtet sind. Beim ersten Mal nimmt sie die Nachricht einfach nur zur Kenntnis: Sophronia tot, von Rebellen hingerichtet, Temarin unter bessemianischer Herrschaft, die Rebellen, die ihre Schwester getötet haben, allesamt tot. Beim zweiten Mal sucht sie nach einem Hinweis darauf, dass es sich um eine verschlüsselte Nachricht handelt, findet jedoch nichts. Beim dritten Durchlesen richtet sie ihre Aufmerksamkeit auf das, was ihre Mutter ihr mit diesen Worten zu verstehen geben will.
Ich habe Temarins Herrschaft übernommen.
Nun ja, das war von Anfang an ihr Plan gewesen. Nur dass alles etwas schneller vonstattengegangen ist, als Daphne es für möglich gehalten hat. Allerdings hätte Sophronia die Armee ihrer Mutter in Temarin willkommen heißen sollen. Der Gedanke bereitet Daphne Magengrimmen, aber sie drängt ihn zurück und konzentriert sich auf den Brief.
Umso mehr zähle ich darauf, in dir und Beatriz Trost zu finden.
Da ist sich Daphne sicher, auch wenn sie bezweifelt, dass es ihrer Mutter dabei in erster Linie um Trost geht. Nein, ohne Sophronia werden Daphne und Beatriz sich umso mehr anstrengen müssen, um die Pläne der Kaiserin zu unterstützen. Daphne denkt an Beatriz, die im Palast von Vallon unter Hausarrest steht, wie sie zuletzt hörte, vor allem deshalb, weil sie sich wie Sophronia den Befehlen ihrer Mutter widersetzt hat. Falls ihre Mutter das beim Verfassen des Briefes noch gar nicht wusste, hat sie es inzwischen sicherlich erfahren, und das bedeutet, dass nun noch mehr Verantwortung auf Daphnes Schultern lastet. Sie wendet ihre Aufmerksamkeit dem nächsten Absatz zu, in dem die Kaiserin König Leopold erwähnt.
König Leopold ist es offenbar gelungen, aus dem Palast zu fliehen, bevor die Rebellen ihn zusammen mit Sophronia hinrichten konnten, aber seither gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihm.
Leopold ist also geflohen. Daphne hasst ihn dafür. Wie konnte er überleben, aber Sophronia nicht? Als die Schwestern das letzte Mal miteinander sprachen, hat Sophronia angekündigt, dass zwei ihrer Vertrauten zu Daphne kommen würden – Leopold und Violie. Doch in Anbetracht von Leopolds familiären Verbindungen zur königlichen Familie von Cellaria würden sie vermutlich eher bei Beatriz Schutz suchen als bei ihr. Vielleicht sollte sie das ihrer Mutter schreiben, die Frage ist nur wie, ohne ihr zugleich Sophronias letzte Worte zu verraten wie auch den Umstand, dass sie mithilfe von Sternenstaub Verbindung zueinander aufgenommen haben. Daphne bringt es nicht über sich, diesen besonderen Moment mit jemandem zu teilen.
In einem ist sie sich jedoch sicher: Ihre Mutter hat nicht die Absicht, Leopold den Thron wieder zu überlassen, sosehr sie auch das Gegenteil behaupten mag. Daphne entgeht nicht, dass sie Leopolds Brüder mit keinem Wort erwähnt hat. Wenn der König tot ist, müsste der Thron eigentlich an einen von ihnen übergehen, aber Daphne weiß, dass ihre Mutter das nicht zulassen wird.
Sie sieht von dem Brief auf und blickt zwischen Bairre und Cliona hin und her.
»Meine Schwester ist tot«, sagt sie.
Es ist nicht das erste Mal, dass sie diese Worte laut ausspricht. Sie hat sie zu Bairre und Aurelia gesagt, gleich nach ihrem Gespräch mit Sophronia und Beatriz, mit tränenerstickter Stimme. Diesmal gibt sie die Worte ganz ruhig wieder, obwohl sie das Gefühl hat, als schnürten sie ihr die Kehle zu.
Bairre ist nicht überrascht, wohl aber Cliona. Sie runzelt die Stirn und macht einen Schritt auf Daphne zu, als wolle sie sie umarmen, hält aber inne, als Daphne abwehrend die Hand hebt. Sie will im Moment nicht berührt werden, will nicht getröstet werden. Wenn jemand sie berührt, wird sie zusammenbrechen, und das darf nicht passieren. Also richtet sie sich auf und zerknüllt den Brief.
»Von Rebellen hingerichtet«, fügt sie hinzu. Ein Hauch von Bitterkeit muss sich in ihre Stimme eingeschlichen haben, denn Cliona weicht einen Schritt zurück.
Dieses Detail war neu für Daphne, und es trifft sie umso tiefer, weil sie selbst mit den Rebellen konspiriert. Ihr ist klar, dass Cliona, Bairre und die anderen frivianischen Rebellen nichts mit Sophronias Tod zu tun haben, aber die aufflammende Wut tut ihr merkwürdigerweise gut. Es ist das einzig gute Gefühl, das sie gerade hat, also hält sie daran fest.
»Von temarinischen Rebellen«, betont Bairre, wie immer um Tatsachen bemüht, aber Daphne will ausnahmsweise keine logischen Argumente hören.
»Sophronia war sehr leichtgläubig«, sagt sie und strafft die Schultern. »Sie hat Menschen vertraut, die ihr Vertrauen nicht verdienten.«
Sie weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber als sie die Worte laut ausspricht, glaubt sie daran. Es ergibt einen Sinn, ist etwas Greifbares, an das sie sich klammern und auf das sie die Schuld schieben kann. Sophronia hat den falschen Leuten vertraut. Diese Leute sind jetzt tot. Ihre Mutter hatte recht – die Erkenntnis ist nur ein schwacher Trost, aber immerhin.
»Daphne«, wagt Bairre sich behutsam vor.
»Dein Verlust tut mir leid«, versichert Cliona. »Aber die temarinischen Aufrührer waren unbesonnene Narren, die keinen anderen Plan verfolgten, als diejenigen aufs Schafott zu bringen, die sie für die Elite hielten. Du weißt, dass das nicht vergleichbar ist«, fügt sie hinzu und neigt den Kopf zur Seite. »Außerdem ist es jetzt ein bisschen spät, um einen Rückzieher zu machen.« Von mitfühlender Zuneigung ist nun nichts mehr zu spüren, Cliona ist so scharfzüngig wie immer. Daphne ist ihr dankbar dafür.
»Ich denke, über diesen Punkt sind wir längst hinaus«, erwidert sie. »Aber eines kann ich dir versichern: Ich bin nicht wie meine Schwester.« Daphne merkt, wie ihre Hände zittern und ihr die Kehle eng wird. Sie ist kurz davor, die Fassung zu verlieren, aber das darf nicht passieren, nicht vor aller Augen. Sie würde sterben vor Scham.
Cliona sieht sie einen Moment lang an und nickt knapp. »Du wirst Zeit brauchen, um zu trauern«, sagt sie. »Bairre und ich werden dem König die Nachricht überbringen und ihm mitteilen, dass du dich für das Abendessen entschuldigen lässt.«
Daphne nickt nur. Sie weiß nicht, ob ihre Stimme ihr gehorchen würde, und wenn doch, was dabei herauskäme. Cliona verlässt leise das Zimmer, aber Bairre bleibt noch einen Moment da und sieht Daphne unverwandt an.
»Es geht mir gut«, stößt sie hervor. »Die Nachricht kommt ja nicht gerade überraschend. Ich wusste, dass sie … Ich wusste, dass sie … nicht mehr da ist.«
Bairre schüttelt den Kopf. »Ich wusste auch, dass Cillian im Sterben lag«, sagt er, und Daphne denkt an ihre erste Begegnung mit Bairre, nur wenige Tage nachdem er seinen Bruder verloren hatte. »Ich wusste es seit Langem. Aber es hat nicht weniger wehgetan, als er dann tatsächlich von uns gegangen ist.«
Daphne presst ihre Lippen zu einer dünnen Linie zusammen. Einerseits sehnt sie sich danach, die Distanz zwischen ihnen zu überwinden und sich in seine Arme zu werfen. Dann würde er sie halten, sie trösten. Andererseits würde sie damit Schwäche zeigen und das könnte sie nicht ertragen.
»Danke«, erwidert sie stattdessen. »Ich glaube nicht, dass dein Vater die Hochzeit noch einmal verschieben will, wo doch schon so viele Hochländer eingetroffen sind. Richte ihm bitte aus, dass es mir morgen wieder gut genug gehen wird und die Hochzeit stattfinden kann.«
Einen Moment lang scheint Bairre noch etwas sagen zu wollen, überlegt es sich dann jedoch anders. Er nickt ihr noch einmal zu, bevor er sich zum Gehen wendet. Er geht durch die Tür, durch die auch Cliona verschwunden ist, und zieht sie fest hinter sich zu.
Aber auch nachdem er gegangen und Daphne allein in ihrem Zimmer zurückgeblieben ist, kann sie nicht weinen. Stattdessen liegt sie auf dem Bett, starrt an die Decke und hört im Geiste immer wieder Sophronias letzte Worte.
Ich liebe euch bis zu den Sternen.
Violie
In ihrer Zeit im temarinischen Palast hat sich Violie an einen gewissen Komfort gewöhnt, und das sogar als Zofe: Ihr Bett war weich und groß genug, um sich bequem darauf auszustrecken, ihre Kleidung war immer frisch gewaschen, jeden zweiten Tag nahm sie ein Bad. Nach fünf Tagen in den Wäldern von Amivel weiß sie, dass sie kleine Annehmlichkeiten wie diese nie wieder als selbstverständlich ansehen wird.
Immerhin kommt sie besser zurecht als König Leopold, der, so vermutet Violie, noch nie zuvor in seinem Leben auch nur die kleinste Unbequemlichkeit erdulden musste.
Das ist unfair ihm gegenüber, gesteht sie sich sofort ein. Leopold hat einiges durchlitten, als Ansel ihn nach der Erstürmung des Palasts als Gefangenen festgehalten hat. Und als er das erste Mal wie aus dem Nichts an dem zwischen Violie und Sophronia verabredeten Treffpunkt in der Höhle tief in den Wäldern von Amivel aufgetaucht ist, waren seine Handgelenke von den harten Fesseln wund gescheuert. Violie hat einen Stoffstreifen ihres Kleides mit sauberem Wasser aus dem Merin, einem nahe gelegenen Fluss, benetzt und seine Wunden versorgt, während er ihr erzählte, was passiert war.
Sophronia hatte sie belogen – sie beide. Sie hatte nie die Absicht gehabt, sich selbst in Sicherheit zu bringen, sie wollte nur Leopold retten. Violie schaffte es nicht einmal, richtig wütend auf sie zu sein, immerhin hatte sie selbst Sophronia öfter belogen als ihr die Wahrheit gesagt. Sie wünschte nur, Sophronia wäre dieses eine Mal in ihrem Leben egoistisch gewesen, aber das war so, als würde man sich wünschen, dass die Sterne nicht leuchten.
Violie beobachtet Leopold, der neben ihr auf einem Heuballen schläft, in einer kleinen, leeren Scheune neben einem verlassen wirkenden Haus – einem ehemaligen Bauernhof, wie sie vermutet. Jetzt deutet nichts mehr darauf hin, dass es hier Leben gibt, weder von Tieren noch von Menschen.
Aber zumindest steht die Scheune noch, und selbst die spärlichen Heuballen sind ein bequemeres Lager als alles, was sie beide in den letzten Tagen zur Verfügung hatten.
Sophronia war so verliebt in Leopold, geht es Violie durch den Kopf, während sie seinen entspannten Gesichtsausdruck betrachtet. Sein bronzenes Haar ist zerzaust und schmutziger als je zuvor, er hat dunkle Ringe unter den Augen und sein Mund ist ganz leicht geöffnet. Er hat ihr so viel bedeutet, dass sie ihr eigenes Leben für seines gegeben hat.
Es ist nicht fair von Violie, ihm das zu verübeln, aber sie tut es trotzdem. Und jetzt hat sie einen nutzlosen König am Hals – einen nutzlosen König, auf den sogar ein Kopfgeld ausgesetzt ist und den viele Leute lieber eigenhändig umbringen würden, als ihn auszuliefern und die Belohnung einzufordern.
Nicht zum ersten Mal erwägt Violie, ihn zurückzulassen. Sie könnte sich davonschleichen, bevor er aufwacht, und er würde sie nie aufspüren – vorausgesetzt, er würde sich überhaupt die Mühe machen, nach ihr zu suchen. Sie wäre frei von ihm, frei, zu ihrer Mutter zurückzukehren, frei von jeglicher Verantwortung gegenüber anderen.
Versprich mir, dass du dich um Leopold kümmerst, egal was passiert.
Sophronias Stimme drängt sich in ihre Gedanken und erinnert Violie an ein Versprechen, von dem sie nie gedacht hätte, dass sie es jemals würde halten müssen, jedenfalls nicht auf diese Weise. Aber sie hat dieses Versprechen nun einmal gegeben.
Langsam schlägt Leopold die Augen auf und runzelt wie jeden Morgen die Stirn, als er die fremde Umgebung wahrnimmt. Dann sucht er ihren Blick, und Violie kann ihm ansehen, wie die vergangenen sechs Tage in sein Bewusstsein zurückkehren. Sie beobachtet, wie sich seine Augen weiten, sein Kiefer anspannt, sein Herz bricht. Wie jeden Morgen, wenn er sich daran erinnert, dass Sophronia tot ist.
Violie muss sich nicht jedes Mal neu erinnern. In ihren Albträumen sieht sie es immer wieder vor sich, sieht, wie Sophronia, blass und sichtlich mitgenommen von den Tagen ihrer Gefangenschaft, die Stufen zum Schafott hinaufgeführt wird, sieht, wie der Scharfrichter ihren Kopf auf den hölzernen Block drückt, der blutig ist von denen, die vor ihr hingerichtet wurden, sieht, wie die silberne Klinge der Guillotine herabsaust und Sophronias Kopf von ihrem Körper trennt, während die Menge um Violie und Leopold herum in Jubel ausbricht.
Sophronia hat nicht einmal geschrien. Sie hat nicht geweint und nicht um ihr Leben gebettelt. In diesem Moment schien sie bereits meilenweit weg zu sein, und das, denkt Violie, war wohl die einzige Gnade, die die Sterne ihr gewährt haben.
Nein, Violie vergisst nie, nicht einmal im Schlaf.
»Wir können es heute bis zum Alder-Gebirge schaffen«, verkündet sie, obwohl sie sich denken kann, dass Leopold das selbst weiß. Sie muss irgendetwas sagen, um die unangenehme Stille zu beenden, die sie so oft umgibt. Letzte Woche waren sie noch Fremde – als Violie Sophronias Zofe war, hat Leopold sie vermutlich keines Blickes gewürdigt. Jetzt haben sie nur noch einander, sind durch Sophronias letzte Tat miteinander verbunden.
Leopold nickt, sagt aber kein Wort, sodass Violie sich gezwungen sieht weiterzusprechen, um das Schweigen zu brechen. »Nahe der Küste gibt es eine beliebte Handelsroute«, fährt sie fort. »Wir kommen besser durch, wenn wir diesen Weg und nicht den über die Berge nehmen. Bevor wir aufbrechen, sollten wir uns allerdings noch in der Hütte umsehen. Ich vermute, es war schon lange niemand mehr hier, aber vielleicht ist noch Proviant da oder etwas, das wir verkaufen können …«
Leopolds entsetzter Gesichtsausdruck lässt sie innehalten.
»Du willst, dass ich mein eigenes Volk bestehle?«, fragt er.
Violie knirscht mit den Zähnen. »Es ist nicht Euer Volk, zumindest nicht im Moment«, stellt sie klar. »Und wenn Ihr im Alder-Gebirge umkommt, werdet Ihr auch in Zukunft nie wieder über Temarin herrschen.«
»Das ist mir egal, ich kann doch nicht einfach …«
»Ich habe Sophronia versprochen, dass ich Euch beschütze«, unterbricht sie ihn. »Soll ihr Opfer umsonst gewesen sein, nur weil Ihr an Prinzipien festhaltet, die, mit Verlaub, im Moment völlig wertlos sind?«
Es ist ein Tiefschlag, aber er sitzt, wie sie an Leopolds zusammengepressten Zähnen erkennt. In den letzten Tagen hat Violie gelernt, dass die Erwähnung von Sophronia ein todsicheres Mittel ist, um ihn zum Schweigen zu bringen, auch wenn sie dadurch selbst jedes Mal ein wenig aus der Spur gerät.
Sie verspürt den Drang, sich zu entschuldigen, doch noch bevor sie das tun kann, lenkt ein Geräusch außerhalb der Scheune ihre Aufmerksamkeit auf sich – Schritte.
Violie packt sofort den Dolch, den sie immer griffbereit hat – diesmal steckt er in dem Heuballen direkt neben ihrem Schlafplatz. Auf Zehenspitzen schleicht sie zum Scheunentor, von wo leises Stimmengemurmel an ihr Ohr dringt, Worte in … Cellarisch?
Sie beherrscht die Sprache nicht so gut wie das Bessemianische oder das Temarinische, aber sie erkennt den Klang wieder.
Stirnrunzelnd blickt sie zu Leopold, der es offenbar ebenfalls gehört hat, denn er sieht sie verwirrt an. Sie befinden sich zwar in der Nähe des Alder-Gebirges, das die südliche Grenze zwischen Temarin und Cellaria markiert, aber abgesehen von Händlern gibt es hier nicht viele Reisende, und sie befinden sich weit abseits der großen Straßen, die üblicherweise von Händlern frequentiert werden.
Die Schritte und Stimmen kommen näher. Violie drückt sich an die Wand neben der Tür, während Leopold hinter einem Heuballen in Deckung geht, einen großen Stock in der Hand, den er als behelfsmäßige Waffe bei sich führt.
Die Tür öffnet sich knarrend, und zwei Männer treten ein, einer mittleren Alters, der andere etwa in Violies und Leopolds Alter. Beide sehen ziemlich mitgenommen aus, doch Violie entgeht nicht, dass ihre Kleidung zwar verschmutzt, aber von feiner Machart ist.
Es spielt keine Rolle, wer sie sind, denkt Violie. Jeder in Temarin ist auf der Suche nach Leopold, dem geflohenen König, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Wenn diese Leute herausfinden, wer er ist, sind Violie und er so gut wie tot. Sie umklammert ihren Dolch fester und macht sich zum Angriff bereit, doch Leopolds Stimme lässt sie erstarren.
»Lord Savelle?«, fragt er und richtet sich auf.
Der ältere Mann dreht sich zu Leopold und blinzelt ein paarmal, als könnte er seinen Augen nicht trauen. »Eure … Eure Majestät?«, stammelt er. »Das kann doch wohl nicht … König Leopold?«, fragt er, als fürchte er, das Trugbild vor seinen Augen könne sich allein beim Klang von Leopolds Namen in Luft auflösen.
Leopold lässt den Stock fallen und schüttelt den Kopf, wie um seine Verwunderung loszuwerden. »Ja, ich bin es«, bestätigt er. »Ich dachte, Ihr wärt in einem cellarischen Gefängnis oder bereits tot.«
»Und ich dachte, Ihr wärt in Eurem Palast«, erwidert Lord Savelle und mustert Leopold mit gerunzelter Stirn. »Und auch … sauberer.«
»Kurz nachdem wir die Nachricht von Eurer Gefangenschaft erhielten, gab es einen Putsch – wir konnten gerade noch aus dem Palast entkommen. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Cellaria, um bei meinem Cousin Zuflucht zu suchen.«
Der jüngere Mann schüttelt den Kopf. »Pasquale und Beatriz wurden wegen Verrats verhaftet«, berichtet er. »Auch wir konnten gerade noch entkommen.«
»Bei allen Sternen«, stößt Violie hervor und blickt zu Leopold, der sich räuspert.
»Lord Savelle, das ist …«
»Eine Vorstellung ist nicht nötig, ich erkenne den bessemianischen Akzent«, sagt Lord Savelle und bedenkt sie mit einem kleinen Lächeln. »Königin Sophronia, nehme ich an. Eure Schwester hat mir unter großen Opfern das Leben gerettet und dafür bin ich ihr ewig dankbar.«
Violies Herz wird schwer. Sie weiß, dass Sophronia und sie sich ähnlich sehen, sie weiß, dass dies ein Grund war, warum die Kaiserin sie in ihre Dienste genommen hat, aber jetzt dreht sich ihr bei dem Gedanken daran der Magen um.
»Die Töchter dieser Familie scheinen einiges gemeinsam zu haben«, sagt sie mit einer Grimasse. »Ich fürchte, Königin Sophronia ist der Belagerung des Palastes nicht so glimpflich entkommen wie wir. Ich war ihre Zofe, Violie.«
»Königin Sophronia ist auch gefangen?«, fragt der jüngere Mann auf Temarinisch, allerdings mit einem deutlich hörbaren cellarischen Akzent. Er sieht gut aus, ganz der Sohn aus adligem Hause – ein junger Mann mit weichen Gesichtszügen und einem freundlichen Wesen.
Violie und Leopold tauschen einen bedeutungsschweren Blick aus.
»Nein«, bringt Leopold nach einem Moment hervor. »Nein, sie ist hingerichtet worden.«
Darüber haben Violie und er bisher noch kein einziges Mal gesprochen, nicht seit sie nach Kavelle zurückgeeilt sind, nachdem sie erfahren hatten, dass Sophronia sie bezüglich ihrer Pläne belogen hatte.
Lord Savelles Augen und die seines Begleiters weiten sich. »Das muss ein Irrtum sein«, stößt Lord Savelle hervor.
Violie schluckt. Wieder sieht sie vor sich, wie die Klinge herabsaust und Sophronias blonder Kopf von ihrem Körper wegrollt. Da war so viel Blut.
»Nein, leider nicht«, sagt sie zu Savelle, bevor sie sich dem jungen Mann zuwendet. »Und wer seid Ihr?«
»Ambrose«, antwortet er und stammelt: »Ich bin … ich war … Pasquale und ich sind … Freunde.«
»Er hat mir geholfen, aus Cellaria zu entkommen«, erklärt Lord Savelle. »Prinzessin Beatriz hat mich mithilfe von Magie aus dem Gefängnis befreit und ich habe Ambrose und Prinz Pasquale am Hafen getroffen. Wir waren mit unserem Boot schon ein gutes Stück aufs Meer hinausgesegelt, als wir sahen, wie die Wachen kamen und Prinz Pasquale in Gewahrsam nahmen.«
Violie wirft Leopold einen Blick zu. »Wir brauchen also einen anderen Plan«, stellt sie fest.
»Und wir ebenso«, erwidert Lord Savelle. »Wir waren auf dem Weg zu Euch, aber ich nehme an, Ihr habt im Augenblick keine Truppen, die in Cellaria einmarschieren könnten«, fügt er hinzu.
»Hat er nicht«, antwortet Violie für Leopold. »Aber die Kaiserin von Bessemia schon.«
Lord Savelle runzelt die Stirn und schaut zwischen Leopold und Violie hin und her. »Was hat denn die Mutter von Prinzessin Beatriz mit der Sache zu tun?«
»Das ist eine ziemlich lange Geschichte«, antwortet Violie. »Und bevor ich sie erzähle, könnte ich etwas zu essen vertragen.«
Ambrose hält einen Beutel hoch. »Wir haben mit unseren letzten Münzen ein wenig Proviant gekauft«, sagt er. »Ihr könnt gerne etwas davon haben.«
»Oh, wir können doch nicht …«, beginnt Leopold, aber Violie ist zu hungrig für Höflichkeiten.
»Danke«, sagt sie.
Bei einem Frühstück mit Brot und Käse am Küchentisch des verlassenen Bauernhauses erzählt Violie den Männern alles, was sie ihnen anzuvertrauen wagt – dass die Prinzessinnen von Bessemia als Spioninnen ausgebildet wurden, damit ihre Mutter ihrem erklärten Ziel, den ganzen Kontinent zu erobern, ein Stück näher kommen konnte. Wie Violie vor zwei Jahren rekrutiert worden ist, um Sophronia zu überwachen, weil die Kaiserin sie für zu schwach hielt, um ihren Plan rücksichtslos in die Tat umzusetzen. Wie Sophronia sich dann tatsächlich gegen ihre Mutter gestellt und wie sich die Kaiserin mit Leopolds Mutter Eugenia verbündet hat, um Leopold und Sophronia zu stürzen und beide hinrichten zu lassen.
»Ich habe versucht, Sophronia zur Flucht zu verhelfen, aber sie hat sich geweigert, ohne Leopold zu gehen«, erklärt Violie, während sie den letzten Rest Brot und Käse teilen. »Der Plan war, dass sie einen Wunsch, den ihre Mutter ihr und ihren Schwestern mitgegeben hatte, dazu nutzen sollte, um sich und Leopold zu mir in eine Höhle weit weg vom Palast zu bringen.«
»Aber sie wusste die ganze Zeit, dass der Wunsch nur stark genug sein würde, um einen von uns zu retten«, beendet Leopold den Bericht. »Und ehe ich sie daran hindern konnte, nutzte sie ihn für mich und nicht für sich selbst.«
»Der Wunsch … war er in einen Diamantarmreif gefasst?«, fragt Lord Savelle. Leopold und Violie nicken. »Prinzessin Beatriz hat ihren benutzt, um mich zu retten.«
»Wir können also nicht auf den Schutz Cellarias zählen«, fasst Leopold zusammen. »Wir können nicht in Temarin bleiben und auch Bessemia kann man nicht trauen. Vielleicht Friv? Sophronias Schwester Daphne könnte uns Hilfe gewähren …«
Violie verzieht keine Miene, aber alles, was sie über Prinzessin Daphne weiß, lässt sie vermuten, dass von ihr wohl kaum Hilfe gegen die Kaiserin zu erwarten ist. Leopold hat natürlich recht, er muss jede Chance nutzen, um irgendwo Schutz zu finden – doch für Violie selbst gilt das nicht.
»Ihr drei solltet euch auf den Weg nach Friv machen«, schlägt sie vor und fährt mit dem Finger über den Holztisch, um auch die letzten Krümel zu erwischen – wer weiß, wann sie ihre nächste Mahlzeit bekommt. »Ich werde zu Beatriz nach Cellaria weiterreisen.«
Die drei starren sie verwundert an, aber für Violie ist es ein perfekter Plan. Indem sie Leopold der Obhut von Lord Savelle anvertraut, muss sie nicht mehr für ihn sorgen, und ihre Schuld gegenüber Sophronia ist zur Hälfte getilgt. Wenn sie auch Beatriz retten könnte, so Violies Überlegung, wären sie und Sophronia sogar quitt.
Lord Savelle bricht als Erster das Schweigen und räuspert sich. »Als wir in Temarin anlegten, hörten wir unter den Matrosen das Gerücht, Prinzessin Beatriz und Prinz Pasquale seien zu einer Schwesternschaft und einer Bruderschaft ins Alder-Gebirge gebracht worden«, sagt er. »Wir hatten gehofft, zuerst die Rückendeckung der Temariner zu gewinnen, bevor wir einen Befreiungsversuch unternehmen. Denn ohne die Unterstützung von Soldaten ist dieses Unternehmen … nun ja …«
»So gut wie ein Todesurteil«, beendet Leopold den Satz für ihn. »In den unwegsamen Bergen kommen jedes Jahr mindestens ein Dutzend Menschen ums Leben. Und die Schwestern- und Bruderschaften dort sind praktisch Gefängnisse. Man kann nicht einfach hineinspazieren und sich dann wieder verabschieden.«
»Ich komme mit«, mischt Ambrose sich zu Violies Überraschung ein, und als sie seinem festen Blick begegnet, weiß sie, dass er sich nicht umstimmen lassen wird. Sie nickt.
»Nichts für ungut, Ambrose, aber das allein ist keine große Beruhigung«, wendet Leopold ein.
Ambrose zuckt mit den Schultern. »Ich hätte sofort kehrtgemacht und sie geholt, als uns das Gerücht zu Ohren kam, aber ich musste erst Lord Savelle in Sicherheit bringen, wie ich es versprochen hatte. Violie hat recht – Ihr beide solltet nach Friv weiterreisen und wir werden nach Cellaria zurückkehren.«
»Um dort was zu tun?«, fragt Leopold.
Violie blickt Ambrose an. »Das weiß ich nicht, aber bis dahin haben wir eine Reise von mehreren Tagen vor uns. Zeit genug, um es unterwegs herauszufinden.«
Leopold betrachtet Violie mit gerunzelter Stirn. Nach einer Weile nickt er knapp. »Gut, ich komme auch mit.«
Violie schnaubt. »Das kann doch nicht Euer Ernst sein.«
»Ich meine es genauso ernst wie du«, erwidert er. »Du bist nicht die Einzige, die eine Schuld wiedergutzumachen hat.«
Tief in ihrem Inneren weiß Violie, dass er recht hat, dass sie nicht die Einzige ist, die von Schuldgefühlen geplagt und in ihren Träumen von Sophronias Tod heimgesucht wird. Trotz aller Fehler, die Leopold gemacht hat – er hat sie von Herzen geliebt.
»Ihr habt mehr als eine Schuld wiedergutzumachen«, entgegnet sie, um ihr Mitgefühl im Keim zu ersticken. »Meint Ihr nicht, dass es besser wäre, sie in Friv zu begleichen?«
Leopold hält ihrem Blick stand, aber anders als erwartet weist er ihren Einwand nicht geradeheraus zurück. Stattdessen seufzt er. »Nein. Ich glaube nicht. Sophronia wollte, dass wir nach Cellaria zu Beatriz und Pasquale gehen. Sie hätte sich von der derzeitigen Lage nicht davon abhalten lassen und das werde auch ich nicht tun.« Er wendet sich an Lord Savelle, der ihn gedankenverloren betrachtet. »Könnt Ihr allein nach Friv weiterreisen?«
»Keiner sucht nach mir. Wenn ich allein unterwegs bin, werde ich weniger auffallen, allerdings weiß ich nicht, an wen ich mich in Friv wenden soll. Ich habe eine entfernte Cousine auf den Silvan-Inseln … In Altia«, fügt Lord Savelle hinzu und meint damit eine der kleineren Inseln. »Ich werde dort untertauchen, und wenn jemand von Euch Hilfe oder eine Unterkunft braucht, kann er jederzeit zu mir kommen.«
»Mit welchem Geld?«, fragt Violie. »Ich dachte, Ihr hättet den letzten Aster ausgegeben.«
Lord Savelle lächelt vage. »Ich bin nicht so alt, dass ich nicht für eine Überfahrt arbeiten kann, meine Liebe«, erklärt er. »Ich schrubbe das Schiffsdeck oder nehme Fische aus, wenn es sein muss.«
»Hier …« Leopold kramt in seiner Jacke und holt eine juwelenbesetzte Anstecknadel hervor – jene, die er in der Nacht der Belagerung trug. Sie gehört zu den wenigen Dingen, die er noch besitzt, neben seinem Siegelring, den diamantenen Manschettenknöpfen und seinem Samtmantel mit der Rubinschnalle. Die Gegenstände sind wertvoll und würden ihnen ein Jahr oder länger genug zu essen sichern, aber sie in Temarin zu verkaufen, ist zu riskant. Lord Savelle hat allerdings recht – er wird nicht gesucht, und nach den Strapazen der Reise, die er hinter sich hat, käme niemand auf die Idee, ihn für einen Adeligen zu halten. Alle werden annehmen, dass er die Anstecknadel gestohlen hat und ihn wahrscheinlich sogar noch dafür loben.
Lord Savelle nimmt die Nadel und steckt sie ein. »Und ihr drei?«, fragt er.
»Wenn Ihr für Eure Mahlzeiten arbeiten könnt, können wir das auch«, antwortet Leopold achselzuckend.
»Auf dem Weg hierher haben wir in einem Gasthaus am Rande der Berge haltgemacht«, berichtet Ambrose. »Wir mussten Geschirr waschen und Ställe ausmisten und bekamen dafür eine Mahlzeit und ein Bett.«
»Klingt gut«, sagt Leopold und Violie kann sich ein Schnauben nicht verkneifen. Sie bezweifelt, dass Leopold überhaupt weiß, was es heißt, einen Stall auszumisten. Er würde auf dieser Reise nur Ballast sein. Er würde sie nur aufhalten und sich wahrscheinlich die ganze Zeit beschweren. Sie öffnet den Mund, um erneut Einwände vorzubringen, schließt ihn aber sofort wieder.
Sie hat Sophronia versprochen, ihn zu beschützen. Wenn er länger in Temarin bei Lord Savelle bleibt, wird das nicht möglich sein, nicht wenn das ganze Land nach ihm sucht. Cellaria ist die sicherste Lösung.
»Dann sollten wir nicht herumtrödeln.« Sie stößt sich vom Tisch ab und steht auf. »Wir hatten Glück, dass in der Hütte niemand war, aber ich möchte nicht riskieren, jemandem über den Weg zu laufen – ich bezweifle, dass andere Wegbekanntschaften sich als so freundlich erweisen werden wie Ihr beide.«
Beatriz
Beatriz sitzt im Schneidersitz auf ihrer Pritsche, den Rock ihres langen grauen Kleides um sich herum ausgebreitet, die Augen geschlossen. Es blieb nicht viel Zeit, um alles durchzugehen, was sie über diese neue Kraft wissen muss, die in ihr erwacht ist, aber Nigellus wurde nicht müde zu betonen, wie wichtig Konzentration und Geduld sind – und weder das eine noch das andere zählte je zu Beatriz’ Stärken.
Aber wenn sie ganz still dasitzt und die Augen geschlossen hält, wird sie Nigellus’ Signal wohl nicht verpassen. Mit einer Hand umklammert sie das Fläschchen mit Sternenstaub, das er ihr vor seiner Abreise dagelassen hat. Das Glas ist warm in ihren Fingern, da sie es seit dem gestrigen Tag kaum weggelegt hat.
Jeden Moment wird Nigellus ihr nun das Zeichen geben. Wenn er das tut, muss sie bereit sein.
Jeden Moment.
Vielleicht schon in der nächsten Sekunde.
Sie öffnet die Augen gerade so weit, dass sie sich in ihrer Zelle umschauen kann. Was, wenn sie es bereits verpasst hat? Vielleicht war es zu leise und durch die dicken Steinwände nicht zu hören. Vielleicht …
Bevor sie den Gedanken zu Ende führen kann, donnert es so laut und so nah, dass der Wasserkrug auf ihrem Tisch über die Kante kippt und auf dem Steinboden zerschellt.
Beatriz springt auf, öffnet die Phiole mit dem Sternenstaub und streut ihn sich auf die Hand. Dabei denkt sie an den Wunsch, den Nigellus sie Wort für Wort auswendig lernen ließ, damit nichts schiefgeht.
Wünsche sind knifflig, hat er ihr eingeschärft, als hätte sie seit ihrer Kindheit nicht schon öfter Sternenstaub benutzt. Beatriz weiß, dass der Schlüssel zu einem erfolgreichen Wunsch in der Genauigkeit liegt. Ein Wunsch an die Sterne ist wie Wasser in einem Eimer: Hat er auch nur das kleinste Loch, versickert das Wichtigste.
»Ich wünsche mir, dass ein Blitz in meine Zelle einschlägt und ein faustgroßes Loch in sie reißt«, stößt sie die Worte hervor. Kaum hat sie sie ausgesprochen, ist draußen ein weiterer Donnerschlag zu hören, dann bricht ein Stein aus der Wand und fällt in einer Staubwolke zu Boden.

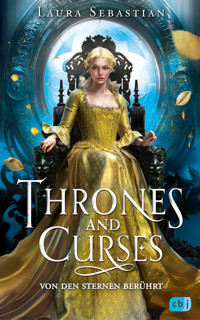
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










