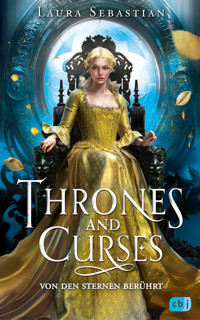
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Thrones-and-Curses-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der Plan: Heirat. Das Komplott: ein Königreich zu Fall bringen. Das Ziel: die Weltherrschaft.
Seit dem Tag ihrer Geburt ist das Schicksal der drei Prinzessinnen Sophronia, Daphne und Beatriz vorbestimmt: Sie werden eines Tages Königinnen sein. Und nun, kurz nach ihrem sechzehnten Geburtstag, müssen die drei ihr Heimatland verlassen und ihre Prinzen heiraten. Die Drillinge scheinen die perfekten Bräute zu sein: wunderschön, intelligent und vor allem sittsam. Eine fatale Fehleinschätzung, denn Sophie, Daphne und Beatriz sind keine Unschuldslämmer. Seit ihrer Kindheit wurden die drei in Täuschung, Verführung und Waffenkunst unterrichtet. Und das mit einem einzigen Ziel – die Monarchien ihrer Nachbarländer zu stürzen. Doch das Leben außer Landes stellt jede der drei vor ihre ganz eigenen Probleme und während nach und nach dunkle Wahrheiten ans Licht kommen, müssen sie sich fragen: Werden sie dem Plan treu bleiben? Oder müssen sie lernen, dass sie niemandem vertrauen können – nicht einmal einander?
Der fesselnde Auftakt zur neuen großen Fantasy-Trilogie der New-York-Times-Bestsellerautorin Laura Sebastian über drei Schwestern, die Magie der Sterne und den Kampf um die Krone.
Die Thrones-and-Curses-Reihe:
Thrones and Curses – Von den Sternen berührt (Band 1)
Thrones and Curses – Für die Krone geboren (Band 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 689
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
LAURA SEBASTIAN
VON DEN STERNEN BERÜHRT
Aus dem Englischen von Petra Koob-Pawis
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2024 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Text copyright © 2022 by Laura Sebastian
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Castles in their Bones« Delacorte Press,
an imprint of Random House Children’s Books,
a division of Penguin Random House LLC, New York.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Übersetzung: Petra Koob-Pawis
Lektorat: Christina Neiske
Umschlaggestaltung und Illustration: Isabelle Hirtz, Hamburg
sh · Herstellung: UK
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28318-6V004
www.cbj-verlag.de
Für meinen Bruder Jerry.Selbst wenn wir miteinander stritten,waren wir stets zwei gegen den Rest der Welt.
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
Daphne
Sophronia
Beatriz
Daphne
Sophronia
Beatriz
Daphne
Sophronia
Beatriz
Daphne
Beatriz
Sophronia
Daphne
Daphne
Beatriz
Beatriz
Sophronia
Beatriz
Daphne
Sophronia
Beatriz
Daphne
Sophronia
Beatriz
Sophronia
Daphne
Sophronia
Beatriz
Daphne
Sophronia
Beatriz
Sophronia
Daphne
Beatriz
Beatriz
Daphne
Daphne
Sophronia
Sophronia
Daphne
Sophronia
Beatriz
Daphne
Beatriz
Daphne
Sophronia
Margaraux
Dank
Sie wollen gleich weiterlesen? Unsere Empfehlungen für Sie…
Newsletter-Anmeldung
Man sagt, am Geburtstag der Prinzessinnen leuchten die Sterne heller, doch sie selbst glauben nicht an derlei Unsinn. Die Sterne sehen aus wie immer, und in diesem Jahr, in der Nacht, bevor die drei zum ersten Mal ihr Zuhause verlassen und getrennte Wege gehen werden, scheint alles, auch die Sterne, viel dunkler zu sein.
Der Lärm des rauschenden Fests hallt noch durch den Palast, als es bereits auf Mitternacht zugeht, aber die Prinzessinnen haben der Feier längst den Rücken zugekehrt. Daphne nimmt eine Flasche Champagner aus einem Eiskübel, während Beatriz dem Diener schöne Augen macht und Sophronia derweil aufpasst, dass sie nicht von ihrer Mutter überrascht werden. Sie haben ihre Pflicht getan, getanzt und angestoßen, Hände geschüttelt und Wangen geküsst, gelächelt, bis die Gesichtsmuskeln schmerzten, aber die letzten Minuten ihrer Jugend wollen sie so verbringen, wie sie vor sechzehn Jahren auf die Welt gekommen sind: zusammen.
In ihren Privatgemächern hat sich seit ihrer Kindheit kaum etwas verändert – seit die drei Schwestern aus der Kleinkinderstube dorthin übergesiedelt sind –, es sind immer noch drei identische weiße Räume, die in einen gemeinsamen Salon führen. Und in jedem steht ein weißes, mit üppigen Seidenkissen ausstaffiertes Himmelbett, dazu noch ein Sekretär und ein Schrank aus Birkenholz mit Goldintarsien in Form von Ranken und Blüten sowie ein großer, flauschiger rosafarbener Teppich. Der gemeinsame Salon ist mit dick gepolsterten Samtsesseln und einem großen Marmorkamin ausgestattet, in den die Sternbilder eingemeißelt sind, die zur Zeit ihrer Geburt über den Himmel zogen – in der Mitte ein in den Marmor eingelegter Opal, der den Vollmond symbolisiert, und um ihn herum die Sternbilder: die Dornenrose, der Hungrige Falke, das Einsame Herz, die Flammenkrone und natürlich die Drei Schwestern.
Gerüchten zufolge hatte Kaiserin Margaraux den königlichen Himmelsdeuter Nigellus beauftragt, mithilfe von Magie dafür zu sorgen, dass ihre Töchter zu der Zeit geboren werden, wenn die Drei Schwestern hoch am Himmel stehen. Andere wiederum halten das für lächerlich – warum hätte sie sich drei Mädchen wünschen sollen, wenn ein einziger Junge viel nützlicher gewesen wäre?
Wieder andere raunen, dass Nigellus einen Stern aus dieser Konstellation auf die Erde geholt hat, um den Kinderwunsch der Kaiserin zu erfüllen, obwohl keiner der Sterne am Firmament zu fehlen scheint. Aber dass sie diesen ganz besonderen Wunsch ausgesprochen hat, darin sind sich alle einig. Wie sonst hätte der Kaiser im hohen Alter von siebzig Jahren plötzlich drei Töchter zeugen können, wo doch seine letzte Frau und seine zahllosen Mätressen nie schwanger geworden waren?
Und dann ist da noch die Sache mit den Augen der Prinzessinnen – sie haben weder die braunen der Mutter noch die blauen des Vaters. Die Augen der drei Schwestern haben einen sternenfeinen Silberschimmer, wie er nur denjenigen vorbehalten ist, die mit Magie gezeugt wurden. Jenen, durch deren Adern Sternenstaub fließt.
Daphne
Daphne sitzt auf dem Teppich vor dem Kaminsims und kann nicht umhin, die Sternbilder zu betrachten, während sie die Rockfalten ihres grünen Organzakleides wie Blütenblätter um sich herum auffächert.
Im Sternbild der Dornenrose geborene Kinder gelten als besonders schön.
Den im Sternbild des Hungrigen Falken geborenen wird großer Ehrgeiz nachgesagt.
Die Kinder des Einsamen Herzens sind dafür bekannt, dass sie mehr Opfer bringen als andere.
Die Flammenkrone garantiert den Nachkommen große Macht.
Und die Drei Schwestern stehen für Gleichgewicht und Harmonie.
Natürlich gibt es Ausnahmen – Daphne weiß von vielen Menschen, die im Sternbild der Dornenrose geboren wurden und nicht mit Schönheit gesegnet sind, und auch von vielen, die unter der Flammenkrone geboren wurden und Schornsteinfeger und Kohlbauern geworden sind. Dennoch glauben die meisten Menschen an die Vorzeichen der Sterne – selbst Daphne, die sich bei den meisten Dingen auf ihr logisches Denken verlässt, nimmt sich die täglichen Horoskope zu Herzen, die ihr beim Frühstück vorgelegt werden.
Ihr Blick wandert immer wieder zum Kaminsims, während sie sich abmüht, die stibitzte Champagnerflasche mit ihrer gläsernen Nagelfeile zu öffnen. Als der Korken nach einigem Herumhantieren mit lautem Knall aus der Flasche springt, stößt sie vor Schreck einen kleinen Schrei aus. Der Korken schießt in die Höhe, prallt gegen den Kronleuchter und bringt die Kristalle zum Klingen. Champagner sprudelt kalt und nass auf ihr Kleid und den Teppich.
»Vorsicht!«, ruft Sophronia und eilt in das angrenzende Badezimmer, um ein Handtuch zu holen.
Beatriz schnaubt spöttisch und hält drei zierliche Kristallgläser an die Flaschenöffnung, damit Daphne sie fast bis zum Rand füllt. »Oder was?«, ruft sie Sophronia hinterher. »Wir sind doch gar nicht mehr lange genug hier, um Ärger wegen eines ruinierten Teppichs zu bekommen.«
Sophronia, die gerade mit einem Handtuch in der Hand zurückgekehrt ist und bereits anfängt, den verschütteten Champagner aufzuwischen, runzelt die Stirn.
Als Beatriz den Ausdruck auf ihrem Gesicht sieht, wird ihr Ton weicher. »Tut mir leid, Sophie«, sagt sie, bevor sie einen Schluck aus einem der Gläser nimmt und die anderen beiden an ihre Schwestern weiterreicht. »Ich wollte nicht …« Sie stockt, weil sie selbst nicht weiß, was genau sie nicht wollte.
Sophronia scheint es auch nicht zu wissen, aber sie lässt das feuchte Handtuch auf den Boden fallen und sinkt neben Beatriz aufs Sofa. Als Beatriz den Arm um sie legt, knistert der Taft des rosafarbenen, schulterfreien Kleides.
Daphne sieht sie über den Rand ihres Glases hinweg an und trinkt die Hälfte des Champagners in einem Zug, bevor ihr Blick auf das nasse Handtuch fällt.
Wenn es trocken ist, denkt sie, werden wir schon nicht mehr hier sein. Und uns ein Jahr lang nicht sehen.
Der erste Teil ist noch halbwegs erträglich – Bessemia ist ihre Heimat, aber sie haben immer gewusst, dass sie weggehen würden, sobald sie die Volljährigkeit erreicht hätten. Beatriz in den Süden nach Cellaria, Sophronia in den Westen nach Temarin und Daphne in den Norden nach Friv. Solange Daphne zurückdenken kann, haben sie sich auf ihre Aufgabe vorbereitet: die drei Prinzen zu heiraten, mit denen sie verlobt sind, um anschließend deren Länder in den Krieg zu treiben, damit ihre Mutter die Scherben aufsammeln und wie neue Juwelen für ihre eigene Krone zusammenfügen kann.
Aber das ist noch Zukunftsmusik. Daphne schiebt energisch alle Gedanken an die Intrigen ihrer Mutter beiseite und konzentriert sich auf ihre beiden Schwestern. Die sie, wenn alles nach Plan verläuft, ein Jahr lang nicht wiedersehen wird. Sie haben in ihrem ganzen Leben nie mehr als ein paar Stunden getrennt verbracht. Wie sollen sie das ein ganzes Jahr lang durchhalten?
Beatriz scheint zu merken, dass Daphnes Lächeln zu kippen droht, denn sie verdreht theatralisch die Augen – wie sie es immer tut, wenn sie versucht, ihre eigenen Gefühle zu verbergen.
»Komm her«, sagt sie mit leicht brüchiger Stimme und klopft einladend auf den freien Platz an ihrer Seite.
Daphne steht vom Teppich auf, lässt sich wenig anmutig neben Beatriz aufs Sofa plumpsen und legt ihren Kopf auf Beatriz’ nackte Schulter. Beatriz’ trägerloses himmelblaues Kleid sieht furchtbar unbequem aus, die eng geschnürte Corsage gräbt sich in ihre Haut und hinterlässt dort rote Stellen, die sich am oberen Saum deutlich abzeichnen, aber Beatriz scheint das nicht zu spüren.
Daphne fragt sich, ob das Verbergen jeglicher Gefühlsregungen ein Trick ist, den Triz während ihrer Ausbildung bei den Palastkurtisanen gelernt hat – ihrer Mutter zufolge eine unabdingbare Notwendigkeit, um ihr spezielles Ziel in Cellaria zu erreichen –, oder ob ihre Schwester von Natur aus so ist: nur zwei Minuten älter, aber stets mit dem Auftreten einer Frau, während Daphne selbst sich immer noch wie ein Kind fühlt.
»Machst du dir Sorgen?«, fragt Sophronia und nippt leicht an ihrem Glas.
Obwohl sie Drillinge sind, verträgt Sophronia weniger Alkohol als ihre Schwestern. Ein halbes Glas Champagner hat bei ihr die gleiche Wirkung wie zwei volle Gläser bei Daphne und Beatriz. Hoffentlich weiß das eine ihrer Zofen in Temarin, denkt Daphne. Und hoffentlich hat dort jemand ein Auge auf ihre Schwester, wenn sie und Beatriz nicht für Sophronia da sein können.
Beatriz schnaubt. »Warum in aller Welt sollte ich nervös sein? Mittlerweile habe ich das Gefühl, ich könnte Lord Savelle im Schlaf verführen.«
Lord Savelle spielt eine erste wichtige Rolle im großen Plan der Kaiserin. Der temarinische Botschafter in Cellaria sorgt seit zwei Jahrzehnten dafür, dass der Frieden zwischen beiden Ländern gewahrt bleibt – seit Jahrhunderten hat es keine Friedenszeit mehr gegeben, die so lange währte. Indem sie ihm seine Ehre nimmt, wird Beatriz den Konflikt neu entfachen und noch ein paar zusätzliche Holzscheite ins Feuer legen.
»Cellaria … allein schon das Land macht mich nervös«, gibt Sophronia mit Schaudern zu. »Keine Himmelsdeuter, kein Sternenstaub, keinerlei Magie. König Cesare hat angeblich einen Mann bei lebendigem Leib verbrennen lassen, weil er ihn für eine Dürre verantwortlich machte.«
Beatriz zuckt nur mit den Schultern. »Na ja, ich habe mich darauf vorbereitet, nicht wahr?«, sagt sie. »Und der zunehmende Verfolgungswahn des Königs wird es für mich noch einfacher machen, einen Krieg anzuzetteln. Vielleicht bin ich eher wieder hier als ihr beide.«
»Ich würde auf Sophie wetten«, sinniert Daphne und nippt am Champagner. »Sie ist die Einzige von uns, die sogar einen König und nicht nur einen Prinzen heiratet. Ich bin sicher, Leopold wird Cellaria den Krieg erklären, sobald sie einmal mit den Wimpern klimpert und ihn darum bittet.«
Obwohl sie es im Scherz gesagt hat, folgt ihren Worten betretenes Schweigen. Sophronia wendet den Blick ab, ihre Wangen werden feuerrot, und Beatriz wirft Daphne einen bösen Blick zu. Daphne hat das Gefühl, etwas nicht mitbekommen zu haben, und das nicht zum ersten Mal. Die drei Schwestern stehen sich nahe, aber Beatriz und Sophronia waren schon immer ein bisschen enger miteinander. Für Daphne ist das nicht weiter schlimm, schließlich stand sie ihrer Mutter schon immer am nächsten.
»Beatriz ist die Hübscheste von euch – es wird ihr nicht schwerfallen, die Herzen der Cellarier zu erobern. Sophronia ist die Lieblichste und wird die Temariner mit Leichtigkeit für sich gewinnen«, hat die Kaiserin erst am Vortag zu Daphne gesagt und dabei wie ein General geklungen, der seine Truppen in den Kampf schickt. Daphne hat einen Stich der Enttäuschung verspürt, bis ihre Mutter sich zu ihr gebeugt, ihre kühle Hand an Daphnes Wange gelegt und sie mit einem seltenen strahlenden Lächeln beschenkt hat. »Aber du, mein Schatz, bist meine schärfste Waffe, daher brauche ich dich in Friv. Bessemia braucht dich in Friv. Wenn du eines Tages meinen Platz einnimmst, musst du beweisen, dass du ihn ausfüllen kannst.«
Scham und Stolz kämpfen in Daphne, und sie nimmt einen weiteren Schluck von ihrem Champagner, in der Hoffnung, dass ihre Schwestern nichts bemerken. Sie kann es ihnen nicht einmal verübeln, wenn sie Dinge vor ihr verheimlichen – sie selbst hat auch ihre Geheimnisse.
Ihr Verstand sagt ihr, dass ihre Mutter recht hatte, als sie Daphne gebeten hat, das vertrauliche Gespräch für sich zu behalten – sie hatte nie erwähnt, dass sie eine von ihnen zu ihrer Nachfolgerin machen würde, und allein das Wissen, dass ihre Wahl auf Daphne gefallen ist, würde Eifersucht schüren. Und das will Daphne nicht. Vor allem nicht heute Abend.
Seufzend lässt sie sich noch tiefer in das gepolsterte Sofa sinken. »Wenigstens sind eure Verlobten hübsch und gesund. Einer der frivianischen Kundschafter sagt, Prinz Cillian sei so oft einem Aderlass unterzogen worden, dass seine Haut mit Schorf bedeckt ist. Ein anderer meinte, dass er wahrscheinlich keinen weiteren Monat mehr leben wird.«
»Ein Monat ist genug Zeit, um ihn zu heiraten«, erwidert Beatriz ungerührt. »Im Grunde macht das deine Aufgabe sehr viel einfacher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dir in die Quere kommen wird, und Friv ist ein so junges Land, dass es ein Leichtes sein dürfte, das nach dem Tod des einzigen Thronfolgers eintretende Chaos auszunutzen. Vielleicht bist du die Erste, die nach Hause kommt.«
»Hoffentlich«, erwidert Daphne. »Aber ich kann nicht glauben, dass ich im kalten, elenden Friv festsitzen werde, während du dich an den sonnigen Stränden Cellarias entspannst und Sophie sich auf den legendären Festen der Temariner vergnügen darf.«
»Von Erholung am Strand oder Amüsement auf Festen kann ja wohl keine Rede sein«, wendet Sophronia ein, aber Daphne winkt ab.
»Es ist trotzdem besser als Schnee, grauer Himmel und noch mehr Schnee«, murrt sie.
»Kein Grund, theatralisch zu werden«, sagt Beatriz augenrollend. »Außerdem hast du die einfachste Aufgabe von uns allen. Was musst du denn schon tun? Das Siegel des Königs stehlen? Ein paar Dokumente fälschen? Gib’s zu, Daph.«
Daphne schüttelt den Kopf. »Du kennst unsere Mutter – da steckt sicher noch mehr dahinter.«
»Hört auf«, mischt Sophronia sich mit zittriger Stimme ein. »Ich will nicht mehr darüber reden. Heute ist unser Geburtstag. Sollte es da nicht um uns gehen und nicht um sie?«
Daphne und Beatriz tauschen einen vielsagenden Blick, und schließlich ist es Beatriz, die ihr antwortet.
»Natürlich, Sophie«, sagt sie. »Sollen wir einen Toast aussprechen?«
Sophronia überlegt einen Moment, bevor sie ihr Glas erhebt. »Auf unseren Siebzehnten«, sagt sie.
Daphne lacht. »Oh, Soph, hast du schon einen Schwips? Wir sind sechzehn.«
Sophronia zuckt mit den Schultern. »Das weiß ich«, sagt sie. »Aber mit sechzehn müssen wir uns verabschieden. Mit siebzehn werden wir wieder hier sein. Gemeinsam.«
»Dann also auf unseren Siebzehnten«, antwortet Beatriz und hebt ihr Glas.
»Auf unseren Siebzehnten«, stimmt Daphne zu und stößt mit ihren Schwestern an, bevor die drei ihren letzten Schluck Champagner trinken.
Sophronia lehnt sich gegen die Sofakissen, schließt die Augen und scheint endlich zufrieden zu sein. Beatriz nimmt Sophronias leeres Glas und stellt es zusammen mit ihrem eigenen auf den Boden, damit sie nicht im Weg sind, bevor sie sich neben ihrer Schwester zurücklehnt und zur gewölbten Decke hinaufblickt, wo auf einem tiefblauen Hintergrund in glitzerndem Gold wandernde Sternenkonstellationen gemalt sind.
»Wie Mama immer sagt«, murmelt Beatriz. »Wir sind drei Sterne desselben Sternbilds. Die Entfernung wird daran nichts ändern.«
Es ist eine überraschend emotionale Aussage von Beatriz, aber Daphne fühlt sich gerade selbst ein wenig sentimental, also rollt sie sich neben ihren Schwestern ein und schlingt ihre Arme um die Taillen der beiden.
Die große Marmoruhr im Salon schlägt Mitternacht, die lauten Glockenschläge dröhnen in Daphnes Ohren. Sie verdrängt die Worte ihrer Mutter aus ihren Gedanken und hält einfach nur ihre Schwestern eng umschlungen.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.« Sie küsst die beiden nacheinander auf die Wangen und ihre blassrosa Lippen hinterlassen einen Abdruck auf der Haut.
»Alles Gute zum Geburtstag«, antworten die beiden, aber man merkt ihnen an, wie müde sie sind. Sekunden später sind sie eingeschlafen. Daphne hört ihre ruhigen, gleichmäßigen Atemzüge, aber sosehr sie sich auch anstrengt, sie findet keine Ruhe. Der Schlaf holt sie erst ein, als die Morgensonne durchs Fenster späht.
Sophronia
Sophronia kann nicht weinen, nicht in Gegenwart der Kaiserin, nicht einmal in der Kutsche auf dem Weg zum Zentrum von Bessemia, dem Ort, an dem sie und ihre Schwestern sich endgültig verabschieden werden. Die Tränen brennen in ihren Augen, lassen ihre Kehle kribbeln, aber sie zwingt sich, sie zurückzuhalten, denn sie spürt den kritischen Blick ihrer Mutter, die immer auf der Suche nach Fehlern ist – bei Sophronia, wie es scheint, noch mehr als bei Daphne oder Beatriz.
Tränen sind eine Waffe, sagt Kaiserin Margaraux gerne und schürzt dabei ihre stets makellos geschminkten Lippen. Aber eine, die an mich verschwendet ist.
Sophronia hat nicht die Absicht, ihre Tränen als Waffe zu benutzen, aber sie kommt nicht gegen die Flut von Emotionen an, die sie zu überwältigen drohen. Sie zwingt sich, ihre Fassung zu bewahren, in dem Bewusstsein, dass die Kaiserin ihr gegenüber auf der Bank sitzt, schweigsam und standhaft und stark auf eine Art und Weise, die Sophronia nicht beherrscht, egal, wie viele Lektionen sie bekommen hat.
Die Kutsche holpert, und Sophronia nutzt die Gelegenheit, sich verstohlen eine Träne wegzuwischen.
»Ihr kennt eure Anweisungen«, sagt ihre Mutter und beendet damit das Schweigen. Sie klingt leidenschaftslos, fast gelangweilt. Als wäre sie auf dem Weg zu einem Wochenende auf dem Lande, anstatt sich von allen drei Kindern auf einmal verabschieden zu müssen. »Ich erwarte, dass ihr mich auf dem Laufenden haltet.«
»Ja, Mama«, sagt Daphne.
Wie sie da nebeneinandersitzen, ist die Ähnlichkeit zwischen ihnen nicht zu übersehen. Sie beschränkt sich nicht nur auf die tintenschwarzen Locken, die ihre herzförmigen Gesichter umspielen, nicht nur auf die von dichten Wimpern umrahmten Augen – Daphnes sind sternenstaubsilbern wie die von Sophronia und Beatriz, die ihrer Mutter sind wie flüssiger Bernstein – und auch nicht auf die Sommersprossen, die über ihre hohen Wangenknochen und fein gezeichneten Nasen tanzen. Es ist die Art, wie sie sitzen, mit geradem Rücken, die Knöchel überkreuzt, die Hände im Schoß. Es ist der Schwung ihrer vollen Lippen, die an den Mundwinkeln leicht nach unten gezogen sind.
Aber wenn Daphne lächelt, strahlt sie eine Wärme aus, die Sophronia von ihrer Mutter nicht kennt.
Der Gedanke macht ihr das Herz schwer, und sie wendet den Blick von Daphnes Gesicht ab und richtet ihn stattdessen auf das samtene Kissen hinter der Schulter ihrer Schwester.
»Ja, Mutter«, sagt nun auch sie und hofft, dass ihre Stimme wie die von Daphne klingt, fest und entschlossen. Aber natürlich tut sie das nicht. Natürlich bebt sie.
Die Augen ihrer Mutter verengen sich, und sie öffnet den Mund, um Sophronia zu tadeln. Aber Beatriz kommt ihr zuvor und stellt sich, wieder einmal, mit einem kalten, spöttischen Lächeln schützend zwischen Sophronia und die Kaiserin.
»Und wenn wir anderweitig beschäftigt sind?«, fragt sie und zieht die Augenbrauen hoch. »Nach allem, was ich gehört habe, kann das Leben als Frischvermählte ziemlich … anstrengend sein.«
Ihre Mutter wendet den Blick von Sophronia ab und richtet ihn auf Beatriz.
»Spar dir deine Energie für Cellaria, Beatriz«, sagt sie. »Du wirst mir stets die neuesten Entwicklungen berichten, verschlüsselt natürlich, so wie du es gelernt hast.«
Beatriz und Daphne verziehen das Gesicht, nur Sophronia nicht. Sie stellt sich bei der Kryptologie weitaus geschickter an als ihre Schwestern, und obwohl sie die beiden innig liebt, bereitet es ihr insgeheim Freude, sich in etwas hervortun zu können, was den beiden anderen Mühe bereitet. Vor allem, weil es sonst so wenig gibt, worin sie sich auszeichnen könnte. Sie beherrscht weder Beatriz’ Flirt- und Verkleidungskünste, noch kann sie mit Daphnes Talent im Umgang mit Giften oder einem Dietrich mithalten. Aber sie kann einen Code in der Hälfte der Zeit knacken, die die beiden brauchen, und fast ebenso schnell einen neuen entwickeln, und obwohl alle drei Schwestern auch in Fragen der Wirtschaft unterrichtet wurden, war Sophronia die Einzige, die sich gerne mit Steuergesetzen und Haushaltszahlen beschäftigt hat.
»Und ich muss euch wohl nicht daran erinnern, dass euer Leben als Frischvermählte nur gespielt ist.« Der Blick ihrer Mutter ruht jetzt so eindringlich auf Sophronia, dass sie ein Kribbeln überläuft.
Sophronias Wangen fangen an zu brennen und sie spürt nun auch die Blicke ihrer Schwestern mit einer Mischung aus Mitleid, Sympathie und, in Daphnes Fall, einer Portion Verwirrung. Sophronia hat ihr nicht von dem Gespräch erzählt, das ihre Mutter vor einer Woche mit ihr geführt hat, von dem kalten Blick in ihren Augen, als sie Sophronia rundheraus fragte, ob sie Gefühle für König Leopold entwickelt habe.
Sophronia war der Meinung, dass sie weder gezögert noch anderweitig einen Anlass gegeben hatte, an ihrer Antwort zu zweifeln, als sie Nein gesagt hatte, aber ihrer Mutter war die Lüge nicht entgangen.
»Ich habe dich nicht dazu erzogen, so töricht zu sein, dich der Illusion von Liebe hinzugeben«, hatte sie daraufhin gesagt und Sophronia einen Folianten mit Dokumenten in die Hand gedrückt – Berichte ihrer Spione in Temarin. »Du liebst ihn nicht. Du kennst ihn nicht einmal. Er ist unser Feind, das darfst du nie vergessen.«
Sophronia schluckt und verdrängt die Erinnerung und damit auch das, was in diesen Dokumenten steht. »Du musst uns nicht erneut darauf hinweisen«, antwortet sie.
»Gut«, sagt die Kaiserin, bevor ihr Blick auf Beatriz fällt und sich ihr Stirnrunzeln vertieft. »Wir sind fast da, denk an deine Augen.«
Beatriz verzieht das Gesicht, greift jedoch nach dem Smaragdring an ihrer rechten Hand. »Es juckt aber«, sagt sie, während sie den Smaragd dreht und den Ring erst über das eine, dann über das andere Auge hält und in jedes einen grünen Tropfen aus dem Ring fallen lässt. Sie blinzelt ein paarmal, und als sie die Lider wieder öffnet und ihre Mutter anblickt, sind ihre Augen nicht mehr silbern wie die von Sophronia und Daphne, sondern leuchtend grün.
»Du würdest dich noch sehr viel unwohler fühlen, wenn die Cellarier deine Sternenaugen zu Gesicht bekämen, das kann ich dir versichern«, erwidert die Kaiserin vielsagend.
Beatriz runzelt die Stirn, widerspricht ihrer Mutter aber nicht. Wie Sophronia weiß auch sie, dass ihre Mutter recht hat. Selbst in Bessemia sind Sternenaugen eher selten; man findet sie bei Kindern, deren Eltern Sternenstaub verwendet haben, um sie zu zeugen. Sie sind nicht die einzige Adelsfamilie mit silberfarbenen Augen – so manche Ahnenreihe konnte nur dank großer Mengen an Sternenstaub und in seltenen Fällen dank der Hilfe eines Himmelsdeuters fortgeführt werden. Aber in Cellaria ist Magie verboten, und es gibt viele Geschichten über cellarische Kinder, die wegen ihrer silbernen Augen getötet wurden, wobei Sophronia sich gelegentlich fragt, wie viele dieser Kinder wohl einfach nur graue Augen hatten.
Die Kutsche hält an, und ein kurzer Blick aus dem Fenster bestätigt, dass sie an ihrem Ziel angekommen sind, einer Lichtung in der Mitte des Nemaria-Waldes. Die Kaiserin macht jedoch keinerlei Anstalten auszusteigen, ihr Blick wandert langsam von einer Tochter zur nächsten.
Bei genauerem Hinsehen meint Sophronia, einen Anflug von Traurigkeit bei ihrer Mutter zu entdecken. Einen Hauch von Bedauern. Doch kaum ist er aufgetaucht, ist er auch schon wieder verschwunden, verborgen hinter einer Maske aus Eis und Stahl.
»Ihr seid jetzt auf euch allein gestellt«, sagt die Kaiserin mit leiser Stimme. »Ich werde nicht da sein, um euch zu führen. Aber ihr habt euch lange darauf vorbereitet, meine Täubchen. Ihr wisst, was zu tun ist, ihr wisst, wen ihr angreifen müsst, ihr wisst, wo sie verwundbar sind. In einem Jahr werden wir jeden Winkel dieses Kontinents beherrschen und niemand wird ihn uns mehr nehmen können.«
Sophronia spürt, wie ihr das Herz aufgeht, wie immer, wenn sie an diese Zukunft denkt. Sosehr sie sich auch vor dem kommenden Jahr fürchtet, weiß sie doch, dass es sich am Ende lohnen wird – wenn ganz Vesteria ihnen gehört.
»Aber ich habe noch etwas für euch«, fährt ihre Mutter fort. Sie greift in die Tasche ihres Gewands, holt drei kleine rote Samtbeutel mit Kordelzug heraus und reicht jeder Tochter einen.
Sophronia öffnet ihr Beutelchen und lässt den Inhalt in ihre Handfläche gleiten. Zum Vorschein kommt ein kühles Silberarmband, an dem ein einzelner Diamant baumelt, kleiner als ihr kleinster Fingernagel. Ein kurzer Blick bestätigt ihr, dass ihre Schwestern das gleiche Geschenk erhalten haben.
»Ist das nicht ein bisschen zu schlicht für deinen Geschmack, Mama?«, bemerkt Beatriz mit spitzen Lippen.
Es stimmt, der Geschmack ihrer Mutter ist zumeist sehr opulent: schweres Gold, Edelsteine in der Größe von Krocketbällen, Schmuck, der seinen Preis lauthals herausschreit.
Kaum ist ihr dieser Gedanke durch den Kopf geschossen, dämmert es Sophronia.
»Der Schmuck soll niemandem auffallen«, sagt sie und blickt die Kaiserin an. »Aber warum? Es ist doch nur ein Diamant.«
Daraufhin weicht der sonst so gleichmütige Ausdruck der Kaiserin einem schmallippigen Lächeln.
»Weil es keine Diamanten sind, meine Täubchen.« Sie streckt die Hand aus, um Daphnes Kette und ihr Handgelenk zu ergreifen. Während sie spricht, legt sie Daphne das Armband um. »Ich habe sie bei Nigellus in Auftrag gegeben. Setzt sie klug ein – und auch nur, wenn es unbedingt sein muss.«
Bei der Erwähnung von Nigellus tauscht Sophronia einen verstohlenen Blick mit ihren Schwestern aus. Der engste Berater ihrer Mutter und kaiserliche Himmelsdeuter ist ihnen schon immer ein Rätsel gewesen, auch wenn er seit ihrer Geburt ein fester Bestandteil ihres Lebens ist. Er ist freundlich zu ihnen, wenn auch ein wenig unterkühlt, und er hat ihnen nie einen Grund gegeben, ihm zu misstrauen. Sie sind nicht die Einzigen, die ihm gegenüber auf der Hut sind – der ganze Hofstaat mag ihn nicht –, aber alle fürchten ihn und die Kaiserin viel zu sehr, als dass sie jemals mehr tun würden, als heimlich zu tuscheln.
Sophronia kann sämtliche Himmelsdeuter auf dem Kontinent an zwei Händen abzählen – jede königliche Familie beschäftigt einen, nur das Königshaus von Cellaria nicht. Darüber hinaus gibt es noch einige wenige Himmelsdeuter, die entweder von Natur aus oder aufgrund ihrer Ausbildung ein Nomadenleben führen. Die Macht, Sterne vom Himmel zu holen, ist ihnen zwar angeboren, aber es ist eine Gabe, deren Beherrschung ein umfangreiches Studium erfordert. Ungeübte Himmelsdeuter gelten als gefährlich, da sie angeblich Sterne aus Versehen herabholen und Wünsche wahr werden lassen, indem sie ihnen eine Stimme verleihen. Aber soweit Sophronia sich erinnern kann, wurde in Bessemia zu ihren Lebzeiten noch kein einziger Himmelsdeuter geboren.
»Sternenstaub?«, fragt Beatriz mit einem Anflug von Spott. »Wie enttäuschend. Ich hätte bei jedem beliebigen Händler in der Stadt für ein paar Hundert Aster eine Phiole kaufen können.«
Beatriz ist die Einzige, die so mit ihrer Mutter spricht, und jedes Mal, wenn sie das tut, überläuft es Sophronia kalt, obwohl sie ihr in diesem Fall zustimmen muss. Sternenstaub ist nicht gerade eine Seltenheit – jedes Mal, wenn ein Sternenschauer in Vesteria niedergeht, suchen Erntehelfer das ganze Land nach Pfützen mit Sternenstaub ab, um ihn dann pfundweise zu Händlern zu bringen, die ihn in Flaschen abfüllen und zusammen mit feinen Juwelen und Seidenwaren verkaufen. Schon eine Prise davon reicht für einen Wunsch, und auch wenn diese kleine Portion allenfalls stark genug ist, um einen gebrochenen Knochen zu heilen oder einen Pickel verschwinden zu lassen, ist doch jedes Körnchen wertvoll. Jeder Händler, der etwas auf sich hält, hat Sternenstaub im Angebot, nur in Cellaria nicht, wo es keine Sternenschauer gibt. Nach den Überlieferungen der Cellarier ist Sternenstaub kein Geschenk der Sterne, sondern ein Fluch, und selbst sein Besitz ist ein Verbrechen. Für die Cellarier ist das Ausbleiben von Sternenregen eine Belohnung für ihre Frömmigkeit und ein Zeichen dafür, dass die Sterne dem Königreich wohlgesonnen sind, auch wenn Sophronia sich hin und wieder fragt, ob nicht vielleicht das Gegenteil der Fall ist, ob die alten Überlieferungen als eine Art Trost niedergeschrieben wurden, um die Cellarier davon zu überzeugen, dass ein Leben ohne diese Magie, zu der sie keinen natürlichen Zugang haben, ein besseres Leben ist.
Die Kaiserin lächelt nur.
»Nicht Sternenstaub«, sagt sie. »Ein Wunsch. Von Nigellus.«
Daraufhin wird sogar Beatriz still und betrachtet ihr Armband mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Angst. Und auch Sophronia nimmt den Schmuck näher in Augenschein. Sternenstaub gilt gemeinhin nicht als übertriebener Luxus, aber ein Wunsch von einem Himmelsdeuter ist etwas ganz anderes. Normalerweise werden solche Wünsche persönlich geäußert, indem der Himmelsdeuter sich einen Stern wünscht und diesen mit Magie vom Himmel holt. Die Wünsche, die auf diese Weise ausgesprochen werden, sind stärker und vermögen viel mehr als normaler Sternenstaub, aber die Zahl der Sterne ist begrenzt, sodass sie nur in äußersten Notfällen zum Einsatz kommen dürfen. Soweit Sophronia weiß, ging es das letzte Mal, als Nigellus sich einen Stern gewünscht hat, darum, eine monatelange Dürre in Bessemia zu beenden. Damit hat er zweifellos Tausenden von Menschen das Leben gerettet und die Wirtschaft Bessemias vor dem Zusammenbruch bewahrt, aber viele waren der Ansicht, dass der Preis dafür zu hoch war. Sophronia kann immer noch die Stelle am Himmel sehen, an der dieser Stern einst funkelte, als Teil der Bewölkten Sonne, einer Konstellation, die einen Wetterumschwung ankündigt. Sophronia hätte gerne gewusst, in welchen Sternbildern drei Sterne fehlen, weil sie jetzt in einem Schmuckstück gefangen sind.
»Und er ist in dem Stein?«, fragt Beatriz skeptisch.
»So ist es«, bestätigt ihre Mutter und behält ihr Lächeln bei. »Mithilfe einer speziellen Alchemie, die Nigellus dafür entwickelt hat. Es sind die einzigen drei, die es gibt. Ihr müsst nur den Stein zerbrechen und euch etwas wünschen. Es ist ein starker Zauber, stark genug, um ein Leben zu retten. Aber auch hier gilt: Man sollte sie nur benutzen, wenn man keine anderen Möglichkeiten hat.«
Beatriz hilft Sophronia mit dem Verschluss des Armbands und danach hilft Sophronia ihr. Die Kaiserin schaut ihre drei Töchter an und nickt ein letztes Mal.
»Kommt, meine Täubchen.« Sie stößt die Kutschentür auf und lässt das helle Morgenlicht herein. »Zeit zu fliegen.«
Beatriz
Beatriz muss blinzeln, als sie aus der Kutsche steigt. Das Sonnenlicht blendet sie und verstärkt das Jucken in ihren Augen. Der Apotheker, der die Augentropfen hergestellt hat, hat ihr zwar versichert, dass sie sich rasch daran gewöhnen würde, aber sie hat die Tropfen nun schon ein paarmal angewendet und hat ihre Zweifel, ob das jemals der Fall sein wird. Doch so ungern sie es auch zugibt, ihre Mutter hat recht – es ist eine Unannehmlichkeit, die man hinnehmen muss.
Als sie ihre Augen wieder öffnet, sieht sie drei Kutschen mit offenem Verdeck, die ihnen vom Palast vorausgefahren sein müssen – alle in den bessemianischen Farben Puderblau und Gold und jeweils von einem Paar reinweißer Pferde gezogen, in deren Mähnen und Schweife Bänder geflochten sind. Neben jeder Kutsche steht ein kleines Seidenzelt. Eines in frivianischem Grün, eines in temarinischem Gold und eines in cellarischem Scharlachrot, jeweils flankiert von zwei entsprechend gekleideten Wachen.
Die bessemianische Delegation, die die kaiserliche Kutsche eskortiert, schart sich um das Gefährt, und Beatriz entdeckt einige bekannte Gesichter, darunter Nigellus mit seinen kalten Silberaugen und seinem langen schwarzen Gewand. Selbst in der Mittagshitze steht ihm keine einzige Schweißperle auf der alabasterweißen Stirn. Er muss mindestens so alt sein wie ihre Mutter, aber allein seinem Aussehen nach zu urteilen, könnte man meinen, dass er Beatriz und ihren Schwestern altersmäßig näher ist.
Vor jedem Zelt schart sich eine Gruppe gut gekleideter Männer und Frauen, deren Gesichter ineinander zu verschwimmen scheinen – die Adelsdelegationen der jeweiligen Länder. Die cellarische Abordnung sticht schon von Weitem heraus, ihre Vertreter tragen ausgefallene Farben, die Beatriz noch nicht einmal genau benennen könnte. Sie sehen freundlich aus, mit ihrem breiten, strahlenden Lächeln, aber Beatriz weiß nur allzu gut, dass der Schein trügen kann. Egal, wie oft Beatriz von ihrer Mutter den genauen Ablauf der offiziellen Übergabe gehört hat, sie fühlt sich immer noch nicht vorbereitet. Sie versucht, sich ihre Nervosität nicht anmerken zu lassen, hält den Rücken gerade und den Kopf hoch.
Die Kaiserin küsst ihre Töchter ein letztes Mal auf die Wangen, und als Beatriz an der Reihe ist, spürt sie die Lippen ihrer Mutter dünn und kalt auf ihrer Haut. Dann ist es vorbei. Keine Gefühlsduselei, keine Abschiedsworte, keine Liebesbezeugungen. Nicht, dass Beatriz etwas anderes erwartet hätte. Sie versucht, sich einzureden, dass sie nichts dergleichen von ihrer Mutter will, zugleich muss sie sich eingestehen, dass es wehtut, als die Kaiserin sich von ihnen abwendet und die drei Schwestern in der Mitte der Lichtung zurücklässt, im wörtlichen und übertragenen Sinne zwischen den Welten gefangen.
Daphne macht den ersten Schritt – so wie immer, Beatriz kann sich nicht erinnern, dass es jemals anders gewesen wäre. Mit gestrafften Schultern und festem Blick geht sie auf das frivianische Zelt zu. Sie bemüht sich, die Gefühlskälte ihrer Mutter nachzuahmen, aber im letzten Moment wirft sie einen Blick zurück, und Beatriz sieht die Unsicherheit in ihren Augen. Unwillkürlich fragt sie sich, was wohl passieren würde, wenn Daphne Nein sagen würde, wenn sie sich weigern würde, das Zelt zu betreten, wenn sie ihrer Mutter nicht gehorchen würde. Aber natürlich geschieht nichts dergleichen. Daphne würde eher eine Sternschnuppe mit der bloßen Hand auffangen, als sich den Wünschen der Kaiserin zu widersetzen. Mit einem letzten flüchtigen Lächeln für Beatriz und Sophronia betritt Daphne das Zelt und verschwindet aus dem Blickfeld.
Beatriz sieht Sophronia an, die ihre Angst noch nie so gut verbergen konnte wie Daphne.
»Komm schon«, sagt Beatriz zu ihr. »Wir gehen zusammen.«
Zusammen bis zur letzten Minute, denkt sie, aber sie spricht es nicht laut aus. Sie folgen Daphnes Beispiel, und bevor sie in ihren Zelten verschwinden, schenkt Beatriz Sophronia ein letztes Lächeln, das die bebenden Lippen ihrer Schwester nicht ganz erwidern können.
Sie hofft, dass Sophronia nicht vor den Temarinern weint, denn das sollte nicht der erste Eindruck sein, den sie von ihr bekommen – und ihre Mutter hat immer betont, wie wichtig ein guter erster Eindruck ist.
Kaum hat Beatriz das von Kerzenlicht erhellte Zelt betreten, wird sie von einer Schar Frauen belagert, die in schnellem Cellarisch sprechen. Beatriz beherrscht die Sprache zwar annähernd perfekt, aber alle reden so hektisch und mit ganz unterschiedlichen Sprachfärbungen, dass sie genau zuhören muss, um zu verstehen, was sie sagen.
»Bessemianische Mode«, sagt eine Frau geringschätzig und zupft an dem weiten, spitzenbesetzten blassgelben Rock von Beatriz’ Kleid. »Pah, sie sieht aus wie ein gewöhnliches Gänseblümchen.«
Bevor Beatriz protestieren kann, meldet sich eine andere Frau zu Wort und kneift ihr dabei in die Wangen. »Hier fehlt es auch an Farbe. Wie eine unbemalte Porzellanpuppe – schlicht und unscheinbar.«
Unscheinbar. Die abwertenden Worte versetzen ihr einen Stich. Was ist sie, wenn nicht schön? Schönheit ist die einzige Eigenschaft, die man mit ihr verbindet: Daphne ist die Charmante, Sophronia die Kluge und Beatriz die Schöne. Welchen Wert hat sie ohne dieses Attribut?
Aber die Cellarier haben andere Maßstäbe – sie wollen Schönheit, die schrill und dramatisch und übertrieben ist. Also beißt sie sich auf die Zunge und lässt sich anstupsen und herumschieben, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Sie lässt zu, dass man ihr das Kleid über den Kopf zieht und es wie einen alten Lumpen zu Boden wirft, dass man ihr das Mieder aufschnürt und das Hemd auszieht, sodass sie nackt und zitternd in der kühlen Herbstluft steht.
Aber wenigstens hören jetzt die abfälligen Bemerkungen auf. Sie spürt die taxierenden Blicke auf sich.
»Nun«, sagt die erste Frau mit zusammengekniffenem Mund. »Zumindest wissen wir, dass sie genügend isst. Einige dieser bessemianischen Frauen bestehen nur aus Knochen – keine Brüste, keine Hüften, überhaupt kein Fleisch. Wenigstens muss ich keine Kleider für ein Skelett schneidern.«
Die Frau zieht Beatriz ein neues Hemd über den Kopf, dann schnürt sie ihr ein neues Korsett. Während ihr bessemianisches Korsett so eng war, dass sie darin kaum atmen konnte, ist dieses lockerer. Es betont ihre Brüste und Hüften mehr, als dass es sie verkleinert.
Als Nächstes folgt ein Unterrock, der voluminöser ist als alles, was Beatriz bisher getragen hat, selbst zu einem offiziellen Ball. Er ist so weit, dass es schwierig sein wird, durch Türen zu passen, geschweige denn in eine Kutsche zu steigen, aber wenigstens ist der Stoff leicht. Selbst unter den vielen Schichten fühlt ihre Haut sich kühl an. Sie spürt sogar die raschelnde Brise, die durch das Zelt hereinweht.
Und schließlich das Kleid selbst: rubinroter und goldener Seidendamast mit breiten Schultern und einem tiefen Ausschnitt, der mehr Haut entblößt, als es irgendjemand in Bessemia vor Sonnenuntergang je wagen würde. Ohne Spiegel ist schwer zu beurteilen, ob es ihr steht, aber die Frau, die das Ankleiden übernommen hat, nickt zufrieden, bevor sie ihren Platz der Frau überlässt, die offenbar für die Kosmetik zuständig ist.
Im nächsten Moment flirrt es nur so vor ihrem Gesicht: Pinsel und Farbe, Haare, die gezogen, gelockt und aufgetürmt werden, Metallkämme, die über ihre Kopfhaut kratzen, bis es wehtut. Kühle Farbtupfer auf Augen, Wangen und Lippen, und zum Schluss Puder, der über das ganze Gesicht gestäubt wird. Es ist ermüdend, aber Beatriz ist zu klug, um sich zu beschweren. Sie zuckt nicht einmal mit der Wimper, denn sie hat gelernt, ganz ruhig zu bleiben – wie eine lebende, atmende Puppe.
Schließlich helfen ihr die Näherin und die Frisierzofe in ein Paar zierliche Schuhe mit Absatz, die aus demselben Material wie ihr Kleid gefertigt sind.
»Sie ist sehr hübsch, nicht wahr?«, sagt die Frau, die sie geschminkt hat, und mustert Beatriz mit leicht zur Seite geneigtem Kopf.
Die Näherin nickt. »Prinz Pasquale dürfte sehr glücklich mit seiner Braut sein.«
»Wo es ja sonst nicht viel gibt, worüber er glücklich wäre«, antwortet die Frisierzofe schnaubend.
Beatriz lächelt und macht einen kleinen Knicks. »Vielen Dank für eure großen Bemühungen«, sagt sie zur allgemeinen Überraschung in fließendem, akzentfreiem Cellarisch. »Ich freue mich sehr darauf, Cellaria zu sehen.«
Die Frisierzofe findet zuerst ihre Sprache wieder.
»V-verzeiht, Eure H-hoheit«, stottert sie aufgeregt und mit roten Wangen. »Ich wollte nicht respektlos sein, weder Euch noch dem Prinzen gegenüber …«
Beatriz winkt ab. Ihre Mutter hat stets betont, wie wichtig es ist, sich bei den Bediensteten beliebt zu machen. Schließlich sind sie diejenigen, die am meisten wissen. Und die Bemerkung über Pasquale verrät ihr nichts, was sie nicht schon von den Spionen ihrer Mutter gehört hat, die ihn als einen mürrischen, launischen Jungen beschrieben haben. »Also, wollen wir?«
Die Näherin beeilt sich, die Zeltklappe aufzuhalten, damit Beatriz noch einmal in das helle Sonnenlicht treten kann. Sie ist die Letzte, die ihr Zelt verlässt, ihre beiden Schwestern sitzen bereits in ihren jeweiligen Kutschen, umgeben von devoten Höflingen.
Sie kommen ihr wie zwei Fremde vor.
Sophronia gleicht einem kunstvoll gefertigten Törtchen, das in einem Meer aus juwelenbesetzten Chiffonrüschen in abgestuften zitronengelben Farbtönen schwimmt, ihr blondes Haar ist gelockt und zu einer Steckfrisur mit allerlei Schleifen und Edelsteinen aufgetürmt. Daphne hingegen trägt ein grünes Samtkleid, das man im Vergleich zu Sophronias und ihrem eigenen Kleid nur als schlicht bezeichnen kann. Es hat lange, schmale Ärmel, die die Schultern frei lassen, und auf das Mieder sind mit schimmerndem schwarzem Garn zarte Blumen gestickt; ihr pechschwarzes Haar ist straff aus dem Gesicht gekämmt und zu einem Zopf geflochten, der ihre hohen Wangenknochen betont und ihr bis über den Rücken fällt.
Sie sind beide wunderschön, aber schon jetzt werden die Unterschiede deutlich. In einem Jahr könnten sie sich völlig fremd sein. Bei dem Gedanken wird Beatriz ganz flau, aber sie versucht, es nicht zu zeigen. Stattdessen trippelt sie zu ihrer eigenen Kutsche und achtet darauf, dass sich die Absätze ihrer Schuhe nicht in den Boden graben und sie ins Stolpern gerät. Ein Gardist hilft ihr in die Kutsche und sie lässt sich auf dem leeren Platz zwischen zwei cellarischen Damen mit rot lackierten Lippen nieder.
Die Frauen überschütten sie sofort in gestelztem Bessemianisch mit Komplimenten.
»Danke«, antwortet Beatriz auf Cellarisch, offensichtlich zu deren Erleichterung, aber den Rest des Geplauders nimmt sie kaum wahr.
Stattdessen schaut sie zu ihren Schwestern. Ihr Kutscher treibt die Pferde an, und das Gefährt setzt sich ruckelnd in Bewegung, Richtung Süden, doch Beatriz wendet ihre Augen nicht von den anderen beiden ab, bis sie aus ihrem Blickfeld verschwunden sind.
Daphne
Daphne dachte, sie würde den Moment bewusst erleben können, in dem sie das Land ihrer Geburt verlässt. Sie hat sich immer einen Ort vorgestellt, an dem das fruchtbare grüne Gras und die blühenden Blumen aufhören und der harten braunen Erde und den Schneeflecken weichen, für die Friv bekannt ist. Sie hat sich vorgestellt, dass sie es in der Luft riechen würde, dass sie die duftende, frische Luft von Bessemia ausatmen und die kalte, tote Luft von Friv einatmen würde.
Stattdessen vollzieht sich die Veränderung ganz allmählich auf der dreitägigen Reise nach Norden. Die flache Erde geht in sanfte Hügel über, deren Bewuchs immer karger wird. Die Bäume werden knorriger und kahl wie ein Skelett, ihre Äste biegen sich in Richtung eines Himmels, der jedes Mal, wenn Daphne blinzelt, etwas grauer zu werden scheint. In jedem Gasthaus, in dem sie haltmachen, wird der Akzent des Wirts und seiner Gäste rauer und schärfer, obwohl sie immer noch Bessemianisch sprechen.
Heute werden sie die Grenze erreichen und dann gibt es wirklich kein Zurück mehr.
Das ist ein Fehler, denkt Daphne, während sie beobachtet, wie sich die Welt um sie herum verändert, sich in etwas Unerkennbares und Dunkles verwandelt. Sie will nach Hause, in den Palast, in dem sie laufen gelernt hat. Sie möchte zurück zu ihrer Mutter und sich in ihrem Schatten sicher und wohl fühlen. Sie möchte die Arme um ihre Schwestern legen und spüren, wie ihre Herzen gemeinsam schlagen, so wie es sein sollte.
Die Sehnsucht ist so stark, dass sich ihre Kehle unter der Spitze ihres neuen hochgeschlossenen Kleides zusammenzieht und sie das Gefühl hat, zu ersticken. Eine Sekunde lang stellt sie sich vor, wie es wohl wäre, sich das Kleid vom Leib zu reißen, wie es sich wohl anfühlen würde, den steifen Samt unter ihren Fingern zu spüren, wenn der Stoff einen Riss bekommt und sie wieder tief durchatmen kann, ohne dass die Haut an ihrem Hals juckt und ihr heiß ist. Schon jetzt vermisst sie die untaillierten pastellfarbenen Kleider ihrer Kindheit und die Gewissheit, sich immer in Sophronia und Beatriz wiedererkennen zu können, drei Mädchen mit den gleichen Gesichtszügen, wie die Facetten eines Diamanten.
Sie versucht, nicht an ihre Schwestern zu denken, wie sie sie zuletzt gesehen hat, Fremde mit seltsamen Gesichtern, aufgeputzt, in Korsette geschnürt, zurechtgezupft und -gezogen, sodass Daphne mehrmals blinzeln musste, um sie überhaupt noch zu erkennen.
»Geht es Euch gut?«, fragt ihre Begleiterin, die mit ihr in der Kutsche sitzt. Lady Cliona, die Tochter von Lord Panlington.
Daphne nimmt an, dass der König sie geschickt hat, damit sie ihr auf dieser Reise zur Seite steht, und dass sie dankbar sein sollte, jemanden in ihrem Alter als Gesellschaft zu haben und nicht eine steife Matrone mit zusammengekniffenen Augen und geschürzten Lippen.
Sie ruft sich alles in Erinnerung, was sie über Lord Panlington weiß – er war einst das Oberhaupt des Panlington-Clans, bevor die Clankriege endeten und Bartholomew König des vereinigten Friv wurde. Panlington war ein Furcht einflößender Kriegsherr und eines der letzten Clanoberhäupter, das seinen Treuschwur leistete. Seit Kriegsende ist er jedoch einer von Bartholomews loyalsten Höflingen, einige Spione haben ihn sogar als dessen Freund bezeichnet.
Über Lady Cliona weiß sie deutlich weniger, nur, dass sie seine einzige Tochter ist und er noch fünf Söhne hat. Es heißt, Cliona sei sein Liebling. Die Spione berichteten, sie sei furchtbar eigensinnig, frech und hoffnungslos verwöhnt. Sie betonten nicht ausdrücklich, dass sie schön sei, aber es war die Rede von sechs abgelehnten Heiratsanträgen im letzten Jahr, seit ihrem sechzehnten Geburtstag, daher ist Daphne wie selbstverständlich davon ausgegangen.
Jetzt, wo sie ihr gegenübersitzt, stellt Daphne überrascht fest, dass Lady Cliona keine klassische Schönheit ist, zumindest nicht nach bessemianischen Maßstäben. Ihr Gesicht ist nicht makellos, sondern voller Sommersprossen, und ihre kupferfarbenen Locken sind wild und ungezügelt, sodass sie sich kaum zu einem Haarknoten bändigen lassen. Ihre scharf geschnittenen Gesichtszüge verleihen ihr eine Strenge, die sie älter aussehen lässt als siebzehn. Aber in den vergangenen drei Tagen konnte Daphne feststellen, dass sie schlau und schlagfertig ist und jeden, vom Kutscher über die Gastwirte bis zu den Wachen, in Sekundenschnelle um den Finger wickeln kann.
Daphne beschließt, ihre junge Gesellschafterin zu mögen – genauer gesagt beschließt das Mädchen, das sie zu sein vorgibt, Cliona zu mögen.
»Mir geht es gut«, sagt Daphne und zwingt sich zu einem Lächeln. »Ich denke, ich bin ein bisschen nervös«, fährt sie zögernd fort. »Prinz Cillian und ich haben im Laufe der Jahre nur ein paar Briefe ausgetauscht und ich weiß so gut wie nichts über ihn. Habt Ihr ihn kennengelernt?«
Eine Gefühlsregung flackert über Clionas Gesicht, verschwindet jedoch viel zu schnell, als dass Daphne etwas daraus ableiten könnte. »Ja, natürlich«, sagt Cliona und schüttelt den Kopf. »Wir sind zusammen am Hof aufgewachsen. Er ist sehr nett und sieht gut aus. Ich bin sicher, er wird Euch vergöttern.«
Daphne versucht, erleichtert auszusehen, aber sie weiß, dass das nicht die Wahrheit ist – nicht die ganze Wahrheit. Prinz Cillian liegt im Sterben, und jeder scheint es zu wissen. Im letzten Bericht der Spione war die Rede davon, dass er sein Bett seit drei Monaten nicht mehr verlassen habe und sein Zustand sich zusehends verschlechtere. Er muss nur lange genug leben, um mich zu heiraten, denkt Daphne insgeheim, auch wenn eine kleine Stimme in ihrem Kopf sie sofort für ihre Gefühllosigkeit tadelt. Die Stimme klingt eindeutig nach Sophronia.
»Und wie sind die Menschen in Friv so?«, fragt Daphne. »Ich habe gehört, es ist immer noch ein … unruhiges Land. Was halten sie davon, dass eine fremde Prinzessin ihre nächste Königin werden soll?«
Da ist er wieder, dieser vage Blick, diese großen Augen und zusammengepressten Lippen. Ein Ausdruck, der, wie Daphne inzwischen festgestellt hat, immer dann in Clionas Augen tritt, wenn sie lügt.
»Ich bin sicher, sie werden Euch bewundern, Hoheit«, sagt Lady Cliona mit einem strahlenden Lächeln. »Warum auch nicht?«
Daphne lehnt sich zurück und mustert ihre Begleiterin. »Ihr seid keine sehr gute Lügnerin, nicht wahr, Lady Cliona?«
Cliona erstarrt für einen Moment und ringt sich schließlich ein reumütiges Lächeln ab.
»Als ich ein Kind war, sagte meine Mutter immer, die Sterne hätten mich mit einer ehrlichen Zunge gesegnet, aber heute scheint es eher ein Fluch zu sein«, gibt sie zu.
Daphne lacht. »Ist Friv denn von so vielen Lügnern bevölkert, dass Euch die Wahrheit wie ein Fluch erscheint?«
Cliona schüttelt lachend den Kopf. »Gilt das nicht für alle Höfe?«
Die Fahrt geht noch einige Stunden so weiter, und sie vertreiben sich plaudernd die Zeit, bis die Sonne hoch am Himmel steht und die Kutsche neben einem breiten, schnell dahinfließenden Fluss zum Stehen kommt, dessen lautes Rauschen Daphne bereits hört, noch ehe der Verschlag der Kutsche geöffnet wird. Auf der anderen Seite des Flusses stehen weitere Kutschen, alle dunkelgrau, bis auf eine, die, leuchtend grün lackiert und mit goldenem und schwarzem Dekor geschmückt, von zwei reinschwarzen Rössern gezogen wird, die größer sind als alle Pferde, die Daphne je gesehen hat.
Hier trifft Bessemia auf Friv, der Fluss Tenal markiert die Grenze. Daphne weiß, dass es viele Überwege gibt für jene, die zu Fuß unterwegs sind, und auch breitere Brücken, die Teil der Handelsrouten sind, aber hier an dieser Stelle ist weit und breit keine Brücke in Sicht.
»Die Tradition schreibt vor, dass Ihr die Grenze nach Friv zu Fuß überquert«, erklärt Cliona, als sie Daphnes verwunderten Blick sieht.
»Zu Fuß?«, fragt sie und runzelt die Stirn. »Etwa mitten durch das Wasser?« Als Cliona nickt, schreckt Daphne unwillkürlich zurück. »Aber es wird eiskalt sein. Wie soll ich denn das Gleichgewicht halten?«
»Jemand wird dafür sorgen, dass Ihr nicht fallt«, sagt Cliona leichthin und macht eine lässige Handbewegung, bevor ihr Blick auf eine Gestalt fällt, die am Flussufer wartet. »Seht Ihr? Da ist Bairre.«
»Bär?«, fragt Daphne verwirrt und ein wenig beunruhigt. Sie späht durchs Kutschenfenster, sieht jedoch keinen Bären, sondern nur eine Schar von Fremden. Cliona hat keine Gelegenheit zu antworten, denn schon reicht ein Lakai Daphne die Hand, um ihr beim Aussteigen zu helfen.
Es ist immer noch bessemianischer Boden, denkt sie, aber das ist nur ein geringer Trost.
Cliona weicht nicht von ihrer Seite, und als sie der Prinzessin ihren Arm anbietet, nimmt Daphne ihre Unterstützung an. Das Terrain ist ihr nicht vertraut, ihre neuen Stiefel sind zu eng, und das Letzte, was sie will, ist, dass der erste Eindruck, den sie in Friv hinterlässt, darin besteht, dass sie kopfüber auf die Nase fällt.
Ein erster Eindruck bleibt für immer, also achtet darauf, dass es ein guter ist, pflegte ihre Mutter zu sagen. Daphne wiederholt ihre Worte bei sich und hofft, dass sie nicht schon zu einer Enttäuschung wird, bevor sie überhaupt einen Fuß über die Grenze gesetzt hat.
Ein junger Mann wartet am Ufer. Als sie auf ihn zugehen, neigt er den Kopf, aber seine Miene bleibt unergründlich. Sein kastanienbraunes Haar ist lockig und lang, vom Wind zerzaust verdeckt es seine Augen. Er sieht gut aus, findet Daphne, aber auf diese unberechenbare, wilde Art, die nach einem Haarschnitt, einem Bad und einem Glas Champagner verlangt, um die verkniffene Stirn zu glätten und den angespannten Kiefer zu lockern. Er hat dunkle Ringe unter den Augen, die sich deutlich von seiner blassen Haut abheben, und sie fragt sich, wann er das letzte Mal sein Bett oder die Sonne gesehen hat.
»Bairre«, sagt Cliona. Also kein Bär, denkt Daphne, sondern Bairre, der uneheliche Sohn König Bartholomews. Er nickt Cliona knapp zu, bevor sein Blick auf Daphne fällt und er sich vor ihr verbeugt. »Normalerweise würde Euch Euer Verlobter hinüberbegleiten«, fährt Cliona fort, »aber in Anbetracht des Gesundheitszustands von Prinz Cillian …« Sie verstummt.
Bei der Erwähnung von Cillian zuckt der Junge zusammen – Bairre zuckt zusammen. Die Spione haben nicht viel über ihn herausgefunden, obwohl er sein ganzes bisheriges Leben am Hof verbracht hat. Angeblich ist er als Säugling, nur wenige Wochen alt, in einem Korb auf den Stufen des Palasts gefunden worden, kurz nach Ende der Clankriege. Außer einem Zettel mit seinem Namen hatte er nichts bei sich, aber der König zögerte nicht, ihn als sein eigenes Kind zu betrachten, und zog ihn ungeachtet der Proteste von Königin Darina zusammen mit Prinz Cillian auf.
»Eure Hoheit«, sagt Bairre, und seine Stimme ist so kühl wie der Wind, der vom Tenal herüberweht. Er blickt zurück auf den Fluss und die Höflinge, die auf der anderen Seite warten.
Daphne folgt seinem Blick und nimmt die unwirtliche Kargheit des Landes mit seinem grauen Himmel, den kahlen Bäumen und dem Wildwuchs in sich auf. Beim Anblick der Höflinge in ihren tristen Samtkleidern und Hermelinmänteln hat sie Mühe, nicht zurückzuweichen. Schon jetzt sehnt sie sich nach der sanften Schönheit von Bessemia, den Rüschen, der Seide, dem Glitzer. Wenn sie die Frauen ansieht, kann sie kein einziges Schmuckstück entdecken, nicht einmal einen Hauch von Rouge. Die Menschen hier sind fade und farblos, und Daphne kann sich nicht vorstellen, dass sie sich jemals als eine von ihnen fühlen wird.
Friv ist ein raues, freudloses Land, hat ihre Mutter gesagt. Bewohnt von rauen, freudlosen Menschen. Es ist ein Land, das vom Krieg geprägt ist und nach Blut giert.
Daphne schaudert.
»Ihr könntet Euch zumindest ein Lächeln abringen«, bemerkt Bairre und reißt sie unsanft aus ihren Gedanken. »Sie sind den ganzen Weg gekommen, um Euch zu begrüßen.«
Daphne zwingt sich zu einem Lächeln, denn sie weiß, dass er recht hat. Sie kann dieses Land hassen – nichts kann das verhindern –, aber die Leute dürfen es nicht wissen.
»Bringen wir es hinter uns«, sagt Bairre mit gepresster Stimme.
Daphne wirft ihm einen verärgerten Blick zu und öffnet den Mund, um etwas zu erwidern, beißt sich dann aber auf die Zunge und schweigt. Sie hat eine dreitägige Reise hinter sich, musste ihre Schwestern und ihr Zuhause verlassen und soll nun in eiskaltes Wasser springen – verwundert es da, dass sie drauf und dran ist, jemandem den Kopf abzureißen? Aber den Bastard des Königs zu beleidigen, wird ihr nichts nützen, also lässt sie es zu, dass Cliona ihr die Stiefel auszieht, die Schnürsenkel verknotet und sich die Schuhe über die Schulter wirft. Bairre gleitet mit einem Platschen in den Fluss und streckt seinen Arm nach Daphne aus.
Die Strömung ist so wild, dass sie Bairre umzureißen droht, doch er schafft es, das Gleichgewicht zu behalten. Daphne fasst etwas Zutrauen und ergreift seinen Arm. Ihr Herz klopft so laut, dass es wohl auf der anderen Seite des Flusses zu hören sein muss, aber sie gibt sich einen Ruck und lässt sich von Bairre ins Wasser helfen.
Die Kälte raubt ihr den Atem, und sie muss sich beherrschen, nicht laut aufzuschreien. Das Wasser reicht ihr bis zu den Hüften, durchnässt ihr Samtkleid und macht den Stoff so schwer, dass sie sich nur mit Mühe aufrecht halten kann. Sie klammert sich so verzweifelt an Bairres Arm, dass sie beinahe fürchtet, ihm blaue Flecken zuzufügen.
Cliona ist als Nächste im Wasser, sie stützt Daphne auf der anderen Seite, und gemeinsam durchqueren sie den Fluss mit langsamen, vorsichtigen Schritten.
»Ihr brecht Euch noch einen Zahn ab, wenn Ihr weiter so mit den Zähnen klappert«, sagt Bairre wenig mitfühlend zu Daphne. Die Kälte scheint ihm nichts auszumachen, das Einzige, was ihn zu stören scheint, ist sie selbst.
Sie blickt ihn mit zusammengezogenen Augenbrauen von der Seite an. »Ich kann nichts dafür«, erklärt sie mit bebender Stimme. »Es ist kalt.«
Bairre hat nur ein Schnauben für sie übrig. Er schüttelt den Kopf. »Es ist eigentlich noch Sommer.«
»Es ist eiskalt und ich bin nass«, sagt sie und kann nicht verhindern, dass ihre Stimme weinerlich klingt. Wenn ihre Mutter hier wäre, würde sie Daphne am Ohr packen und zurechtweisen. Aber zumindest gelingt es Daphne noch, die Tränen zurückzuhalten. Wenn sie erst einmal zu weinen anfängt, öffnen sich alle Schleusen, das weiß sie genau, also presst sie ihre Kiefer zusammen und blickt stur geradeaus. Sie setzt einen Fuß vor den anderen und denkt an ein warmes Kaminfeuer und heißen Tee.
Als sie auf der anderen Seite des Flusses ankommen, streckt ein Mann die Hand aus, um Daphne aus dem Wasser zu helfen, aber erst als sie sicher auf frivianischem Boden steht und jemand ihr eine smaragdgrüne Flanelldecke über die Schultern legt, sieht sie die goldglänzende Krone auf seiner Stirn und erinnert sich daran, dass sie einen Knicks machen muss.
»Eure Majestät«, sagt sie zu König Bartholomew, aber die Begrüßungsworte, die man jetzt von ihr erwartet, verschwimmen in ihrem Kopf, entgleiten ihr völlig. Sie sollte eine bestimmte Formel aufsagen, ein Loyalitätsversprechen, doch alles, woran sie denken kann, ist die Kälte in ihren Gliedern.
König Bartholomew lächelt freundlich und Daphne klammert sich geradezu an dieses bisschen Wärme. »Willkommen in Friv, Prinzessin Daphne«, sagt er auf Bessemianisch, bevor er sich an Bairre wendet, der Cliona aus dem Fluss hilft.
»Wie war die Durchquerung?«, fragt er ihn auf Frivianisch.
Bairre sieht den König an und macht sich gar nicht erst die Mühe, eine Verbeugung anzudeuten, wohingegen Cliona ein wenn auch etwas zittriger Knicks gelingt. Stattdessen zuckt er mit den Schultern und schaut finster drein.
»Ich verstehe nicht, warum das jetzt noch nötig gewesen sein soll«, murmelt er mit einem Seitenblick auf Daphne.
König Bartholomew zuckt bei seinen harschen Worten zusammen, doch dann schüttelt er den Kopf.
»Es stehen wichtigere Dinge auf dem Spiel, Bairre.«
Bairre lacht, kalt und rau. »Wichtigere Dinge?«, fragt er. »Was denn? Handelswege und eine cannadraghische Prinzessin …«
Der König bringt ihn mit einem Blick zum Schweigen, bevor er zu Daphne schaut, die, in ihre wärmende Decke geschmiegt, das Gehörte zu verstehen versucht.
»Eure Mutter hat mir versichert, dass Ihr Euch fleißig vorbereitet und unsere Sprache erlernt habt«, sagt er und lächelt, auch wenn es etwas angestrengt wirkt. »Ich entschuldige mich für Bairres Manieren. Wir haben ein Zelt aufgebaut, damit Ihr Euch trockene Kleidung anziehen könnt. Lady Cliona, würdet Ihr die Prinzessin bitte begleiten und auch selbst etwas Trockenes anziehen? Da mag ich König sein, so viel ich will, Euer Vater wird meinen Kopf verlangen, wenn Ihr Euch hier den Tod holt.«
Cliona versinkt in einem Knicks. »Natürlich, Majestät.« Sie greift nach Daphnes Arm und führt sie zu einem Zelt aus Sackleinen, das zwischen zwei hohen Kiefern aufgebaut ist.
»Worüber haben sie gesprochen?«, will Daphne wissen.
»Ich bin mir nicht sicher«, sagt Cliona und beißt sich auf die Unterlippe.
»Und dieses Wort?«, fragt Daphne nach. »Cannadraghisch?«
»In Eurer Sprache gibt es keinen vergleichbaren Ausdruck«, weicht Cliona aus. »Genau genommen heißt es so viel wie weich, aber das trifft es nicht ganz. Das Wort wird verwendet, um jemanden zu beschreiben, der an ein luxuriöses Leben gewöhnt ist.«
Daphne kann zwischen den Zeilen lesen – Bairre hat sie soeben ein verwöhntes Prinzesschen genannt.
Sophronia
Es hat zwei Tage gedauert, um nach Temarin zu gelangen, und einen weiteren Tag, um die Außenbezirke der Hauptstadt Kavelle zu erreichen, aber zumindest ist die Reise bisher reibungslos verlaufen. Sophronia ist sich nicht sicher, ob es an der holprigen Straße liegt oder an ihrer Nervosität, Leopold bald persönlich zu begegnen, aber ihr ist ganz flau im Magen – vielleicht ist es auch eine Kombination aus beidem, zusammen mit dem neuen temarinischen Korsett, das so eng geschnürt ist, dass sie kaum Luft holen kann und sich ihr bei jedem Atemzug die Walknochenstäbe in den Brustkorb bohren.
Ihr bleibt nichts anderes übrig, als langsam und flach zu atmen, während sie ihren Begleiterinnen zuhört, die in schnellem Temarinisch reden, das sie nur zu drei Vierteln versteht. Sie dachte, sie würde es fließend beherrschen, aber sie hat sich noch nie mit jemandem in dieser Sprache unterhalten, der so ungeniert dem Alkohol zuspricht.
Eine der Frauen, Herzogin Henrietta, ist Leopolds Großcousine, die andere, Herzogin Bruna, ist seine Tante väterlicherseits. Als sie sich ihr vorgestellt haben, hat Sophronia stumm gelächelt und genickt, als hätte man sie nicht schon vor ihrem sechsten Geburtstag gezwungen, den königlichen Stammbaum von Temarin auswendig zu lernen. Als wüsste sie nicht, dass der Ehemann von Herzogin Bruna eine Vorliebe für Glücksspiel und Frauen hat, weshalb die einst so glanzvolle Familie hoch verschuldet ist, oder dass der älteste Sohn von Herzogin Henrietta eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Kammerdiener ihres Mannes hat. Es ist seltsam, ihnen nach so vielen Jahren, die man ihre Namen und auch die Namen und das Alter ihrer Ehemänner, Kinder und anderen Verwandten kennt, nun endlich persönlich zu begegnen. Es ist fast so, als würden Figuren aus einem Buch vor ihren Augen lebendig werden, selbst wenn diese Figuren sich als laut und betrunken herausstellen.
Sie blickt aus dem Fenster auf den stillen Wald am Stadtrand von Kavelle und versucht, nicht daran zu denken, was vor ihr liegt. In etwa einer Stunde wird sie Leopold gegenüberstehen. Es wird ihr sicherlich merkwürdig vorkommen, zumal sie sich in den letzten zehn Jahren Hunderte von Briefen geschrieben haben. Briefe, die anfangs steif und gezwungen klangen, kaum mehr als ein paar gestelzte Worte beinhalteten, die aber mit der Zeit in seitenlange Beschreibungen ausuferten, in denen sie ihre privaten Gedanken und die Einzelheiten ihres täglichen Lebens schilderten. In gewisser Weise hat sie das Gefühl, Leopold bereits besser zu kennen als irgendjemanden sonst auf der Welt, außer vielleicht ihre Schwestern.
Aber das stimmt nicht, sagt sie sich. Das Dossier, das ihre Mutter ihr gegeben hat, war Beweis genug. Der Leopold, den sie zu kennen glaubte, hätte die Steuern für seine Untertanen nicht verdreifacht, um seinen eigenen Reichtum zu vergrößern. Er hätte nicht zwei Dutzend Familien vertrieben und ihr Dorf dem Erdboden gleichgemacht, um ein neues Jagdhaus zu errichten. Er hätte nicht einen Mann hinrichten lassen, weil er sich mit Spottzeichnungen über ihn lustig gemacht hatte. Aber der echte Leopold hat all das und mehr getan, seit er im vergangenen Jahr den Thron bestiegen hat.
Sie kennt ihn nicht wirklich, genauso wenig wie er sie kennt, und das darf sie nie vergessen.
Jeder in Temarin ist unser Feind, Sophronia, hat ihre Mutter ihr eingeschärft, als sie ihr das Dossier überreichte. Wenn du das nicht bedenkst, sind wir vielleicht alle zum Untergang verdammt.

















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











