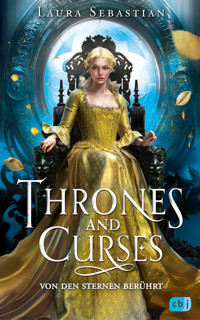9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die ASH PRINCESS-Reihe
- Sprache: Deutsch
Für die Freiheit setzt sie alles aufs Spiel
Die Fortsetzung der grandiosen »Ash Princess«! Nach ihrer spektakulären Flucht vor dem Kaiser bleibt die einstige Ash Princess Theodora eine Gefangene ihrer Pflichten: Eine strategische Heirat steht an, um Astrea mit militärischer Stärke zu befreien. Am Hof von König Eristo erhalten Theo und ihre kleine Entourage Exil, um den geeigneten Partner zu finden. Doch während Theo versucht, zwischen ihren Freunden und ihrer Geisel Prinz Sören Vertrauen zu stiften, wütet ein kaltblütiger Mörder unter den Heiratsanwärtern. Steckt der Kaiser dahinter? Dann muss auch Theo um ihr Leben fürchten. Doch da kommt von unerwarteter Seite Unterstützung ...
Dunkle und brillante Fantasy vom Feinsten, raffiniert geschrieben mit klugen Wendungen - die ASH PRINCESS kommt aus der Asche und greift nach den Sernen… Mitreißender und düster-romantischer Lesestoff für Fans von Sarah J. Maas und Victoria Aveyard.
Alle Bände der ASH PRINCESS-Reihe:
ASH PRINCESS (Band 1)
LADY SMOKE (Band 2)
EMBER QUEEN (Band 3)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 683
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Laura Sebastian
Aus dem amerikanischen Englischvon Dagmar Schmitz
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Laura Sebastian
Translated from the English language
First published as »Lady Smoke« in the United States by Delacorte Press,
an imprint of Penguin Random House US
Copyright © für die deutschsprachige Ausgabe 2019
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Übersetzung: Dagmar Schmitz
Redaktion: Heike Brillmann-Ede
Covergestaltung: Anke Koopmann | Designomicon
Covermotiv: Shutterstock.com (Azer Merz; Ironika; SayHope; Tithi Luadthong)
Karte: © 2019 by Isaac Stewart
TP · Herstellung: UK
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-21410-4V003
www.cbj-verlag.de
FÜR OMA CAROLE,eine Rebellenkönigin, wie sie im Buche steht
UND FÜR OPA RICH,der ihre Geschichten lebendig hält
Prolog
Meine Mutter sagte einmal zu mir, dass Friede für Astrea die einzige Möglichkeit sei zu überleben. Wir bräuchten keine riesigen Armeen, meinte sie, wir müssten unsere Kinder nicht zwingen, Krieger zu werden. Wir zettelten keine Kriege an wie andere Länder, weil wir nicht nach mehr Besitz strebten, als wir benötigten. Astrea genügte uns, sagte sie.
Sie hatte sich nie vorstellen können, dass der Krieg zu uns kommen würde, angezettelt oder nicht. Sie sollte gerade noch lange genug leben, um zu sehen, wie schlecht sich Frieden gegen die schmiedeeisernen Schwerter und die unersättliche Habgier der Kalovaxianer ausnahm.
Meine Mutter war eine Königin des Friedens, aber ich weiß nur zu gut, dass Friede allein nicht genügt.
Allein
Der gewürzte Kaffee rinnt süß über meine Zunge. Er ist mit einem großzügigen Klecks Honig zubereitet, auf die Art, wie ihn Crescentia liebt.
Wir sitzen unter dem Pavillon wie schon tausendmal zuvor und halten zum Schutz gegen die kühle Abendluft mit beiden Händen unsere dampfenden Porzellantassen umfasst. Einen Moment lang ist es wie früher und eine behagliche Stille umgibt uns in der Dunkelheit. Es hat mir gefehlt, mit ihr zu reden, aber das hier fehlt mir auch – die Art und Weise, wie wir schweigend beisammensitzen konnten, ohne das Bedürfnis zu haben, die Stille mit nichtssagendem Geplauder zu füllen.
Aber das ist absurd. Wie kann mir Cress fehlen, wenn sie direkt vor mir sitzt?
Sie lacht, als könne sie meine Gedanken lesen, und stellt ihre Tasse mit einem Klirren auf dem Unterteller ab, das mir durch Mark und Bein geht. Sie lehnt sich über den vergoldeten Tisch zu mir vor und ergreift mit beiden Händen meine Hand.
»Oh Thora«, sagt sie, und ihre Stimme trällert meinen falschen Namen wie eine Melodie. »Du hast mir auch gefehlt. Aber nächstes Mal verfehle ich dich nicht.«
Bevor ich aus ihren Worten klug werden kann, verändert sich das Licht, und die Sonne scheint, immer heller und heller, bis Cress vollständig angestrahlt ist, jede schauderhafte Einzelheit von ihr. Ihr Hals, der vom Kinn bis zum Schlüsselbein kohlschwarz ist und rau wie ungeschliffener Stein, verbrannt von dem Encatrio, das ich ihr servieren ließ, ihre Haare kreideweiß und spröde, ihre Lippen grau gefärbt wie die Aschekrone, die ich immer tragen musste.
Angst und Schuldgefühle überwältigen mich, als sich vor meinem geistigen Auge die Mosaiksteinchen zu einem Bild zusammenfügen. Ich denke daran, was ich ihr angetan habe und warum ich es getan habe. Ich sehe wieder ihr Gesicht auf der anderen Seite des Zellengitters vor mir, als sie mir mit einem Ausdruck eisiger Wut sagte, dass sie diejenige wäre, die meinen Tod am lautesten bejubeln würde. Ich denke daran, dass die Gitterstäbe dort, wo sie sie berührt hatte, glühend heiß waren.
Ich will ihr meine Hand entziehen, aber sie hält sie fest, und ihr Märchenprinzessinnen-Lächeln verwandelt sich in ein Grinsen, das Reißzähne entblößt, deren scharfe Spitzen von Blut und Asche bedeckt sind. Ihre Haut fühlt sich brennend heiß an, sogar noch heißer als die Haut von Blaise. Sie brennt wie Feuer, und ich versuche zu schreien, aber es kommt kein Ton heraus. Als ich schließlich meine Hand nicht mehr spüre, bin ich zunächst erleichtert. Bis ich den Blick senke und sehe, dass sie sich in Asche verwandelt hat, unter Cress’ Griff zu Staub zerfallen ist. Das Feuer bahnt sich seinen Weg meinen Arm hinauf und den anderen hinunter, breitet sich über meinen Brustkorb aus, über meinen Körper, meine Beine, meine Füße. Als Letztes geht mein Kopf in Flammen auf und ich sehe nur noch Cress und ihr monströses Lächeln.
»Na bitte. Ist es so nicht besser? Jetzt wird dich niemand mehr mit einer Königin verwechseln.«
Ich bin klitschnass, als ich aus dem Schlaf hochschrecke, die Baumwolllaken haben sich um meine Beine verheddert und sind schweißfeucht. Mir wird schlecht, und mein Mageninhalt droht hochzukommen, dabei bin ich mir nicht einmal sicher, ob ich abgesehen von ein paar Brotrinden letzte Nacht überhaupt etwas gegessen habe, das hochkommen könnte. Ich setze mich im Bett auf, lege eine Hand auf meinen Bauch, um ihn zu beruhigen, und versuche blinzelnd, meine Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen.
Es dauert einen Moment, bis ich begreife, dass ich weder in meinem Bett bin noch in meinem Gemach oder im Palast. Der Raum ist klein, das Bett kaum mehr als eine schmale Pritsche mit einer dünnen Matratze, zerschlissenen Laken und einer Decke. Mein Magen schlingert so heftig hin und her, dass ich das Gefühl habe, mich übergeben zu müssen. Bis mir schließlich klar wird, dass es keineswegs mein Magen ist, der hin und her schaukelt, sondern der Raum selbst. Mein Magen macht nur die Bewegung mit.
Die Ereignisse der letzten beiden Tage holen mich wieder ein. Das Verlies, der Urteilsspruch des Kaisers und Elpis, die vor meinen Augen einen qualvollen Tod stirbt. Ich denke an Søren, der mich gerettet hat, nur um anschließend selbst gefangen genommen zu werden. Kaum gedacht, schiebe ich den Gedanken von mir. Es gibt vieles, weswegen ich ein schlechtes Gewissen haben muss – Søren in Geiselhaft zu nehmen, kann nicht dazugehören.
Ich befinde mich auf der Smoke, erinnere ich mich. Wir sind unterwegs zu den Anglamar-Ruinen, von wo aus wir damit beginnen wollen, uns Astrea zurückzuholen. Ich bin allein in meiner Kajüte, wohlauf und in Sicherheit, während Søren irgendwo auf dem Schiff in Ketten liegt.
Ich schließe die Augen und lasse den Kopf in meine Hände sinken, doch sobald ich das tue, erscheint Cress’ Gesicht vor mir: rosige Wangen, niedliche Grübchen und große graue Augen – so wie sie aussah, als ich ihr das erste Mal begegnet bin. Mir wird das Herz schwer bei dem Gedanken an das Mädchen, das sie damals war, an das Mädchen, das ich damals war, das ihr danach nicht mehr von der Seite wich, weil in dem Albtraum, zu dem mein Leben geworden war, Cress meine einzige Rettung war. Allzu schnell wird dieses Bild von Cress durch das ersetzt, wie sie bei unserer letzten Begegnung aussah: voller Hass in ihren kalten grauen Augen und die Haut an ihrem Hals rau und schwarz verkohlt.
Sie hätte das Gift eigentlich nicht überleben dürfen. Wenn ich sie nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich es nicht glauben. Einerseits bin ich froh, dass sie noch lebt, andererseits werde ich nie vergessen, wie sie mich angesehen hat, als sie schwor, Astrea und alle seine Bewohner niederzubrennen. Und wie sie sagte, sie würde den Kaiser fragen, ob sie nach meiner Hinrichtung meinen Kopf behalten dürfe.
Ich lasse mich auf den Rücken zurückfallen und lande mit einem dumpfen Geräusch auf dem dünnen Kissen. Mein ganzer Körper schmerzt vor Erschöpfung, aber mein Verstand will einfach nicht zur Ruhe kommen. Trotzdem schließe ich die Lider und versuche, jeden Gedanken an Cress aus meinem Kopf zu verbannen, doch sie lässt sich nicht vertreiben, lauert weiter wie ein Gespenst im Hintergrund.
Im Raum ist es zu ruhig, so ruhig, dass die Lautlosigkeit ein eigenes Geräusch ist. Mir fehlt das Atmen meiner Schatten, die winzig kleinen Bewegungen, wenn sie auf dem Stuhl hin und her rutschen, mir fehlt ihr Flüstern. Es ist eine ohrenbetäubende Art von Stille. Ich drehe mich von einer Seite auf die andere und ziehe fröstelnd die Decke enger um mich, bis ich erneut das Feuer von Cress’ Berührung spüre und die Decke von mir strample, bis sie in einem Wust auf den Boden fällt.
An Schlaf ist nicht zu denken. Ich rolle mich aus der Koje, greife nach dem dicken Wollumhang, den Drachenfluch in meiner Kajüte zurückgelassen hat, und ziehe ihn über mein Nachthemd. Eingekuschelt und konturlos versinke ich bis zu den Fußknöcheln darin. Der Stoff ist durchgescheuert und schon so oft geflickt, dass von dem ursprünglichen Umhang vermutlich kaum ein Fitzelchen Stoff übrig ist, trotzdem ist er mir tausendmal lieber als die feinen Seidengewänder, die mich der Kaiser zu tragen gezwungen hat.
Wie immer lässt der Gedanke an den Kaiser die Flamme des Zorns in meinem Inneren so hell auflodern, dass sie mich versengt und mein Blut in einen glühenden Lavastrom verwandelt. Es ist ein Gefühl, das mir Angst macht – und das ich zugleich genieße. Blaise hat mir versprochen, dass ich eines Tages eigenhändig die Fackel an den Leichnam des Kaisers halten werde, um ihn zu Asche zu verbrennen. Es ist ein Gefühl, das erst vergehen wird, wenn ich es getan habe.
In Sicherheit
Die schmalen Gänge der Smoke sind still und verlassen, keine Menschenseele in Sicht. Die einzigen Geräusche sind das leise Fußgetrappel oben an Deck und das gedämpfte Tosen der Wellen, die gegen den Schiffsrumpf schlagen. Ich gehe einen Gang entlang, biege in einen anderen ab und suche den Weg hinauf an Deck, bis mir schließlich dämmert, dass ich mich hoffnungslos verlaufen habe. Obwohl ich dachte, eine ungefähre Ahnung von der Aufteilung der Räumlichkeiten zu haben, als uns Drachenfluch am Abend durch das Schiff führte, kommt es mir jetzt, zu dieser späten Stunde, wie ein vollkommen anderer Ort vor. Ich werfe einen Blick über meine Schulter und erwarte, einen meiner Schatten hinter mir her huschen zu sehen, bis mir wieder einfällt, dass sie nicht da sind. Niemand ist da.
Zehn Jahre lang hat mich die ständige Gegenwart anderer erdrückt und mir die Luft zum Atmen genommen. Ich habe den Tag herbeigesehnt, an dem ich sie endlich loswerden und allein sein konnte. Aber jetzt fehlen sie mir plötzlich. Sie würden mich zumindest davor bewahren, mich zu verlaufen.
Nachdem ich noch einige Male falsch abgebogen bin, entdecke ich schließlich eine steile Treppe, die an Deck führt. Ihre Stufen sind wacklig und knarzen, und ich steige sie langsam und vorsichtig hoch, aus Angst, dass mich jemand hört und mir folgen könnte. Erneut muss ich mir ins Gedächtnis rufen, dass ich mich nicht verbotenerweise irgendwohin schleiche, sondern gehen darf, wohin ich will.
Ich stoße die Tür auf, Meeresluft peitscht mir ins Gesicht und weht mein Haar in alle Richtungen. Ich streiche es mit einer Hand zurück, um es mir aus den Augen zu halten, und ziehe mit der anderen Hand meinen Umhang enger um mich. Wie abgestanden die Luft unten war, merke ich erst jetzt, als frische Luft in meine Lunge strömt.
An Deck arbeiten ein paar Besatzungsmitglieder. Es ist eine kleine Rumpfmannschaft, die dafür sorgt, dass die Smoke mitten in der Nacht nicht vom Kurs abkommt oder sinkt. Aber sie sind zu übernächtigt und viel zu sehr auf ihre Arbeit konzentriert, um mehr als einen flüchtigen Blick für mich übrig zu haben, als ich an ihnen vorbeihaste.
Die Nacht ist kalt, erst recht bei dem grimmigen Wind, der hier draußen auf See herrscht. Ich verschränke die Arme vor dem Oberkörper und gehe zügig Richtung Schiffsbug. Mag sein, dass ich mich erst noch daran gewöhnen muss, allein zu sein, aber ich glaube nicht, dass ich jemals von der endlosen Weite des Horizonts genug bekommen werde. Keine Mauern, keine Begrenzungen. Nur Luft und Meer und Sterne. Der Himmel ist übersät von Sternen, so vielen, dass es schwerfällt, einen bestimmten auszumachen. Artemisia hat mir erklärt, dass sich Seefahrer an den Sternen orientieren, um ein Schiff zu steuern, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie das möglich sein soll. Es sind einfach viel zu viele, um schlau daraus zu werden.
Der Bug des Schiffes ist nicht so menschenleer, wie ich gehofft hatte. Vorn an der Reling steht eine einsame Gestalt, vorgebeugt, die Schultern hochgezogen, starrt sie auf den Ozean hinunter. Noch bevor ich nah genug bin, um die Gesichtszüge zu erkennen, weiß ich, dass es Blaise ist. Er ist der einzige Mensch, den ich kenne, der in dieser lässigen Körperhaltung eine derart fiebrige Energie verströmt.
Erleichterung durchflutet mich und ich eile auf ihn zu.
»Blaise.« Ich berühre seinen Arm. Die Hitze seiner Haut und die Tatsache, dass er um diese Stunde noch wach ist, zerreißen mir das Herz und wollen meine Gedanken auch noch in andere Richtungen zerren, aber ich lasse es nicht zu. Nicht jetzt. Jetzt brauche ich einfach nur meinen ältesten Freund.
Er wendet sich überrascht zu mir um und lächelt, allerdings etwas verhaltener als sonst.
Wir haben nicht mehr miteinander gesprochen, seit wir heute Nachmittag an Bord gekommen sind, und offen gestanden habe ich mich insgeheim ein bisschen davor gefürchtet. Ihm wird inzwischen klar sein, dass ich auf der Fahrt zur Smoke unsere Becher vertauscht und ihm den Tee gegeben habe, den er eigentlich für mich mit einem Schlaftrunk versetzt hatte. Er wird auch wissen, warum ich es getan habe. Doch das ist kein Gespräch, das ich jetzt führen will.
»Konntest du nicht schlafen?«, fragt er mich und blickt erst um sich, bevor er mich wieder ansieht. Er öffnet den Mund, schließt ihn aber gleich wieder und räuspert sich. »Es ist nicht so einfach, sich daran zu gewöhnen, auf einem Schiff zu schlafen. Bei dem Geschaukel und dem Geräusch der Wellen …«
»Daran liegt es nicht«, sage ich. Ich will ihm von meinem Albtraum erzählen, kann mir aber schon denken, was er dazu sagen wird: Es war bloß ein Traum. Es ist nicht wirklich passiert. Cress ist nicht hier, sie kann dir nichts tun.
Das mag zwar stimmen, trotzdem gelingt es mir nicht, daran zu glauben. Und außerdem will ich nicht, dass Blaise erfährt, wie sehr mich der Gedanke an Cress noch immer beschäftigt, wie schwer das, was ich ihr angetan habe, auf meinem Gewissen lastet. In Blaises Vorstellung ist die Sache klar: Cress ist der Feind. Er würde meine Schuldgefühle nicht verstehen, und schon gar nicht die Sehnsucht, die in mir aufkeimt. Er würde nicht verstehen, wie sehr mir Cress fehlt, selbst jetzt noch.
»Ich habe dir nichts von Drachenfluch erzählt«, sagt er nach einer Weile, unfähig mich anzusehen. »Ich hätte dich warnen müssen. Es kann keine angenehme Überraschung gewesen sein, einer Fremden gegenüberzustehen, die das Gesicht deiner Mutter hat.«
Ich lehne mich neben ihn an die Reling, und wir starren beide nach unten, dorthin, wo die Wellen gegen den Schiffsrumpf schlagen.
»Du hättest es mir vermutlich erzählt, wenn ich nicht unsere Teebecher vertauscht hätte«, gebe ich zu bedenken.
Er schweigt und einen Moment lang hört man nur das Meer. »Und warum hast du es getan?«, fragt er dann leise, als sei er sich nicht sicher, ob er die Antwort hören will.
Und auch ich bin mir nicht sicher, ob ich sie ihm geben will, aber tief in meinem Inneren hege ich die Hoffnung, dass er sie mit einem Lachen abtut und mir sagt, dass ich mich irre.
Ich hole tief Luft, um mich zu stählen. »Bevor wir Astrea verlassen haben, hat mir Erik erklärt, was Berserker sind, und er hat auch erklärt, woran man sie erkennt«, sage ich langsam.
Blaise neben mir erstarrt, schaut mich aber nicht an und unterbricht mich auch nicht, deshalb fahre ich fort. »Er sagte, wenn sich die Minenkrankheit verschlimmert, zeigt sich das an fiebrig heißer Haut und Unbeherrschtheit mit unkontrollierbaren Ausbrüchen von Magie, Gefühlsschwankungen und Schlaflosigkeit.«
Blaise stößt zitternd den Atem aus. »So einfach ist das nicht«, sagt er leise.
Ich schüttle den Kopf, um ihn wieder klar zu bekommen, drücke mich von der Reling ab und verschränke die Arme vor der Brust. »Du bist gesegnet«, erwidere ich. »Du hast die Mine überlebt und deine Flucht liegt jetzt schon Jahre zurück. Du leidest nicht an der …« Ich bringe es nicht über die Lippen. Minenkrankheit. Es ist nur ein Wort, das für sich genommen eigentlich harmlos klingt. Aber es bedeutet sehr viel mehr als eine Krankheit, die man auskurieren könnte.
Ich will unbedingt, dass er mir bestätigt, dass ich recht habe und er keinesfalls an dem tödlichen Wahnsinn leidet. Dass es keinesfalls so schlimm ist. Doch er bleibt stumm. Wie versteinert, die Schultern hochgezogen und die Arme auf den Ellbogen aufgestützt, verharrt er über die Reling gebeugt, die Hände so fest vor sich verschränkt, dass die Fingerknöchel weiß hervortreten.
»Ich weiß es nicht, Theo«, sagt er schließlich. »Ich glaube nicht, dass ich … krank bin.« Er ist ebenfalls nicht in der Lage, das Wort auszusprechen. »Aber ich habe auch nie das Gefühl gehabt, gesegnet zu sein.«
Das Geständnis kommt als Flüstern und verliert sich in der Nachtluft, um nie wieder in Worte gefasst zu werden. Ich frage mich, ob es das erste Mal ist, dass er es ausgesprochen hat.
Ich berühre ihn an der Schulter, damit er mich ansieht, und lege meine Hand auf die Narbe an seiner Wange, die zeigt, dass er von Glaidi auserkoren wurde. »Ich habe gesehen, welche Magie in dir steckt, Blaise«, erwidere ich. »Glaidi hat dich gesegnet, ich weiß es. Vielleicht unterscheidet sich die Kraft deiner Magie von der Magie anderer Hüter, aber sie ist nicht … es ist keine Krankheit. Es ist etwas anderes, es ist weit mehr als das. Es kann gar nicht anders sein.«
Für einen kurzen Moment sieht er aus, als wolle er mir widersprechen, dann legt er seine Hand auf meine und lässt sie dort. Ich bemühe mich, nicht darauf zu achten, wie heiß seine Haut ist.
»Warum konntest du nicht schlafen?«, fragt er mich.
Ich kann ihm nicht von meinem Albtraum erzählen, aber ihn anlügen kann ich auch nicht. Ich entscheide mich für den Mittelweg und sage ihm die halbe Wahrheit.
»Ich kann nicht schlafen, wenn ich alleine bin«, antworte ich, als wäre es so einfach. Wir wissen beide, dass dem nicht so ist.
Ich warte, was er dazu sagt, darauf, dass er mir erklärt, wie absurd es ist, dass es mir nicht fehlen sollte, Schatten zu haben, die mir auf Schritt und Tritt folgen und jede meiner Bewegungen beobachten. Aber natürlich sagt er das nicht. Er weiß, dass es nicht das ist, was ich zum Ausdruck bringen will.
»Ich werde mit dir schlafen«, erwidert er, bevor ihm klar wird, was er gerade gesagt hat. Es ist zu dunkel, um es mit Sicherheit sagen zu können, aber ich glaube, seine Ohren färben sich rot. »Ich meine … na ja, du weißt, was ich meine. Ich kann bei dir bleiben, wenn es dir hilft.«
Ich lächle schwach. »Ich glaube, das wird es«, sage ich, und weil ich nicht widerstehen kann, belasse ich es nicht dabei. »Ich könnte bestimmt noch viel ruhiger schlummern, wenn ich wüsste, dass du ebenfalls versuchen würdest zu schlafen.«
»Ach, Theo«, sagt er seufzend.
»Ich weiß«, sage ich. »So einfach ist es nicht.«
Als Blaise und ich uns auf den Weg zu meiner Kajüte machen, spüre ich die Augen der Besatzung auf uns. Ich kann mir vorstellen, wie es für sie aussehen muss, wenn wir beide um diese Stunde gemeinsam unter Deck gehen. Noch vor Sonnenaufgang werden alle darüber tuscheln, dass Blaise und ich ein Liebespaar sind. Mir wäre es zwar lieber, wenn überhaupt nicht über mich getuschelt würde, wenn dieses Getuschel jedoch das Gerücht über Søren und mich in den Hintergrund drängt, habe ich nichts dagegen.
Eine Romanze zwischen mir und Blaise ist deshalb ein besseres Gerücht, weil es etwas ist, das die Besatzung rückhaltlos befürwortet, und sei es nur aus einem einzigen Grund: Er ist Astreaner. Und je mehr Rückhalt ich in der Besatzung habe, desto besser. Unwillkürlich muss ich daran denken, wie abweisend und abschätzig Drachenfluch mir gegenüber war, als ich an Bord kam. Sie hat mit mir gesprochen, als wäre ich ein verwirrtes Kind und keine Königin. Ihre Königin. Ich fürchte, es wird noch schlimmer werden.
Ich zwinge mich, diesem Gedanken nicht länger zu folgen. Wie bin ich bloß so berechnend geworden? Ich empfinde eine tiefe Zuneigung für Blaise, und ich weiß, er erwidert dieses Gefühl, aber darüber habe ich nicht einen Moment nachgedacht. Stattdessen kam mir sofort eine Verschwörung in den Sinn, und ich habe überlegt, wie ich Blaise zu meinem Vorteil nutzen kann. Wie konnte ich nur so ein Mensch werden?
Ich denke schon wie der Kaiser. Die Erkenntnis jagt mir einen Schauder über den Rücken.
Blaise spürt es. »Geht es dir gut?«, fragt er, als ich die Tür zu meiner Kajüte öffne und ihn hineinführe.
Ich drehe mich zu ihm um und verbanne die Stimme des Kaisers aus meinem Kopf. Ich überlege nicht, ob jemand Blaise und mich hereinkommen sah oder was die Leute sagen werden oder wie ich das Gerede zu meinem Vorteil nutzen kann. Ich denke nicht über das nach, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ich denke nur an uns beide, allein in diesem Raum.
»Danke, dass du bei mir bleibst«, sage ich anstelle einer Antwort.
Er lächelt kurz und wendet den Blick ab. »Du tust mir einen Gefallen. Ich teile die Kajüte mit Heron, und er schnarcht laut genug, um das ganze Schiff erbeben zu lassen.«
Ich lache.
»Ich werde mich auf den Boden legen, während du schläfst«, sagt er.
»Tu das nicht«, sage ich zu meiner eigenen Verwunderung.
Seine Augen weiten sich leicht, als er mich ansieht. Eine gefühlte Ewigkeit lang stehen wir wie festgewachsen und schweigen, bis ich den Bann breche. Ich trete auf ihn zu und nehme seine Hand.
»Theo«, sagt er, doch ich halte ihm einen Finger an die Lippen, bevor er diesen Moment mit Bedenken verderben kann, die ich nicht hören will.
»Kannst du mich … kannst du mich einfach nur in den Armen halten?«, bitte ich ihn.
Er seufzt, und ich weiß, er will ablehnen und zur Vorsicht mahnen, erklären, dass er besser Abstand wahren sollte, weil ich nicht mehr seine Freundin aus Kindertagen bin. Ich bin seine Königin und das macht alles sehr viel komplizierter. Deshalb spiele ich eine Karte aus, von der ich weiß, dass er dazu nicht Nein sagen kann.
»Ich fühle mich dann sicherer, Blaise. Bitte.«
Sein Blick wird sanft, und ich weiß, ich habe ihn. Ohne ein Wort nehme ich meine Hand von seinen Lippen und ziehe ihn mit mir auf die Koje. Wir passen perfekt zusammen, sein Körper an meinen geschmiegt, seine Arme um mich gelegt. Sogar hier auf dem Meer duftet er nach Herdfeuer und Gewürzen. Nach zu Hause. Seine Haut ist glühend heiß, doch darüber will ich jetzt nicht nachdenken. Ich spüre seinen Herzschlag in mir, im Gleichtakt mit meinem, und lasse mich davon in den Schlaf lullen.
Familienbande
Als ich aufwache, ist Blaise fort, und in der Kajüte ist es viel zu kalt ohne ihn. Auf dem Kissen neben meinem Kopf liegt eine Nachricht:
Ich habe heute Morgen Dienst und muss das Deck schrubben. Wir sehen uns heute Abend.
Der Deine,
Blaise
Der Deine. Die Worte gehen mir nicht aus dem Kopf, als ich versuche, meine zerzausten Locken zu glätten und meine zerknitterten Kleider zu richten, um einigermaßen vorzeigbar zu sein. In einem anderen Leben wäre ich angesichts seiner Wortwahl vermutlich hingerissen, aber hier und jetzt nagt sie an mir. Es dauert einen Moment, bis mir der Grund dafür klar wird: Genauso hat auch Søren seine Briefe unterschrieben.
Ich versuche, mit meinen Gedanken nicht zu lange bei Søren zu verweilen. Er ist am Leben und in Sicherheit, das ist alles, was ich derzeit für ihn tun kann. Es ist mehr, als er verdient hat, nach dem, was er in Vecturia verbrochen hat. An seinen Händen klebt zu viel Blut, um sie je wieder reinwaschen zu können.
Und was ist mit deinen Händen?, flüstert eine Stimme in meinem Kopf. Sie klingt wie die Stimme von Cress.
Ich ziehe die Stiefel an, dir mir Drachenfluch gegeben hat. Sie sind eine Nummer zu groß und sitzen so lose, dass die Absätze beim Gehen auf den Boden knallen. Aber ich kann mich nicht beschweren, besonders wenn man bedenkt, dass ich im Gegensatz zu Blaise keine Arbeiten auf dem Schiff zu verrichten habe. Bei Drachenfluchs Führung über das Schiff gestern Abend hat sie erklärt, dass jeder eine Aufgabe zugewiesen bekommt, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Heron macht täglich Kombüsendienst und Artemisia muss sich jeden Tag für ein paar Stunden um die Segel kümmern. Sogar die Kinder übernehmen kleinere Aufgaben: Sie schenken zur Essenszeit Wasser aus oder erledigen Botengänge für Drachenfluch.
Ich habe Drachenfluch gefragt, was ich tun könne, um zu helfen, aber sie hat bloß gelächelt und herablassend meine Hand getätschelt.
»Du bist unsere Prinzessin. Das genügt. Mehr musst du nicht für uns tun.«
Ich bin eure Königin, hatte ich ihr entgegnen wollen, die Worte aber nicht über die Lippen gebracht.
Als ich auf Deck hinaustrete, steht die Sonne überraschend hoch am Himmel und ist so gleißend hell, dass sie mich blendet. Wie lange habe ich geschlafen? Es muss schon fast Mittag sein, auf dem Schiff herrscht emsiges Treiben. Ich suche das überfüllte Deck nach einem mir bekannten Gesicht ab, blicke aber nur in ein Meer von fremden Gesichtern.
»Euer Majestät«, sagt ein Mann. Er trägt einen Eimer Wasser und verbeugt sich im Vorbeieilen.
Ich öffne den Mund zu einer Erwiderung, aber bevor ich etwas sagen kann, knickst eine Frau und wiederholt den Gruß. Nach einer Weile wird mir klar, dass es vermutlich das Beste ist, als Antwort einfach nur zu lächeln und zu nicken.
Und so gehe ich lächelnd und nickend das Deck entlang und halte Ausschau nach jemandem, den ich kenne, aber kaum habe ich ein mir bekanntes Augenpaar entdeckt, wünschte ich, es wäre anders.
Elpis’ Mutter Nadine steht unter dem Großsegel, den Wischmopp in der Hand, mit dem sie die Planken schrubbt und den sie jetzt wie erstarrt in der Luft hält, während schmutziges Wasser herabtropft. Sie lässt mich nicht aus den Augen, auch wenn ihr Gesicht ausdruckslos bleibt. Die Ähnlichkeit mit ihrer Tochter ist so frappierend, dass es mir bei unserer ersten Begegnung die Sprache verschlagen hat. Sie hat das gleiche runde Gesicht und die gleichen tief in den Höhlen liegenden, großen dunklen Augen wie Elpis.
Als ich ihr gestern Abend nach Drachenfluchs Führung durch das Schiff von Elpis’ Tod berichtete, blieb sie höflich und sagte trotz ihrer Tränen nur das Richtige. Sie dankte mir, weil ich versucht hätte, ihre Tochter zu retten, ihr eine Freundin war, und dafür, dass ich dem Kaiser Rache geschworen hätte, doch es klang schal, und mir wäre es lieber gewesen, sie hätte mich beschimpft und mir vorgeworfen, ihre Tochter auf dem Gewissen zu haben. Ich glaube, es wäre sogar eine große Erleichterung gewesen, wenn jemand meine Schuldgefühle in Worte gefasst hätte.
Sie reißt den Blick von mir los und konzentriert sich wieder aufs Putzen, wobei sie so heftig schrubbt, als wolle sie ein Loch ins Holz reiben.
»Theo«, ruft eine Stimme hinter mir.
Ich bin so dankbar für die Ablenkung, dass ich einen Moment brauche, bevor mir aufgeht, dass es Artemisia ist.
Sie steht an die Reling gelehnt und hat das Gleiche an wie ich: eine enge braune Hose und ein weißes Baumwollhemd. Wobei ihr die Sachen irgendwie besser stehen, als hätte sie sich aus freien Stücken so gekleidet und nicht, weil es nun mal nichts anderes gibt. Sie hat den Körper dem Wasser zugewandt und hält die Arme vor sich ausgestreckt, obwohl sie mich jetzt gerade ansieht. Ihre Haare, die in zerzausten weißen Wellen über ihre Schultern fallen, gehen an den Spitzen in ein leuchtendes Himmelblau über. Wie in einem Nest sitzt darin die Spange, die ich von Crescentia stibitzt habe und deren dunkelblaue Wasser-Magiesteine im Sonnenlicht glitzern. Ich weiß, dass Artemisia wegen ihrer Haare Hemmungen hat, und bemühe mich, sie nicht anzustarren, aber es fällt mir schwer. An ihrer Hüfte trägt sie einen Dolch mit einem goldverzierten Griff. Erst denke ich, es sei meiner, aber das kann nicht sein. Mein Dolch lag vorhin noch unter meinem Kopfkissen versteckt in meiner Kajüte.
Es dauert einen Augenblick, bis ich erkenne, was sie tut. Die Wasser-Magiesteine in ihrem Haar glitzern nicht einfach nur in der Sonne; sie glühen, weil sie ihren Zauber einsetzt. Und wenn ich genauer hinschaue, sehe ich die Magie ihren Fingern entströmen, so hauchfein wie der Wasserdunst über dem Meer.
»Was machst du da?«, frage ich und nähere mich ein wenig misstrauisch. Ich bilde mir gern ein, ich hätte keine Angst vor Artemisia, aber ich wäre schön dumm, wenn ich keine hätte. Sie ist ein furchterregendes Geschöpf, sogar ohne ihre Magie.
Sie grinst schelmisch und verdreht die Augen. »Meine Mutter findet, wir sollten schneller segeln, für den Fall, dass uns die Kalovaxianer verfolgen.«
»Deshalb hat sie dich um Hilfe gebeten?«
Artemisia lacht. »Oh nein, meine Mutter würde niemals irgendjemanden um Hilfe bitten, nicht einmal mich«, sagt sie. »Nein, sie hat es mir befohlen.«
Ich lehne mich neben sie an die Reling. »Ich hätte nicht gedacht, dass du dir von irgendjemandem etwas befehlen lässt.«
Sie schweigt und zuckt nur mit den Schultern.
Ich schaue hinaus in die endlose Weite der blauen Wellen, die sich bis zum Horizont ausdehnt. Ich kann auch die anderen Schiffe aus Drachenfluchs Flotte erkennen, die im Kielwasser der Smoke folgen. »Also, was machst du?«, frage ich noch einmal.
»Ich verändere die Gezeiten zu unseren Gunsten, sodass sie mit uns gehen und nicht gegen uns«, antwortet sie.
»Das erfordert eine ziemlich starke Magie. Bist du sicher, dass du allein damit fertigwirst?«
Ich will sie mit der Frage nicht kränken, aber Artemisia reagiert gereizt. »Es ist nicht so schwer, wie es scheint. Man muss lediglich ein Gewässer dazu bringen, das zu tun, was es ohnehin tun will, nur eben in eine andere Richtung. Buchstäblich ein Gezeitenwechsel. Und es ist ja nicht so, als ob ich das ganze Calodische Meer umwandle, bloß das Stück Wasser rund um unsere Flotte.«
»Du wirst schon wissen, was du tust«, erwidere ich.
Wir schweigen beide, während ich sie weiter bei der Arbeit beobachte, sehe, wie sie anmutig ihre über das Meer ausgestreckten Hände in der Luft dreht und feiner magischer Wasserdunst aus ihren Fingerspitzen strömt.
Sie ist meine Cousine, erinnere ich mich plötzlich wieder, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass mir dieser Gedanke irgendwann einmal weniger abstrus vorkommen wird. Wir sind so verschieden, wie zwei Menschen nur sein können, doch unsere Mütter waren Schwestern. Sogar Zwillinge.
Als ich Artemisia das erste Mal sah, veränderte sich ihre Haarfarbe, die das Kennzeichen für ihre Wassermagie ist und zwischen Weiß und Kobaltblau changiert, zu einem ins Rötliche spielenden Dunkelbraun. In dem Moment dachte ich, sie würde sich über mich lustig machen oder mich in Verlegenheit bringen wollen, aber Mahagonibraun muss früher auch ihre Haarfarbe gewesen sein, wie bei unseren Müttern und bei mir. Artemisia muss die ganze Zeit gewusst haben, dass wir Cousinen sind, hat aber nie ein Wort gesagt.
In unseren Adern fließt dasselbe Blut, denke ich, und was für eins.
»Findest du es nicht seltsam, dass wir vom Feuergott abstammen, du aber von der Wassergöttin auserkoren wurdest?«, frage ich.
Sie wirft mir einen Blick von der Seite zu. »Eigentlich nicht«, sagt sie. »Ich bin nicht besonders gläubig, das weißt du. Vielleicht stammen wir wirklich von Houzzah ab, vielleicht ist es aber auch nur ein Märchen, das unserer Familie den Anspruch auf den Thron sichern soll. Jedenfalls glaube ich nicht, dass Magie etwas mit Blut zu tun hat. Heron sagt, Suta hätte mich in ihrem Tempel gesehen und unter allen, die dort waren, auserkoren und mit der Gabe gesegnet, aber ich weiß nicht, ob mir diese Version besser gefällt.«
»Und welche Version gefällt dir?«, hake ich nach.
Sie antwortet nicht, sondern konzentriert sich weiter auf das Meer vor ihr, wobei sie ihre Hände mit der Anmut einer Tänzerin durch die Luft bewegt. »Warum interessierst du dich so für meine Gabe?«, fragt sie dann.
Jetzt ist es an mir, mit den Schultern zu zucken. »Aus keinem besonderen Grund. Die meisten Menschen interessieren sich dafür, nehme ich an.«
»Nein, eigentlich nicht«, erwidert sie stirnrunzelnd und zieht die Hände abrupt nach links und wieder vor sich zurück. »Meist erzählen mir die Leute nur, wie gesegnet ich sei. Manchmal streichen sie mir dabei übers Haar. Ich hasse das. Jedenfalls stellen sie mir nie Fragen. Damit würden sie nur Gefahr laufen, etwas über das Leben in der Mine zu erfahren, und davon wollen sie nichts hören. Besser, die Leute stellen sich das Ganze als etwas Mystisches vor, das ihr Vorstellungsvermögen übersteigt.«
»Du würdest dich wundern, wie wenig es gibt, das mein Vorstellungsvermögen übersteigt«, erwidere ich leichthin, obwohl mir ihre Worte einen Stich versetzen.
Falls Artemisia mein Unbehagen bemerkt, geht sie nicht darauf ein. »Du hast furchtbar lange geschlafen«, sagt sie stattdessen.
Es klingt ein bisschen spitz, aber nicht so spitz wie ihre Bemerkungen sonst. So war es gestern schon, nachdem wir an Bord der Smoke gekommen waren. Sie sprach viel leiser und ihre Bewegungen waren fahriger als gewöhnlich. So kenne ich Artemisia eigentlich nicht. Von dem Biss oder Sarkasmus, den ich von ihr gewohnt bin, ist nichts mehr zu merken. Im Schatten ihrer Mutter ist sie kaum noch sie selbst.
»Ich hatte nicht vor zu verschlafen. Ich war fast die ganze Nacht wach …«
»Blaise sagt, du hast dich nicht gut gefühlt«, unterbricht sie mich, aber der süffisante Blick, den sie mir dabei zuwirft, sagt mir, dass sie im Grunde etwas ganz anderes meint. Die Gerüchteküche scheint schon zu brodeln.
Meine Wangen brennen. »Ich bin wohlauf«, erwidere ich und überlege, wie ich am geschicktesten das Thema wechsele. Nach einer Weile deute ich mit einem Nicken zu dem Dolch an ihrer Hüfte. »Wozu brauchst du den?«
Sie senkt die Hände und der Magiestrom verebbt. Achtlos berührt sie den goldverzierten Griff auf die gleiche gedankenverlorene Weise, in der die Frauen bei Hof an ihrem Schmuck nesteln. »Ich wollte nachher versuchen, ein wenig damit zu üben«, gesteht sie. »Ich hatte kaum noch Gelegenheit, den Dolch zu benutzen, nachdem ich deine Schatten aus dem Weg geräumt hatte, deshalb bin ich etwas eingerostet.«
»Du hast sie umgebracht?«
Sie stößt ein verächtliches Schnauben aus. »Was dachtest du denn? Wer sonst? Heron sagt, es verstößt gegen seine Gabe, jemandem Schaden zuzufügen, und Blaise macht sich nur ungern die Hände schmutzig, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Er hätte es vermutlich selbst getan, wenn ich ihn darum gebeten hätte, aber …« Sie verstummt.
»… aber du tust es gern«, beende ich den Satz für sie. »Es gefällt dir.«
Ihre Augen blitzen und ihr Lächeln ist grimmig. »Es ist ein gutes Gefühl, sich revanchieren zu können«, sagt sie, und ich mache mich schon auf eine spitze Bemerkung darüber gefasst, dass ich Søren nicht töten konnte, als ich die Gelegenheit dazu hatte, aber die kommt nicht.
»Ich kann es dir beibringen«, sagt sie zu meiner Verwunderung stattdessen. »Wie man mit einem Dolch umgeht, meine ich.«
Ich schaue auf die Waffe und versuche, mir vorzustellen, wie ich sie benutzen würde. Nicht so, wie ich es im Tunnel mit Søren gemacht habe, mit zitternden Händen und lähmendem Zweifel, sondern wie jemand, der weiß, was er tut. Ich denke an den säuerlichen Atem des Kaisers an meinem Hals, daran, wie seine Hand meine Taille umfasste und über meine Hüfte strich. Ich fühlte mich in diesen Momenten hilflos – und ich will mich nie wieder hilflos fühlen. Ich schiebe den Gedanken weit von mir. Ich bin keine Mörderin.
»Nach Ampelio … nein, ich … ich glaube nicht, dass ich das Zeug dazu habe …« Ich zögere und wünschte, es wäre anders.
»Ich glaube, du würdest dich wundern, wozu du alles das Zeug hast«, sagt Artemisia.
Bevor ich etwas entgegnen kann, werden wir vom Klang sich nähernder Absätze unterbrochen, deren Klacken lauter und energischer klingt als die Schritte anderer Leute. Artemisia scheint die Gangart zu erkennen, denn sie schrumpft schon in sich zusammen, noch bevor sie sich umdreht.
»Mutter«, sagt sie, und ihre Hand auf dem Dolchgriff beginnt fahrig zu zucken.
Eine nervöse Angewohnheit, begreife ich, obwohl ich gestern bei der Vorstellung, dass irgendjemand Artemisia nervös machen könnte, noch gelacht hätte. Ich stähle mich innerlich und drehe mich ebenfalls um. »Drachenfluch«, sage ich.
Selbstsicher und hocherhobenen Hauptes steht sie vor uns und scheint mehr Raum einzunehmen, als es bei ihrer Größe eigentlich der Fall sein dürfte. Sie hat die gleiche Kluft an wie die anderen Besatzungsmitglieder, abgesehen vom Schuhwerk. Anstelle schwerer Arbeitsstiefel trägt Drachenfluch Stiefel mit kniehohem Schaft und breiten, hohen Absätzen. Anfangs habe ich mich gefragt, ob es wirklich zweckmäßig ist, auf einem Schiff Stiefel mit solchen Absätzen zu tragen, aber sie ist noch kein einziges Mal damit gestolpert. Und sie lassen sie größer erscheinen und für ihre Mannschaft vermutlich achtunggebietender.
Als sich unsere Blicke begegnen, lächelt sie, aber es ist nicht das gleiche Lächeln wie das meiner Mutter. Vielmehr sieht sie mich ähnlich nachdenklich an, wie Cress ein Gedicht zu betrachten pflegte, dessen Übersetzung ihr Mühe bereitete.
»Ich freue mich zu sehen, dass ihr beide euch versteht«, sagt sie, klingt aber keineswegs erfreut, sondern leicht gereizt, als hätte sie sich über irgendetwas geärgert, wobei ich vermute, dass sie immer so klingt.
»Natürlich verstehen wir uns«, sage ich und probiere es mit einem Lächeln. »Artemisia war unersetzlich, als es darum ging, mich aus dem Palast herauszuholen und den Theyn umzubringen. Ohne sie hätten wir es nie geschafft.«
Artemisia steht stumm neben mir und hält den Blick auf die Holzplanken unter den Stiefeln ihrer Mutter gesenkt.
»Ja, sie ist wirklich etwas Besonderes. Das einzige Kind, das mir geblieben ist, weshalb sie mir umso unersetzlicher ist.«
Sie sagt es mit einem Unterton, der Artemisia zusammenzucken lässt. Art hatte einen Bruder. Ich weiß, dass er mit ihr in der Mine war, bis er die Krankheit bekam und von einem Wächter ermordet wurde, den Art später getötet hat. Bevor ich zu viel über die Spannungen zwischen Artemisia und ihrer Mutter nachdenken kann, reißt mich Drachenfluch aus meinen Grübeleien.
»Wir müssen überlegen, wie es weitergehen soll, Theo. Lass uns in meiner Kammer darüber sprechen.«
Ich setze zu einer Erwiderung an, doch Art kommt mir zuvor. »Euer Majestät«, mahnt sie leise, wobei sie ihre Mutter immer noch nicht ansieht.
»Mmh?«, fragt Drachenfluch. Danach zu urteilen, wie sie ihre Schultern verkrampft, hat sie ihre Tochter allerdings ganz genau verstanden.
Artemisia hebt endlich den Blick und sieht ihrer Mutter in die Augen. »Du solltest sie mit Euer Majestät anreden, besonders dann, wenn dich andere hören können.«
Drachenfluchs Lächeln ist angespannt wie ein Bogen vor dem Schuss. »Natürlich, du hast vollkommen recht«, sagt sie, wobei die Worte gezwungen klingen. Sie wendet sich wieder mir zu und deutet eine Verbeugung an. »Erbitte untertänigst Eure Anwesenheit in meiner bescheidenen Kammer, Euer Majestät. Besser so, Artemisia?«, fragt sie.
Art antwortet nicht. Ihre Wangen sind knallrot und sie senkt abermals den Blick.
»Ist schon gut«, sage ich und lenke Drachenfluchs Aufmerksamkeit auf mich, bevor sie ihre Tochter endgültig in ein Häufchen Staub verwandelt.
Drachenfluch lässt den Blick stirnrunzelnd erst zu mir und dann zurück zu Artemisia wandern. »Und dir habe ich aufgetragen, dich bis zum Mittag um die Gezeiten zu kümmern. Du hast noch eine Stunde. Meinst du, das schaffst du?«
Die Aufforderung in ihrer Stimme ist unmissverständlich. Art spannt die Kiefermuskulatur an. »Jawohl, Kapitän«, sagt sie und streckt ihre Hände aufs Neue dem Meer entgegen.
Ohne ein weiteres Wort dreht sich Drachenfluch um und winkt mir, ihr zu folgen. Ich suche Artemisias Blick und schenke ihr ein aufmunterndes Lächeln, doch ich glaube nicht, dass es zu ihr durchdringt. Zum ersten Mal, seit ich sie kenne, sieht sie verloren aus.
Konflikt
Sobald wir in Drachenfluchs Kammer treten, wünschte ich, ich hätte Art gebeten mitzukommen. Es ist ein selbstsüchtiger Wunsch, schließlich konnte sie es kaum erwarten, der Gegenwart ihrer Mutter zu entkommen, aber ich wünschte es mir trotzdem. Die beiden Männer, die dort warten, sind Drachenfluch tief ergeben, und ich habe das Gefühl, in eine Falle getappt zu sein. Zwar komme ich mir nicht so ausgeliefert vor wie in der Nähe des Kaisers und des Theyn – wie ein Lamm in der Höhle des Löwen, so drückte es die Kaiserin immer aus –, doch auch nicht viel besser. In diesem Raum werde ich jedenfalls keine Verbündeten finden.
Ich bin die Königin, rufe ich mir in Erinnerung und straffe die Schultern. Ich bin meine eigene Verbündete, und das muss genügen.
Die Männer springen auf, als sie mich sehen, wobei ich vermute, dass ihre Ehrerbietung eigentlich Drachenfluch gilt.
Einer heißt Eriel und ist ein bisschen älter als Drachenfluch. Er hat einen roten Bart und kein einziges Haar mehr auf dem Kopf, und er führt das Oberkommando über Drachenfluchs gesamte Flotte – die Smoke, die Fog, die Dust, die Mist und ein halbes Dutzend kleinerer Schiffe, deren Namen mir entfallen sind. Gestern Abend hat er mir erzählt, dass er vor einigen Jahren seinen linken Arm in einer Schlacht verlor und ihn seither durch einen blank polierten schwarzen Holzstumpf ersetzt, an dessen Ende eine zur Faust geballte Hand geschnitzt ist. Der Verlust eines Arms hätte für die meisten Krieger wohl den Abschied vom Soldatenleben bedeutet, aber Eriels strategisches Geschick macht ihn unersetzlich, auch wenn er nicht mehr kämpfen kann. Drachenfluchs kleine Armee hat sich im Kampf gegen dreimal größere kalovaxianische Bataillone wacker geschlagen und das ist größtenteils Eriels sorgsamer Planung mit den Kapitänen der anderen Schiffe zu verdanken.
Der Mann neben ihm heißt Anders. Er ist ein Lord aus Elcourt, der vor zwei Jahrzehnten seinem lockeren Leben entflohen ist, damals war er noch sehr jung und suchte das Abenteuer. Das hat er gewiss gefunden. Gestern erzählte er mir, dass er die ersten Jahre, in denen er ganz auf sich allein gestellt war, nur knapp überlebt hat, denn er besaß weder nennenswerte Fertigkeiten, noch konnte er mit Geld umgehen. Geld war kein ewig sprudelnder Quell, wie er immer geglaubt hatte, sondern etwas, das man sich hart erarbeiten und notfalls auch stehlen musste. Und so zog er stehlend von Land zu Land und lernte später andere an, die das Stehlen für ihn erledigten. Als ihm auch dieses Leben zu langweilig wurde, beschloss er, Pirat zu werden, und heuerte auf Drachenfluchs Schiff an.
»Setzt euch«, befiehlt Drachenfluch, bevor ich Gelegenheit habe, etwas zu sagen.
Vielleicht hatte Artemisia recht, ihre Mutter zurechtzuweisen, weil sie mich Theo nennt. Vielleicht versucht Drachenfluch absichtlich, meine Stellung zu schwächen. Bei diesen beiden Männern dürfte ihr das nicht schwerfallen. Obwohl alle formvollendet höflich zu mir sind, seit ich an Bord gekommen bin, hege ich keinen Zweifel daran, dass ich ihrer Vorstellung von Astreas Rebellenkönigin nicht gerecht werde, wie immer die auch aussehen mag.
Aber ich bin schon von sehr vielen einschüchternden Leuten unterschätzt worden, und es kommt mir gar nicht erst in den Sinn, mich in mich selbst zurückzuziehen, nur um keine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Stattdessen richte ich mich zu meiner vollen Größe auf, wobei ich neben Drachenfluch mit ihren hohen Absätzen vermutlich zwergenhaft wirke.
»Ich danke euch, dass ihr euch zu dieser Zusammenkunft mit mir eingefunden habt«, sage ich und erwidere den Gruß der beiden Männer mit einem Nicken, bevor ich mich herausfordernd Drachenfluch zuwende, um zu sehen, ob sie es wagt, meine Aussage anzufechten. »Und ich danke dir, Tante, dass du dieses Treffen arrangiert hast.« Ich lächle süß. »Es ist an der Zeit, dass wir besprechen, wie es jetzt weitergeht. Würde einer von euch bitte so freundlich sein, Blaise und Heron hinzuzuholen?«
Drachenfluchs Nasenflügel blähen sich so unmerklich, dass es mir entgangen wäre, wenn ich nicht auf eine Reaktion von ihr gelauert hätte. Sie presst kurz die Zähne aufeinander, bevor sie den Anflug eines Lächelns auf ihre Lippen zwingt.
»Ich denke nicht, dass das nötig sein wird, Theo«, sagt sie. »Unsere besten Strategen und Diplomaten habe ich bereits hier versammelt«, sie deutet zu den beiden Männern. »Blaise und Heron haben in deiner Sache viel getan, aber sie sind noch Jungen mit wenig Erfahrung.«
Ihre dunklen Augen sind unerbittlich, und es kostet mich meine ganze Kraft, ihrem Blick nicht auszuweichen. Es sind immerhin die Augen meiner Mutter, mit denen sie mich ansieht, und wenn ich in sie hineinschaue, fühle ich mich wieder wie ein Kind. Aber ich bin kein Kind mehr, und ich kann es mir nicht erlauben, mich wie eins zu fühlen, nicht einmal für einen kurzen Moment. Es steht zu viel auf dem Spiel. Also erwidere ich ihren Blick und gestatte mir keine Unsicherheit.
»Sie sind meine Berater«, erwidere ich sanft, aber entschieden. »Ich vertraue ihnen.«
Drachenfluch legt den Kopf schräg. »Und uns vertraut Ihr nicht, Euer Majestät?«, fragt sie, und ihre Augen weiten sich. »Wir wollen nur Euer Bestes.«
Die Männer murmeln zustimmend.
»Davon bin ich überzeugt«, sage ich und lasse ein beruhigendes Lächeln aufblitzen. »Nur kennen wir uns erst so kurze Zeit, dass ich fürchte, ihr könnt noch gar nicht wissen, was das Beste für mich ist. Das wird sich bestimmt bald ändern, aber ihr werdet mir gewiss beipflichten, dass wir keine Zeit zu verlieren haben.«
»Das haben wir in der Tat nicht«, bestätigt Drachenfluch. »Weshalb es mir nicht einleuchten will, warum wir noch weitere Leute hinzuziehen sollten, wenn diejenigen, die ich bereits zusammengerufen habe, mehr als fähig sind …«
Ich falle ihr mit scharfem Tonfall ins Wort. »Wenn du Blaise und Heron gleich hättest rufen lassen, als ich dich darum gebeten habe, statt zu streiten, nur um des Streites willen, wären sie längst zu uns unterwegs. Möchtest du jetzt noch mehr Zeit vergeuden, während die Kalovaxianer ihre Bataillone aufstellen, um uns endgültig zu vernichten?«
Sie schweigt einen quälend langen Moment, aber ich kann ihren Groll spüren, der in Wellen von ihr ausgeht. Ich halte ihrem Blick stand und ihre Wut schürt meine eigene an. Undeutlich nehme ich ein schwaches Brennen an den Fingerspitzen wahr, wage es jedoch nicht, den Blick zu senken, um hinzusehen. Es kommt mir vage bekannt vor, so ähnlich hat es sich angefühlt, als ich heute Nacht aus dem Albtraum mit Cress aufwachte. Ich verschränke die Arme und schiebe meine Fingerspitzen unter die Ärmel meines Hemdes, in der Hoffnung, dass das Brennen aufhört, wenn ich es nicht beachte.
Nach einer gefühlten Ewigkeit wendet sich Drachenfluch an Anders, obwohl sich jeder Muskel in ihrem Körper dagegen zu sträuben scheint. »Geh und hol die Jungen«, weist sie ihn an. Ihre Stimme klingt angespannt. »Und beeil dich.«
Anders’ blaue Augen huschen unsicher zwischen ihr und mir hin und her, bevor er eine Verbeugung in Richtung Drachenfluch und dann zu mir andeutet. Ohne ein Wort eilt er hinaus und lässt uns in einem unbehaglichen Schweigen zurück.
Ich stimme einen stummen Triumphgesang an und vergesse meine brennenden Fingerspitzen.
»Du bist deiner Mutter kein bisschen ähnlich«, sagt Drachenfluch unvermittelt.
Und einfach so verschwindet mein Triumphgefühl. Die Worte landen wie ein Fausthieb in meinem Magen, aber sie sind weniger schmerzhaft als die Erkenntnis, dass sie recht hat. Sich ihren Widersachern entgegenzustellen, ihnen das Wort im Mund umzudrehen, hartnäckig an der eigenen Sicht der Dinge festzuhalten – das war nicht die Strategie, die meine Mutter als Königin verfolgte. Sie bezauberte, vermittelte und schlichtete. Und sie gab, wann immer sie konnte, weil sie so viel zu geben hatte.
Und noch eine Erkenntnis überkommt mich, bei der meinen Körper ein Schauder durchläuft, den ich zu unterdrücken versuche. Ich habe die Lage nicht gemeistert wie meine Mutter. Ich habe sie gemeistert wie der Kaiser.
Es vergehen einige angespannte Minuten, bevor Anders mit Blaise und Heron im Schlepptau zurückkehrt. Beide schauen verwirrt drein, als sie in den jetzt noch beengteren Raum treten und sich wortlos rechts und links neben mich stellen.
»Na endlich«, faucht Drachenfluch.
Blaise und Heron werden sich inzwischen zusammengereimt haben, was passiert ist, zumindest ein Stück weit. Sie müssen erkannt haben, dass dieses Zusammentreffen eigentlich ohne sie stattfinden sollte, dass Drachenfluch versucht hat, sie auszuschließen. Oder vielleicht erdolcht Blaise sie ja aus einem ganz anderen Grund mit seinen Blicken. Heron dagegen sieht niemanden an, sein Blick ist ernst und bedrückt und in sich gekehrt. So guckt er schon, seit wir an Bord gekommen sind, und ich fürchte, Elpis’ Tod belastet sein Gewissen noch schwerer als meins. Schließlich war es seine Aufgabe, sie aus dem Palast zu holen und auf die Smoke in Sicherheit zu bringen, nachdem sie den Theyn vergiftet hatte.
Ich lächele Drachenfluch strahlend an. »Nachdem wir nun vollzählig sind, können wir fortfahren. Wir werden die Anglamar-Ruinen ansteuern, wo wir uns für einen Angriff auf die Feuer-Mine rüsten wollen, um die Sklaven daraus zu befreien.«
Eriel räuspert sich und sieht mich ein wenig skeptisch an. »Ich würde von einem solchen Vorgehen abraten, Euer Majestät«, sagt er in ruppigem Tonfall. Durch seinen Akzent, den ich nicht einordnen kann, klingen seine Worte melodisch und bedrohlich zugleich. »Mit den wenigen Kriegern, die wir haben, geradewegs auf die Kalovaxianer loszugehen, würde zu nichts führen. Sie werden uns mit Leichtigkeit schlagen. Wir sind schlicht zu wenige für diese Aufgabe.«
»Darauf hatten wir uns aber geeinigt, bevor ich eure Hilfe angenommen habe.« Ich schaue von Eriel zu Drachenfluch und spüre erneut Wut in mir aufsteigen.
»Die Lösung«, wirft Anders ein, »liegt darin, unsere Streitkräfte zu verstärken.« Seiner hochgestochenen Redeweise konnten offenbar auch die Jahre als Dieb und Pirat nichts anhaben.
Blaise stößt ein spöttisches Prusten aus. »Mehr Streitkräfte? Wieso sind wir nicht darauf gekommen? Und auch Ampelio nicht? Es hätte uns bestimmt eine Menge Ärger erspart. Ach, Moment, wartet, wir sind ja darauf gekommen. Aber kein anderes Land will den Kalovaxianern die Stirn bieten.«
»Jedenfalls nicht aus reiner Herzensgüte. Der Rest der Welt hat viel zu große Angst vor dem Kaiser, um uns zu helfen, deshalb müssen wir dafür sorgen, dass es sich für sie lohnt, uns beizustehen«, sagt Drachenfluch und sieht mir in die Augen. »Und ich denke, das Einzige, was sie von uns haben wollen, ist etwas, das herzugeben Ampelio nicht einen Wimpernschlag lang in Erwägung gezogen hätte.«
Mein Mund wird trocken. »Und das wäre?«
»Dich«, sagt sie rundheraus. »Genauer gesagt, eine Heirat mit dir.«
»Königinnen heiraten nicht«, sagt Heron vollkommen entgeistert bei dem bloßen Gedanken. Ich bin ihm dankbar dafür, denn ich selbst kann anscheinend keine Worte mehr bilden.
»Tun wir doch nicht so, als wären dies normale Umstände, mein Lieber.« Obwohl Heron mindestens zwei Köpfe größer ist als sie, lässt Drachenfluch es so klingen, als würde sie mit einem Kind sprechen. »Ich denke, Theo wird ihren Stolz zum Wohle ihres Landes zurückstellen können.«
»Das hat nichts mit Stolz zu tun.« Ich habe Mühe, meine Stimme ruhig zu halten und die Panik zu verbergen, die in mir aufsteigt. »Diesen Männern geht es doch überhaupt nicht um mich, sie haben es nur auf Astrea und unsere Magie abgesehen.«
Drachenfluch zuckt mit den Schultern, als sei das nicht weiter wichtig. »Wenn wir Astrea noch länger den Kalovaxianern überlassen, wird keine Magie mehr übrig sein. Es ist ein Opfer, aber ein notwendiges.«
»Du hast leicht reden, du bist schließlich nicht diejenige, die irgendetwas opfert«, stoße ich hervor.
»Wir wissen nicht, ob es überhaupt notwendig ist«, sagt Blaise, bevor Drachenfluch etwas erwidern kann. »Es gibt andere Möglichkeiten …«
»Ach? Und welche?« Fragend zieht sie die Augenbrauen hoch.
»Wir haben den Prinzen noch nicht als Druckmittel eingesetzt. Wenn wir ihn für eine der Minen eintauschen …«
»Leider taugt er nicht so gut als Geisel, wie wir es uns erhofft hatten«, wirft Eriel ein. »Der Kaiser will ihn überhaupt nicht zurückhaben. Er sieht in ihm eine Bedrohung und betrachtet ihn als Feind. Wir haben dem Kaiser einen Gefallen getan, indem wir ihm den Prinzen abgenommen haben. Er streut bereits das Gerücht, sein Sohn sei freiwillig mit Euch gegangen, Euer Majestät.«
Das ist gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt, denke ich.
»Dann benutzen wir ihn eben nicht als Geisel.« Sogar in meinen eigenen Ohren klingt meine Stimme verzweifelt. »Eigentlich hatten wir geplant, ihn dazu zu benutzen, einen Keil zwischen seinen Vater und das kalovaxianische Volk zu treiben. Wir wollten den Prinzen töten und die Tat einem der Männer aus der Leibgarde des Kaisers in die Schuhe schieben, um auf diese Weise den Hof ins Chaos zu stürzen. Ich wüsste nicht, warum wir nicht auch um seine Flucht eine Geschichte spinnen sollten, mit der wir ein ähnliches Ergebnis erzielen.«
»Der Kaiser wird dafür sorgen, dass man seinen Sohn bei Hof als Verräter betrachtet«, nimmt Blaise den Faden auf, ohne mir damit zu widersprechen; er folgt meinem Gedankengang und gibt mir Gelegenheit, eine Lösung zu finden.
»Aber der ganze Hof hat gesehen, auf welche Art und Weise sich der Prinz bei dem Bankett seinem Vater widersetzt hat«, sage ich. »Sie wären dumm, wenn sie den Kaiser beim Wort nähmen. Wenn es einen Weg gäbe, durch zusätzliches Getuschel noch weitere Zweifel zu streuen, könnten wir der Geschichte vielleicht eine andere Richtung geben, sodass sie glauben, Søren habe sie keineswegs im Stich gelassen, sondern der Kaiser habe ihn verstoßen. Der ganze Hof hat doch gehört, dass ich den Kaiser beschuldigt habe, die Kaiserin ermordet zu haben. Auch darüber werden sie bereits tuscheln. Es dürfte nicht schwer sein, die Höflinge gegen den Kaiser aufzubringen, wenn wir die richtigen Leute hätten, die etwas in die richtigen Ohren flüstern.«
Blaise nickt bedächtig und wendet sich wieder Drachenfluch zu. »Haben wir solche Leute?«, fragt er.
»Ich habe eine Handvoll Spione bei Hof«, räumt sie zögernd ein. »Aber sie geben lediglich ihr Wissen an mich weiter, sie greifen nicht selbst in das Geschehen ein. Das ist der einzige Grund, warum ich es geschafft habe, dass sie bisher unentdeckt und am Leben geblieben sind.«
Unwillkürlich muss ich an Elpis denken, die so lange sicher war, bis ich sie gebeten habe einzugreifen. Ich höre ihre Schmerzensschreie in den letzten Momenten vor ihrem Tod. Ich sehe ihren zur Unkenntlichkeit verkohlten Leichnam vor mir, als er aus dem Thronsaal gezerrt wird. Ich schlucke hart und hasse mich für das, was ich jetzt sagen muss.
»Die Zeit, sich in Sicherheit zu wiegen, ist vorbei. Wenn wir nicht die Gelegenheit beim Schopf ergreifen, werden wir vielleicht überleben, aber mehr auch nicht. Ich wünsche mir für Astrea mehr als das – und das solltest du auch.«
Drachenfluchs Kiefermuskulatur ist angespannt. »Na schön«, sagt sie. »Ich werde dafür sorgen, dass Entsprechendes in die richtigen Ohren geflüstert wird, wie du es nennst, aber für eine Schlacht um die Feuer-Mine sind wir trotzdem noch zu wenige. Eriel sagt, Sta’Crivero erreichen wir in vier Tagen.«
Eriel, der dem Gespräch aufmerksam gefolgt ist und dabei auf den Fußballen auf und ab gewippt hat wie ein ungeduldiges Kind, schaut jetzt überrascht, als er seinen Namen hört, nickt jedoch hastig.
»In Sta’Crivero werden wir König Etristo treffen«, fährt Drachenfluch fort.
Es dauert eine Sekunde, bis ich verstehe, worauf sie hinauswill. »Ich werde diesen König Etristo nicht heiraten.« Ich betone jedes Wort deutlich, als ließe sich die Angelegenheit allein dadurch aus der Welt schaffen, dass sie mich besser hört.
Sie lacht nur. »Aber nicht doch, Liebes. Etristo ist viel zu alt für dich, ganz abgesehen von der Tatsache, dass er bereits eine Frau hat. Nein, er ist lediglich so freundlich, eine Art von … Empfang für dich auszurichten. Die Oberhäupter von Ländern aus der ganzen Welt werden sich dort einfinden, um dich kennenzulernen, und dir im Gegenzug für eine Heirat ihre Truppen anbieten.«
»Ich bin nicht irgendein Schmuckstück, das sich gegen das höchste Gebot versteigern lässt«, sage ich und kann nicht verhindern, dass sich meine Stimme höherschraubt. Mir wird auf einmal am ganzen Körper furchtbar heiß, so ähnlich hat es sich auch angefühlt, als ich aus meinem Albtraum aufgewacht bin. Schweißtropfen treten mir auf die Stirn, aber ich wische sie fort. Ich weiß wirklich nicht, warum Drachenfluch ihre Kammer so stark heizen muss. Ich weiß auch nicht, warum ich anscheinend die Einzige bin, die es bemerkt. »Ich bin die Königin und treffe meine eigenen Entscheidungen.«
Drachenfluch presst die Lippen aufeinander und mustert mich einen Moment lang nachdenklich und schweigend.
»Selbstverständlich liegt die Entscheidung bei dir«, sagt sie schließlich mit gezwungenem Lächeln und berechnendem Blick. »Aber ich bitte dich eindringlich, eine Heirat ernsthaft in Erwägung zu ziehen. In der Zwischenzeit werden wir Kurs auf Sta’Crivero halten. Zumindest können wir dort im Durcheinander des Hafens Zuflucht finden, solange wir uns einen anderen Plan überlegen.«
Ich willige ein, ihren Vorschlag in Erwägung zu ziehen, obwohl mir allein bei dem Gedanken daran schlecht wird.
Das Geständnis
Als ich nach meiner Zusammenkunft mit Drachenfluch wieder an Deck komme, schlägt mir frische Luft entgegen, und meine Haut beginnt sich abzukühlen. Ich wische mir den Schweiß von Stirn und Oberlippe und werfe verstohlen einen Blick nach rechts und links zu Blaise und Heron neben mir. Ihnen scheint die Hitze in Drachenfluchs Kammer überhaupt nichts ausgemacht zu haben. Vielleicht werde ich ja krank – wundern würde es mich nicht, nach allem, was passiert ist. Vielleicht hat mir auch meine Fantasie nur einen Streich gespielt als Reaktion auf die große Anspannung und den Ärger.
»Es muss einen besseren Weg geben als eine Heirat«, reißt mich Blaise aus meinen Gedanken.
Ich schlucke. »Ja«, pflichte ich ihm bei, ohne ihn oder Heron anzusehen. Stattdessen schaue ich auf das geschäftige Treiben an Deck, wo die Menschen hin und her eilen, um die Smoke mit voller Kraft in eine Zukunft zu steuern, die mir wieder einmal aus den Händen genommen wurde. Drachenfluch mag mir zwar vorgegaukelt haben, ich hätte eine Wahl, aber ich bin nicht so dumm zu glauben, dass es so einfach werden wird.
»Ich fasse es nicht, dass sie vorhatte, dich bei dieser Zusammenkunft ganz allein in die Enge zu treiben«, sagt Heron.
Ich stoße ein Schnauben aus. »Ich schon. Bei den Göttern, ich bin diese Spielchen so satt«, verkünde ich kopfschüttelnd. »Ich habe die Spielchen des Kaisers zehn Jahre lang mitgemacht. Ich bin ihm nicht entkommen, um jetzt gezwungen zu sein, ihre mitzuspielen.« Ich drehe mich um und sehe die beiden an.
»Ich habe Drachenfluch gesagt, dass ihr meine Berater seid. Und auch wenn ich es vorhin für besser hielt, Artemisia nicht dabeizuhaben, wegen der verheerenden Wirkung, die ihre Mutter anscheinend auf sie hat, gehört Art ebenfalls dazu. Ihr drei seid meine Vertrauten hier.«
Blaise nickt, aber Heron wirkt unsicher, seine Augen verweilen einen Moment zu lange auf mir. Was er auch sagen möchte, es wird nicht über seine Lippen kommen.
»Ich weiß, du musst zurück an deine Arbeit, Blaise. Heron, würdest du mir bitte beim Essen Gesellschaft leisten?«
Blaise neigt den Kopf in meine Richtung, bevor er sich zum Bug aufmacht. Heron nickt, allerdings widerstrebend, weshalb ich mich bei ihm unterhake und ihn zur Messe lotse.«
»Ist alles in Ordnung?«, frage ich.
»Natürlich«, sagt er auf eine Art und Weise, die mich umso mehr davon überzeugt, dass dem nicht so ist.
Es ist spät für ein Mittagessen und der Speiseraum hat sich größtenteils schon geleert. Die Handvoll Leute, die noch darin versammelt ist, beobachtet mich, als ich mir meine Ration Schiffszwieback und Dörrfleisch nehme. Ich bin es gewohnt, beobachtet zu werden – die Kalovaxianer haben mich auch nie aus den Augen gelassen –, allerdings steckt hier keine Bosheit dahinter. Aber Erwartungen, was sich irgendwie noch schlimmer anfühlt. In meinem Magen bildet sich ein harter Knoten, während ich darauf warte, dass Heron seinen Teller füllt.
Wir finden problemlos einen leeren Tisch in einer Ecke fernab von lauschenden Ohren, und ich lasse Heron einen Moment lang schweigend essen und auf seine Speisen hinabstarren, um meinem Blick auszuweichen. Eigentlich passt das nicht zu ihm, normalerweise hätte er ein derartiges Verhalten respektlos gefunden. Doch es hat gar nichts mit mangelndem Respekt zu tun, vielmehr scheint er meine Nähe zu scheuen. Ob er denkt, ich gebe ihm die Schuld an Elpis’ Tod?