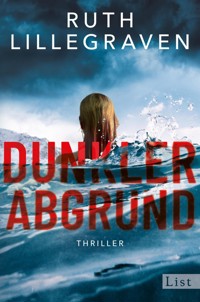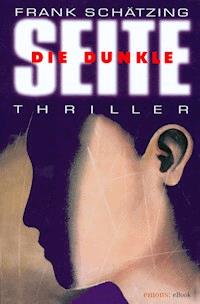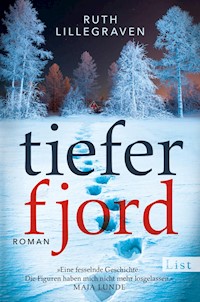
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Thriller-Sensation aus Norwegen – packendes Nordic Noir trifft auf erstklassigen Psychothriller Ein kleiner Junge wird bewusstlos in eine Klinik in Oslo eingeliefert, er stirbt kurz darauf an den Folgen seiner Verletzungen. Der diensthabende Arzt Haavard ist überzeugt, dass der Junge misshandelt wurde. Bevor die Polizei die Eltern, pakistanische Einwanderer, vernehmen kann, wird der Vater des Jungen erschossen aufgefunden. Im Gebetsraum der Klinik. Ein Mord aus Fremdenhass? Haavards Frau Clara ist geschockt, als sie von den Ereignissen erfährt. Schon lange kämpft die Politikerin für ein neues Gesetz, das misshandelten Kindern früher helfen soll. Bisher war ihr Kampf vergebens. Kurz darauf wird eine iranischstämmige Frau ermordet und ausgerechnet Haavard gerät ins Visier der Ermittler. Clara muss ihn entlasten, um politisch weiter tragbar zu sein. Dabei weiß sie überhaupt nicht, wo ihr Mann zu den Tatzeiten war. Doch Haavard ahnt nichts von Claras dunkler Vergangenheit ... »Ich habe das Buch verschlungen und die Figuren haben mich nicht mehr losgelassen.« Maja Lunde
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Tiefer Fjord
Die Autorin
Ruth Lillegraven wurde 1978 in Hardanger geboren und lebt heute in Bærum. 2005 debütierte sie mit einer Gedichtsammlung. Seitdem veröffentlichte sie Lyrik, Kinderbücher, ein Theaterstück und einen Roman. Tiefer Fjord ist ihr erster Spannungsroman und der Auftakt der Clara-Trilogie. Ruth Lillegravens Bücher wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem erhielt sie den Brage-Preis und den Nynorsk Literaturpreis.
Das Buch
Begeisterte Stimmen zu Deep Fjord »Dieser Thriller ist erfrischend anders. Eine fesselnde Geschichte, kunstvoll erzählt. Ich habe das Buch verschlungen und die Figuren haben mich nicht mehr losgelassen.« MAJA LUNDE »Das Beste und Schwierigste an diesem Spannungsroman ist, dass wir das Mordmotiv verstehen, ja, fast schon gutheißen. Ein Thriller mit philosophischem Einschlag.« BERGENS TIDENDE
Ruth Lillegraven
Tiefer Fjord
Roman
Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Deutsche Erstausgabe im List VerlagList ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH1. Auflage Juli 2021© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021Titel der norwegischen Originalausgabe: Alt er mitt (Kagge Forlag, Oslo)Umschlaggestaltung: ZERO Media GmbH – Simone MellarTitelabbildung: © arcangel / Tony Watson (Schnee mit Fußspuren);© FinePic®, München (Bäume, Haus und Hintergrund)E-Book-Konvertierung powerded by Pepyrus.comISBN 978-3-8437-2564-4
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog –
Clara
Teil 1
1 –
Haavard
2 –
Clara
3 –
Haavard
4 –
Clara
5 –
Haavard
6 –
Roger
7 –
Haavard
8 –
Clara
9 –
Haavard
10 –
Clara
11 –
Roger
12 –
Haavard
13 –
Clara
14 –
Haavard
15 –
Clara
Teil 2
16 –
Leif
17 –
Clara
18 –
Haavard
19 –
Clara
20 –
Leif
21 –
Clara
22 –
Haavard
23 –
Clara
24 – Haavard
25 –
Clara
26 –
Haavard
27 –
Roger
28 –
Haavard
29 –
Clara
30 –
Haavard
31 –
Clara
32 –
Haavard
33 –
Clara
34 –
Haavard
35 –
Clara
36 –
Haavard
37 –
Clara
38 –
Haavard
39 –
Clara
40 –
Susanne
Teil 3
41 –
Haavard
42 –
Clara
43 –
Haavard
44 –
Clara
45 –
Haavard
46 –
Clara
47 –
Leif
48 –
Haavard
49 –
Clara
50 –
Haavard
51 –
Clara
52 –
Leif
53 –
Clara
54 –
Leif
55 –
Clara
56 –
Leif
57 –
Haavard
Teil 4
58 –
Clara
59 –
Haavard
60 –
Clara
61 –
Haavard
62 –
Clara
63 –
Leif
64 –
Haavard
65 –
Clara
66 –
Haavard
67 –
Leif
68 –
Haavard
69 –
Clara
Teil 5
70 –
Sabiya
71 –
Roger
72 –
Sabiya
73 –
Clara
74 –
Leif
75 –
Clara
Anhang
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog – Clara
Motto
Alles ist nah, alles ist fern, so weit.Alles ist dem Menschen nur geliehen auf Zeit.Alles ist mein, alles wird mir genommen,schon bald wird mir alles genommen.Der Baum, die Wolke, der Boden,auf dem ich gehe – nichts bleibt.»Am schönsten ist es in der Dämmerung«(Det är vackrast når det skymmer – Auszug)Pär Lagerkvist
Prolog – Clara
1988
Der Wagen krachte mit einem so fürchterlichen Knall aufs Wasser, dass ich richtig überrascht war, als ich die Augen wieder aufmachte und wir trotzdem noch am Leben waren. Ich bin noch nie geflogen, aber ich denke, so fühlt sich ein Flugzeugabsturz an. Ein paar Sekunden danach war es auf einmal ganz still, ich hab gedacht, alles ist noch mal gut gegangen, wir treiben mit dem Auto im Wasser wie in einem Boot, bis uns jemand rettet. Aber dann ist das Wasser zu den Lüftungsöffnungen und überall reingeschossen, und mir wurde klar, dass niemand uns retten konnte.
Oh, Entschuldigung, ich sollte wohl besser von vorn anfangen … Also, es war ein Mittwoch, unser Heimatkundelehrer war krank, darum hatten wir früher schulfrei als sonst. Ich hätte zu Papa nach Hause gehen können, ich wohne bei ihm. Aber Magne, mein Stiefvater, hatte gesagt, wir könnten mal zusammen Mama im Krankenhaus besuchen, wenn ich wollte. Sie war wegen irgendwelchen Frauensachen operiert worden. Jetzt passt es gut, wegen der ausgefallenen Schulstunde, dachte ich. Also bin ich zu dem Hof hochgegangen, wo Magne und Mama wohnten. Er schien sich zu freuen, als er mich sah. Wir setzten uns ins Auto, fuhren den steilen Kiesweg vom Hof runter zur Hauptstraße und bogen in Richtung Krankenhaus ab. Als wir auf die weite Kurve zufuhren, blendete uns die sehr helle Sonne.
Ja, und dann ging alles so schnell, ich erinnere mich nicht genau.
In der einen Sekunde fuhren wir in die Kurve rein, in der nächsten sind wir auf meiner Seite aus der Kurve rausgeflogen. Wir waren wohl zu schnell. Ich konnte eigentlich nur noch schreien, dann sind wir auf dem Wasser aufgeschlagen. Magne hat meinen Sicherheitsgurt aufgemacht und gerufen, ich soll das Fenster runterlassen und da aussteigen. Natürlich habe ich gedacht, er tut dasselbe, aber dann habe ich mich umgedreht und gesehen, dass er immer noch auf dem Fahrersitz saß, steif und schlank, ich begriff nicht, warum. Ich versuchte, meine Tür von außen zu öffnen, aber es ging nicht, sie war wie abgeschlossen. Dann wollte ich um das Auto rumschwimmen, es hat eine Weile gedauert. Der Wagen ist immer schneller gesunken, ich rüttelte an der Fahrertür, aber auch sie saß felsenfest. Ich schlug ans Fenster, versuchte, zu Magne Kontakt aufzunehmen, aber er hat einfach nur dagesessen. Dann musste ich zur Oberfläche schwimmen.
Das Wasser war viel kälter, als ich gedacht hätte, meine Glieder wurden steif, und ich habe es mit letzter Kraft ans Ufer geschafft. Dann habe ich zitternd und weinend auf einem Stein gesessen. Ich glaube ja eigentlich nicht an Gott, ganz sicher kann man aber auch nicht sein, nicht wahr, also habe ich ein bisschen gebetet. Aber Magne ist nicht aufgetaucht, und irgendwann wurde mir klar, dass er das nie mehr tun würde, dass ich ihn nie mehr wiedersehen würde.
Entschuldigung, ich will eigentlich nicht weinen, aber es ist so ein schrecklicher Gedanke, dass er mir geholfen hat und ich ihn einfach untergehen ließ. Mama tut mir so leid, und Magne auch.
»Danke, Clara«, sagt der Polizist und nickt zu der Solo-Limonade und der Puddingschnecke auf dem Tisch hin, ich soll mich bedienen, aber mir wird schon beim Anblick des gelben Puddings übel.
Der Polizist scheint ganz in Ordnung zu sein, ich frage mich trotzdem, ob er einer von denen ist, die nicht verstehen, nicht verstehen wollen.
Durch das Fenster sehe ich Leute parken, die zu der Arztpraxis neben dem Gemeindehaus wollen, in dem wir sitzen.
Auf der anderen Straßenseite sehe ich den Laden. Die Schule. Und das Altersheim. Ringsherum liegen die Berge, behüten uns. Oder sperren uns ein.
Dahinter liegt der Fjord.
Teil 1
1 – Haavard
Was auch passiert, lass dich nicht scheiden.
Diesen Rat hatte mir ein geschiedener Freund am Abend davor gegeben, beim Bier, im Hintergrund lief die Premier League. Eine Scheidung ist so scheißteuer, sagte er. Du wirst ausgeplündert. Mal dir ein finanzielles Worst-Case-Szenario aus und multipliziere es mit zwei. Nein, mit drei! So teuer ist eine Scheidung.
Okay, ich halte aus, ich stehe es durch.
Die Terrassentür fällt laut zu, das ist Claras passiv-aggressive Art, mich zu wecken. Durch die wehenden weißen Gardinen zeichnet sich ihre hochgewachsene, schmale Gestalt auf der Terrasse vor dem Schlafzimmer ab.
Clara ist ein Gewohnheitstier. Sie steht morgens gern ein paar Minuten so da, in derselben Titanic-Positur, wie auf der Fähre, wenn wir nach Westnorwegen fahren.
Die letzten Tage über hat eine fast brutal drückende, flirrende Hitze in der Luft gelegen, ganz ungewohnt nach dem langen, strengen Winter und dem mehr oder weniger ausgefallenen Frühling. In der Schule der Jungs, auf der Straße, in den Geschäften, überall reden die Leute darüber, dass eben noch Winter war, dass es keinen Frühling gegeben hat, und jetzt diese plötzliche afrikanische Hitze.
Ich selbst genieße sie. Wenn Clara endlich ihren Gesetzesvorschlag durchbringt, können wir vielleicht einen Ausflug nach Kilsund machen. Meine Eltern werden nicht jünger, und wir müssen die Hütte für die Saison klarmachen.
»Du musst aufstehen«, sagt Clara, als sie wieder reinkommt. »Sonst schafft ihr es nicht rechtzeitig zur Schule.«
Wir sind diese Woche an der Reihe, eine Gruppe von Schülern zu begleiten, und ich habe versprochen, das heute zu übernehmen.
Mir ist etwas übel, ich habe eine Fahne. Das waren gestern ein paar Bier zu viel, oder ich vertrage weniger als früher.
Die Augen lasse ich zu, tue so, als würde ich noch schlafen. Es hat Clara immer irritiert, dass ich kein Morgenmensch bin wie sie. Aber das bedeutet nicht, dass ich es nicht aus dem Bett schaffe, um die Kinder zur Schule zu begleiten, denn das mache meistens ich.
»Haavard?« Sie stupst mir mit dem Knie ans Bein. Es tut weh.
»He, was soll das?«, frage ich verärgert. »Tust du mir mit Absicht weh?«
Sie seufzt.
»Ich habe um acht eine wichtige Besprechung und muss gleich aus dem Haus.«
»Und ich habe bis morgen früh durchgehend Dienst«, murmele ich.
»Du bist nicht der Einzige, der Leben retten muss«, sagt sie.
Ich schwinge die Beine aus dem Bett, setze mich auf die Bettkante und gähne.
»Haben die Kinder gefrühstückt?«
»Sind gerade dabei.«
Jetzt steuert sie das Bad an, das sie als ihr privates Reich ansieht, um dort ihr Ministeriumsgesicht aufzusetzen. Mich packt der Übermut, ich springe auf und spurte an ihr vorbei. Ohne die Tür zu schließen, mache ich den Klodeckel auf und pinkele im Stehen, dass es nur so spritzt.
Sie steht draußen, kein Wort.
Warum muss sie ums Verrecken noch hier stehen und rummaulen, dass sie keine Zeit hat und ich mich beeilen soll, wo sie längst hätte fahren können? Was kontrolliert sie mich und treibt mich an, als wäre ich nicht daran gewöhnt, mit den Kindern allein zu sein, sie ist doch kaum zu Hause?
Seit sie an dem Gesetzesvorschlag arbeitet, ruft sie an, um Bescheid zu sagen, dass sie zum Abendessen nach Hause kommt, nicht wie sonst, wenn sie es nicht schafft.
Pfeifend spaziere ich aus dem Badezimmer.
Ohne einen Blick geht sie rein, schließt die Tür ab.
Ich ziehe mich an und gehe runter.
Die Jungs sitzen am Esstisch. Ihr Anblick in den Pyjamas lässt mich innerlich immer ganz weich werden. Die schmalen Hälse, Nikolais vom Schlaf verstrubbeltes Haar, die Locken in Andreas’ Nacken.
Doch dann sehe ich, dass sie Schokopops essen. Noch dazu jeder mit seinem iPad vor der Nase.
Ich deute auf das Paket mit den Schokopops. »Die sind nur am Wochenende erlaubt! Das wisst ihr genau. In dem Zeug sind nicht mehr Nährstoffe als in der Verpackung.«
»Mama hat gesagt, wir dürfen«, rufen sie im Duett.
Im Schrank finde ich eine Packung Paracetamol und schlucke eine mit Milch, die ich direkt aus dem Karton trinke.
»Und was sagt eure Oma übers iPad?«
Noch mal im Duett: »Unfug!«
»Nein. Sie sagt, ihr kriegt noch viereckige Augen.«
Die Jungs schlürfen die Schokokissen und die Milch auf, die jetzt hellbraun geworden ist, während sie sich wegen irgendeines Fortnite-Spiels zanken, das sie in ihrem Alter noch gar nicht haben dürften.
Jetzt kommt auch Clara runter.
»Schokopops?« Ich ziehe die Augenbrauen hoch. »Im Ernst?«
»Sie haben sich geweigert, was anderes zu essen. Du warst ja nicht hier, irgendwas müssen sie ja frühstücken.«
»Herrgott noch mal«, murmele ich.
Plötzlich springen die Jungs auf und laufen zur Gartentür hinaus.
»He!«, rufe ich. »Wo wollt ihr hin? Kommt zurück! Sofort!«
Kurz darauf sind sie wieder da, jeder hat zwei Äste Flieder in der Hand. Eigentlich will ich schimpfen, weil sie ohne Erlaubnis aufgestanden sind, und wegen der abgerissenen Zweige, aber ich verkneife es mir, sie sind so süß und stolz.
»Einer für Mama und einer für Papa«, sagt Nikolai. Andreas lächelt sein zeitloses Lächeln. »Bitte nicht mehr streiten.«
»Nein«, sage ich. »Und vielen Dank, das ist lieb von euch.«
Ich suche eins meiner Skalpelle von der Arbeit im Durcheinander der Schublade, um die Zweige anzuschneiden. Beim zweiten rutscht das Messerchen aus irgendeinem Grund ab, mir direkt in die Kuppe des Mittelfingers.
»Verdammte Scheiße!«, rufe ich.
»Die Skalpelle sollten auch wirklich nicht überall rumfliegen, das habe ich dir schon x-mal gesagt«, sagt Clara.
»Danke«, fauche ich. Es blutet stark.
»Was ist passiert, Papa?«, fragt Nikolai.
»Zum Teufel noch mal«, sage ich, dann reiße ich mich zusammen. »Ich habe mir in den Finger geschnitten.«
»Tut es weh?«
»Ein bisschen. Zum Glück bin ich Arzt, da kann ich es selbst nähen«, sage ich, es soll aufmunternd klingen. Nicht sehr überzeugend.
»Es kann doch nicht so schwer sein, ein bisschen aufzupassen?«, sagt Clara, ach so empathisch. Jedes Mal, wenn die Kinder oder ich uns wehtun, reagiert sie genervt. Sie scheint es als ein Zeichen der Schwäche anzusehen.
Ich untersuche den Finger, reiße ein Blatt Küchenpapier ab und wickele es darum, versuche, wieder der coole Papa zu sein.
»Fluchen ist aber verboten, Papa«, sagt Andreas.
»Tut es sehr weh?«, fragt Nikolai.
»Tschüss dann.« Mit raschen Schritten geht Clara durch Küche und Flur. Erst als die Haustür ins Schloss fällt, lockere ich die Schultern und lächele die Kinder richtig an.
So geht es also bei uns zu. So weit ist es gekommen.
2 – Clara
Wer ein richtiger Minister sein will, greift kaum jemals selbst zum Telefon. Für gewöhnlich ruft die Sekretärin von Justizminister Anton Munch an und fragt, ob ich rüberkommen kann.
Im Ton höflich, aber die Frage ist rein rhetorisch.
Her mit dir. Pronto.
»Ich komme.« Ich stehe auf, streiche mein Kostüm glatt, speichere das Dokument, an dem ich arbeite. Mein drittes Kind. Ein Vorschlag zur Gesetzesänderung. Prop. 220 L. 78 Seiten. 11. Kapitel. Vorbemerkung, Zielsetzung. Geltendes Recht, Erwägungen und Vorschläge. Anmerkungen. Dann der neue Gesetzestext.
Und ganz am Schluss wie immer die absurde Formel Wir, Harald, König von Norwegen.
Der Gesetzesvorschlag soll dafür sorgen, dass alle Instanzen, ob Krankenhaus oder Jugendamt, Kindergarten oder Gesundheitswesen, stärker verpflichtet sind, jeden Verdacht von Gewalt gegen Kinder oder Missbrauch weiterzuge-ben.
Diese Meldepflicht ist im geltenden Recht bislang zu unverbindlich formuliert, überall steht die Schweigepflicht im Vordergrund.
Das soll anders werden.
Der Vorschlag ist so gut wie fertig. Jetzt arbeite ich noch am Text, straffe ihn und feile und poliere an ihm herum wie an einer Skulptur, damit er rundherum glänzt.
Und ich setze meine Ehre daran, den aufgeblasenen, unverständlichen Stil zu vermeiden, den wir Juristen gewöhnlich produzieren, lauter verschachtelte Nebensätze und Einschübe, bis es eine unlesbare Soße wird, wegen der die PR-Leute sich die Haare raufen, wenn sie Presseerklärungen zustande bringen müssen. Jedes Jahr neu werden etliche externe Berater engagiert, die uns beibringen sollen, uns verständlich auszudrücken. Klartext sozusagen.
Klartext können sie haben.
Ich klackere auf meinen Stilettos durch die Gänge zur politischen Abteilung. Absätze auf braunem Schiffsboden. In den Verwaltungsetagen haben wir nur Linoleum, hier im Allerheiligsten ist Teakholz verlegt, mit schwarzen Streifen zwischen den Deckplanken.
Der Erste, dem ich bei den Politikern begegne, ist dieser idiotische, auf den Hinterbeinen stehende ausgestopfte Eisbär. Wahrscheinlich auf Spitzbergen geschossen, auf der Treppe vor der Kirche. Gereckter Rücken, starrer Blick. Ich reiche ihm gerade mal bis zum Ellbogen. Er hört auf den Namen »Oddbjørn«.
Seit einiger Zeit arbeite ich direkt Minister Munch zu, abseits vom Dienstweg. In den letzten Monaten bin ich ihm und damit meinem Ziel immer näher gekommen.
Sämtliche Einwände und Fragen der verschiedenen Vorgesetzten habe ich in diesen Tagen gelöst. Der Vorschlag muss zwar noch eine Anhörung überstehen, bevor er dem Parlament vorgelegt werden kann, aber wenn der Minister sein Okay gibt, ist schon viel gewonnen.
Ein Ministerium spürt schnell, ob es an seiner Spitze eine Führungspersönlichkeit hat oder nicht. Munch ist jetzt seit einem Jahr im Amt, inzwischen merkt man, dass er viel heiße Luft produziert, aber ich sehe ihn weniger kritisch als andere, eben wegen meines Projekts.
Der Höhepunkt war vor einer Woche. Wir saßen in seinem Büro, er lehnte sich im Schreibtischstuhl zurück, faltete die Hände hinter dem Kopf und sagte:
»Okay, Clara. Wir machen das.«
Auch jetzt sitzt er wieder hinter seinem großen braunen Schreibtisch, dahinter passende Bücherschränke.
Am Tag nach der Schlüsselübergabe hat er die Gemälde, die in seinem Büro hingen, rausgeworfen und durch einen riesigen Flachbildschirm-Fernseher ersetzt. Außerdem hat er das Büro mit Hunderten Miniaturhelikoptern und Militärfahrzeugen geschmückt, was die Journalisten nur zu gerne in ihren Artikeln erwähnen.
Der aufgeräumte Teakholzschreibtisch, das Obst, die weißen Kaffeetassen, der Fernseher, die Schnellhefter, die ironischen Kaktustrophäen der Boulevardzeitschrift Se og Hør, nichts scheint besonders, aber der Mann hinter dem Schreibtisch sitzt auf einem der mächtigsten Posten des Landes.
»Komm rein«, sagt er jetzt, ohne von seinem Telefon aufzublicken.
»Hei Clara«, sagt eine Stimme. Erst jetzt bemerke ich Ernst Woll hinter dem Besprechungstisch in der Ecke.
Das gesamte politische Führungspersonal besteht aus Männern. Woll ist der tougheste und der einzige Jurist. Sein Büro ist das größte, sein Einfluss der größte.
Früher gab es immer nur einen Minister und einen Staatssekretär, jetzt ein ganzes Rudel Staatssekretäre, dazu noch politische Referenten. Alle kämpfen sie um die Gunst des Justizministers, wetteifern darum, wer am fleißigsten ist und am meisten zustande bringt.
Alle, die ein politisches Amt innehaben, müssen unablässig beweisen, dass sie es auch ausfüllen, und dafür müssen sie sich in alles Mögliche einmischen. Darum verzögern die Staatssekretäre ständig die Arbeit und stehlen den Mitarbeitern ihre Zeit, die Besseres zu tun hätten.
Der Minister ist mit seiner Funktion als Galionsfigur beschäftigt und damit, seine Sache in den Medien und auf Facebook gut zu machen, die Staatssekretäre sitzen in den Besprechungen, sind den Fachreferenten auf den Fersen und treffen die meisten politischen Entscheidungen.
Trotzdem habe ich Munch dazu bringen können, sich für meinen Gesetzesvorschlag zu engagieren. Und es ist mir gelungen, Woll zu umgehen. Bis jetzt.
»Wir werden dich nicht lange aufhalten«, sagt Woll.
»Kein Problem«, sage ich.
»Ja, Clara.« Munch blickt endlich von seinem Telefon auf. »Unser Vorschlag ist im Kabinett diskutiert worden …«
Stille.
»Ja?« Mir dämmert, dass diese Besprechung in eine andere Richtung laufen könnte als gedacht. Die beiden schauen einander kurz an. Munch wirkt widerwillig. Woll zuckt mit den Schultern, scheint bereit, es hinter sich zu bringen.
»Und, ja … Wir müssen ihn auf Eis legen«, sagt Munch endlich.
Die Härchen an meinen Armen stellen sich unter der weißen Seidenbluse auf.
»Wie meinst du das?«, frage ich mit belegter Stimme. »Die Minister haben doch meine Vermerke gelesen?«
»Du weißt doch, so was passiert ständig. Kontroverser Vorschlag. Koalitionsregierung. Die anderen halten ihn für zu radikal. Und ich habe gerade andere Sachen auf der Platte, die ich unbedingt durchbringen muss.«
»Aber das wäre das Wichtigste, was du in deiner Amts-zeit tust«, sage ich. »Wissen deine Kollegen nicht, was das für die Schwächsten in unserer Gesellschaft bedeuten würde?«
Hinter meinem Rücken lacht Woll ein kurzes, trockenes Lachen und unterbricht mich:
»You win some, you lose some. Die Sache ist gelaufen.« In seiner Stimmung knistert eine Spur Schadenfreude.
So sind sie. Es geht ausschließlich um Macht.
Alles kann Verhandlungssache sein. Alles kann gekippt werden.
»Du hast den Minister gehört. Danke, dass du gekommen bist«, fügt Woll noch hinzu und steht auf. Ein ministerieller Rauswurf.
Munch sieht wieder auf sein Mobiltelefon, mich schaut er nicht mehr an.
Ich drehe mich um, fast überrascht, dass mein Körper gehorcht, gehe aus der Tür, am Schreibtisch von Munchs Sekretärin vorbei, an dem gigantischen Obstkorb, der hier doppelt so groß ist wie in den Fachabteilungen.
Vorbei am Eisbären, der in seiner täppischen Freundlichkeit plötzlich erschreckend wirkt.
Vorbei an den Teilen der Helikopter- und Militärfahrzeugsammlung, die bis ins Vorzimmer gedrungen sind, aus der Abteilung hinaus, durch die Flure.
Irgendwann bin ich endlich zurück in meinem Büro, ziehe die Tür hinter mir zu, rutsche an der Innenseite zu Boden und bleibe dort mit angezogenen Knien sitzen.
Haavard nennt mich immer die Eiskönigin. Er selbst kann bei jeder sich bietenden Gelegenheit weinen.
Ich glaube, ich habe seit dem Tag vor dreißig Jahren nicht mehr geweint, und ich habe auch nicht vor, damit anzufangen. Aber jetzt lege ich die Hände vors Gesicht, die Fingerspitzen auf den Augen. Ich versuche, ruhig zu atmen. Es gelingt mir nicht.
Als ich dreizehn war, im Jahr nach dem Unfall, übernachtete ich manchmal allein auf der Sommeralm. Drei, vier Nächte nacheinander. Ich kochte mir selbst, heizte ein, las, wanderte.
Einmal kam ich auf die Idee, einen Berg in der Umgebung zu besteigen, den Trollskavlen. Eine lange, anstrengende Wanderung, aber mein Vater hatte mir erklärt, welchen Weg er als Jugendlicher gegangen war, ich hatte ihn auf der Karte verfolgt und wusste, dass ich es schaffen konnte. Und ich hätte es auch geschafft, wenn der Sonnenschein, bei dem ich aufgebrochen war, nicht plötzlich von dichten Wolken verdeckt gewesen wäre.
Wenige hundert Meter vor dem Gipfel zog dichter Nebel auf.
Erst verschwand der Gipfel. Dann sah ich überhaupt nichts mehr.
Alles war weiß.
Ich nahm Karte und Kompass hervor und bewegte mich voran, meinte, es sei die richtige Richtung. Irgendwann kam ich zu einem Steilhang, den ich wohl vorher erstiegen hatte. Ich drehte mich um, Angst im Bauch, und kletterte runter, bis ich auf einmal mitten im Hang stecken blieb, angespannt wie Spiderman, und weder vor noch zurück konnte.
Ich hatte mich verstiegen. Mein Vater hatte mal erzählt, dass das in den Bergen Schafen auf der Sommerweide manchmal passiert. Dann stehen sie da auf einem schmalen grünen Vorsprung im schwarzen Fels und blöken.
Manchmal kann man sie mit Seilen hochhieven, wenn sie erreichbar sind, aber manchmal bleibt nur, sie abzuschießen.
Jetzt ging es mir auch so. Es war weit bis nach unten, ich wusste nicht, wohin ich die Füße setzen sollte.
Nach einer Weile versuchte ich es trotzdem, Tritt um Tritt. Ein Haltegriff hier, einer dort.
Für einen oder zwei Meter ging das gut. Dann stürzte ich ab.
Viele Minuten lag ich da und rang nach Luft, erst dann konnte ich anfangen nachzuspüren, ob ich mir etwas gebrochen hatte.
Dasselbe Gefühl habe ich jetzt, wo ich am Boden des Ministeriums für Justiz und öffentliche Sicherheit sitze, dreißig Jahre später.
Ich habe so viel in diesen Gesetzesvorschlag investiert. Er bedeutet mir mehr als alles andere.
Und jetzt haben die beiden da oben ihn mir weggenommen, ihn zerstört, ohne die geringste Ahnung, was sie damit anrichten.
3 – Haavard
Kaum habe ich den weissen Kittel angezogen und die Abteilung betreten, wird mir klar, dieser Dienst wird ein Marathon. Bei dem schönen Wetter war die ganze Stadt auf den Beinen. Und uns wird jetzt das Fallobst geliefert, in Form von Verletzungen und Krankheiten. Die Patienten kommen Schlag auf Schlag. 15 Uhr 35: ein kleines Mädchen im diabetischen Koma. 16 Uhr 21: ein asthmakranker Junge mit allergischem Schock. 16 Uhr 53: ein Geschwisterpaar nach einer Massenkarambolage. 17 Uhr 20: ein lebensgefährlich dehydrierter Sechsjähriger.
Und dann, um 18 Uhr 53, kommt eine ganze Familie.
Der Mann, Mitte dreißig, trägt einen ungefähr vierjährigen Jungen in den Armen. Wahrscheinlich in Norwegen lebende Pakistaner, vielleicht auch Afghanen. Der Junge hat eine blaue kurze Hose und ein rotes T-Shirt an. Am rechten Zeigefinger ein Star-Wars-Pflaster. Dreck unter den Fingernägeln. Ein Armband aus kleinen Kugeln mit Buchstaben darauf. Der kleine Kopf, blauschwarzes Haar.
Leblos hängt er in den Armen seines Vaters.
»Muss mit Arzt sprechen!«, ruft der Vater. Er trägt ein blaues Chelsea-Sweatshirt und ein Basecap. Sein Gesicht ist voller Aknenarben.
Direkt hinter ihm kommt Roger angerannt, und mit ihm eine Wolke von Aftershave. Ein süßlicher Duft, aus der Mode gekommen, vielleicht aus einer dieser Flaschen, die wie ein männlicher Torso oder eine Matrosenuniform oder so aussehen.
Natürlich habe ich weder gegen Schwule noch gegen Krankenpfleger etwas. Und Roger ist fachlich ganz ausgezeichnet, einsatzfreudig, erfahren, warmherzig und fürsorglich. Einer mit vielen Qualitäten. Nur übertreibt er es leider immer mit dem Duft.
»Ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass ich ihn aufnehme«, sagt er jetzt. »Eigentlich müssten sie in die Notaufnahme. Aber er ist mit dem Jungen sofort weitergelaufen. Und jetzt schicken wir sie doch nicht wieder weg, oder?«
»Nein, natürlich nicht.«
Hier im Krankenhaus Ullevål haben wir die besten Notfallteams, andere Krankenhäuser schicken uns ihre schwersten Fälle, meist mit dem Krankenwagen zur zentralen Aufnahme. Aber manchmal bringt jemand sein Kind selbst. Wer weiß, wo die Kinderstation ist, kommt direkt hierher.
So diplomatisch wie möglich sage ich zu dem Vater: »Ich bin der diensthabende Arzt. Was ist deinem Jungen passiert?«
»Bist du blind, Arzt?« Der Vater baut sich dicht vor mir auf, in den Augen Angst und Wut zugleich. Erinnert mich an die Stadtstreicher, die in dem Viertel, wo ich aufgewachsen bin, auf den Schulhof kamen.
»Siehst du nicht, er ist ohnmächtig, Arzt! Er wacht nicht auf!«
Die Mutter trägt einen Hijab, Jogginghosen schauen unter dem Salwar Kamiz hervor. Sie fuchtelt beim Reden mit den Händen. Der Mann sagt etwas in einer mir unverständlichen Sprache, sie verstummt.
Der Junge ist so klein und dünn, schmale Hüften und ein Hals wie ein Vögelchen, dieselben blauen und orangen Sneaker wie Andreas sie hat, nur dass diese schmutzig und abgetragen sind, mit einem Loch am großen Zeh.
»Wie alt ist er?«, frage ich, nehme dem Mann den Jungen aus den Armen und lege ihn auf den Untersuchungstisch.
Vier Finger. Die Mutter schaut mich flehend an, ringt die Hände, ihre Knöchel sind weiß.
»Was ist passiert?«
»Er ist gefallen. Von Baum. Und eingeschlafen. Jetzt will er nicht mehr aufwachen! Tu was, Arzt!«
Ich gebe Roger ein Zeichen, dass er Kollegen hinzurufen soll. »Er braucht ein CT«, sage ich halblaut.
Die Mutter fängt an zu weinen, der Mann herrscht sie an. Ich stehe kurz still. Muss mich besinnen, ein paar Sekunden lang. Der Junge ist bewusstlos. Draußen vor dem Fenster singen die Vögel. Ich wäre auch gern im Freien.
Denn ich spüre dieses besondere kribbelnde Gefühl, so wie wenn du erkennst, dass das Kopfweh an einem Hirntumor liegt, dass der Ausschlag durch Leukämie ausgelöst wird, dass du bald jemandem eine Nachricht überbringen musst, die er lieber nicht hören würde.
Das Gefühl umgibt mich wie kalte Luft.
Ich beuge mich über den Jungen. Er riecht säuerlich nach Erbrochenem. Aber auch nach Staub und Sonne und etwas anderem, Kaugummi, Zahncreme, Shampoo und einem schwachen Duft von Ingwer, Knoblauch und Curry.
»Gehen Sie ein bisschen spazieren«, sage ich zu den Eltern. »Ich kümmere mich um Ihren Sohn.«
Sie wirken skeptisch, verlassen aber den Behandlungsraum. Kurz darauf kommt Sabiya herein.
»Was ist los?« Sie ist außer Atem.
Sabiya ist kaum größer als 1,55, und wegen ihres leichten, lautlosen Gangs sieht es aus, als würde sie durch die Flure schweben. Ihr schulterlanges Haar glänzt immer, sie hält es mit einer Spange zusammen. Weder Schmuck an den Fingern noch Nagellack, ganz nach Vorschrift. Ihre Bewegungen sind effizient, aber graziös.
»Weiß nicht«, antworte ich. »Bestenfalls schwere Gehirnerschütterung. Vom Baum gefallen.«
Sie steht still da und mustert den Jungen mit einem seltsamen Gesichtsausdruck.
»Aha«, meint sie schließlich und fängt an, den Jungen auszuziehen, während sie Roger und Bente, eine Krankenschwester, herumkommandiert.
Hinter ihrem Rücken zwinkere ich Bente zu, die wie üblich rot wird.
Ausziehen und Nachprüfen ist eines von Sabiyas Steckenpferden. Vor ein paar Wochen hat sie in der Morgenrunde einen kurzen Vortrag gehalten, mitsamt einer Powerpoint-Präsentation, Fotos von Rücken mit den Spuren von Peitschenhieben oder Mündern voller Wunden, Röntgenbilder von gebrochenen Knochen. Wir bekommen das im Studium beigebracht. Aber wenn man im Krankenhaus anfängt, muss es immer so schnell gehen, da sind die Zeichen leicht zu übersehen. Da müssen wir besonders aufpassen, uns die wenigen Sekunden Zeit nehmen, auch dann nachzuschauen, wenn das Kind eigentlich wegen etwas anderem eingeliefert wurde. Alle nickten etwas schuldbewusst, als sie das sagte.
Jetzt bückt sie sich und rollt den Ärmel des roten Pullovers hoch.
»Verdammt«, sage ich, als ich die Flecken auf der Innenseite des Armes sehe. Kleidung ist trügerisch, mit ihr sieht alles ganz normal aus. Sabiya greift eine Schere, schneidet die Sachen des Jungen auf.
Überall Hämatome. Auf den Schultern, an den Beinen.
Ich hole tief Luft. »Verdammte Scheiße.«
»Ja, da gibt es keinen Zweifel«, sagt Sabiya, immer noch beeindruckend professionell. Gemeinsam mit Roger heben wir den Jungen in ein Bett, dann schieben wir es eilig durch die Flure zur Notaufnahme, wo das CT gemacht werden soll. In solchen Situationen möchte ich Roger nicht im Wege sein. Niemand von uns hat mehr Erste-Hilfe-Erfahrung als er, niemand hat mehr Verletzte und Kranke in Krankenwagen hinein- oder aus ihnen herausgehoben.
19 Uhr 40. Das CT ist fertig. Sabiya und ich warten auf die Bilder. Ein paar Kollegen kommen dazu, Kardiologen und Anästhesisten.
Da hören wir hinter uns schwere Schritte und gehetzte Atemzüge. Der Vater des Jungen stürmt herein.
»Zutritt verboten«, sage ich bestimmt und gehe ihm entgegen. Er steht unerschütterlich da.
»Was hast du gesagt, Arzt?«
»Sie müssen draußen warten.«
»Scheißrassist«, sagt er.
»Die Regeln gelten für alle«, sagt Roger barsch.
Widerwillig entfernt sich der Mann, läuft aber im Flur unruhig auf und ab wie ein zorniger Ochse.
Als ich mich wieder umdrehe, steht Sabiya da und blickt mich mit einem merkwürdigen Ausdruck an.
»Kennst du ihn?«, frage ich.
Sie nickt, sagt aber nichts weiter, und da kommen die Röntgenbilder. Es ist wohl das allererste Mal, dass ich Sabiya fluchen höre. Ich sehe ihr über die Schulter, sehe den großen Schatten auf dem Bild.
Wie ein unheilvoller Tintenfleck.
»Traumatische Hirnblutung. Er muss sofort operiert werden«, sage ich.
Sabiya nickt nur kurz, sie hat feuchte Augen und ist blass um die Nase.
Wir schieben das Bett mit dem Jungen zurück in unsere Abteilung. Der Vater bleibt uns dicht auf den Fersen.
Die Anästhesisten kontrollieren auf dem Monitor Blutdruck und Puls, Sauerstoffsättigung und Herzschlag. Die Kollegen bereiten Narkose und Intubation vor, schließen das Beatmungsgerät an.
Die Eltern kommen herein. Die Mutter weint, der Vater brüllt etwas wie, wir sollen gefälligst aufpassen, unseren Job tun. Jemand schiebt ihn wieder hinaus. Roger folgt ihm auf den Flur und versucht, ihn zu beruhigen.
Sabiya geht zu dem Jungen, streichelt ihm vorsichtig die Wange, auf der staubigen Haut sind Tränenspuren. Dann nimmt sie die kleine Hand mit dem Star-Wars-Pflaster und redet leise und ruhig auf Panjabi mit ihm. Der Junge ist so klein und blass, kann nichts erklären oder verstehen. Aber es muss einfach gut gehen, bald wird er die Augen wieder aufmachen, sich langsam erholen. In den nächsten Tagen werde ich regelmäßig nach ihm schauen, werde mir genug Zeit nehmen, um mit ihm zu reden und zu scherzen, ich werde sehen, wie er auflebt und fröhlicher, sicherer wird.
Noch während ich das denke, fallen Puls und Sauerstoffsättigung plötzlich schnell ab.
Verflucht, denke ich. Verflucht, verflucht, verflucht. Verzweiflung befällt mich. Wir dürfen ihn nicht verlieren.
Der Anästhesist legt sofort einen venösen Zugang am Arm des Jungen, um Adrenalin zu spritzen.
»Besorg Notfallblut«, sage ich zu Roger.
Wir legen dem Jungen schnell eine Infusion und geben ihm weitere Mittel, um den Blutdruck zu stabilisieren. Er wird zum OP gebracht. Wir eilen hinterher. Vor dem OP übernimmt der Anästhesist, wir müssen zurückbleiben.
Es ist 21 Uhr 10. Keiner sagt etwas. Sabiya wandert ruhelos auf und ab. Ich gehe zum Fenster. Draußen rumpelt die Straßenbahn vorbei. Autos warten an der roten Ampel. Während die Leute ringsum auf den Restaurantterrassen ihre Gläser auf den Sommer erheben, während die Welt sich weiterdreht wie üblich, wird der kleine Junge wieder aus dem OP geschoben.
Der Neurochirurg, einer unserer erfahrensten, schüttelt den Kopf.
»Die Blutung ist zu groß, nicht mit dem Leben vereinbar.«
Am liebsten würde ich mich auf den Boden setzen und weinen.
Vier Jahre lang hat er leben dürfen. Vier Jahre lang mit blauen Flecken.
Er wird zu seinem Zimmer zurückgeschoben.
»Wir müssen die Angehörigen informieren«, sage ich. »Und die Mutter versteht kein Norwegisch.«
Ich höre mir selbst zu und begreife, wie feige und pathetisch es von mir ist, Sabiya diese Aufgabe zuzuschieben.
Ohne ein Wort nimmt sie die Eltern beiseite.
Der Vater schlägt mit der Faust auf die Wand ein. Die Mutter sinkt zusammen. Sabiya streichelt ihr den Rücken. Wir anderen stehen ratlos da. Später muss ein weiteres CT gemacht werden, zur Bestätigung, dass die Blutversorgung des Gehirns unterbrochen ist und der Junge für tot erklärt werden kann. All das dauert seine Zeit, es wird wahrscheinlich nicht vor morgen passieren. Dann müssen wir die Eltern auch nach einer Organspende fragen. Wir versuchen, den Angehörigen Zeit für ihre Entscheidung zu lassen, allzu lange warten können wir aber auch nicht.
In unserer Gruppe herrscht eine andere Wärme als sonst. Wir stehen das hier gemeinsam durch. Es tut weh. Aber wir haben auch andere Patienten, kranke Kinder warten auf uns, um die wir uns nicht kümmern konnten, während wir dieses eine zu retten versuchten. Der Ausnahmezustand darf nicht zu lange dauern.
Da kommt der Vater gerannt. Bente möchte ihm die Hand auf die Schulter legen, er wischt sie weg.
»Es tut mir sehr leid«, sage ich.
»Wo ist der Gebetsraum?«
Ich sage nicht, was ich denke: Ein Vater, der seinen Sohn zu Tode prügelt, hat im Gebetsraum nichts verloren. Was er getan hat, ist unverzeihlich. Ich drehe mich nur halb weg.
»Bente«, murmele ich. »Zeigst du ihm, wo das ist?«
Während sein Rücken durch die Glastür verschwindet, lege ich beide Hände flach an die Wand, lasse den Kopf dazwischen sinken, atme tief durch.
Einmal, zweimal, dreimal.
4 – Clara
Heute mag ich mit niemandem reden, eigentlich nicht mal mit meinem Vater. Aber ich rufe ihn jeden Tag an, das ganze Jahr über. Wenn er nichts von mir hört, macht er sich Sorgen. Als die Jungs im Bett sind, wähle ich seine Nummer.
»Hallo, wie geht’s?«, frage ich, als er abnimmt.
Ich sehe ihn vor mir. Er steht beim Telefonieren gern am Fenster und blickt über den Fjord. Er schaut sowieso gern in die Ferne. Steht da und glotzt, hat Mutter immer gesagt. Also habe ich das wahrscheinlich von ihm.
»Jaaa«, antwortet er mit zittriger Stimme.
»Was ist los?«
»Ich hab mich nicht so ganz auf dem Damm gefühlt und beim Arzt vorbeigeschaut.«
»Ja?« Meine Kopfhaut kribbelt.
Er murmelt so leise, dass ich es nicht verstehe.
»Papa, kannst du etwas lauter sprechen?«
»Ja, er hat mich dann mit dem Krankenwagen hierhergeschickt.«
»Wo ist hierher?«
»Ins Krankenhaus«, sagt er. »Sie sagen, ich habe vielleicht einen kleinen Schlaganfall gehabt oder so … Bist du noch da?«
Ich muss mich räuspern. »Ja.« Mir ist schwindlig.
»Das kommt sicher in Ordnung«, sagt er. Er klingt allerdings überhaupt nicht zuversichtlich. »Bis morgen muss ich erst mal hier bleiben, vielleicht auch länger. Ah, jetzt kommen sie Blut abnehmen. Bis später.«
Als ich auflege, spüre ich es.
Etwas Nasses rinnt aus meinen Augen, ich kann es nicht zurückhalten.
Und dann ruft Haavard an.
5 – Haavard
»Ja bitte?« Claras Stimme klingt belegt, wahrscheinlich ist sie über ihrem Mac eingenickt, das passiert ihr öfter.
Es ist 21 Uhr 40. Die morgendliche Missstimmung dürfte jetzt verflogen sein, obwohl sie ein Elefantengedächtnis hat.
»Clara, könntest du mal nachschauen, ob die Jungs gut schlafen?«
»Wie meinst du das?«
Sie klingt nicht mehr sauer. Nur müde und etwas traurig.
»Nur kurz mal nachschauen. Ob alles in Ordnung ist …«
»Also wirklich, ich sitze hier nebenan im Wohnzimmer, seit ich sie ins Bett gebracht habe. Und sie haben deinen Schlaf, die würden nicht mal aufwachen, wenn über dem Haus ein Flugzeug die Schallmauer durchbricht. Was hast du denn?«
Ich schlucke.
»Ist was passiert?«
Ich stehe allein in einem dunklen Waschraum unserer Abteilung. Und jetzt bricht es aus mir heraus.
»Dieser verfluchte Mistkerl mit seinem Chelsea-Sweatshirt, voll auf Anabolika …«
»Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.«
»Kommt mit seinem Vierjährigen hier reingerannt. Angeblich ist der Junge vom Baum gefallen. Wir untersuchen ihn, überall Hämatome, Abschürfungen und Brandwunden … Das CT zeigt eine massive Hirnblutung. Jetzt liegt er hier, hirntot, wir warten nur noch darauf, die Geräte abzustellen.«
»Oh mein Gott«, flüstert Clara ins Telefon.
»Und damit nicht genug, der Mann schlägt hier die ganze Zeit Krach. Als ob wir schuld wären! Eben gerade hat er Zugang zum Gebetsraum verlangt. Zum Beten! Schlägt seinen kleinen Sohn tot und will dann beten! Was ist das für eine Welt. Du hättest den Jungen mal sehen sollen, Clara, er hat mich so an unsere Jungs in dem Alter erinnert. Hatte sogar die gleichen Sneaker an wie Andreas.«
Ein paar Sekunden lang herrscht Stille, ich höre leise Geräusche, sie scheint sich zu bewegen. Dann flüstert sie, wahrscheinlich steht sie in der Tür des Kinderzimmers:
»Die Jungs schlafen.«
»Danke«, erwidere ich, ebenso flüsternd, und mir ist es sehr ernst damit.
Um zehn gehe ich ins Freie. Ich brauche unbedingt eine Pause, um den Rest des Nachtdienstes durchzuhalten. Wenn ich nachher wieder drin bin, darf ich nicht vergessen, die Polizei anzurufen. Das ist in diesem Fall Standard.
Im Foyer des Krankenhauses steht ein Seeräuberschiff mit schwarzer Totenkopfflagge, eigentlich ziemlich unpassend an diesem Ort.
Ich drehe draußen eine kleine Runde und will eben wieder reingehen, da sehe ich eine Gestalt im Gebüsch dicht am Gebäude, die sich vornübergebeugt erbricht.
»Sabiya«, sage ich. »Alles in Ordnung?«