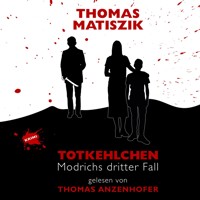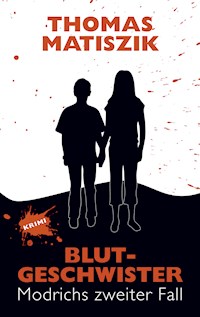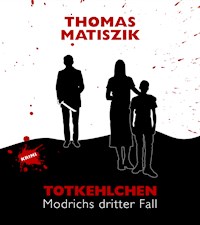4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Empire-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
TIEFSCHWARZE SCHULD
Nach dem Schuss auf einen vermeintlich bewaffneten Geiselnehmer muss Corinna Dupont den Polizeidienst quittieren.
Was soll sie nun mit ihrem Leben anfangen? Ihre Karriere ist dahin, ihr Konto steckt in den Miesen und mit ihrem Lebensgefährten Paul Lobrecht - einem der besten Strafverteidiger des Landes - läuft es ebenfalls nicht gut.
Doch dann läutet es an ihrer Tür. Eine gewisse Theresa Mallen stellt sich ihr vor. Ihr Mann Hugo Mallen, der Chefarzt des Dortmunder Klinikums, hat sich wenige Tage zuvor umgebracht. Niemand will glauben, dass er keinen Suizid begangen hat. Die Witwe bietet eine stattliche Summe, um der Sache nachzugehen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Corinna willigt ein, ohne zu ahnen, welch düsteren Geheimnisse sie offenlegen wird und wie sehr der Fall mit ihrem eigenen Leben verbunden ist.
Im Auftakt zur Corinna-Dupont-Reihe überschlagen sich alsbald die Ereignisse: Ein weiterer Suizid folgt. Ein Kleinflugzeug kracht in ein Riesenrad. Ein Mann entführt seine Kinder.
Zufall?
Wenn Sie nun dachten, das wäre schon alles, kennen Sie Thomas Matiszik noch nicht. Ein Thriller der einem kaum Luft zum Atmen lässt: spannend, gewieft und unbarmherzig.
TODESPRÜFUNG
Als Privatermittlerin Corinna Dupont endlich eine Diagnose ihres angegriffenen Gesundheitszustandes erhält, kann sie sich dennoch nicht ihren eigenen Problemen widmen. Ausgerechnet ihr behandelnder Arzt wird der Vergewaltigung bezichtigt und gerät ins Visier der Polizei. Sie sagt zu, ihm zu helfen, und gerät dabei schon bald in ein Netz aus Gewalt und Lügen. Kommissar David Schmelzer sieht sich unterdessen mit einem grauenvollen Verbrechen konfrontiert. Dem Opfer wurden sämtliche Knochen zertrümmert, zudem weist der geschundene Körper Spuren von Missbrauch auf, die ihm post mortem zugefügt wurden. Doch warum wurde das Gesicht der Leiche wie bei einer Beerdigung wieder hergestellt? Währenddessen wird Hannes Jochimsen, der für seine jüngsten dienstlichen Verfehlungen nicht zur Rechenschaft gezogen wurde, mit einem Fall aus seiner Vergangenheit konfrontiert, der ihn an die Grenzen seiner Belastung bringt. Einer der Täter ist aus dem Gefängnis entlassen worden und sinnt nach Rache. Drei zunächst scheinbar unzusammenhängende Fälle treffen in Thomas Matisziks neustem Roman "TODESPRÜFUNG" aufeinander und verweben sich zu einer intelligenten Handlung voller Abgründe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Thomas Matiszik
Tiefschwarze Schuld & Todesprüfung
Der Autor:
© Sarah Heilbrunner
Thomas Matiszik wurde am 22.01.1967 in Recklinghausen geboren und wuchs in Oer-Erkenschwick als jüngstes von vier Kindern auf.
Nach 12 Semestern Lehramtsstudium an der Ruhruniversität Bochum arbeitete Thomas Matiszik als freier Musik-Journalist für die beiden Radiosender 1Live und WDR2 und schrieb Artikel für mehrere Stadt- und Musikmagazine. Seit Mitte der 90er-Jahre arbeitet er als freier Konzertagent in Bochum und hat Bands wie Reamonn, die H-Blockx oder auch Hollywood-Star Kevin Costner betreut. Mit seiner Frau und seinen drei Kindern lebt er unweit von Dortmund im beschaulichen Holzwickede.
Ende 2013 beginnt Thomas Matiszik mit seinem Debütroman „Karlchen“. Heute blickt der Autor stolz auf drei Romane zurück, die als Modrich-Trilogie bekannt und von den Kritikern gefeiert wurden.
Thomas Matiszik
Tiefschwarze Schuld & Todesprüfung
Ein Corinna-Dupont-Thriller-Sammelband
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Oktober 2023 Empire-Verlag
Empire-Verlag OG, Lofer 416, 5090 Lofer
Lektorat: Susanne Armbruster, Nicole Siemer
https://www.susannearmbruster.de
Korrektorat: Peter Wolf
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Cover: Chris Gilcher
https://buchcoverdesign.de/
Illustrationen Band 1: Adobe Stock ID 56773153, Adobe Stock ID 124573637, Adobe Stock ID 137622416 und freepik.com
Illustrationen Band 2: Adobe Stock ID 127813003, Adobe Stock ID 124573637, Adobe Stock ID 137622416 und freepik.com
Thomas Matiszik
Tiefschwarze Schuld
Ein Corinna-Dupont-Thriller 1
Über das Buch:
Nach dem Schuss auf einen vermeintlich bewaffneten Geiselnehmer muss Corinna Dupont den Polizeidienst quittieren.
Was soll sie nun mit ihrem Leben anfangen? Ihre Karriere ist dahin, ihr Konto steckt in den Miesen und mit ihrem Lebensgefährten Paul Lobrecht – einem der besten Strafverteidiger des Landes – läuft es ebenfalls nicht gut.
Doch dann läutet es an ihrer Tür. Eine gewisse Theresa Mallen stellt sich ihr vor. Ihr Mann Hugo Mallen, der Chefarzt des Dortmunder Klinikums, hat sich wenige Tage zuvor umgebracht. Niemand will glauben, dass er keinen Suizid begangen hat. Die Witwe bietet eine stattliche Summe, um der Sache nachzugehen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Corinna willigt ein, ohne zu ahnen, welch düsteren Geheimnisse sie offenlegen wird und wie sehr der Fall mit ihrem eigenen Leben verbunden ist.
Im Auftakt zur Corinna-Dupont-Reihe überschlagen sich alsbald die Ereignisse: Ein weiterer Suizid folgt. Ein Kleinflugzeug kracht in ein Riesenrad. Ein Mann entführt seine Kinder.
Zufall?
Wenn Sie nun dachten, das wäre schon alles, kennen Sie Thomas Matiszik noch nicht. Ein Thriller der einem kaum Luft zum Atmen lässt: spannend, gewieft und unbarmherzig.
Für Elmar
Das schauerlichste Übel, also der Tod, geht uns nichts an; denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da, und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr.
- Epikur (griech. Philosoph)
PROLOG
Draußen tobte einer der schlimmsten Orkane der letzten Jahre. Die Sturmböen warfen die Regenmassen mit einer solchen Gewalt gegen die Fenster, dass sie die Scheiben buchstäblich einzudrücken drohten. Unter den Sohlen seiner soeben noch frisch geputzten und besten schwarzen Schuhe meinte Lewin zu spüren, wie der Boden bebte. Als sich der Sturm, erneut aufheulend, gegen die Häuser warf, erschien eine Szene aus einem Edgar-Wallace-Film vor seinem inneren Auge. Fehlte nur noch, dass Klaus Kinski mit satanischem Grinsen im Butler-Kostüm um die Ecke kam. »Mylord haben geläutet?«, würde er flüstern. Lewin lächelte gequält. Klaus Kinski kam leider nicht. Unter Umständen hätte dessen Erscheinen ihn davon abbringen können, den letzten, endgültigen Schritt zu tun. Aber er war allein und fest entschlossen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Das Zeug, das in einem offenen Tütchen vor ihm auf dem Tisch lag, sah vollkommen harmlos aus, doch es würde ihn binnen Sekunden aus dem Leben katapultieren.
Er hatte sich das Kaliumzyanid nicht besorgen müssen, es hatte vor genau neun Tagen in einem Umschlag im Briefkasten seines Büros gelegen. In dem Umschlag mit dem Tütchen befanden sich außerdem hochgradig kompromittierende Fotos. Lewin beim Ringelreigen. Nackt. Um ihn herum Kinder, das älteste vielleicht zehn. Ebenfalls nackt. Lewin war auf diesen Aufnahmen erregt. Das war unschwer zu erkennen.
Ein Brief informierte ihn schließlich kurz und bestimmt darüber, dass das belastende Bildmaterial in den Briefkästen seiner Familie und bei der Presse landen würde, sollte er nach Ablauf von zehn Tagen noch am Leben sein. Heute war Tag neun. Lewin wollte nicht länger warten. Er hatte genug Zeit gehabt, um über alles nachzudenken, und festgestellt, dass es keinen anderen Ausweg für ihn gab. Wem hätte er sich auch anvertrauen sollen? Niemand, wirklich absolut niemand aus seinem Umfeld wusste von seiner Veranlagung. Dass diese krankhaft war, hatte sich Lewin niemals eingestehen wollen. Eine Therapie wäre vielleicht eine Lösung gewesen, aber dafür war es jetzt zu spät.
Sein Leben war ohnehin vorbei. Was nützte es da schon, einen weiteren Tag verstreichen zu lassen? Lewin spürte den kalten Schweiß unter seinen Achseln und griff zitternd nach dem Tütchen. Nun grollte der Donner, als wolle er Lewin bei dem finalen Schritt Hilfe leisten. Ein letztes Mal nahm er das Foto in die Hand. Es zeigte seine Frau Katja, seine Tochter Jasmin, den kleinen Eugen und ihn, glücklich und sorgenfrei während des gemeinsamen Urlaubs in der Toskana vor zwei Jahren.
Der Abend, an dem er Jo Heinle im Dortmunder Restaurant Acapulco zum ersten Mal begegnet war, schoss ihm blitzartig durch den Kopf. Lewins Hand schien nun außer Kontrolle. Nur mühsam schaffte er es, den Inhalt des Tütchens verlustfrei in ein Glas Wasser zu schütten. Er trank es in einem Zug leer. Das Klopfen des Zimmermädchens war das Letzte, was er registrierte, bevor die Atemlähmung einsetzte. Ein zarter Hauch von Bittermandel entströmte Markus Lewins Mund.
DER FALL LILLY – 24 Monate zuvor
»Stehen bleiben! Langsam umdrehen!«
Die Menschen am Bahnsteig acht starrten Corinna an, als stünde das Ende der Welt unmittelbar bevor. Alle verharrten wie betäubt, wo sie sich gerade befanden. Gollisch tat, wie ihm geheißen.
»Sie müssen diese Dupont sein!«, sagte er. »Man hat mir von Ihrem äußerst ominösen Besuch erzählt. James Bond hätte seine wahre Freude an Ihnen. Aber warum Sie zwei unschuldige Kinder aus ihrer sicheren Obhut reißen, wird wohl für immer Ihr Geheimnis bleiben. Ich empfehle Ihnen jedenfalls dringend, eine Tauglichkeitsuntersuchung durchführen zu lassen, auch zu Ihrem eigenen Schutz.«
Corinna ließ Gollisch nicht aus den Augen. Ihr war klar, dass der Mann sie aus dem Konzept bringen wollte.
»Aber mal ernsthaft, werte Frau Kommissarin«, er grinste süffisant, »was genau werfen Sie mir eigentlich vor? Wieso stehen Sie mit gezogener Waffe vor mir – muss ich etwa um mein Leben fürchten?«
»Ich werde Sie wegen fahrlässiger Tötung in den Knast bringen. Bei Ihren Vorstrafen dürfte es für jeden Verteidiger schwierig werden, so was wie Bewährung auszuhandeln! Ich nehme meinen Job sehr ernst, wissen Sie? Und wenn Sie diesen unseligen Ort in Bayern tatsächlich als sichere Obhut ansehen, ist Ihnen eh nicht mehr zu helfen!«
Gollisch zögerte kurz. Oder wich er gar vor ihr zurück? Sie glaubte zu erkennen, wie es in dem Mann arbeitete. Hatte sie einen neuralgischen Punkt getroffen? Doch Gollisch blieb vorerst unbeeindruckt.
»Oh, wie wunderbar! Eine Überzeugungstäterin, natürlich mit der Betonung auf Überzeugung, nicht wahr? Jetzt bekomme ich es aber mit der Angst zu tun«, entgegnete er ironisch. »Mich würde wirklich interessieren, wie Sie zu diesem überraschenden Fazit kommen?«
»Ihr Interesse ehrt mich wirklich. Auch wenn es das Interesse eines Menschen ist, den ich gemeinhin als Dreckskerl bezeichne«, gab Corinna prompt zurück. »Aber ob Sie es nun glauben oder nicht, wir haben doch tatsächlich einen Zeugen gefunden. Einen jungen Mann, der zufälligerweise zur selben Zeit auf demselben Rastplatz war wie Sie, und der, während er einen Baum markierte, einen Mann bemerkte, der hinter einem Jungen herlief.«
Gollisch versuchte, sein Pokerface zu wahren.
»Der Zeuge hat weiter ausgesagt, dass zuerst der Junge und dann der Mann hinter einem Hügel verschwanden. Zurück kam jedoch nur eine Person, so der Zeuge. Und jetzt raten Sie mal, wer das war?«
Aus Gollischs Gesicht wich jegliche Farbe.
»Ist Ihnen nicht gut?«, hakte Corinna nach. »Oder erinnern Sie sich plötzlich wieder an alles? Ich schätze, Sie wurden einfach leichtsinnig, richtig? Hat der Junge die Pinkelpause etwa zur Flucht genutzt?«
»Was hätte ich denn tun sollen?«, knurrte Gollisch.
»Wie bitte? Reden Sie so laut, dass alle Sie verstehen können!« Corinna wähnte sich auf dem richtigen Weg. Der Mann würde bald einknicken und auspacken. »Los, machen Sie schon. Erleichtern Sie Ihr Gewissen, Gollisch! Sagen Sie allen hier Anwesenden, woher Sie den Jungen hatten. Ihn und die anderen Kinder, die noch immer an diesem abscheulichen Ort sind.«
»Wenn ich nur wüsste, wovon Sie reden!« Der Moment war vorbei. Die Schultern gestrafft, mit aus voller Überzeugung geschwellter Brust richtete sich Gollisch plötzlich auf. Von einer Sekunde zur anderen riss er eine Frau zu sich, legte ihr seinen linken Arm wie eine Schraubzwinge um den Hals und schnürte ihr langsam die Luft ab.
Corinna versuchte zu erkennen, was Gollisch in seiner rechten Hand hielt. War das eine Pistole, die er der Frau ins Genick drückte? Doch für Fragen war es zu spät - Corinna sah, wie der bedauernswerten Frau die Sinne schwanden und sie den Halt verlor. Wie eine Puppe steckte sie in Gollischs eisernem Griff. Corinna zielte, so gut sie konnte, auf Gollischs Kopf. Der hielt die Geisel wie einen willenlosen Schutzschild vor sich. Es blieb nur ein Versuch. Jetzt!, dachte sie, aber in der nächsten Sekunde war Gollischs Kopf von dem seiner Geisel vollständig verdeckt.
Aus der Bahnhofshalle hörte Corinna schnelle Schritte. Bevor die Verstärkung kam, fällte sie eine Entscheidung.
»Dupont, nicht!«
Zu spät. Corinna hatte bereits abgedrückt. Das Geschoss bohrte sich in das Bein der Frau und streckte sie zu Boden.
Gollisch machte erschrocken einen Satz zurück und ließ seine Geisel wie Ballast fallen. Blutend, schreiend und mit schmerzverzerrtem Gesicht krümmte sich die Frau auf dem kalten Betonboden des Bahnsteigs. Sie zitterte am ganzen Leib und schlug immer und immer wieder mit der flachen Hand auf ihr unversehrtes Bein, als könne sie damit den Schmerz im anderen verringern. Die Menschen am Bahnsteig stoben auseinander, einige warfen sich zu Boden oder suchten anderweitig Schutz. Währenddessen hatten sich zwei Polizisten auf den verdutzten Gollisch gestürzt und ihm Handschellen angelegt.
»Verdammt, was tun Sie denn da?« Jochimsen war außer sich.
Corinna stand immer noch breitbeinig da, die Waffe im Anschlag. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie den Atem anhielt.
Jochimsen kniete sich neben die schluchzende Verletzte und versuchte, ihren lädierten Oberschenkel notdürftig zu versorgen, indem er ein Taschentuch auf die Wunde drückte, das jedoch sofort blutdurchtränkt war. Jochimsens dilettantische Erste-Hilfe-Maßnahme bereitete der Frau nur weitere Schmerzen. Sie wehrte sich und trat mit dem gesunden Bein nach ihm.
Gollisch beobachtete die Szenerie und begann, höhnisch zu lachen.
»Wenn ich könnte, würde ich Ihnen glatt applaudieren, Frau Kommissarin.«
»Halten Sie ›s Maul«, raunte Jochimsen, gefolgt von einem leisen »Scheiße!«.
Langsam ließ Corinnas Anspannung nach, der Puls und ihre Atmung normalisierten sich wieder. Ruhig steckte sie die Dienstwaffe zurück in das Holster. Zum ersten Mal hatte sie auf einen Menschen geschossen. Auf der Polizeischule, die sie vor etwas mehr als drei Monaten mit Auszeichnung absolviert hatte, war sie immer unter den Besten gewesen. Vor allem als es ums Schießen ging. Sie wusste genau, wo der Schuss treffen musste, um einen Flüchtenden niederzustrecken, ohne ihn zu töten. In der Theorie schien alles so einfach. Doch das hier war die Realität. Und die Frau dort war keine Flüchtende, sondern eine Geisel, deren Leben in Gefahr gewesen war. Das, was Corinna eben getan hatte, widersprach allem, was sie auf der Polizeischule zum Thema Geiselnahme gelernt hatte. Die Gesundheit der Geisel hatte immer Vorrang. Ihr ins Bein zu schießen war indes völlig abwegig.
»Ich habe ihn gewarnt, Chef! Mir blieb keine Wahl«, sagte Corinna. Jochimsens Mimik drückte alles andere als Verständnis aus.
»Bleiben Sie ruhig!«, rief er den verängstigten Menschen zu und hielt dabei seinen Dienstausweis in die Höhe. »Sie sind außer Gefahr. Die Lage ist unter Kontrolle. Gehen Sie in Ruhe Ihrer Wege. Wir bedauern es sehr, wenn Sie diesen Tag nicht in allzu guter Erinnerung behalten werden!«
Mit dem letzten Satz warf Jochimsen Corinna einen gleichermaßen vorwurfsvollen und herablassenden Blick zu, dann forderte er telefonisch den Chef der Kriminaltechnischen Untersuchung an.
»Strasser, kommen Sie mit einem Team zum Hörder Bahnhof. Und bringen Sie einen Notarztwagen mit. Calamity Jane hat ihren ersten Job mit besonderer Präzision und Sorgfalt erledigt!«
»Er hat eine Waffe auf die Frau gerichtet, Chef. Außerdem habe ich ihn gewarnt!«, wiederholte Corinna und versuchte, ihrer Stimme mehr Nachdruck zu verleihen.
»Einen Scheiß haben Sie getan, Dupont! Sie haben eine unschuldige Frau schwer verletzt. Wo haben Sie eigentlich das Schießen gelernt?«
Die Verletzte lag noch immer leise wimmernd auf dem kalten Boden des Bahnsteigs. Eine Polizistin redete leise auf sie ein, tröstete und beruhigte sie allmählich. Bis der Notarztwagen eintreffe, würden noch ein paar Minuten vergehen. Die Schmerzen im Oberschenkel schienen in Intervallen wiederzukehren. In einem Moment lag die ehemalige Geisel wie ein müdes Kind im Schoß der Beamtin, um im nächsten Augenblick vor Schmerzen aufzujaulen und Corinna mit Blicken zu durchbohren, die selbst fröhlich singende Nachtigallen hätten abrupt verstummen lassen.
»Hätte ich etwa das Risiko eingehen sollen, die Geisel tödlich zu treffen? Ihr Körper hatte den der Zielperson vollständig verdeckt. Da blieb mir nur die Improvisation«, erklärte Corinna zu ihrer Rechtfertigung. »Gollisch hatte mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass ich auf die Geisel schieße. So haben wir diesen Dreckskerl überwältigen können. Jetzt bekommt er einen fairen Prozess und hoffentlich einen langen unbezahlten Urlaub hinter Gittern. Haben wir seine Waffe?«
Jochimsen schüttelte fassungslos den Kopf. »Es gibt keine Waffe, Dupont. Der Mann war unbewaffnet, und Sie haben beinahe eine Unschuldige ins Jenseits befördert. So sieht es aus. Ich fürchte, das könnte bereits das Ende Ihrer bemerkenswert kurzen Karriere bei der Polizei sein. Aber ich habe es Ihnen ja bereits gesagt: Wer nicht hören will, muss fühlen!«
KAPITEL 1
»Hallo, Mama! Danke, das ist ganz lieb, dass du an mich gedacht hast!«, sagte Corinna.
Dreiunddreißig, eine Schnapszahl, dachte sie und lächelte bitter. Dass ihre Mutter sie heute anrief, ließ sich nicht vermeiden. Einmal im Jahr wahrte sie den Schein und gratulierte ihrer Tochter zum Geburtstag.
»Ich soll dich auch ausdrücklich von Papa grüßen und umarmen.«
Auch diesen Satz hörte Corinna Jahr für Jahr.
»Danke!«, antwortete sie emotionslos. »Umarmen muss nicht sein. Und grüße ihn nicht zurück.«
Ihre Mutter ließ sich hörbar in einen Sessel fallen. Das konnte nur der Fernsehsessel sein, von dem aus Corinnas Vater jeden Abend die Nachrichten verfolgte. Zu jedem aktuellen Thema hatte er eine Meinung und seine Wahrheit hatte mit der Realität meist nicht sehr viel zu tun. Er wusste immer, wer woran schuld war und welche dunkle Macht demnächst dafür sorgen würde, dass es ihnen allen noch schlechter erginge.
»Kommst du zurecht? Hast du einen neuen Job? Ich mache mir wirklich Sorgen.«
Corinna biss sich auf die Lippe. Das war schwer zu beantworten. Sie ertrug diese Heuchelei schon lange nicht mehr. Eigentlich war es ihrer Mutter egal, wie es um sie bestellt war. Ansonsten hätte sie damals, vor fast zwei Jahren, als ihre Tochter in der Klatschpresse wieder und wieder wie eine tollwütige Revolverheldin dargestellt worden war, sicherlich mehr Anteil genommen als mit einem ihrer obligatorischen Anrufe.
Seit damals hatte Corinna immer wieder einen vollständigen Kontaktabbruch zu ihren Eltern geplant, aber noch fürchtete sie sich vor diesem Schritt. Schließlich waren es ihre Eltern. Und Corinnas Kindheit war glücklich, erfüllt und glatt verlaufen. Es war ihr Vater gewesen, der Corinna eingeimpft hatte, immer das zu tun, wofür sie wirklich brannte. »Kompromisse sind etwas für Diplomaten«, so lautete einer seiner Leitsprüche. Corinna hatte inzwischen verstanden, was er damit meinte.
Doch in den letzten Monaten war ihr Vater ein anderer Mensch geworden, ein manipulativer Charakter, der seine Frau steuerte, wie es ihm gerade passte. Und sie ließ es einfach geschehen. Das war der Grund, warum alles, was Corinna noch für ihre Mutter empfand, Mitleid war.
So fügte sie sich den kleinen Ritualen, die der Anstand gebot, und antwortete kurz und knapp.
»Ich komme klar. Danke der Nachfrage.«
Das war gelogen. Seit ihrer Demission bei der Polizei lief nichts mehr zusammen. Hatte sie einen neuen Job? Nein, es sei denn, man zählte das Schnüffeln im Privatleben eines nahen Verwandten dazu. Aber diese Blöße wollte Corinna sich nicht geben.
»Wie geht es dir, Mama?«
»Ich kann mich nicht beklagen«, kam es lapidar zurück.
»Du könntest schon, aber du tust es nicht.« Nun war es ihr doch wieder passiert. Corinna ärgerte sich über ihre Unbeherrschtheit.
»Fängst du schon wieder damit an?«, gab ihre Mutter vorwurfsvoll zurück. Doch Corinna war nun in Geberlaune und wollte sich nicht mehr bremsen.
»Ich war es schließlich nicht, die dich wie eine Leibeigene behandelt und nach Strich und Faden betrogen hat! Du hast es sogar schwarz auf weiß. Es ist Zeit, aufzuwachen, Mama. Jeder in unserer Nachbarschaft weiß, dass Papa ein Schürzenjäger ist. Und sie alle wundern sich, warum du noch immer zu ihm hältst wie eine Schiffsbesatzung zu ihrem Kapitän, obwohl dieser schon längst von Bord gegangen ist. Ich ertrage das alles nicht mehr, Mama.«
»Er vermisst dich, Corinna. Er geht daran zugrunde.«
Corinna ballte die Hand zur Faust und spürte, wie sich ihre Fingernägel in die Haut gruben. »Ich vermisse ihn aber nicht. Und wenn er daran zugrunde geht, ist es mir egal. Er hat es sich redlich verdient. Ich habe keinen Vater mehr!«
Mit diesen Worten legte Corinna auf. Ihr war klar, dass ihre Mutter wieder weinen würde. Irgendwann würde ihr Vater das merken. Er würde sich zu seiner Frau setzen, die Hand auf ihr Knie legen und ein »Lass gut sein« murmeln. Danach würde alles weitergehen wie immer.
»Scheiß drauf!«, beendete Corinna ihre Gedanken und ging ins Bad. Paul würde in einer Dreiviertelstunde da sein. Bis dahin wollte sie das Gespräch mit ihrer Mutter aus ihrem Kopf verbannt haben.
KAPITEL 2
Leyla stand vor dem Eingangsportal des Dortmunder Klinikums. Nur noch eine, dachte sie. Seit fast drei Jahren arbeitete sie hier nun schon als Kinderkrankenschwester, doch an die Wechselschichten hatte sich ihr Körper noch immer nicht gewöhnen können. Das Problem war, dass sie praktisch nach keiner Nachtschicht in den Schlaf fand. Sie lag dann grübelnd in ihrem Bett und versuchte, die Ereignisse der letzten Schicht auszublenden, die Bilder aus dem Krankenhaus in die Dunkelheit gleiten zu lassen. All die Online-Seminare, an denen sie teilgenommen hatte, um mit dem Stress besser klarzukommen, halfen ihr jedoch bestenfalls bei den ereignisarmen Schichten, die es kaum mehr gab. Der Beginn der alljährlichen Grippesaison Anfang November schreckte sie nicht im Vergleich zu dem, was das ganze Jahr über an manch einem Tag passierte. Und so saß ihr der Schlafmangel in den Knochen, auch wenn die Sonne schien.
Leyla nahm einen tiefen Zug und drückte ihre Zigarette am randvollen Aschenbecher aus, der auf der Fensterbank des Pförtnerbüros stand und vor sich hin qualmte. Ihr Kaffee war mittlerweile kalt geworden. Sie fröstelte.
Das, was die kleine Eileen ihr soeben erzählt hatte, war der letzte Beweis für die Schuld des Mannes, den das kleine Mädchen nur widerwillig und voller Furcht Vater nannte. »Degorski, dieses Schwein«, murmelte Leyla. Im selben Moment wurde hinter ihr die Eingangstür aufgedrückt. Es war Julian, ein Krankenpfleger von der Intensivstation.
»Leyla Radomski, du bist meine Rettung!«, flötete er in Leylas Richtung, blieb stehen, zündete sich mit leeren Händen eine »Zigarette« an und nahm einen ersten gierigen Zug.
»Lass mich raten«, sagte Leyla lachend. »Möchtest du vielleicht eine rauchen?«
Julian machte einen Luftsprung, gerade so, als hätte er soeben erfahren, dass er im Lotto gewonnen hatte.
»Du musst Gedanken lesen können!«
Leyla hielt ihrem Kollegen die Zigarettenschachtel hin. Julian hatte es tatsächlich wieder einmal geschafft, sie von ihren düsteren Gedanken abzubringen. Das Leben war schon ernst genug, aber solange sie sich seine Slapstick-Einlagen in homöopathischen Dosen verabreichte, hörte die Sonne nicht gänzlich auf zu scheinen.
»Dazu bedarf es keiner großartigen hellseherischen Fähigkeiten«, antwortete sie trocken, »Situationen wie diese hier spielen sich zwischen uns beiden seit fast drei Jahren nahezu jeden Tag ab.«
Julian blickte empört, verdrehte die Augen, stemmte beide Fäuste gegen die Hüften und streckte Leyla sein kleines Bäuchlein entgegen. Wieder einmal machte er den Oliver Hardy: »Du hältst mich also für einen Schnorrer, ja? Ist es das, was du mir gerade sagen willst? Ich bin enttäuscht, Stanley, bitter enttäuscht. Ich denke, ich werde mich nachher vor den Zug werfen. Vorher werde ich aber einen Abschiedsbrief bei der Krankenhausleitung hinterlegen, in dem ich allein dich für mein Elend verantwortlich mache. Ist es wirklich das, was du willst, Stanley?«
Leyla hielt sich den Bauch vor Lachen und wedelte hektisch mit den Armen. »Hör sofort auf damit«, prustete sie, »der Lachflash in der letzten Woche hat mir gereicht. Bis in die Nacht habe ich immer wieder an deine Comedy-Einlage denken müssen und konnte deshalb nicht pennen. Am anderen Morgen sah ich aus wie Karl Dalls Tochter!«
Julian spreizte den Zeigefinger und den Daumen seiner rechten Hand und stützte nachdenklich sein Kinn darauf.
»Letzte Woche? Ach, meinst du meine Erstickungstod-Performance in der Kantine? Sehr beeindruckend, oder? Aber leider überhaupt nicht witzig! Die Gräte dieses Fisches steckt heute noch irgendwo in meinem Verdauungstrakt fest. Und so etwas wird auch noch als Filet verkauft. Wer auch immer das verbrochen hat, kann sich auf was gefasst machen. Einen Julian Seidel meuchelt man nicht ungestraft!«
Leyla rang nach Luft. Wenn es irgendjemanden gab, der sie jederzeit so zum Lachen bringen konnte, dann war das Julian.
»Ich muss los«, sagte sie und deutete auf ihren Pieper, »mein Typ wird verlangt. »Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es heute ruhig geblieben wäre!« Sie eilte ins Krankenhaus zurück.
Julian hielt inne, nahm noch einen Zug, drückte dann die Zigarette aus und lief der ins Krankenhaus eilenden Leyla hinterher.
»Ich habe in zwei Stunden Feierabend. Lass uns dann noch einen Kaffee trinken, okay?«
Leyla drehte sich um und schüttelte leicht den Kopf. Ihr Gesichtsausdruck war urplötzlich sehr ernst. Julian gab sich noch längst nicht geschlagen.
»Okay, Kaffee ist vielleicht keine so gute Idee. Wie wäre es hiermit: Wir gehen zu mir und vögeln uns die Seele aus dem Leib?«
Leyla grinste. »Kaffee ist schon gut. Aber erst nach dem Vögeln.«
Julian traute seinen Ohren nicht. Hatte sie das wirklich gerade zu ihm gesagt?
»Es wird aber sicher etwas dauern, bis ich zur Verfügung stehe. Muss noch wen erledigen!«
Jetzt war es Julian, der losprustete.
»Der war gut, Leyla Radomski. Mach dir meinetwegen bloß keinen Stress. Ich bin da und warte auf dich, egal, wie lange es dauert.«
»Und wir treffen uns besser bei mir. Ich muss mich erst einmal frisch machen und umziehen, bevor ich dich an meinen Luxuskörper lasse!«
Leyla warf Julian einen Luftkuss zu und verschwand im Foyer des Krankenhauses. Er konnte sein Glück nicht fassen und klopfte sich mehrmals an die Stirn. »Klopf auf Holz«, murmelte er und blickte dabei am Krankenhausgebäude hinauf. Im allerletzten Augenblick konnte er der dunklen Masse ausweichen, die neben ihm auf den Asphalt klatschte. Er stolperte und rollte einen kleinen Abhang hinunter. Für einen kurzen Moment blieb er auf dem Rücken liegen und bewegte vorsichtig seine Gliedmaßen. Gut, er hatte sich bei dem unfreiwilligen Stunt keine Verletzungen zugezogen. Langsam kroch er auf allen vieren den Abhang zum Klinikeingang hoch. Das, was da lag, sah verdächtig nach Professor Hugo Mallen aus, dem Leiter des Klinikums. Oder dem, was nach einem freien Fall aus dem sechsten Stock von ihm noch übriggeblieben war.
»Alter …, das darf doch nicht wahr sein!«, brach es aus Julian heraus.
KAPITEL 3
Paul Lobrecht war Strafverteidiger. Einer der besten des Landes. Allerdings auch einer der meistgehassten. Sein Credo war, dass jede Person vor Gericht das Anrecht auf einen guten Verteidiger hatte. Egal, welche Gräueltaten er oder sie begangen haben mochte. Als Teilhaber der Kanzlei Weitmar, Lobrecht & Partner hatte Paul in den letzten Jahren auch Mandanten verteidigt, die die Boulevardpresse und später die öffentliche Meinung bereits vorverurteilten und am liebsten geteert und gefedert durch die Straßen getrieben hätten. Die ermittelnden Polizeibeamten und Staatsanwälte hassten Paul Lobrecht wie die Pest. Für sie war es nur schwer nachvollziehbar, wie jemand, der das Gesetz vertrat, Mörder, Vergewaltiger oder Drogendealer vor Gericht verteidigen und sie nicht selten vor dem Knast bewahren konnte. In dubio pro reo war Paul Lobrechts Maxime, selbst wenn der Zweifel an der Schuld seines Mandanten äußerst gering und die Beweislage nahezu erdrückend war.
Solange die Gegenseite während des Prozesses keine lückenlose Indizienkette vorbrachte, gab es für Lobrecht und seine Mandanten immer noch ein Schlupfloch, ein Hintertürchen, um das Urteil entweder auf Bewährung oder gar auf Freispruch zu drehen. Nicht selten ließ Lobrecht dabei Moral und Ethik, die ja durchaus einen Teil seines Jobs ausmachten, einfach über Bord gehen und in der tosenden See der Verantwortungslosigkeit untertauchen.
Sein vorläufiges Meisterstück war die Verteidigung eines Mädchenhändlerrings, der im Süden Recklinghausens sein Unwesen trieb.
Als Corinna ihm mit einem hervorgepressten »Ach, du bist’s!« die Tür öffnete, ahnte Paul, dass Corinnas Stimmungsbarometer auf Tief stand.
»Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen?«
»Die Laus, die mir über die Leber gelaufen ist, ist meine Mutter.«
Mit diesen Worten drehte sie Paul den Rücken zu und schlurfte zerknirscht zurück in Richtung Küche.
Paul folgte ihr, legte die Rosen und die Tickets auf die Kommode im Flur, entledigte sich seiner Jacke und rümpfte die Nase.
»Verstehe!«, antwortete er schließlich, während er den Blick durch Corinnas Wohnung schweifen ließ. »Sie hat es echt raus, nicht wahr? Wann hat sie dir gratuliert?«
Die Kaffeemaschine mahlte mit ohrenbetäubender Lautstärke. Corinna lugte um die Ecke.
»Was?«
»Wann hat sie angerufen?«, wiederholte Paul.
Corinna zuckte mit den Schultern und verschwand wieder in der Küche.
»Vor ›ner Stunde vielleicht? Ich weiß es nicht. Ist das wichtig?«
Paul griff nach der halb leeren Flasche, die auf dem Tisch in Corinnas Wohnzimmer stand. Er prüfte das Etikett und schüttelte sich wie jemand, dem man eine Kakerlake untergejubelt hatte.
»Wenn dich die Anrufe deiner Mutter so runterziehen, dann solltest du einfach nicht mehr drangehen. Und wenn du es doch tust und dir danach unbedingt die Kante geben musst, dann doch bitte mit etwas Anständigem und nicht mit einem solchen Fusel.«
Es dauerte weniger als drei Sekunden, ehe Corinnas Kopf abermals zum Vorschein kam.
»Leck mich!«
»Grundsätzlich gerne«, erwiderte Paul dreist und setzte sein Gewinnerlächeln auf. Es wäre nicht das erste Mal, dass er Corinnas Temperament, das ihr bereits des Öfteren durchgegangen war, zügeln musste. Paul Lobrecht glaubte zu wissen, wie das ging. Diesmal jedoch hatte er die falschen Worte gewählt.
»Hau ab, Paul!«, schrie Corinna. »Du bist nicht witzig, ich bin nicht in Stimmung. Also verzieh dich einfach!«
Paul schaute erst verdutzt, dann frustriert. Schließlich griff er nach seiner Jacke und ließ die Wohnungstür mit lautem Scheppern ins Schloss fallen.
Corinna sah aus ihrem Wohnzimmerfenster und blickte ihrem Lebensgefährten hinterher. Wild gestikulierend hielt er sein Handy ans Ohr und – so schien es Corinna zumindest – fluchte wie ein Rohrspatz. Zur Krönung trat er wütend gegen eine Bierdose, die auf ihrem Flug gegen die Fahrertür eines parkenden Autos knallte.
Corinna seufzte. So konnte es wahrlich nicht weitergehen. Seit sie den Polizeidienst quittiert hatte, war es mit ihrem Selbstvertrauen stetig abwärtsgegangen. Bis zuletzt hatte sie gehofft, den Mobbingattacken ihres Chefs gewachsen zu sein. Aber Jochimsen war stärker gewesen und hatte Corinna einen veritablen Strick aus dem Vorfall am Hörder Bahnhof gedreht. Corinna hatte irgendwann kapitulieren müssen, um nicht völlig zugrunde zu gehen. Vielleicht war sie auch eine Spur zu naiv gewesen, als sie angenommen hatte, dass sie mit ihren Ersparnissen hinkommen würde. Corinnas Konto steckte tief in den Miesen, ihre Rücklagen waren fast aufgebraucht. Die einzigen beiden Menschen, die ihr vermutlich Geld leihen könnten und auch würden, hatte sie heute vor den Kopf gestoßen. Gedankenverloren schaute sie auf die Blumen und die Tickets. Ihr stand weder der Sinn nach Rosen noch nach einer vierzehntägigen Karibikkreuzfahrt.
»Jaja, geh du nur« seufzte Corinna erneut. »Was meinst du, Kalle? Bin ich heute zickiger als sonst?«
Aus der Ecke ihres Wohnzimmers war ein lang gezogenes Maunzen zu hören, dem Klang eines Elektrorasierers nicht unähnlich.
Kalle, der stattliche Stubentiger, stolzierte gemächlich auf Corinna zu und strich um ihre Beine.
»Danke für deine Unterstützung«, sagte sie und nahm den Kater auf den Arm. »Ich denke, es ist Zeit, mich endlich gebührend zu feiern. Der feine Herr wird sich wieder beruhigen, oder?«
Kalle gab Corinna einen sanften Nasenstüber und schnurrte weiterhin behaglich.
»Schön, dass wenigstens du meiner Meinung bist! Möchtest du vielleicht auch einen Grappa?«
KAPITEL 4
Sie war diesem Schwein bis in die dritte Etage gefolgt. Degorski war viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um zu bemerken, dass sie ihm dicht auf den Fersen war. Dabei hatte sie sich auf dem Weg zu dem Hochhaus in Dortmund-Derne nicht einmal sonderlich geschickt angestellt. So nah, wie sie dem SUV dieses Ekels mit ihrem Fiesta gekommen war, hätte es Degorski eigentlich auffallen müssen. Einmal hätte es sogar fast gekracht, als sie zu spät bemerkt hatte, dass die Ampel auf Rot umgesprungen war. Degorski hatte in dem Moment nur kurz in seinen Rückspiegel geschaut und verständnislos den Kopf geschüttelt, bevor er wieder Gas gegeben und sie ihn fast verloren hatte. Eine knappe Woche hatte sie ihn beschattet. So war ihr Gott sei Dank nicht entgangen, dass Degorski sein Standardfahrzeug, einen anthrazitfarbenen Kleinwagen, zu seiner Vertragswerkstatt gebracht hatte, um eine Inspektion durchführen zu lassen.
Vor der Tür des Hochhauses nestelte Degorski nervös an seinem Schlüsselbund herum. Er schien mit seinen Gedanken woanders, bemerkte er doch weder die ältere Dame, die ihren Hund unmittelbar neben ihm ins Blumenbeet pinkeln ließ, bevor sie weiterzog, noch schien er den Streit des Ehepaars im Erdgeschoss zu hören.
Sie kauerte ungefähr drei Meter von Degorski entfernt hinter einer Reihe überquellender Mülltonnen, die träge vor sich hin dampften. So gut es ging hielt sie die Luft an, um sich dann instinktiv wegzuducken, als es im Erdgeschoß schepperte. Sie verstand nichts von dem, was die Frau ihrem Mann an den Kopf warf, aber der Tonfall allein machte ihr klar, dass es sich nicht um Komplimente handeln konnte. Sowohl Pfannen als auch Töpfe schienen dort sehr tief zu fliegen.
Um ein Haar wäre ihr die Tür vor der Nase zugefallen. Im letzten Moment schaffte sie es, ihren rechten Fuß dazwischenzubekommen.
Degorski hatte es sichtlich eilig, er nahm jeweils zwei Stufen auf einmal und war kurze Zeit später schnaufend vor seiner Wohnung im dritten Stock angekommen. Sie war ihm so leise wie nur irgend möglich gefolgt, hörte ihn schnaufen.
»Papa ist wieder zu Hause«, rief er noch immer völlig außer Atem, bevor er die Tür aufschloss und die Wohnung betrat.
Nachdem sie im Flur noch für eine kurze Weile verharrt hatte, nahm sie die letzten Stufen, bis sie schließlich vor Degorskis Wohnung stand. Sie legte ihr Ohr an die Tür und lauschte.
»Eileen geht es schon viel besser«, hörte sie ihn sagen, »die Ärzte meinen, dass sie schon bald wieder nach Hause darf.«
Ein Schluchzen war zu hören. Das musste die Schwester sein. Eileen hatte mit tränenerstickter Stimme erzählt, wie sich ihre Angst um Johanna noch gesteigert hatte, seitdem sie ihr nicht mehr beistehen konnte. Ihre zwei Jahre jüngere Schwester war Degorski nun hilflos ausgeliefert. Seit dem Unfalltod ihrer Mutter war es an der Zwölfjährigen, ihre Schwester vor den Übergriffen des Vaters zu schützen. Eileen hatte angefangen zu zittern, als sie die furchtbaren Details erzählte. Degorski hatte offenbar Johanna zu seiner Ersatzehefrau auserkoren. Während er Eileen weitestgehend in Ruhe ließ, nahm er die Zehnjährige fast täglich mit in das Schlafzimmer und schloss die Tür hinter sich. Eileen hatte das Schreien und Weinen ihrer geliebten Schwester nicht mehr ertragen können und war mit einem Messer auf ihren Vater losgegangen.
Keine zwei Stunden später fand sich Eileen im Krankenwagen wieder und schrie vor Angst und Schmerzen. Degorski hatte ihr das Messer abgenommen und sie vor den Augen ihrer Schwester damit bearbeitet, um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, sie beim nächsten Mal umzubringen, falls nur ein Sterbenswörtchen nach außen dringen würde. Den herbeigerufenen Sanitätern hatte er dann die Geschichte von dem seelisch labilen Mädchen erzählt, das er schon des Öfteren beim Hantieren mit einem Messer oder einer Schere erwischt habe. Johanna suchte während des Lügenmonologs ihres Vaters den Blick der Sanitäter und nickte eifrig.
»So schlimm wie heute war es allerdings noch nie«, hatte Degorski abschließend mit einem Schulterzucken erklärt, bevor sich der Notarztwagen mit Eileen in Bewegung setzte.
Sie legte den Karton vor Degorskis Wohnungstür ab, klingelte und eilte die Treppen hinunter.
KAPITEL 5
Katja Lewin hatte eine mehr als unruhige Nacht hinter sich. Ihr Mann hatte sich nicht – wie sonst üblich, wenn er länger arbeitete – gemeldet und den Kindern und ihr eine gute Nacht gewünscht. Markus Lewin war Gerichtsvollzieher und unter anderem für den Dortmunder Stadtteil Eving zuständig. Dort hatte er in den letzten zwei Jahren immer öfter Wohnungen leer räumen müssen. Die Menschen in seinem Revier ertrugen es kaum noch, wenn der Fernseher des Nachbarn größer war oder dessen Auto mehr PS hatte. Kam Neid ins Spiel, saß das Geld stets besonders locker. Auch wenn es meist nicht das eigene war.
Darlehen wurden in geradezu inflationärer Weise gewährt. Und wenn das Konto leer war, nahm man eben ohne Bedenken einen weiteren Kredit auf. Um das eigene Gewissen zu beruhigen, waren es in der Regel nur kleine Beträge. Doch irgendwann ließen sich die Raten nicht mehr bezahlen, da halfen auch Kontoverschiebungen nicht mehr. Das war dann der Moment, in dem Lewin auf der Bildfläche erschien.
Vielleicht hätte sie Verdacht schöpfen müssen, als er am Morgen zuvor das Haus mit einem »Bis irgendwann mal« verlassen hatte. Sie hatte das als einen seiner typischen Scherze aufgefasst. Nun aber überkam sie die nackte Angst.
Keine Nachricht von Markus. Katja hatte wiederholt versucht, ihn auf dem Handy zu erreichen und ihm mehrere Nachrichten auf der Mailbox hinterlassen.
Jasmin stand im Kücheneingang und schien sofort den besorgten Blick ihrer Mutter zu bemerken.
»Hast du was von Papa gehört?«, fragte Katja.
Jasmin schüttelte den Kopf.
»Wir müssen sofort die Polizei anrufen und ihn als vermisst melden.«
Jasmin war erst vierzehn, also eigentlich mitten in der Pubertät. Erstaunlicherweise handelte sie in vielen Dingen bereits sehr erwachsen. Nicht selten hatte sie auf ihren drei Jahre jüngeren Bruder Eugen aufgepasst, wenn ihre Eltern abends mal länger unterwegs waren.
Eugen war im Vergleich zu Jasmin ein echter Satansbraten, wie Katja zu sagen pflegte. Wenn ihn jemand bändigen konnte, dann Jasmin.
Katja hatte den Summton an der Eingangstür kaum wahrgenommen, während Jasmin völlig aufgekratzt die Haustür geöffnet hatte, in der Hoffnung, endlich wieder ihrem Vater in die Augen schauen zu können. Er würde sicher einen mehr als plausiblen Grund dafür haben, dass er seiner Frau und seinen Kindern eine unruhige Nacht beschert hatte.
Der Polizist, der vor der Tür stand, nahm seine Mütze vom Kopf. »Darf ich bitte kurz eintreten?«
Katja Lewin zitterte am ganzen Körper und musste sich an der Flurgarderobe festhalten. In diesem Moment begriff auch Jasmin, was nun folgen würde.
KAPITEL 6
Der einzige Mensch, der Irene Müller regelmäßig besuchte, war ihre Urenkelin. Ein gutes Kind. Unbelehrbar und dickköpfig, aber ein gutes Kind. Irene Müller hatte lange versucht, ihr auszureden, Krankenschwester zu werden, aber Leyla ging einfach ihren Weg. Genau wie früher, als sie immer die Einzige gewesen war, die mit den Jungs auf der Straße bei jedem Wetter Fußball spielte oder stundenlang mit dem Mountainbike ihre Runden drehte. Bis vor zwei Jahren, als Irene Müller noch in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebte und sich weitestgehend selbst versorgen konnte, war Leyla mindestens einmal pro Woche zum Essen vorbeigekommen.
»Oh, bist du verliebt?«, flachste Leyla, wenn das Essen wieder einmal komplett versalzen war. Die Gespräche waren es, die Leyla und Irene Müller zusammenhielten. Egal, ob es die Scheidung ihrer Eltern oder ihr erstes Mal war – es gab praktisch nichts, was Leyla ihrer Uroma vorenthielt.
So war es auch nicht weiter verwunderlich, dass Leyla bei einem ihrer Besuche im Immergrün relativ schnell feststellte, dass mit Irene Müller etwas nicht stimmte. Der Pfleger, der bei Leylas Besuch das Zimmer betrat, umnach dem Rechten zu sehen, ließ keine Gelegenheit aus, Irene Müller zu berühren. Immer wieder ging er wie beiläufig an ihrem Bett vorbei und betatschte die alte Dame kaum merklich. Irene Müller war dieser Kontakt, auch wenn er auf Leyla im ersten Moment völlig normal wirkte, sichtlich unangenehm. Immer wieder schien sie zu versuchen, der Hand des Pflegers auszuweichen, sobald er in der Nähe ihres Bettes war. Ebenso vermied sie jegliche Gefühlsregung. Kein Lächeln, kein Wort des Grußes, nichts.
»Was ist los mit dir, Omi?«, fragte Leyla neugierig, als der Pfleger das Zimmer verlassen hatte. »Hat der Typ die Krätze oder warum meidest du ihn wie der Teufel das Weihwasser?«
Irene Müller schloss die Augen und ließ sich in ihr Kopfkissen fallen. Eine Träne lief der alten Dame die Wange hinunter. Leyla wusste nicht, was das alles zu bedeuten hatte.
»Soll ich später wiederkommen? Ist dir nicht gut?«
Irene Müller gewann langsam ihre Fassung wieder, war aber immer noch in sich gekehrt.
»Irgendetwas stimmt hier doch nicht«, fuhr Leyla fort. »So habe ich dich noch nie erlebt. Komm schon, raus mit der Sprache!«
Jetzt hatte sich Leylas Uroma erhoben. Ihr dunkelblauer Hausanzug aus Plüschstoff stand ihr wunderbar und ließ sie deutlich jünger aussehen. Langsam krempelte Irene Müller die Ärmel hoch, um danach die Hose bis an die Knöchel herunterzulassen.
Leyla Radomski wich zurück. Der Junge aus dem Irak, der vor ein paar Wochen auf Leylas Station gelegen hatte, war misshandelt worden. Es gab kaum eine Stelle an seinem Körper, die nicht grün oder blau oder beides war. Genauso sah nun Irene Müller aus.
»Was zum Teufel? War er das?«
Leyla war außer sich und rannte zur Tür.
»Nicht, mein Kind! Lass es gut sein.«
Leyla drehte sich zu ihrer Uroma um und schaute sie fragend an. »Du willst, dass ich das so hinnehme? Wenn das wirklich dieser Typ war, dann kannst du sicher sein, dass ich ihn zur Rechenschaft ziehen werde.«
»Nein, Leyla, genau das wirst du nicht tun!«
Irene Müller zitterte, als sie das sagte.
»Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen freien Heimplatz mehr. Oder nimmst du mich so lange auf, bis ich einen gefunden habe?«
»Wir müssen das Schwein anzeigen!«, entgegnete Leyla entschlossen.
»Anzeigen? Wie stellst du dir das vor, mein Kind? Es gibt hier keine Zeugen. Und wenn er einfach behauptet, ich sei unsicher, klapperig und würde mich ständig stoßen und hinfallen, steht erst einmal Aussage gegen Aussage. Ich fürchte, dabei würde ich den Kürzeren ziehen. Wer glaubt schon einem Fossil wie mir? Eher hält man mich doch für dement.«
Leyla blickte betroffen zu Boden. Sie wusste, dass Uroma Irene recht hatte.
»Jetzt sei nicht traurig und mach dir bloß keine Sorgen. Ich komm schon klar. Der Heimleiter hat mir versprochen, dass er sich darum kümmert!«
Leylas Blick verriet immer noch eine gewisse Skepsis.
»Der Heimleiter, soso. Vielleicht stinkt der Fisch ja vom Kopf her …«
»Wie meinst du das, mein Kind? Mach bitte keine Dummheiten!«
Leyla gab ihrer Uroma einen Kuss auf die blauen Stellen an ihren Armen und auf den Mund.
»Ich mache genau das, was nötig ist. Vertrau mir einfach und leg dich wieder hin!«
KAPITEL 7
»Wer zum Geier kann das sein?«, fluchte Degorski laut, richtete sich wieder auf und zog seine Jeanshose hoch. »Rühr dich nicht von der Stelle, verstanden?«
Johanna lag bäuchlings auf ihrem Kinderbett und hatte das Gesicht im Kopfkissen vergraben. Leise summte sie die Melodie von Schwesterherz, ein Song, den sie und Eileen für sich entdeckt und sich immer dann ins Gedächtnis gerufen hatten, wenn die Tyrannei ihres Vaters besonders schlimm war.
Ihr Hals brannte. Sie hatte die Flasche Bourbon fast zur Hälfte geleert, als sie gesehen hatte, dass ihr Vater nach Hause kam. Nur so war es ihr möglich, die Schmerzen zu betäuben und ihren Verstand weitestgehend zu eliminieren. Sie hoffte inständig, dass diese Wirkung noch möglichst lange anhalten würde. Am liebsten ein Leben lang. Ein Leben, das seit gut einem Jahr völlig aus den Fugen geraten war und das Johanna nur zwei Chancen ließ: entweder zu sterben oder ihren eigenen Vater umzubringen. Zusammen mit Eileen hatte sie es schon mehrfach in Erwägung gezogen, aber immer wieder hatte er ihre Pläne durchkreuzt. Degorski war seinen Töchtern immer einen Schritt voraus, seitdem er winzige Kameras in die Lieblingspuppen der beiden eingebaut hatte. Weder Johanna noch Eileen hatten eine Ahnung, dass immer dann, wenn sie mit den Puppen spielten und ihnen in die braunen Knopfaugen schauten, ihr Vater alles mitsah und genau zuhörte.
Die Angst vor ihm und um ihre Schwester hatte beide bislang davon abgehalten, sich anderen Menschen anzuvertrauen. Und Degorski sorgte bei jeder Gelegenheit dafür, dass es so blieb.
Den einzigen Telefonanschluss hatte er mit einer Kindersicherung versehen, die es Johanna und Eileen unmöglich machte zu telefonieren, solange ihr Vater nicht zu Hause war. Degorski war ein Tüftler.
Die Wohnungstür fiel mit einem lauten Krachen wieder ins Schloss. Johanna sehnte sich die Flasche Bourbon herbei. Sie wollte es beenden. So oder so. Es ging einfach nicht mehr.
Zitternd lag sie da und sah, wie ihr Vater neugierig einen Karton öffnete. Es war ein gewöhnlicher Schuhkarton, in dem etwas Schwereres als Schuhe sein musste.
»Papa?«, rief Johanna ängstlich.
Es hatte noch nie etwas Gutes bedeutet, wenn sich ihr Vater Zeit ließ, bevor er in ihr Zimmer trat. Im Gegenteil: Immer dann hatte Degorski etwas besonders Perfides im Sinn gehabt. Johanna war verzweifelt und wollte schreien, merkte aber, wie die Wirkung des Alkohols ihr mehr und mehr zusetzte. Nur mit Mühe konnte sie verhindern, dass sie sich in ihrem Bett erbrach. Hektisch klaubte sie ihre Kleidung zusammen und zog sich an. Johanna wollte ihrem Vater keinen zusätzlichen Grund geben, ihr etwas anzutun. Ihr Unwohlsein wurde allerdings immer heftiger, und so stürzte sie aus ihrem Zimmer, die Bluse nur bis zur Hälfte zugeknöpft. Unter normalen Umständen hätte das schon gereicht, um Degorski wieder auf seinen perversen Plan zu rufen. Nun aber saß er auf einem der Holzstühle in der Küche, vor ihm ein Kassettenrekorder, und lauschte fast andächtig dem, was Eileen irgendjemandem erzählte. Dabei ließ sie nichts aus. Jede noch so scheußliche Kleinigkeit plauderte sie aus. Die Person, der sie Degorskis Schandtaten beichtete, musste eine Frau sein. Immer dann, wenn Eileen innehielt oder ihre Stimme brüchig wurde, ermutigte sie das Kind, weiterzureden.
»Hab keine Angst, wir werden ihn zur Rechenschaft ziehen«, war der längste Satz, den die Frau sagte. Degorski hatte die Fäuste geballt. Schweiß strömte aus sämtlichen Poren seiner Haut.
»Ich will, dass das alles endlich aufhört und Papa dafür bestraft wird.«
Das Ende des Satzes war kaum noch zu verstehen. Offenbar war Eileen mit ihren Nerven am Ende. Abwechselnd konnte man sie schluchzen und würgen hören. Es folgte ein Moment fast vollkommener Ruhe, lediglich ein leises, papiernes Rascheln drang durch die Stille. Schließlich war es erneut Eileen, die leise, aber deutlich vernehmbar sagte: »Hiermit versichere ich, Eileen Degorski, dass ich meinen Vater, Friedhelm Degorski, wegen mehrfacher Vergewaltigung meiner Schwester Johanna vor Gericht bringen und ihn seiner gerechten Strafe zuführen werde.«
Degorski hob beide Fäuste und wollte sie mit aller Kraft auf den Rekorder krachen lassen, als die Stimme der Frau ein weiteres Mal zu hören war: »Lieber Freddy! Ich darf dich doch so nennen, oder? Natürlich ist diese Kassette nur eine Kopie. Das Original ist bereits auf dem Weg zu den Behörden. Morgen, allerspätestens übermorgen wird ein Sondereinsatzkommando deine Wohnung stürmen, dich überwältigen und deine Tochter befreien. Und dann wird man dich vor Gericht zerren, die besondere Schwere der Schuld feststellen und dich für den Rest deines erbärmlichen Lebens in den Knast stecken. Freddy, weißt du eigentlich, was im Knast mit Kinderschändern passiert?«
Die Stimme machte eine kurze Pause.
»Ich gebe dir die Chance, dem zu entgehen. Der Revolver ist geladen. Eine Patrone. Sollst ja nicht auf dumme Gedanken kommen. Bereite deinem jämmerlichen perversen Dasein ein Ende und gib Eileen und vor allem Johanna ihr Leben zurück.
Degorski war nun wie von Sinnen, öffnete das Kassettenfach, riss die Kassette heraus und schleuderte sie in hohem Bogen durch die Küche. Danach schlug er mehrfach mit der Faust auf den Rekorder, bis dieser mit lautem Getöse vom Küchentisch fiel und in seine Einzelteile zerbrach.
Johanna wollte fliehen, war aber gelähmt vor Angst.
Er nahm den Revolver in die Hand und streichelte ihn zärtlich. Langsam entspannte er sich wieder. Ein flüchtiges Lächeln huschte über sein Gesicht.
»Johanna?«, rief er leise, »Zieh dir was an, Schätzchen! Papa und du werden Eileen im Krankenhaus besuchen. Darüber freut sie sich doch bestimmt, hm?«
DER FALL LILLY – 27 Monate zuvor
Jochimsen duldete keine weiteren Götter neben sich. Seine Art zu ermitteln war innerhalb der Dortmunder Polizeibehörde äußerst umstritten, seine Erfolge waren jedoch nicht von der Hand zu weisen. Selbst komplizierteste Fälle landeten irgendwann auf seinem Schreibtisch. Die Kollegen wussten genau: Wenn es irgendjemanden gab, der den Durchblick behielt und sich festbiss wie ein Terrier, dann war er es.
Bis Corinna Dupont zum Team der Mordkommission gestoßen war. Mit zweiunddreißig Jahren war sie zum Dienst in Jochimsens Abteilung angetreten. Zuvor hatte Corinna sich, wie sie selber zu sagen pflegte, beruflich orientiert. Zwei abgebrochene Ausbildungen, die eine als Steuerfachangestellte, die andere als Konditorin, dazu mehrere Semester Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften an der Universität Bochum. Warum sie sich dann schließlich für eine Laufbahn bei der Polizei entschieden hatte, konnte sie bis heute nicht richtig beantworten. Die Initialzündung mochte gewesen sein, dass sie, als passionierte Krimiseherin, in der Regel sehr früh wusste, wer der Täter war. Damit allein wäre sie allerdings nicht zur Besten ihres Jahrgangs geworden.
Corinna konnte sowohl führen als auch delegieren, war gleichermaßen autoritär wie kollegial, besaß ein hohes Maß an Empathie, war vor allem aber immer verlässlich und absolut nicht korrumpierbar. Diese Unbestechlichkeit war ihr in Fleisch und Blut übergegangen.
Was Corinna schlussendlich aber zu einer echten Waffe machte, war ihr Umgang mit derselben. Niemand traf besser als Corinna Dupont. Bei den regelmäßigen Schießübungen bewies sie deutlich, dass sich jeder Polizist im Dortmunder Revier glücklich schätzen durfte, bei gefährlichen Einsätzen eine wie Corinna Dupont an seiner Seite zu wissen.
Und so eilte ihr Ruf ihr voraus und hatte Jochimsen bereits erreicht, als sie sich als neue Kollegin und Partnerin vorstellen wollte. Den Blick in Corinnas Akte vertieft, saß er in seinem Chefsessel, als es an der Tür seines Büros klopfte.
»Ja, bitte!«, erwiderte Jochimsen zackig.
Corinna öffnete die Tür und trat ein. Jochimsen würdigte sie keines Blickes. Stattdessen griff er in die Plastikschale, die vor ihm auf dem Schreibtisch stand und warf sich eine Handvoll des Inhalts in den Mund. Laut schmatzend kaute er auf dem Zeug herum, das Corinna, die etwas unsicher im Eingang stand, noch nicht identifizieren konnte. Langsam ließ sie ihren Blick durch das Büro wandern. Keine Fotos, keine Blumen, dafür lag ein penetranter Moschus- und Veilchenduft in der Luft. Corinna trat nervös von einem Fuß auf den anderen und hüstelte vernehmlich, nachdem Jochimsen immer noch nicht von der Akte aufgeblickt und seine neue Kollegin willkommen geheißen hatte.
»Sie sind sich absolut sicher?«
Jochimsens Frage kam völlig überraschend und ließ Corinnas Unsicherheit noch wachsen.
»Verzeihung? Ich fürchte, ich habe Sie nicht richtig verstanden.«
Endlich schickte sich der Mann an, sie nicht weiter zu ignorieren, sondern drehte langsam den Kopf in Corinnas Richtung und schaute sie für einen langen Augenblick schweigend an. Stimmte was mit ihrer Garderobe nicht? Corinna trug eine Jeans und eine weiße Bluse, dazu flache Schuhe. Nichts Ungewöhnliches. Warum lag also Jochimsens Blick auf ihr, als stünde ihr Hosenstall offen oder als sei die Bluse zu weit aufgeknöpft?
»Sind Sie absolut sicher, dass Sie hier richtig sind?«
Jetzt wurde es wirklich unangenehm. Corinna hatte mit vielem gerechnet, und ja, sie wusste, dass ihr Erscheinungsbild wenig mit dem einer modernen Actionheldin gemein hatte, sie nicht gerade angsteinflößend auf Verbrecher wirken mochte, aber warum warf dieser blasierte Klotz dann überhaupt einen Blick in ihre Akte, wenn sich seine Meinung ohnehin nur nach dem Äußeren richtete?
»Darf ich mich vielleicht setzen?«, fragte sie ein wenig schüchtern. Jochimsen zeigte auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. Als Corinna Platz genommen hatte, griff er erneut in die ominöse Plastikschale. Darin waren Veilchenpastillen, wie sie jetzt erkennen konnte. Ehe sie Jochimsens Frage vollständig beantworten konnte, hielt der ihr die Plastikschale hin. Sie nahm eine Pastille heraus und kaute vorsichtig darauf herum. Dann zückte sie ein Taschentuch und ließ das Teil dezent darin verschwinden. Widerliches Zeug, dachte sie. Warum aß er nicht gleich frisch gepflückte Wildblumen?
»Ganz sicher sogar!«, fuhr Corinna schließlich fort. »Wie Sie meiner Akte sicher entnommen haben, sind meine Qualifikationen für den Posten hier nicht unbedingt die schlechtesten.«
Hatte sie das gerade wirklich gesagt? Corinna spürte ein Kribbeln in der Magengegend. Es war ein ähnliches Gefühl wie das, als sie ihrer Mutter sagen musste, dass sie von zu Hause ausziehen werde. Unangenehme Wahrheiten auszusprechen rief bei Corinna Dupont immer dieses Kribbeln hervor. Danach fühlte sie sich wie von einer Zentnerlast befreit. So auch jetzt.
Jochimsen schien Corinnas Satz jedoch nicht weiter zu beeindrucken.
»Haben Sie schon einmal auf einen Menschen geschossen?«
Jochimsen hatte sich einen Kaffee aus der Thermoskanne, die auf seinem Schreibtisch stand, eingegossen. Auf der Tasse war die Karikatur eines sehr dicken Mannes zu erkennen, der ein T-Shirt mit der Aufschrift Bier formte diesen schönen Körper trug. Genau mein Humor, dachte Corinna und versuchte, die unerwartete Frage wegzulächeln.
»Natürlich nicht! Ich verstehe auch nicht, worauf Sie hinauswollen!«
»Und ich verstehe nicht, was Sie hier zu suchen haben, um ehrlich zu sein«, schoss Jochimsen unbarmherzig zurück.
»Das, was ich Ihrer Akte entnehmen kann, bringt mich vielmehr zu der Annahme, dass Sie gänzlich ungeeignet für die Arbeit bei der Mordkommission sind. Ein richtiger Polizist wird auch als solcher geboren. Und Sie? Sie schnuppern hier rein, schnuppern dort rein und meinen jetzt, den Traumjob gefunden zu haben?«
Corinna zwang sich, ruhig zu bleiben. Das Ganze sollte nicht der Anfang vom Ende ihrer Polizeikarriere sein. Sie musste diesem Ekel Paroli bieten.
»Richtig«, war ihre knappe Antwort. »Genauso ist es. Und ich wüsste nicht, inwiefern mein Lebenslauf jemanden wie Sie zu einer anderen Meinung kommen lassen könnte!«
Das musste gesessen haben. Aus einem etwas irrationalen Grund fühlte sie sich plötzlich wie Muhammad Ali. Nur mit Mühe konnte Corinna ein Lächeln unterdrücken.
Ihre Eltern waren große Fans des vermutlich besten Boxers aller Zeiten gewesen. Irgendwann – sie musste zehn gewesen sein – hatte Corinna sie gebeten, den legendären Rumble in the Jungle mit ihnen schauen zu dürfen, der damals in keinem sportlichen Jahresrückblick fehlte. Der Kampf, in dem Ali seinen größten Widersacher George Foreman am Ende der achten Runde niederstreckte. Es war der Kampf, der Ali endgültig zur Legende machte. Und es war der Kampf, der den Ali Shuffle weltberühmt werden ließ: Um den Gegner zu irritieren, tänzelte Ali kurz, um dann seinen gefürchteten Jab ins Ziel zu bringen.
Corinna musste aufpassen, dass sie selbst nicht zu tänzeln begann, denn ein wenig fühlte sie sich in diesem Moment, wie Ali sich in der achten Runde des Rumble in the Jungle gefühlt haben musste.
»Das ist kein Lebenslauf, sondern die Chronik einer gescheiterten Existenz!«
Jochimsen griff in eine Papiertüte, fischte einen Berliner heraus, tauchte diesen in seinen Kaffee und lutschte schließlich genüsslich an der tropfenden Backware. Dabei verfing sich der Puderzucker in seinem Schnauzbart und zierte zudem seine Nasenspitze. Ohne den Berliner hätte man meinen können, der Kommissar habe die Nase zu tief in Kokain getunkt. Foreman ging nun in den Infight.
»Ich war vierzehn, als ich wusste, dass ich Polizist werden wollte. Mit sechzehn habe ich auf Vögel geschossen, ein Jahr später auf Hasen. Verstehen Sie, was ich Ihnen damit sagen will?«
Corinna musste für die Antwort nicht lange überlegen. Alis Leberhaken waren berüchtigt, und er kannte Foremans Schwachstelle.
»Klar weiß ich das. Vermutlich hatten Ihre Eltern zu Hause einen prall gefüllten Waffenschrank und Sie – hoffentlich – einen Waffenschein. Auf Vögel und Hasen zu schießen erfordert sicher eine Menge Mut und vor allem ein Höchstmaß an kriminalistischem Gespür. Sie sind schon jetzt mein absolutes Vorbild und ein Held.«
Jochimsen legte den Rest des Berliners achtlos auf den Schreibtisch und erhob sich. Er griff ein weiteres Mal nach den Veilchenpastillen. Gleich würde ihn der Ringrichter anzählen.
»Wissen Sie was«, kam Corinna ihm zuvor, »Sie haben meine Bewerbungsunterlagen und meine Personalakte sicher nicht erst seit gestern. Wenn Sie also das, was Sie über mich in Erfahrung gebracht haben, so unglaublich ungeeignet finden, um den Job hier zu machen, warum haben Sie nicht schon eher Ihr Veto eingelegt? Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Sie müssen wohl oder übel mit mir klarkommen.«
Corinna reichte Jochimsen die Hand.
»Dupont. Corinna Dupont. Freut mich, Sie kennenzulernen, Hauptkommissar Jochimsen!«
Ein kurzer kräftiger Händedruck folgte. Dann ein aufgesetztes Lächeln. Jochimsens obere Zahnreihe glänzte mattviolett. Zusammen mit den Zuckerresten in seinen Mundwinkeln ergab dies ein immer unappetitlicher werdendes Bild.
»Ich könnte jetzt etwas essen. Wollen Sie auch noch was? Der Bäcker um die Ecke soll gut sein, wie mir berichtet wurde.«
Keine Reaktion. Stattdessen öffnete Jochimsen die oberste Schublade seines Schreibtischs, fischte eine Akte heraus und hielt sie Corinna vor die Nase.
»Vielleicht ist das hier ja für eine wie Sie genau der richtige Einstieg in den Polizeidienst.«
Corinna versuchte, die Beschriftung der Akte zu entziffern.
»Eine wie ich? Klingt spannend!«, konterte sie. »Wenn Sie mit dem Teil hier nicht ständig hin- und herwedeln würden, könnte ich sogar etwas erkennen.«
Jochimsen drückte Corinna die Akte in die Hand.
»Lesen Sie. Aber lesen Sie alles. Lassen Sie nichts aus. Und wenn Sie merken sollten, dass es Ihnen zu viel wird, geben Sie sie mir einfach zurück. Verstanden?«
»Verstanden!«, wiederholte Corinna den Wortlaut ihres Chefs. »Dann werde ich den Bäcker an einem anderen Tag ausprobieren.«
Corinna las den Namen auf der Akte.
»Bis wann brauchen Sie ein Feedback zu diesem Fall? Ich nehme an, Lilly ist der Name des Opfers?«
Jochimsen nickte nachdenklich.
»Bis gestern! Wir müssen das Schwein finden. Und zwar schnell!«
Corinna salutierte mit der Akte unter dem Arm. Sieg nach technischem K. o. in der achten Runde.
»Aye, aye, Chef! Ich beeile mich.«
Sie hatte das Büro ihres Vorgesetzten fast verlassen, als dieser ihr hinterherrief.
»Düpong!«
»Ja, Chef?« Corinna lugte durch den Türspalt.
»Dieser Fall ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Nummer zu groß für einen Rookie wie Sie. Zögern Sie also nicht, sich helfen zu lassen. Haben Sie mich verstanden?«
Ein gelangweiltes Pffft! und genervtes Augenrollen waren alles, was Corinna in dem Moment für Jochimsen übrighatte. Was für ein Typ! Auf wessen Seite stand der eigentlich? Sie beschloss, sich sofort in die Arbeit zu stürzen, und zog die Bürotür hinter sich zu, ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen. Sie fühlte sich gut. Und sie war bereit. Bereit für die größte Herausforderung ihres Lebens.
KAPITEL 8
Corinna blickte konsterniert auf den Bildschirm, auf dem eine perfekt gestylte Blondine die neuesten Horrormeldungen aus allen Teilen des Erdballs verlas. »Eintausendachthundert! Das ist nicht irgendeine Zahl. Eintausendachthundert Menschen verüben in Nordrhein-Westfalen jedes Jahr Selbstmord. Nur die wenigsten Fälle werden publik gemacht. Selbstmord ist noch immer ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Ein besonders spektakulärer Fall ereignete sich jüngst in Dortmund, wo sich der Chefarzt des Klinikums in den Tod gestürzt hat. Die Polizei fand einen Abschiedsbrief und schließt Fremdverschulden aus!«
Routiniert kraulte Corinna den Nacken ihres Katers, der es sich auf ihrem Schoß gemütlich gemacht hatte.
»Was ist nur los mit dieser Welt? Hm, Kalle, was meinst du dazu, so als Unbeteiligter?«
Kalle schnurrte genießerisch, drehte sich auf den Rücken und streckte sich, bis er fast die doppelte Körperlänge erreicht hatte.
Es war nicht bei einem Grappa geblieben. Die Flasche, die neben ihr auf dem Tisch stand, war fast leer. Sie hielt ihre Hand vor den Mund, atmete aus und verzog angewidert das Gesicht. Konnte es wirklich sein, dass sie in diesem Zustand Brötchen gekauft hatte? Das Lächeln der Bäckereifachverkäuferin war jedenfalls so unverbindlich wie immer gewesen. Corinnas Appetit auf frische Dinkelbrötchen war mit Macht und unmittelbar, nachdem Paul gegangen war und sie noch einen großen Schluck Grappa genommen hatte, gekommen. Und dann hatte sie ihn gesehen. Er hatte frisch gepressten Orangensaft getrunken, Rührei gegessen und dabei auf eine junge Frau eingeredet. Corinna hatte an sich hinabgesehen und kurz überlegt. Nein, dies war nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, um Jochimsen zur Rede zu stellen. Der Schuss wäre nach hinten losgegangen. Und so hatte sie es vorgezogen, die Bäckerei mit den ofenwarmen Brötchen im Arm zu verlassen, ehe ihr ehemaliger Chef sie hatte entdecken können.
»Was ist nur los mit dieser Welt?«, wiederholte sie, »Plastikmüll in den Ozeanen, Religionskriege wie im Mittelalter, Hungersnöte, die Pest ist auch wieder da. Heidewitzka, Herr Kapitän!«
Kalle ließ sich langsam zu ihren Füßen auf den Boden gleiten.
»Und hier bei uns, in diesem unserem Land, wo Milch und Honig fließen, wo niemand wirklich jammern müsste, bringen sich die Leute gleich reihenweise um.«
Corinna griff sanft nach Kalle und platzierte den Kater wieder auf ihrem Schoß, der sogleich seine Krallen ausfuhr und sie an ihrem Oberschenkel wetzte.
»Aua, das tut weh, Kalle!«
Der Kater ließ sich nicht beirren und machte weiter, diesmal allerdings etwas rücksichtsvoller.
»Warum um alles in der Welt begehe ich Selbstmord, wenn ich Klinikleiter bin? Was bitte ist in diesen Mann gefahren? Was kann nur so schlimm gewesen sein, dass er so etwas tut?«
Mit diesen Worten hievte sie Kalle von ihrem Schoß und legte ihn vorsichtig auf seine Decke am anderen Ende des Sofas.
»Ich hole mir eben noch was zu trinken aus der Küche«, erklärte sie ihrem Kater, der sie fragend anschaute.