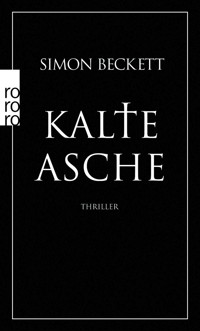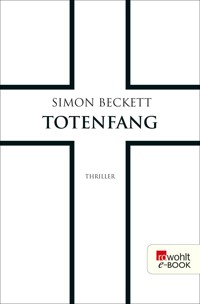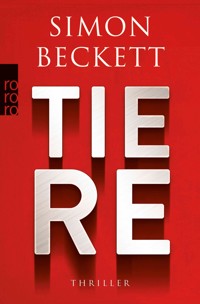
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manche Menschen sind Tiere. Nigel ist ein Außenseiter, aber er ist meistens ganz guter Laune. Im Büro gibt es immer etwas zu kopieren, und außerdem sind da Cheryl und Karen. Auch im Pub, den seine Eltern früher führten und in dem Nigel jetzt wohnt, fühlt er sich wohl. Es gibt hier zwar kein Bier und keine Zigaretten mehr, aber Nigel interessiert sich sowieso mehr für Fernsehen und Comics. Und dann ist da noch der Keller. Hier hält Nigel seine Mitbewohner. Dass die nicht freiwillig da unten wohnen, stört Nigel nicht … Ausgezeichnet mit dem «Marlowe» der Raymond-Chandler-Gesellschaft als «Bester internationaler Spannungsroman».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Simon Beckett
Tiere
Thriller
Aus dem Englischen von Andree Hesse
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Manche Menschen sind Tiere.
Nigel ist sicherlich nicht der Hellste. Aber er ist meistens ganz guter Laune. Im Büro gibt es immer etwas zu kopieren, und außerdem sind da Cheryl und Karen. Auch im Pub, das seine Eltern früher führten und in dem Nigel jetzt wohnt, fühlt er sich wohl. Es gibt hier zwar kein Bier und keine Zigaretten mehr, aber Nigel interessiert sich sowieso mehr für Fernsehen und Comics.
Und dann ist da noch der Keller. Hier hält Nigel seine Mitbewohner. Dass die nicht freiwillig da unten wohnen, stört Nigel nicht …
Ausgezeichnet mit dem «Marlowe» der Raymond Chandler Society als «Bester internationaler Spannungsroman».
Über Simon Beckett
Simon Beckett arbeitete als Hausmeister, Lehrer und Schlagzeuger, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Als Journalist hatte er Einblick in die Polizeiarbeit, ein Wissen, das er in seinen Romanen verarbeitete. Die Thriller «Die Chemie des Todes», «Kalte Asche» sowie «Leichenblässe» standen monatelang auf Platz 1 der Taschenbuch-Bestsellerliste. Simon Beckett ist verheiratet und lebt in Sheffield.
Veröffentlichungen:
Die Chemie des Todes
Kalte Asche
Leichenblässe
Obsession
Flammenbrut
Voyeur
Weitere Informationen zum Autor
Erfahren Sie mehr über Simon Beckett und entdecken Sie spannende Hintergrundinformationen und spannende Aktionen auf www.simon-beckett.de und facebook.com/SimonBeckett.de
Inhaltsübersicht
Dank an Barbara und Bill vom The Washington
Vorwort
Tiere ist mein zweiter Roman und bis heute wohl mein bösester. Hinsichtlich des Stils, der Geschichte und der Erzählperspektive war und ist er sicherlich ein Sonderfall. Mehr noch als beim Vorgänger Voyeur wollte ich einen Erzähler erschaffen, der grausame Taten begeht, für den der Leser aber dennoch Sympathien hegt. Ein Monster mit menschlichem Antlitz, wenn man so will. Außerdem steckt in dem Roman viel schwarzer Humor, denn der Leser soll lachen, selbst wenn ihn die Geschichte erschreckt.
Keine Figur hat mir beim Schreiben so wenig Mühe gemacht wie Nigel, was bei näherer Betrachtung etwas bedenklich ist. Ein Comic-Fan und fernsehsüchtiger Einzelgänger, dem nicht einmal bewusst ist, dass das, was er tut, falsch ist, ja der gar nicht versteht, warum er es tut. Und der, trotz der Vorgänge in seinem Keller, Angst hat, nachts auf die Straße zu gehen, weil ihm ein «Irrer» auflauern könnte.
Da Tiere nach Voyeur erschien, einem feinsinnigen Thriller aus der Sicht eines kultivierten und hochgebildeten Kunsthändlers, wussten viele Leute nicht so recht, wie sie auf Nigel oder auf das Buch reagieren sollten. Deshalb war es umso schöner, als das Buch in Deutschland einen Preis gewann, nämlich den «Marlowe» der Raymond-Chandler-Gesellschaft für den besten internationalen Kriminalroman. Es ist der einzige Preis, den ich jemals gewonnen habe, und ich bin noch heute stolz darauf. Tiere ist wie seine Hauptfigur Nigel ohne Zweifel etwas … anders. Doch mir sind beide ans Herz gewachsen.
Simon Beckett, Oktober 2010
Kapitel 1
Ich hasse es, wenn Karen mit mir flirtet. Sie meint es auch gar nicht ernst. Ich habe extra früher Feierabend gemacht, um ihr aus dem Weg zu gehen, doch dann habe ich den Bus verpasst und stand noch an der Haltestelle, als sie mit Cheryl vorbeikam.
«Hey, Süßer», sagte Karen und zwinkerte mir zu. Cheryl lächelte nur und sagte: «Schönen Abend, Nigel.» Ich wollte sie zurückgrüßen, bekam die Worte aber nicht richtig raus. Ich fühle mich immer komisch, wenn Cheryl mit mir spricht.
Ich grübelte noch darüber nach, als der Bus kam. Ich stieg ein und ging nach oben. Wenn man unten sitzt und es voll wird, steht immer irgendeine fette alte Frau vor einem, und dann kriegt man ein schlechtes Gewissen, wenn man nicht aufsteht. Aber ich sitze sowieso lieber oben. Da hat man einen besseren Ausblick. Sobald man aus dem Stadtzentrum raus ist, kann man meilenweit gucken, jetzt, wo die meisten Fabriken und Geschäfte verschwunden sind. Obwohl nicht mehr viel übrig geblieben ist, was man angucken kann.
Ich muss an der zweiten Haltestelle hinter der Kanalbrücke aussteigen. Ich nehme mir immer vor, eines Tages im Bus zu bleiben, um zu sehen, wohin er fährt, aber ich mache es nie. Wahrscheinlich würde es eh ein Vermögen kosten. Als wir an der Stelle vorbeikamen, wo mal das Schwimmbad gewesen ist, drückte ich auf den Halteknopf und stieg aus. Das Schwimmbad wurde vor ungefähr einem Jahr abgerissen, aber das war mir ziemlich egal. Es ist schon seit Ewigkeiten geschlossen, und ich kann sowieso nicht schwimmen. Und jetzt, wo es weg ist, kann man eine Abkürzung über das Gelände nehmen und muss nicht den ganzen Weg drum herumgehen.
Wenn es abends schon dunkel ist, gehe ich dort nicht mehr lang, denn die Straßenlaternen in der Nähe sind kaputt, und es wird ein bisschen unheimlich. Aber im Sommer, wenn das ganze Unkraut und so wächst, ist es schön. Fast so schön wie ein Park.
Da es warm und sonnig war, ging ich quer über das Gelände. Zum Pub sind es von dort nur zehn Minuten zu Fuß. Er liegt an einer Ecke, und jetzt, wo praktisch alle anderen Häuser abgerissen sind, kann man ihn nicht verfehlen. Schon aus einiger Entfernung konnte ich das Schild quietschen hören. Das macht es immer, sobald eine leichte Brise aufkommt. Irgendwann werde ich es mal ölen müssen.
Ich ging durch das Tor in den Biergarten, der hinter dem Pub liegt, und schloss die Tür zur Küche auf. Ich gehe immer hier rein und nicht durch die Vordertür, weil man dann eher das Gefühl hat, als würde man in ein normales Haus gehen. Und nicht in einen leeren Pub. Ich war kurz davor zu verhungern, ging aber erst mal nach oben, um mich umzuziehen. Ich erledige immer erst die nötigen Arbeiten, bevor ich mir was zu essen mache. Auf diese Weise kann ich danach alles in Ruhe angehen.
Nachdem ich mir ein T-Shirt und eine Jeans angezogen und mein Hemd und die gute Hose aufgehängt hatte, damit die Falten rausgehen, ging ich runter in die Schankstube und dann in den Keller. Man würde annehmen, dass ein Keller total dunkel und dreckig ist, aber das ist er nicht. Die Wände sind mit so einem Isolierzeug weiß getüncht, und es gibt eine richtig helle Glühbirne, damit man sehen kann, was man macht. Dort unten stehen noch immer ein paar Fässer rum, aus denen Schläuche kommen, die durch die Decke zur Theke führen, aber die sind alle leer. Wahrscheinlich ist das Bier mittlerweile verdunstet.
Ich ging zum Spülbecken an der hinteren Wand und nahm die Hundetröge, die darunter stehen. Ich benutze diese Doppelschüsseln, bei denen man auf der einen Seite Futter und auf der anderen Wasser reintun kann. Das ganze Hundefutter lagere ich auch dort. Früher habe ich Dosen gekauft, aber jetzt hole ich das Zeug in den großen Plastikwürsten. Die sind billiger und nehmen später im Mülleimer nicht so viel Platz weg. Ich quetschte ungefähr eine halbe Wurst in jede der vier Schüsseln und stellte sie dann auf das Tablett. Seit ich die Schüsseln mal fallen gelassen habe, nehme ich immer das Tablett. Das war nämlich eine echte Schweinerei.
Gleich neben der Spüle ist eine Tür. Ich schloss sie auf und ging mit dem Tablett in den Gang. Er wirkt ein bisschen schmuddeliger als der Pubkeller, weil die Wände nicht getüncht sind. Aber mein Papa hat eine Lampe angebracht, sodass es jetzt wenigstens hell genug ist. In der Mitte liegt das Ende eines Schlauches mit einer Spritzdüse. Er ist mit der Spüle verbunden, und ich habe ihn so weit wie möglich unter der Tür hindurch in den Gang gezogen, damit ich für das Wasser nicht den ganzen Weg in den Hauptkeller zurückgehen muss.
Ich füllte die leeren Hälften jeder Schüssel und ging weiter zur Tür am anderen Ende. Die schweren Riegel klemmen, und ich habe mir schon ein paar Mal die Knöcheln an ihnen aufgescheuert. Doch an diesem Abend bekam ich sie ohne Probleme auf, öffnete dann die Tür und machte das Licht an.
Zur Fütterung werden sie oft unruhig, an diesem Abend erschienen sie jedoch recht friedlich. Trotzdem schob ich die Schüsseln lieber mit einem Besenstiel unter den Gittern der einzelnen Abteile hindurch. Nur für den Fall. Das Neue bekam sein Futter zum Schluss. Die anderen drei begannen sofort zu fressen, das Neue aber nicht. Es betrachtete nur das Futter und kippte dann die Schüssel um.
«Du kannst uns nicht ständig diesen Fraß vorsetzen!», schrie es, als ich hinausging.
Ich wusste, dass ich mit dem Rothaarigen Probleme bekommen würde.
Kapitel 2
Ich hatte es erst seit ein paar Tagen und bereute es schon. Eigentlich wollte ich es auch gar nicht. Es war selbst schuld gewesen. Ich hatte es auf der Straße stehen sehen, als ich zum Fish-and-Chips-Laden gegangen bin. Ich dachte, es würde auf seinen Freund warten oder so. Es sah nicht so aufgetakelt und verbraucht aus wie die meisten von dieser Sorte. Als ich aus dem Laden kam, stand es immer noch dort, und als ich vorbeiging, sagte es: «Hast du mal die Uhrzeit für mich, Schätzchen?» Ich dachte, sein Freund hat sich verspätet, deswegen sagte ich ihm, wie spät es ist, und wollte schon weitergehen. Aber da fragte es plötzlich: «Wohnst du weit weg von hier?»
Ich dachte immer noch nicht, dass es eine Hure ist. Es hatte zwar einen schwarzen Minirock an und trug hochhackige Schuhe und so, aber es sah trotzdem nicht wie eine aus. Es hatte dunkelrotes Haar, so ein echtes Rot und kein Rotblond, und unglaublich strahlende blaue Augen. Es sah nett aus. Einen Augenblick dachte ich, es wäre einfach nur freundlich. Wollte ein wenig plaudern. Dann sagte es: «Lust auf Gesellschaft?»
Ich war ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein. Trotzdem hätte ich es fast dabei belassen. Ich hatte ziemlichen Hunger und wollte meine Fish and Chips nicht kalt werden lassen. Doch während ich noch überlegte, was ich tun soll, meinte es: «Mit mir kann man viel Spaß haben. Es wird dir gefallen», und lächelte. Ein völlig falsches Lächeln. Das war es dann. «In Ordnung», sagte ich.
Es forderte einen Aufpreis, um mit zu mir nach Hause zu kommen, anstatt zu ihm zu gehen. Aber wir klärten das und gingen los. «Ich bin Marcie», sagte es. «Wie heißt du?» Ich sagte meinen Namen, hielt mich aber ansonsten zurück, weil ich überlegte, was ich tun soll, wenn wir bei mir sind. Ich hatte nicht damit gerechnet, etwas mit nach Hause zu nehmen. Ich war nicht darauf vorbereitet.
Als es den Pub sah, war es total überrascht. «Hier wohnst du?», fragte es. «Ganz allein?» Es blieb vor der Tür stehen, als würde es sich fragen, ob es reingehen soll oder nicht, aber dann folgte es mir doch. Ich hatte seit ein paar Tagen nicht abgewaschen, und als es den Geschirrhaufen in der Spüle sah, meinte es: «Ja, jetzt sehe ich, dass du alleine wohnst.»
Ich wollte es nicht nach oben ins Wohnzimmer bringen. Dann hätte ich es nämlich wieder die Treppe runtertragen müssen. Außerdem hatte es dort oben einfach nichts verloren. Deshalb hielt ich die Tür zur Schankstube auf, damit es dort reinging. Es rührte sich aber nicht. Guckte mich einfach nur an und sagte: «Ich will das Geld im Voraus.» Ich musste mein Essen ablegen und mein Portemonnaie hervorholen. Von meinem Lohn war nicht mehr viel übrig, aber das war egal. Ich würde das Geld ja später zurückbekommen. Als es das Geld nahm, sagte es nicht einmal danke. Ich ging in die Schankstube.
«Hier rein?», fragte es. Ich sagte ja, und es zuckte mit den Schultern. «Wie du willst.» In der Mitte des Raumes blieb es stehen und schaute mich an. Ich legte mein Essen auf einen Tisch, ging hinter die Theke und nahm eine Flasche Whisky. «Willst du was trinken?», fragte ich.
«Ich mag keinen Whisky, danke», sagte es. Das brachte mich durcheinander. Etwas anderes hatte ich nämlich nicht. Bisher hatte noch keines von ihnen abgelehnt. «Eine Tasse Tee?», fragte ich. Es lächelte und sagte: «Nein danke.»
«Ich trinke einen Tee», erklärte ich, und es sagte: «Oh, bitte, lass uns einfach zur Sache kommen, Süßer, ok?» Es klang eher gelangweilt als böse.
Ich wurde ein bisschen nervös. Es musste unbedingt etwas trinken. «Und mein Essen?», fragte ich. Es guckte mich an und sagte: «Du willst vorher essen? Du bist ein echtes Raubtier, was?» Ich wurde rot, aber es lachte nur, schaute auf seine Uhr und meinte: «Na schön, meinetwegen, dann nehme ich eine Tasse Tee.»
Ich sagte, dass ich in einer Minute zurück wäre, und ging wieder hinter die Theke und in die Küche. Ich schloss die Thekenklappe hinter mir, damit ich hören konnte, falls das Rothaarige mir folgen sollte. Dann setzte ich Wasser auf und lief so leise wie möglich nach oben ins Badezimmer. Ich nahm eine Flasche mit den Tabletten meiner Mama aus dem Schrank und ging wieder nach unten. Von den richtig starken waren keine mehr übrig, weil ich die schon aufgebraucht und den Rest in den Whisky getan hatte. Aber ich hatte noch genug von den Tabletten, die sie davor genommen hat, und von denen musste ich einfach nur mehr reintun.
Da das Wasser noch nicht kochte, als ich runterkam, blieb mir genug Zeit, um die Tabletten mit dem Nudelholz meiner Mama zu zermahlen. Das Puder tat ich mit einem Teebeutel in eine Tasse und rührte um. Sie lösen sich immer ziemlich schlecht auf. Selbst den Whisky muss ich vorher immer erst schütteln, damit sich das weiße Zeug vom Boden löst. Zur Sicherheit gab ich ein paar Zuckerwürfel und Milch in den Tee und rührte noch einmal um.
Als ich in die Schankstube zurückkam, saß es vor meinem Essen am Tisch und aß von den Pommes. Als es mich sah, lächelte es. «Hast mich ertappt, was?», sagte es. Ich wusste nicht, was es meinte, und fragte: «Wobei?» – «Wie ich dir deine Pommes wegesse», sagte es. «Tut mir leid, aber wenn man sie riecht, kann man nicht widerstehen, oder? Obwohl sie meiner Figur nicht guttun.»
Es sah nicht so aus, als müsste es auf seine Figur achten. Als ich ihm die Teetasse gab, sagte es danke und trank einen Schluck. Sofort verzog es das Gesicht. «Mein Gott, wie viel Zucker hast du denn da reingetan?», fragte es.
«Nur einen Würfel», sagte ich.
«Aber einen großen», sagte es.
«Ist er zu süß?»
«Nein, schon in Ordnung. Früher habe ich immer zwei genommen, aber das habe ich runtergeschraubt.» Es nahm noch einen Schluck und sagte: «Keine Ahnung, was für einen Tee du hast, aber ich kaufe immer eine andere Sorte.» Ich schob die Pommes und den Fisch rüber.
«Willst du noch Pommes?», fragte ich. «Du mästest mich», sagte es und bediente sich. Aber nur von den Pommes, nicht vom Fisch.
Mitten im Kauen begann es zu gähnen. Ich aß weiter und versuchte, mir nichts anmerken zu lassen. Es trank noch einen Schluck Tee, aber als es dann die Tasse absetzte, verfehlte es fast den Tisch.
«Ich fühl mich komisch», sagte es. Es sprach ziemlich undeutlich und sah aus, als könnte es die Augen kaum offen halten. Ich hob seine Tasse hoch und sagte: «Trink noch einen Schluck.» Es versuchte, den Kopf zu schütteln, aber ich hielt ihm den Becher genau vor den Mund, und es nahm noch ein paar Schlucke, bevor es den Kopf wegdrehte. Der Tee tropfte ihm vom Kinn. Es hatte einen komischen Blick aufgesetzt und sagte etwas, aber ich konnte es nicht verstehen. Dann versuchte es aufzustehen, setzte sich aber sofort wieder hin. Ich ging hinüber und half ihm auf. Es lehnte sich an mich, und als ich es zur Kellertür führte, sackte ihm der Kopf weg. Der Gang die Treppe hinab war etwas heikel, weil es total schlaff war. Aber das waren sie immer, und ich bin schon mit Schwereren fertiggeworden.
Als wir unten waren, öffnete es die Augen und wollte etwas sagen. Ich lehnte es gegen die Wand, während ich die Tür am anderen Ende entriegelte, doch dann sagte es nein und versuchte wegzugehen. Es sah ziemlich komisch aus, denn seine Beine waren total wacklig. Ich musste loslaufen, damit ich es auffangen konnte, bevor es vornüberkippte. Wenn sie erst mal am Boden liegen, kriegt man sie kaum noch hoch.
Als ich es zum letzten Abteil führte, sagten die anderen, das alte Weib, das Dicke und das Schwarze, kein Wort. Sie schauten einfach zu. Das alte Weib brummelte nur wie immer vor sich hin, und dann sagte das Schwarze: «Nein, Mann», und begann zu stöhnen und den Kopf zu schütteln. Das macht es häufig.
«Du kannst sie hier bei mir reinstecken, wenn du willst», sagte das Dicke. Wenn ich das Rothaarige nicht hätte halten müssen, hätte ich ihm einen Eimer Wasser über den Kopf gekippt. Aber da ich das im Moment nicht tun konnte, sagte ich nur, es solle den Mund halten, und ging weiter zum nächsten Abteil. Das hatte eine richtige Matratze und war schon seit ein paar Wochen leer. Das Rothaarige schaute sich um und gab ein paar unverständliche Laute von sich, als ich das Metallgitter aufmachte und es gegen die Wand schlug. Das Rothaarige versuchte, sich von mir loszureißen, aber ich gab ihm einen kleinen Stoß, da stürzte es ins Abteil und fiel auf die Matratze. Es sackte einfach in sich zusammen, sodass ich mich nicht einmal beeilen musste, um das Gitter zu schließen. Ich vergewisserte mich, dass alle Riegel anständig verschlossen waren, und holte dann einen Eimer mit Wasser. Ich habe unten immer zwei oder drei volle Eimer stehen, nur für den Fall. Ich drehte mich zum Abteil des Dicken um und tat so, als würde ich mit dem Eimer ausholen. Da duckte es sich weg und rief: «Nein, nicht! Es tut mir leid!» Es verharrte so, wartend, dann stellte ich den Eimer ab, ohne das Wasser über ihm auszukippen.
Manchmal ist es besser, wenn man sie einfach im Glauben lässt, man würde etwas tun. Auf diese Weise wissen sie nie, wann man es ernst meint.
Wir sind in den Pub gezogen, nachdem mein Papa im Stahlwerk entlassen wurde. Er war Elektriker in der Schmelzerei. Dort stehen die großen Öfen und Maschinen. Einmal hat er mich mitgenommen. An viel kann ich mich nicht erinnern, außer dass es heiß und dunkel und unglaublich laut war. Es gefiel mir nicht. Ich hatte Angst, dass ich mich verlaufen könnte oder dass mich die ganzen Funken verbrennen, die dort rumfliegen.
Dann haben sie ihn entlassen und ihm jede Menge Geld gegeben, mit dem meine Mama und er den Pub kaufen konnten. Der war nicht an eine Brauerei gebunden und hieß früher The Saddle, mein Papa taufte ihn aber in The Brown Bear um. So hieß sein Lieblingspub, als er jünger war. Er hatte extra ein neues Schild anfertigen lassen, doch als es geliefert wurde, war der Bär eher weiß als braun. Meine Mama bekam einen Anfall, weil wir es schon bezahlt hatten. Mein Papa versuchte, den Schildmaler dazu zu kriegen, ein neues zu machen, aber er weigerte sich. Deshalb hatten wir schließlich einen Eisbären draußen hängen. Mein Papa machte immer einen Witz draus und erzählte jedem, der fragte, dass es ein Braunbär ist, dem es nicht besonders gutgeht. Aber meine Mama fand das nie lustig. Ich fand immer, dass der Bär, unabhängig davon, welche Farbe er eigentlich haben sollte, ein bisschen bösartig aussieht.
Die erste Zeit nach unserem Einzug war furchtbar aufregend. Ich lag nachts im Bett und lauschte den Leuten, die unten lachten und redeten. Es war, als würden meine Mama und mein Papa jeden Abend eine Party feiern. Manchmal schlich ich mich runter und spähte durch die Tür in die Küche. Von dort konnte man ein bisschen vom Gesellschaftsraum und von der Schankstube sehen. Der Gesellschaftsraum war fast immer leer, die Schankstube aber jedes Mal zum Bersten voll, sowohl nachmittags als auch abends, denn ständig kamen neue Schichtarbeiter aus den Fabriken. Alle Männer trugen Overalls und Arbeitsklamotten. Unter dem Zigarettenqualm und Bierdunst lag immer ein öliger Maschinengeruch. Ich lauschte gerne ihren Stimmen und dem Klirren der Gläser. Das gab mir ein warmes, behagliches Gefühl.
Aber das ist jetzt alles vorbei.
Kapitel 3
Am nächsten Tag luden mich Cheryl und Karen ein. Ich hatte sie den ganzen Morgen nicht gesehen. So ist es manchmal. Wenn man nichts in ihrer Abteilung zu tun hat, kann man ihnen tagelang nicht über den Weg laufen. Ich arbeite in diesem großen Bürogebäude vom Arbeitsamt. Da geht es überall um Arbeitsvermittlung und so weiter, und es ist echt riesig. Es hat zwölf Stockwerke, und man kann sich leicht darin verlaufen. Ich kenne mich aber ziemlich gut dort aus.
Meine Mama war unglaublich froh, als ich den Job bekam, denn so konnte sie den Leuten sagen, dass ich für die Regierung arbeite. Dabei musste ich mich nicht einmal bewerben. Das Arbeitsamt hatte mich gefragt, ob ich an ein paar Förderprogrammen teilnehmen wollte, und ich sagte, in Ordnung, und füllte ein paar Formulare aus. Als Nächstes sagten sie mir, ich würde hier anfangen. Das Gehalt ist nicht gerade gut, eigentlich kaum höher, als wenn ich Arbeitslosengeld bekommen würde. Aber meine Mama meinte, darum geht es nicht. «Es ist besser für dich, wenn du eine anständige Arbeit hast», sagte sie immer. «Ich will nicht, dass mein Sohn zum Schnorrer wird.»
Ich erledige alle möglichen Arbeiten. Fotokopieren, das mache ich oft. Und Faxe einsammeln. Solche Sachen eben. Zuerst wurde ich in die dritte Etage gesteckt und hatte ein bisschen Angst, dass ich was falsch machen könnte. Abgesehen von mir schien jeder genau zu wissen, was er zu tun hat. In der ersten Woche verursachte ich beim Fotokopieren ein totales Chaos. Ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist, aber am Ende waren alle Seiten in der falschen Reihenfolge und die Kopien mit den Originalen vermengt. Als ich merkte, was ich angerichtet hatte, versuchte ich den ganzen Haufen zu ordnen, machte aber alles nur noch schlimmer. Ich war den Tränen nahe, als Mrs. Lepping kam. Ich dachte, ich werde gefeuert, und wusste nicht, wie ich es meiner Mama sagen soll.
Aber Mrs. Lepping machte keinen Aufstand. Sie sagte nur: «Oh, meine Güte, da haben wir wohl alles durcheinandergebracht, was, Nigel?» Ich sagte ja, und sie meinte, ich solle nicht den Kopf hängen lassen. Dann holte sie jemanden, der mir beim Sortieren half. Ich mochte Mrs. Lepping wirklich gern und war traurig, als sie ging, weil sie ein Baby bekam. Mr. Standing, der ihre Stelle übernahm, war auch in Ordnung. Aber nicht so nett wie sie.
Bevor bei der Arbeit alles umgekrempelt wurde, hatte ich nie mit Cheryl und Karen gesprochen. Nicht nur auf unserer Etage wurde alles anders, sondern im ganzen Amt. Ich landete in der fünften, um für Mr. Dewer zu arbeiten. Obwohl ich dort die gleiche Arbeit mache, wäre meine Mama stolz gewesen, denn in den Etagen aufzusteigen ist praktisch eine Beförderung. Doch am Anfang gefiel es mir nicht. Die Fax- und Kopiergeräte waren anders, außerdem kannte ich keinen. Es war wieder wie damals, als ich eingeschult wurde. Und Mr. Dewer mochte ich auch nicht. Er sieht aus, als hätte er anstelle von Augen Glaskugeln, und will mir ständig was anhängen. Wenn er einem eine Arbeit aufträgt, ist seine Stimme ganz ruhig, aber es klingt immer so, als solle man bloß nicht wagen, etwas falsch zu machen. Als ich einmal stolperte und ein Tablett mit Kaffee auf das Faxgerät fallen ließ, ist er ausgeflippt, obwohl es nicht meine Schuld war. Schließlich hat niemand seine Handtasche auf den Gang zu legen.
Das einzig Gute war, dass ich jetzt im gleichen Stockwerk war wie Cheryl und Karen. Ich hatte sie schon ein paarmal gesehen, in der Kantine oder im Fahrstuhl, aber noch nie mit ihnen gesprochen. Sie hängen immer zusammen rum, und ich finde beide echt hübsch. Karen ist groß und schlank und hat dunkles Haar, Cheryl hat blondes Haar und ist kleiner und ein bisschen mollig. Nicht fett oder so, nur schön.
Ich weiß noch genau, was die ersten Worte waren, die Cheryl zu mir sagte. Ich hatte gerade ein neues Blatt auf den Kopierer gelegt, als sie kam und sagte: «Bist du bald fertig?» Ich nickte, und sie lächelte und sagte: «Danke. Wir wollen ja Seine Hoheit nicht warten lassen.» Zuerst wusste ich nicht, was sie meinte, dann wurde mir aber klar, dass sie über Mr. Dewer gesprochen hatte. Sie hatte sich mit mir über ihn lustig gemacht, und das hat mir sehr gefallen. Ich meine, sie hätte ja nicht freundlich sein müssen, oder?
Danach hat sie immer hallo gesagt und gelächelt, wenn ich an ihrem Schreibtisch vorbeikam. Manchmal gehe ich auch dort vorbei, wenn ich es eigentlich gar nicht muss, obwohl ich dann rot werde. Karen sitzt neben ihr, und ich weiß nicht genau, ob ich Karen mag oder nicht. Ihr Gesicht ist nicht so nett wie Cheryls, nicht so freundlich. Man weiß bei ihr nie, ob sie sich lustig über einen macht. Bis Cheryl mich zu grüßen begann, ignorierte sie mich, aber seitdem grinst sie, wenn ich vorbeigehe. Sie lächelt nicht wie Cheryl, sondern grinst, als würde sie etwas Unanständiges wissen. Dadurch werde ich noch röter. Sie sagt so Sachen wie: «Na, gestern Abend einen draufgemacht, Nigel?», oder: «Dieses Wochenende ab nach Monte Carlo?», und so weiter.
Und auch sonst verhält sie sich komisch. Einmal legte ich gerade ein paar Papiere in einen Aktenschrank, als Karen vorbeiwollte. Sie schlug mir auf den Hintern und sagte: «Na los, beweg deinen Arsch.» Dann, ehe ich mich rühren konnte, begann sie sich vorbeizuzwängen. Allerdings beeilte sie sich nicht, und als ich mich an die Wand drückte, damit sie mehr Platz hatte, blieb sie stehen und sagte: «Was ist los, Nigel? Ich störe dich doch nicht, oder?» Ich schüttelte den Kopf, und sie fragte: «Und warum wirst du dann rot?» Sie wusste genau, warum. Sie stand so nah vor mir, dass mich ihr Busen praktisch berührte. Außerdem hielt ich meinen Atem an, weil ich Cheese-and-Onion-Chips gegessen hatte und sie nicht anhauchen wollte. Ich sagte, ich wüsste nicht, warum, und sie grinste wieder und sagte: «Ja, du weißt es wahrscheinlich wirklich nicht.» Dann ging sie vorbei, und als sie um die Ecke war, hörte ich sie lachen. Außerdem konnte ich danach noch eine Ewigkeit ihr Parfüm an mir riechen. Danach hat sie erst mal nicht mehr mit mir gesprochen. Und auch Cheryl hat immer nur hallo und guten Abend gesagt.
Deshalb konnte ich es nicht glauben, als sie mich einluden. Es war Donnerstag, und ich war zur Mittagszeit mit meinen Broten und einer Dose Cola in den Personalraum gegangen. In die Kantine gehe ich nur freitags, als eine Art Belohnung. Wie auch immer, ich hatte mich gerade hingesetzt und abgebissen, als Cheryl ihren Kopf reinsteckte und fragte: «Lust auf einen Drink? Debbie hat Geburtstag.»
Ich wusste, dass jemand Geburtstag hatte, denn einer der Schreibtische war voll mit diesen Karten. Ich hatte mich aber nicht groß darum gekümmert. Ich kannte die Frau nicht gut genug, um ihr zu gratulieren, außerdem hatte mich vorher noch nie jemand auf einen Drink eingeladen, wenn gefeiert wurde.
Mein Mund wurde ganz trocken. Karen stand hinter Cheryl und sah aus, als könnte sie kaum ein Lachen unterdrücken. Cheryl lächelte auch, aber nicht gehässig. Ich spürte, wie ich rot anlief. Ein Teil von mir wäre gerne mitgegangen, aber ich konnte nicht. Die Vorstellung, dass alle Leute aus dem Büro dort waren und tranken und laut waren und so, behagte mir nicht. Ich schüttelte den Kopf.
«Komm schon, zieh dir ein paar Drinks rein», sagte Karen. «Das wird dir guttun.» Ich schüttelte wieder den Kopf. Ich hätte sowieso nichts sagen können, weil das Brot in meinem Mund zu einem Klumpen geworden war, den ich nicht runterschlucken konnte.
«Trinkst du etwa nicht?», meinte Karen. Sie sagte es so, dass ich mich schämte. So, als wäre es klug, wenn man sich betrinkt, und ich wäre blöd, weil ich es nicht tue. Ich sagte nein und wünschte, die beiden würden mich in Ruhe lasse, selbst Cheryl. Aber Karen grinste noch breiter als sonst. «Warst du überhaupt schon mal in einem Pub?», fragte sie. Ich nickte, und sie meinte: «Ja, ganz bestimmt.»
«Doch, ich wohne in einem», sagte ich. Ich hatte vergessen, dass mein Mund voll war, und als ich sprach, versprühte ich die Krümel überall. Ich trank schnell einen Schluck, um das Brot runterzuspülen, aber ich glaube, darauf achteten sie gar nicht. Sie waren zu überrascht.
«Nie im Leben», sagte Karen.
«Doch!», sagte ich.
Cheryl sagte: «Du wohnst in einem Pub? Ehrlich?», und ich nickte. «Wo denn?», fragte sie. Ich erzählte ihr, wo der Pub ist, und dann meinte Karen: «Und wem gehört er?»
«Mir», sagte ich, und sie rief: «Hör doch auf! Du hast keinen Pub!»
Da flippte ich echt aus. «Doch, ich habe einen! Er gehörte meiner Mama und meinem Papa, aber dann sind sie gestorben und haben ihn mir hinterlassen!» Die beiden schauten sich an, und Cheryl meinte: «Echt?» Sie sahen total beeindruckt aus. Sogar Karen. «Wie heißt er?», wollte Cheryl wissen.
«The Brown Bear», sagte ich.
Karen sah immer noch so aus, als wüsste sie nicht, ob sie mir glauben soll oder nicht. «Hat er eine Konzession und so?», fragte sie. Ich sagte ihr, dass er keine hat. «Dann ist also kein Alkohol mehr da?», sagte sie. Ich wünschte bereits, ich hätte den Mund gehalten. Ich schüttelte wieder den Kopf, aber Karen grinste. «Doch, da ist noch Alkohol, oder?»
«Nein, ehrlich», sagte ich, aber ich merkte, dass sie mir nicht glaubte.
Sie begann zu lachen. «Verdammte Scheiße, hättest du das gedacht?», sagte sie zu Cheryl, schaute mich dann wieder an und fragte: «Und du trinkst nie was?» Ich schüttelte wieder den Kopf, und sie meinte: «Gott, ich wäre die ganze Zeit besoffen!»
Ich wollte sagen, dass wirklich keine Getränke mehr übrig geblieben sind, aber dann steckte dieser Stuart, der immer total geschniegelte Anzüge trägt, seinen Kopf durch die Tür. «Kommt ihr beiden jetzt, oder wie?», fragte er, und Karen sagte: «Ja, in Ordnung. Komm mit, Cher», und ging hinaus.
Cheryl blieb zurück. «Willst du nicht doch mitkommen?», fragte sie. Ich sagte nein danke. Ich war echt durcheinander. Ich wünschte, ich hätte nichts von dem Pub gesagt, und hätte sie fast gebeten, den anderen nichts davon zu erzählen, aber ich traute mich nicht. Und selbst wenn Cheryl nichts sagen würde, Karen würde es bestimmt tun. So etwas gefällt ihr.
Ich wartete die ganze Zeit darauf, dass sie zurückkehrten, und bekam keinen Bissen mehr herunter. Obwohl ich mir meine Lieblingssandwiches mit gekochtem Schinken und Tomaten gemacht hatte, verlor ich total den Appetit. Ich begann bald wieder mit der Arbeit, damit ich keinem über den Weg lief, und eine Weile dachte ich, die Sache wäre überstanden. Aber dann kam Alan, einer von den Typen, die an den Computern arbeiten, auf mich zu und fragte: «In letzter Zeit ein paar Pints gezapft, Herr Wirt?», und alle lachten.
So nannten sie mich für den restlichen Nachmittag: Herr Wirt. Als wenn das ein toller Witz wäre oder so. Ich hätte mich am liebsten verkrochen.
Als ich gerade ein paar Aktenkisten im Lagerraum verstaute, kam Cheryl zu mir. «Sollte das mit dem Pub ein Geheimnis bleiben?», fragte sie.
«Nein, schon in Ordnung», sagte ich. Ich wollte nicht, dass alle Leute denken, ich wäre deswegen sauer. Aber sie merkte wohl, dass es nicht in Ordnung war, denn sie sagte: «Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass es kein anderer erfahren soll.»
Ich sagte nichts. Nicht nur deshalb, weil ich noch ein bisschen verärgert war. Sondern vor allem, weil ich ihr noch nie so nahe gewesen war. Sie stand genau vor mir, und der Raum war klein, und wir waren ganz allein. Sie roch nach so einem süßlichen Parfüm, und das benebelte mich völlig.
«Na ja», fuhr sie fort, «ich wollte dir nur sagen, dass es mir leidtut.» Dann lächelte sie total nett und ging hinaus.
Kapitel 4
An diesem Abend spielte das Rothaarige wieder verrückt. Kaum kam ich rein, begann es herumzukeifen.
«Glaubst du, du kannst uns einfach hier unten einsperren?»
Ich beachtete es nicht. Mein Kopf war voll mit anderen Dingen. Unter anderem hatte ich am Tag zuvor vergessen, die leeren Schüsseln einzusammeln. Ich habe zwei Sets, und wenn ich die vollen reinstelle, nehme ich normalerweise die leeren mit raus. So spare ich mir einen zweiten Weg nach unten. Das Problem ist nur, dass ich nicht immer daran denke. Deshalb musste ich jetzt erst die leeren Schüsseln einsammeln, bevor ich sie füttern konnte. Und wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, wird einem alles zu viel.
Aber das Rothaarige wollte den Mund nicht halten. «Ich rede mit dir», fuhr es fort. «Glaubst du, du kannst uns einfach so einsperren, habe ich gefragt?»
«Ja», sagte ich. Ich stand jetzt vor seinem Abteil. Das Futter, das es ausgekippt hatte, lag immer noch auf dem Boden und über die Matratze verteilt. Aber das hatte es sich selbst zuzuschreiben. Wenn es im Dreck schlafen wollte, bitte schön. Nach einer Weile taten es die meisten.
«Gib mir die Schüssel», verlangte ich. Alle wussten, dass sie ihre Schüsseln durch die Lücke am Boden schieben sollen, damit ich sie einsammeln kann. Die anderen drei hatten es auch schon getan, aber das Rothaarige hatte die Schüssel noch immer in der Hand. Und starrte mich nur an.
«Warum?», wollte es wissen.
«Stell sie hin», sagte ich.
Es drehte die Schüssel um. «Und wenn nicht?», fragte es.
Ich hasse es, wenn sie aufsässig werden. Als würden sie erwarten, dass man ihnen immer antwortet. «Wenn du mir die Schüssel nicht gibst, kriegst du nichts zu essen.»
Es lachte. «Glaubst du, das interessiert mich einen Scheiß?», meinte es. «Soll ich um dieses Scheiß-Hundefutter betteln, oder was?»
Ich mag das Sch-Wort nicht. Ich mag überhaupt keine Flüche, aber das Sch-Wort am wenigsten. Meine Mama ist jedes Mal ausgeflippt, wenn es jemand im Pub benutzt hat. Mein Papa hat zwar immer gesagt, es wäre eine Gastwirtschaft und kein Kloster, aber meine Mama wollte partout keine bösen Worte hören. «Diese Ausdrucksweise kannst du dir für die Arbeit aufsparen», sagte sie immer, wenn sie jemanden fluchen hörte. Als ihr ein Mann daraufhin sagte, sie solle ihn am A… lecken, erteilte sie ihm Hausverbot. Meinen Papa hat das ganz schön sauer gemacht. Im Pub wurde es wesentlich ruhiger, und er sagte, dass wir zu wenig Gäste haben und es uns nicht erlauben können, die paar rauszuschmeißen, die noch kommen. Wenn es ihm nicht gefallen würde, sagte meine Mama, könnte er ja gehen und mit ihnen in der Gosse leben. Ich bin damals verschwunden, denn mir war klar, dass sie gleich wieder streiten würden.
Bevor ich etwas zu dem Rothaarigen sagen konnte, mischte sich das Dicke ein. «Wenn sie kein Essen will, dann gib ihr nichts. Ich nehme ihrs.» Ich nenne es immer noch das Dicke, obwohl es nicht mehr ganz so dick ist wie damals, als ich es holte. Aber es ist immer noch ziemlich dick. Und gefräßig. Manchmal gebe ich ihm extra weniger Futter als den anderen, nur um es zu ärgern.
«Nein, das wirst du nicht, verdammte Scheiße!», schrie das Rothaarige. «Was ist los mit dir, hast du keinen Stolz?»
«Stolz kann man nicht essen», sagte das Dicke. Es stand genau vor seinem Gitter und versuchte, das Rothaarige im Nachbarabteil zu sehen. «Das wirst du auch noch kapieren!»
«Ist mir scheißegal», sagte das Rothaarige. «Ich werde nicht um beschissenes Hundefutter betteln!»
«Warte ab, bis du etwas länger hier bist. Dann wirst du froh sein, etwas zu bekommen», sagte das Schwarze. Es ist in einem der gegenüberliegenden Abteile. Das Rothaarige warf seine Schüssel zu Boden.
«Ihr könnt ja Scheiße fressen, wenn ihr wollt, aber ich nicht!», schrie es. «Ihr seid verdammte Feiglinge, ihr alle!»
«Mund halten! Alle zusammen!», forderte ich sie auf. Ich mag es nicht, wenn sie miteinander reden, solange ich dort bin. Doch das Rothaarige starrte mich nur provozierend an. «Und – was willst du machen?»
Das Dicke stand immer noch direkt vor seinem Gitter und versuchte, um die Ecke zu spähen. «Halt’s Maul, du dämliche Schlampe», rief es, «sonst kriegt keiner was!»
«Gut! Besser wir verhungern, als von ihm wie Tiere gehalten zu werden!», giftete das Rothaarige, und das Dicke schrie zurück: «Halt deine verdammte Klappe!» Sie brüllten sich an, deswegen nahm ich einen Eimer mit Wasser und schüttete ihn erst auf das eine, dann auf das andere. Das Dicke bekam am meisten ab. «Hört auf zu fluchen», sagte ich ihnen, hob die schmutzigen Schüsseln auf und ging hinaus.
Das Schwarze habe ich am längsten. Es war das Erste. Als ich eines Abends von der Arbeit nach Hause kam, stand es da und pinkelte in den Hauseingang. Es lehnte gegen die Wand, in der einen Hand eine Dose Cider, in der anderen sein Ding, und sang. Als ich sagte, es soll aufhören, schaute es auf und drehte sich dann um. Ihm hing immer noch sein Ding raus, es hörte nicht einmal auf zu pinkeln. Ich musste zur Seite springen, um nichts abzukriegen. Es sagte etwas und kam mit ausgestreckter Hand auf mich zu. Wahrscheinlich wollte es Geld, aber genau wusste ich es nicht, denn es lallte total. Und es stank.
Ich ging weg, aber es folgte mir. Ich wünschte, ich hätte es einfach in Ruhe pinkeln lassen, und versuchte, das Tor um die Ecke aufzuschließen, bevor es mich einholte. Nach einer Weile bekam ich es endlich auf, doch das betrunkene Etwas war genau hinter mir, und ich konnte das Tor nicht mehr rechtzeitig zumachen. Ich lief durch den Biergarten zur Hintertür. Den Schlüssel hatte ich zwar schon griffbereit, aber ich kriegte ihn nicht ins Schloss. Es war wie in einem dieser Träume, wo man verfolgt wird und davonlaufen will, aber irgendwie am Boden festklebt. Ich hörte, wie die Kanalratte immer näher kam. Dann ging die Tür endlich auf, und ich schlüpfte hinein. Aber als ich sie hinter mir zumachen wollte, war das Vieh bereits da. Es war total dreckig und nass und eklig. Es steckte eine Hand in die Spalte und berührte mich. Ich konnte nichts machen. Als ich zurückwich, sprang die Tür auf, und die Ratte fiel hinein.
Ich schrie es an, aber es nützte nichts. Es sagte die ganze Zeit: «Hör mal, guck mal, hör mal», als hätte es etwas Wichtiges zu sagen, könnte sich aber nicht klar ausdrücken. Es versuchte, sich am Küchentisch hochzuziehen, schaffte es aber nicht und blieb schwankend und stinkend und schmutzig auf allen vieren hocken. Dann begann es, auf mich zuzukrabbeln, immer noch vor sich hin brabbelnd. Ich nahm die Pfanne aus der Spüle und knallte sie ihm auf den Kopf. Es gab so ein Krachen wie in einem Film. Das Vieh stöhnte, und ich schlug erneut zu und hätte es noch einmal getan, wenn es nicht zur Seite gekippt und liegen geblieben wäre.
Vom rußigen Boden der Pfanne hatte es einen großen, schmierigen Fleck auf dem Kopf. Ich dachte, es wäre tot, aber dann stöhnte es wieder. Trotzdem glaubte ich, es würde gleich sterben. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wusste nur, dass es hier nicht bleiben konnte. Dann fiel mir der Keller ein.
Das Problem war nur, dass ich es nicht anfassen wollte. Abgesehen davon, dass es echt schmutzig war und stank, hing immer noch sein Ding raus, und die ganze Vorderseite der Hose war nass. Deshalb zog ich mir die Gummihandschuhe an, die meine Mama immer zum Abspülen benutzt hat, und ihre zweitbeste Schürze. Das Vieh war total schwer, aber ich musste es nicht hochheben. Da der Boden mit Linoleum und nicht mit Teppich ausgelegt ist, ließ es sich ziemlich leicht durch die Küche und die Schankstube zur Kellertür schleifen. Auf der Treppe wurde es etwas schwierig, aber ich ging die Stufen rückwärts runter und zog es hinter mir her. Danach war es nicht mehr so schlimm, denn unten ist alles eben. Ich schleifte es durch den Gang und in den hinteren Keller. In einem der Abteile lag eine alte Matratze, auf der ich das Vieh ablud. Ich hatte keine Ahnung, ob es sterben würde oder nicht, stellte aber ein Glas Wasser hin, falls es aufwachen sollte.
Als ich etwas später wieder runterging, war es immer noch nicht wach. Gestorben war es aber auch nicht. Es sah so aus, als würde es einfach schlafen, und ich begann mich zu fragen, was passieren würde, wenn es tatsächlich aufwacht. Ich wollte nicht runterkommen und die Tür aufschließen und einem wildgewordenen Vieh gegenüberstehen. Dann fiel mir der große Maschendrahtverschlag im Hauptkeller ein, in dem mein Papa immer die Flaschenkisten gelagert hat, damit Einbrecher nicht so leicht an sie rankamen. Erst überlegte ich, das Vieh wieder aus dem Abteil und in den Verschlag zu schleppen, aber die Idee gefiel mir nicht. Ich wollte es lieber nicht im Hauptkeller haben. Schließlich gelang es mir, die Maschendrahttür mit den alten Werkzeugen meines Papas zu lösen. Sie war groß genug, um das Abteil damit zu verschließen. Mir war nicht ganz klar, wie ich sie befestigen sollte, aber dann erinnerte ich mich an die großen Schrauben, die übrig geblieben waren, als mein Papa das neue Schild draußen angebracht hatte. Die Arbeit hat mir echt Spaß gemacht. Mein Papa war immer ein guter Heimwerker gewesen, und wenn er mich ließ, habe ich ihm gerne geholfen.
Nachdem ich fertig war, machte das Drahtgitter vor dem Abteil einen recht soliden Eindruck, doch um sicherzugehen, holte ich noch ein paar Holzlatten zur Verstärkung. Erst als ich einen Schritt zurücktrat und mein Werk begutachtete, fiel mir ein, dass es nun echt schwer werden würde, das Vieh wieder rauszulassen. Immerhin hatte ich am Boden eine kleine Lücke gelassen, durch die man Futter hereinschieben konnte.
Die Sache mit dem Schwarzen war so leicht gewesen, dass mir gar nicht richtig bewusst war, dass ich es hatte. Ich ging nur einmal am Tag runter, um es zu füttern, und machte einmal in der Woche das Katzenklo sauber, das ich ins Abteil geschoben hatte, damit es sein Geschäft erledigen konnte. Erst jetzt, wo ich es hatte, fielen mir die ganzen anderen auf, die draußen herumliefen. Wenn ich im Bus saß und aus dem Fenster schaute, sah ich mit einem Mal die ganzen Kanalratten und Landstreicher und Flittchen. Es gibt immer mehr davon. Überall sieht man sie betteln und trinken und so weiter. Es sind auch nicht nur alte. Manche sind jünger als ich. Sie arbeiten nicht und sind zu nichts gut. Sie sind nichts weiter als eine Plage.
Deshalb machte ich mich daran, die Seitenteile des Verschlags vor den anderen Kellerabteilen anzubringen. Aber dieses Mal anständig, mit Scharnieren und Riegeln und so, damit ich sie auf- und zumachen kann. Nach zwei weiteren Abteilen ging mir der Draht aus, aber das war kein Problem. Dort, wo die Fabriken abgerissen worden waren, lagen haufenweise Geländer und Fenstergitter und Teile rum. Das Zeug war sogar noch besser als der Draht. Stabiler.
Das alte Weib war das erste, das ich mir absichtlich geholt habe. Es war einfach, aber ich war trotzdem total nervös. Ich bin nicht ins Stadtzentrum gegangen, wo die meisten herumhängen. Von dort wäre der Weg zurück zu weit gewesen. Doch ungefähr eine halbe Meile vom Pub entfernt gibt es noch ein paar Geschäfte an der Hauptstraße. Dort findet man eine Menge Gesocks, denn es gibt ein paar billige Kneipen und viele Hauseingänge, in denen sie pennen können.
Ich sah das alte Weib in einem Mülleimer herumwühlen. Es hatte lange Barthaare am Kinn und ungefähr fünf