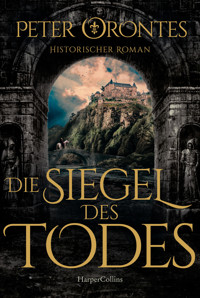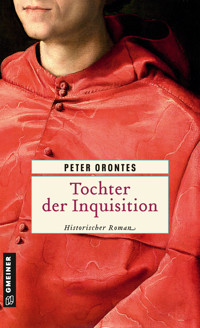
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Steyr, im Jahr des Herrn 1388. Eine Serie grauenvoller Morde, renitente Ketzer und der fanatische Inquisitor Petrus Zwicker stürzen die Stadt in Angst und Schrecken. Angehörige der Waldenserbewegung werden als Ketzer gejagt und gefoltert, Scheiterhaufen lodern auf. Inmitten des rabenschwarzen Geschehens emittelt ein unerschrockenes Paar: Falk von Falkenstein und seine Frau Christine. Dann aber gerät Falk, der selbst ein furchtbares Geheimnis hütet, ins Visier des Inquisitors und damit in tödliche Gefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 786
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Orontes
Tochter der Inquisition
Historischer Roman
Impressum
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2016 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2016
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung des Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_a_Cardinal,_by_Raffael,_from_Prado_in_Google_Earth-x0-y0.jpg
ISBN 978-3-8392-5068-6
DRAMATIS PERSONAE (in alphabetischer Reihenfolge)
Albrecht III* • Herzog von Österreich (geb. 1349, gest. 1395), wird im Roman nur namentlich erwähnt
Ansgar, Bruder Ansgar genannt • Benediktinermönch; Botanikus im Kloster zu Garsten
Bürgel, Lamprecht • Fass- und Wagenmacher aus Steyr; Waldenser; fällt einem Mord zum Opfer
Bürgel, Anna • Witwe des Lamprecht Bürgel, Waldenserin
Engelbert, Bruder Engelbert genannt • Mönch; gehört zur Entourage des Inquisitors
Falkenstein, Falkmar von (auch Falk genannt) • Adliger aus Salerno; Freund von Wernher von Ternberg; wird von diesem gebeten, den Mord an seiner Frau aufzuklären
Falkenstein, Christine von • Ehefrau des Falkmar von Falkenstein, Ärztin aus Salerno
Fever, Els • Waldenserin; wird als rückfällige Ketzerin zu Schlägen mit der Rute verurteilt
Grasser, Hans • Hauptmann der bewaffneten Eskorte des Inquisitors
Heiss, Jobst • Stammgast beim Rabenwirt, angeklagt des Mordes an Dietrich Pützer
Heinrich (1), Bruder Heinrich genannt • Mönch; gehört zur Entourage des Inquisitors
Heinrich (2); Bruder Heinrich genannt • reisender Waldenserprediger (Prediger, Beichtiger), besucht mit seinem älteren Mitbruder Rudlin die Waldensergemeinden
Hohenlohe*, Georg von • Bischof zu Passau, wird im Roman nur namentlich erwähnt
Irmingard • Obermagd im Haushalt Wernher von Ternbergs
Jeckl • Bediensteter des Götz von Kreuzeck auf dem Teufelsturm; geistig zurückgeblieben, körperbehindert; wird auch der »irre Jeckl« genannt
Jos • Knecht auf dem Hof des Peter Seimer
Kerschberg, Heimito von • Sohn des ehemaligen Burggrafen von Steyr
Kranich, Marthe • Kräuterfrau; wird Opfer einer Vergewaltigung
Kreuzeck, Götz von • Ritter;wohnt auf dem »Teufelsturm« bei Waldneukirchen; verbirgt sein Gesicht hinter einer Ledermaske
Lamp, Ferdinand • Notar zu Steyr
Lechner, Balduin • Schweinehirt in Ternberg; Zeuge in einem Gerichtsverfahren
Ludwig, Bruder Ludwig genannt • Mönch; gehört zur Entourage des Inquisitors
Luger,Hermann • Fischer; birgt wiederholt Leichen aus der Enns
Mohr, Heiner • Bauer in Ternberg; Grundhold des Klosters zu Garsten; zählt zusammen mit seiner Familie zu den Waldensern
Neudlinger, Ludwig der • Bannrichter zu Enns (hatte den Blutbann inne, konnte das Todesurteil fällen)
Nikolaus* • Abt des Benediktinerklosters Garsten
Panhalm, Georg von • Stadtrichter zu Steyr; liegt im Streit mit dem Burggrafen Heinrich von Pogner
Penzlein, Siegbert • Büttel, Gerichtsknecht zu Steyr
Pogner, Heinrich von • vom Landesherrn eingesetzter Burggraf zu Steyr; residiert auf der Styraburg; liegt im Streit mit dem Stadtrichter Georg von Panhalm
Praitenberger, Sepp • Bauer in Ternberg, Grundhold des Klosters zu Garsten
Pützer, Dietrich • Stammgast beim Rabenwirt; wird während eines Streites mit Jobst Heiss von diesem erstochen
Rabener, Jakob • Wirt des Gasthauses »Zum Schwarzen Raben«
Rieser, Johann • Bauer in Ternberg; Grundhold des Klosters zu Garsten; befreundet mit Sepp Praitenberger
Rudlin, Bruder Rudlin genannt • reisender Waldensermeister (Prediger, Beichtiger), besucht mit seinem jüngeren Mitbruder Heinrich die Waldensergemeinden
»Rußgesicht« • aus dem Kerker geflohener Waldensermeister; wird diverser Verbrechen bezichtigt
Sassener, Eckhardt der • Verwalter auf Burg Plankenstein
Seimer, Peter • Bauer, Grundhold des Klosters zu Garsten; zählt mit seiner Familie zu den Waldensern
Schachen, Bodo • Büttel, Gerichtsknecht zu Steyr
Schachnitz, Bodo von • Prior des Benediktinerklosters Melk
Schindler, Jörg • Scharfrichter beim Blutgericht zu Judenburg; wird vom Inquisitor nach Steyr beordert; Spezialist in Sachen »peinliche Befragung«
Söhnlein, Hans • Majordomus im Hause Wernher von Ternbergs; Vertreter Wernhers in dessen Abwesenheit
Schreyer, Gundel • Zeitler (Imker); undurchsichtiger Geselle
Schütter, Hans • Steinmetz; Neffe des Botanikus Bruder Ansgar
Steyr, Dietrich von • Stadtpfarrer von Steyr
Süßkind, Esther • Jüdin; wurde vor vielen Jahren wegen Hostienfrevels auf den Scheiterhaufen geschickt
Ternberg, Wernher von • einflussreicher Kaufmann und Magistrat in Steyr; seine Ehefrau Klara wird ermordet; bittet Falkmar von Falkenstein und dessen Frau Christine nach Steyr zu kommen; Falkmar soll in dem Mordfall ermitteln
Ternberg, Klara von • Ehefrau des Ternbergers; sie wird ermordet
Ternberg, Sofia von • leibliche Tochter der Klara von Ternberg; Stieftochter Wernhers; verschwindet spurlos
Yspern*, Ludwig III. von • Abt des Benediktinerklosters Melk
Zink, Wendel • Abdecker zu Steyr, auch »Schinder« genannt
Zwicker*, Petrus • Cölestinerpater; vom Bischof zu Passau eingesetzter Inquisitor für Steyr und Umgebung
… und viel anderes Volk aus Steyr und Umgebung
*Historische Persönlichkeiten
PROLOG
Mai, Anno Domini 1388
Herzogtum Österreich, Gegend um Steyr
Der Mann keuchte vor Anstrengung. Obwohl die Nacht kühl war, perlten Schweißtropfen auf seiner Stirn. Schon seit mehr als einer Stunde trieb er seinen Kahn mit harten Schlägen flussaufwärts. Im Takt der Ruderblätter, die in die dunklen Fluten der Steyr eintauchten, zischten Flüche von seinen Lippen. Auch wenn ihn das Fluchen seinem Ziel nicht eine Elle näher brachte, schien es doch Kraft in seine Arme zu schicken. Ließ doch jede einzelne Verwünschung die Blätter wütend in die Flut klatschen und Fetzen von Spritzwasser durch die Luft wirbeln, die im Mondlicht in unzählige glitzernde Tröpfchen zerstoben.
Nach einer weiteren halben Stunde ließ es der Ruderer etwas gemächlicher angehen, während sein Blick konzentriert das rechte Flussufer absuchte. Offenbar hielt er nach etwas ganz Bestimmtem Ausschau.
»Na endlich, verdammt noch mal!«, knurrte er, als er einer Trauerweide ansichtig wurde, die ihre Zweige bis tief auf die Wasseroberfläche hinunterschickte.
Er steuerte den Kahn unter die baldachinartige Krone des Baumes, holte die Ruder ein und machte den Nachen an einem der Äste fest. Dann schwang er sich über den Bootsrand ins knietiefe Wasser und watete ans Ufer, wo er zuerst einmal innehielt und sich umsah. Das Versteck für das Boot war gut gewählt, niemand würde es unter der Weide vermuten. Das war wichtig, denn der, den er in dieser Nacht zu treffen gedachte, brauchte nicht zu wissen, welchen Weg er genommen hatte. Befriedigt nickte er, die erste Etappe war geschafft. Dann aber verriet ihm ein prüfender Blick auf die bewaldeten Steilhänge, die den Flusslauf säumten, dass der schwierigste Teil der Strecke noch bevorstand. Erneut ließ er einen Fluch vom Stapel.
Nach einer weiteren Stunde hatte er nicht nur den Steilhang, sondern auch eine mit niedrigem Strauchwerk und Gras bestandene Hochebene hinter sich gebracht. Jetzt stand er am Fuß einer Erhebung, die über eine plateauähnliche Kuppe verfügte, welche von einer niedrigen, halb verfallenen Mauer gekrönt wurde. Dahinter ragten vor der hellen Scheibe des Mondes mehrere hohe Bäume sowie die Silhouetten einiger seltsam geformter Grabmäler in den Nachthimmel. Obwohl der Mond ziemlich hell schien, dauerte es eine Weile, bis seine scharfen Augen die von Gras und Unkraut überwucherten Stufen entdeckten, die zum alten Judenfriedhof hinaufführten.
Während er nach oben stieg, spielte ein hintergründiges Lächeln um seine Mundwinkel. Er dachte daran, wie schnell derjenige reagiert hatte, den er gleich treffen würde. Erst vor wenigen Tagen hatte er ihm ein anonymes Schreiben, gespickt mit bestimmten Informationen, zukommen lassen und prompt einen Tag später die Antwort darauf erhalten. Man habe sehr wohl Interesse an dem Wissen, das er gegen einen bestimmten Betrag preisgeben wolle, hatte man ihm mitgeteilt und ihn aufgefordert, in dieser Nacht zum alten Judenfriedhof zu kommen, damit man über die Sache reden könne.
»Endlich«, keuchte der Mann, nachdem er das Plateau erreicht hatte. Zögernd trat er an die marode Mauer heran, die das verwilderte Areal des Friedhofs umschloss.
Ein mulmiges Gefühl beschlich ihn, während er die unregelmäßig verstreuten Grabmäler hinter der Mauer betrachtete, die inmitten alter Bäume und üppig wuchernder Gräser aus dem Boden wuchsen. Vom Zahn der Zeit zu zerspellten, formlosen Gebilden zernagt, ragten sie kreuz und quer empor. Vielleicht war es der Anblick dieser uralten Steine, die selbst zu sterben schienen und im Mondlicht seltsam schimmerten, der ihm einen Schauer über den Rücken jagte. Vielleicht aber auch der Umstand, dass er sich an einem Ort befand, der fremd und unheimlich wirkte und so gar nichts mit einem christlichen Gottesacker gemein hatte. Schon allein die seltsamen Schriftzeichen auf den Steinen konnten einen das Fürchten lehren. Was nicht verwunderte. War das nicht die Schrift derer, die den Herrn ans Kreuz hatten nageln lassen, die Schrift der Gottesmörder, Brunnenvergifter und Hostienschänder, kurzum: der ewig Verfluchten, die – so sie sich nicht zum christlichen Glauben bekehrten – in der Hölle schmoren würden? Ausgerechnet diesen Treffpunkt hatte man ihm genannt.
Kiwitt, kiwitt. – Erschrocken sah der Mann nach oben. Der Ruf des Käuzchens, das sich als dunkler Schatten aus einer nahen Baumkrone löste und mit lautlosem Flügelschlag entschwebte, jagte erneut einen Schauer über seinen Rücken.
»Verdammt! Sei kein Hasenfuß und bring’s hinter dich«, schalt sich der Mann. Er betrat den Friedhof durch eine Bresche in der Mauer, doch er musste sich geradezu zwingen weiterzugehen, um nach der Gruft zu suchen, die man ihm als Treffpunkt genannt hatte.
Es dauerte nicht lange, bis er sie gefunden hatte. Sie befand sich in der Nähe einer Eiche, deren mächtiger Wurzelstock zum Teil aus der Erde ragte und sich bis zur Gruft erstreckte. Vorsichtig stieg der Mann eine zerborstene Steintreppe hinunter und gelangte zu einem Eingang, der nur mit einer Brettertür verschlossen war.
Zuerst zögerte er. Dann aber stieß er die Tür auf und betrat ein stockdunkles, niedriges Gewölbe. Offenbar war die Gruft leer, dennoch roch es nach Moder und Tod. Ihn schauerte, er fror. Das Dunkel, das sich vor ihm auftat, schien undurchdringlich. Er beschloss, keinen einzigen Schritt weiterzugehen, und drückte die Tür so weit auf, dass das Licht des Vollmonds zumindest den Eingangsbereich ausfüllen konnte.
Dann wartete er mit angehaltenem Atem.
»Verdammt, wo er nur bleibt«, murmelte der Mann, nachdem er eine Weile ins Dunkel gestarrt hatte. Er wandte sich um und sah die Steintreppe empor; auf den Stiegen glänzte matt das Mondlicht.
»Keine Sorge, ich bin längst da. Ich ziehe es vor, immer als Erster bei einem Treffen zugegen zu sein. – Halt! Dreh dich nicht um, wenn dir dein Leben lieb ist!«, ertönte plötzlich eine dunkle Stimme in seinem Rücken.
Bereits bei den ersten Worten wollte sich der Mann erschrocken umwenden, doch die unmissverständliche Aufforderung, es nicht zu tun, stoppte seinen Reflex gerade noch rechtzeitig.
Er spürte einen warmen Atem im Nacken.
»Oh, Herr, seid Ihr es?«, fragte er stockend und begann auf einmal zu zittern.
»Wer ich bin, tut nichts zur Sache. Aber ich sehe, ich habe dich erschreckt. O, wie bedauerlich«, erwiderte die Stimme. Sie triefte geradezu vor Hohn. »Aber sei sicher: Dein Schrecken wird noch größer werden, wenn du erfährst, was dir blüht, sollte das Wissen, über das du zu verfügen behauptest, für mich nicht zu verwerten sein. Insbesondere jenes, das von einem gewissen … Sprüchlein handelt«, – die Stimme hielt kurz inne –, »wie lautete es doch gleich?«
Die Stimme war plötzlich ins Zischen geraten. Gleichzeitig fühlte der Mann, wie sich der linke Arm des hinter ihm Stehenden um seinen Hals legte, während seine rechte Hand nach vorn schnellte und ihm ein Messer unter die Nase hielt.
Zu Tode erschrocken, schielte der Mann auf das matt glänzende Metall.
»Wie … wie das Sprüchlein lautete? … Ihr meint … jenes Verslein, … das ich in dem Brief nannte?«, röchelte er.
»Ja. Nenn es mir. Ich will es aus deinem eigenen Mund hören«, zischte die Gestalt.
»›Die … die Glöckchen aus Akkon, … wie lieblich ihr Klang … So nehmt denn ihr Schönen … den Tod in Empfang‹«, rezitierte der Mann stockend den seltsamen Spruch.
»Ja, das ist richtig. So lautete der Vers. Aber nur ganz wenige kannten ihn. Woher ist er dir bekannt? Sag es mir!«, flüsterte die Stimme.
»Ich will es Euch ja auch sagen. Aber Ihr wisst, dass meine Informationen ihren Preis haben. Außerdem habe ich noch Weiteres in Erfahrung gebracht, das Euch nützlich sein dürfte. In dem Brief, den ich Euch schrieb, stand nicht alles. Ihr werdet mich also am Leben lassen müssen«, entgegnete der Mann und verzog das Gesicht zu einem schiefen Grinsen. Ungeachtet der Klinge, auf die er starrte, war seine Kaltblütigkeit zurückgekehrt.
Der Mann fühlte, wie der Arm, der sich um seinen Hals gelegt hatte, zurückgezogen wurde. Doch der Stahl vor seinen Augen blinkte noch immer.
»Du lässt dich nicht so schnell ins Bockshorn jagen, das muss man dir lassen«, tönte die Stimme erneut. Dann folgte ein leises Lachen. »Wie ich schon sagte: Vorausgesetzt, das Wissen, das du anzubieten hast, ist echt, nützt du mir tatsächlich. – In diesem Fall wäre das hier für den Anfang.« Die eine Hand schnellte wieder nach vorne. Diesmal umfasste sie einen prall gefüllten Beutel. Ein leises Klirren ertönte, als sie ihn schüttelte, und ließ das Herz des Mannes höher schlagen. Gierig griff er nach dem Beutel.
Doch sogleich schnellte die Hand wieder zurück.
»O nein. Erst die Ware, dann das Geld, mein Lieber. Wir wollen die guten Kaufmannssitten doch nicht schnöder Gier opfern, nicht wahr?«, spottete er.
Der Mann leckte sich die Lippen.
»Natürlich, Herr, Ihr habt recht. Also lasst Euch berichten.«
Kapitel 1
Montag, 01. Juni 1388 / Freitag, 19. Juni 1388
Nebelschwaden waberten über die Flussauen, als der Fischer Hermann Luger zur Enns hinunterging, um seine Reusen zu inspizieren. Er hoffte auf einen guten Fang. Den benötigte er auch, sollte er doch heute den Küchenmeister auf der Styraburg mit besonders fetten Forellen versorgen. Sie würden einen Teil des üppigen Festmahls bilden, das der Burggraf am Abend wieder einmal auszurichten gedachte.
Wie jeden Morgen stieg Luger aber erst einmal in sein Boot, das am Ufer vertäut lag, um in gewohnter Weise den mitgebrachten Imbiss zu verzehren: einen Kanten Brot, etwas gesalzenen Fisch und einen Krug Bier.
Gerade hatte er den ersten Bissen hinuntergeschlungen, als der zweite auch schon drohte, ihm im Halse stecken zu bleiben! Sein Blick war plötzlich an einer dunklen Masse hängen geblieben, die sich auf den trägen Fluten flussabwärts bewegte.
»Jesus Christus! Nicht schon wieder«, murmelte er entsetzt, während das seltsame Treibgut an ihm vorüberglitt.
Hastig löste er das Tau, mit dem das Boot am Steg befestigt war, ergriff die Ruderblätter und paddelte mit kräftigen Schlägen hinterher. Gleich darauf hatte er es eingeholt. Ohne sich lange zu besinnen, griff er nach der hakenbewehrten Stange zu seinen Füßen und zog damit nur wenige Augenblicke später eine männliche Leiche an Bord. Weil der Tote mit dem Gesicht nach unten auf die Planken zu liegen kam, vermochte Luger ihn zunächst nicht zu erkennen. Dann aber drehte er die massige Gestalt auf den Rücken – und bekreuzigte sich unwillkürlich.
»Bei allen Heiligen, der Bürgel!«, entfuhr es ihm. Entsetzt blickte er auf den Leichnam, um dessen Hals sich ein tiefer, wulstartig geränderter Schnitt zog. Irgendjemand hatte seinem Nachbarn, dem Fass- und Wagenmacher Lamprecht Bürgel, die Kehle durchgeschnitten.
Kaum eine Stunde später pochte die schwielige Hand des Ennsfischers Hermann Luger an das Tor des Stadtrichterhauses zu Steyr.
Keine drei Wochen später bewegten sich auf der Straße, die das Tal der Steyr mit dem nördlichen Ennstal verband, zwei leicht bewaffnete Reiter in Richtung Süden. Die Gerichtsknechte Bodo Schachen und Siegbert Penzlein waren, einem Befehl des Stadtrichters zu Steyr, Georg von Panhalm, folgend, auf dem Weg nach Ternberg. Auf dem dortigen Friedhof sollten sie unter der Aufsicht von Abt Nikolaus, der dem Konvent des Klosters zu Garsten vorstand, ein Grab öffnen. Es barg die Leiche eines unlängst verstorbenen Mannes, von dessen ruchloser Vergangenheit man erst jetzt erfahren hatte. Der Mann war ein Ketzer gewesen. Ketzer aber hatten in geweihter Erde nichts zu suchen. Also hatten Bodo und Siegbert die wichtige Aufgabe, die sterblichen Überreste des Elenden zu bergen, sie in eine Kiste zu verfrachten und diese nach Garsten zu überbringen, wo sie auf dem Schindanger unter reger Anteilnahme der Bevölkerung verbrannt werden sollten. Den Gläubigen zur Warnung und dem Herrn zum Zeugnis, dass seine Kirche sehr wohl über die wahre Lehre wachte und sich ihrer Widersacher erwehrte – wenn es sein musste, selbst über deren Tod hinaus.
»Warum der Panhalm ausgerechnet uns diese Drecksarbeit machen lässt; einen halb verfaulten Ketzer ausgraben«, maulte Bodo und ließ vorübergehend die Zügel fahren, um sich die klammen Finger zu reiben.
»Das fragst du noch?«, entgegnete Siegbert und sah seinen Begleiter verdrießlich an. »Denk doch an die Sache mit dem entflohenen Waldenser. Glaubst du, dass der Stadtrichter den Ärger vergessen hat, den er mit dem Burggrafen deswegen hatte? Ganz schön schlecht sieht der Panhalm seitdem aus. In uns sieht er nach wie vor die Schuldigen. Er is’ immer noch der Meinung, dass sich einer von uns beiden draußen vor dem Kerker hätte postieren sollen, direkt unter dem verfluchten Fenster. Dann hätte der verdammte Ketzerbastard gar nicht erst fliehen können, behauptet er.«
»So’n Quatsch. Die Wache versieht ihren Dienst stets im Wachraum, so steht’s in der Verordnung. Der Stadtrichter hat gewusst, dass der Kerker nicht gescheit gesichert war. Er hätte dem Seipold ordentlich in den Hintern treten müssen. Der ist schließlich der Aufseher für das Schergenhaus. Hätte er nämlich beizeiten das Gitter wieder angebracht, dann wäre nichts geschehen. So aber war das Kerkerfenster nur mit dem hölzernen Laden verschlossen. Und der war gerade mal mit einem Eisenriegel und einem Schloss gesichert. Das aufzukriegen, war ’n Kinderspiel. Ich frag mich sowieso, warum er das Gitter entfernt hat. Er hätte es ja noch dran lassen können, bis das neue fertig is’.«
»Warum, warum. Weil das alte nichts mehr taugte, du Hornochse; ’n paar von den Gitterstäben waren schon fast durchgerostet und die anderen saßen so locker in der Mauer wie die faulen Zähne im Maul meiner Schwiegermutter. Es war höchste Zeit, das Gitter zu entfernen. Der Laden hätte seinen Zweck schon erfüllt, wenn der Schmied ganze Arbeit geleistet hätte. Das Schloss war viel zu schwach«, belehrte Siegbert seinen Genossen mit Nachdruck.
Der Straße folgend, waren sie inzwischen in ein kleines Wäldchen eingedrungen, als Bodo plötzlich sein Pferd anhielt und angestrengt nach vorn starrte. Mit einer Geste bedeutete er seinem Begleiter, ebenfalls stehen zu bleiben.
»Was ist, was hast du?«, wunderte sich Siegbert.
»Da … sieh doch nur …! Da liegt jemand … Könnte ’ne Frau sein«, flüsterte Bodo aufgeregt und wies mit der Hand nach vorn.
»Wo? Ich seh nichts.«
»Hast du Kuhfladen auf den Augen? Dort, rechts vom Wege, neben dem Gebüsch!«
Seit einigen Monaten waren Siegberts Augen nicht mehr die besten; es dauerte ein wenig, bis er endlich, wenn auch nur verschwommen, die dunkle Silhouette eines Körpers wahrnahm, der etwa dreißig Schritte weiter vorn am Wegrand lag.
»Zum Teufel, du könntest recht haben«, murmelte er.
Sie gaben den Pferden die Sporen, sprengten auf die Stelle zu und sprangen aus dem Sattel.
»Bei allen Heiligen – die Ternbergerin! Sie ist tot!«, rief Bodo, der als Erster bei der Frau anlangte. Ein Schauer rann über seinen Rücken, als er den glasigen, aus der Ferne einer jenseitigen Welt kommenden Blick auf sich gerichtet sah, wie ihn fast jeder Leichnam aufwies, dessen Augen im Tod weit aufgerissen waren. Über den Oberkörper der Frau war ein grobes Sackleinen gebreitet. Ihr bleiches Gesicht wurde von langem, schwarzem Haar umrahmt, das wie dahingegossen den Boden bedeckte.
»Tatsächlich. Klara von Ternberg. Ich glaub’s nicht!«, bestätigte gleich darauf auch Siegbert. Im Gegensatz zu Bodo, der einfach nur dastand und auf die Frau herabsah, ging er neben ihr in die Hocke und legte prüfend die Finger an ihren Hals.
»Kein Zweifel, sie ist tot«, bemerkte er.
»Sag ich’s doch. Was hast du denn gedacht. Dass sie vor Müdigkeit eingeschlafen is’?«
»Spar dir deine blöden Bemerkungen«, knurrte Siegbert und hob das Sackleinen hoch. »Sieh mal, hier, man hat sie erstochen.« Siegbert deutete auf einen glatten Riss, den die Cotte der Toten auf der linken Brustseite aufwies, drum herum hatte sich ein riesiger schwarz-roter Fleck ausgebreitet. Unmittelbar über der rechten Hand, auf dem unteren Ende des Kleiderärmels, krabbelten seltsamerweise unzählige Ameisen.
Bodo starrte betroffen auf die Frau herunter. »Hm«, brummte er. »Vor Kurzem erst die beiden Mädchen, dann der Bürgel und jetzt die Ternbergerin. Ich sag dir, der Teufel geht um im Ennstal.«
»Ob es der Leibhaftige war oder einer seiner menschlichen Handlanger, das herauszubekommen, obliegt dem Stadtrichter«, entgegnete Siegbert trocken.
»Ja, wenn ihm der Burggraf nicht wieder dazwischenfährt.«
»Den geht das Ganze nichts an. Die offizielle Jurisdiktion über die Stadt und ihre Bürger obliegt dem Stadtrichter. Andererseits …«, er hielt kurz inne, um zu überlegen, »… ich glaub, diesmal könnten sie durchaus an einem Strang ziehen. Wenn sie sich auch sonst immer um die Zuständigkeiten zanken.«
»An einem Strang? Die beiden? Das glaubst du wohl selbst nicht!«
»Vergiss nicht: Hier geht’s um keinen Geringeren als Wernher von Ternberg, seines Zeichens Magistrat der Stadt Steyr und …«
»… und der hat schon lange die Nase voll von den ständigen Stänkereien des Burggrafen. Er steht eher auf der Seite des Stadtrichters«, unterbrach Bodo.
»Schon; trotzdem dürfte ihm diesmal einiges daran liegen, den Grafen mit ins Boot zu holen. Schließlich geht’s hier nicht nur um irgendein Verbrechen, sondern um den Mord an seinem Eheweib. Er wird den Täter schnellstens auf dem Richtplatz sehen wollen. Also wird er die beiden dazu bringen, die Sache gemeinsam anzugehen, und ich glaube nicht, dass sie sich ihm widersetzen werden.«
»Stimmt. Dazu ist der Ternberger zu mächtig. Schließlich is’ er stinkreich und hat verdammt gute Beziehungen zum Herzog«, räumte Bodo ein.
An ihre ursprüngliche Mission war nun nicht mehr zu denken. Der tote Ketzer würde warten müssen. Sie kamen überein, dass Bodo bei der Leiche wachte, während Siegbert so schnell wie möglich nach Steyr zurückreiten und den Stadtrichter informieren würde.
Kapitel 2
Donnerstag, 30. Juli 1388
Die beiden Reiter, die an diesem Donnerstagvormittag die Brücke über die Steyr passierten, hatten alle Mühe voranzukommen. Sie ließen sich inmitten eines nicht enden wollenden Stroms von Menschen, Tieren und Fuhrwerken, der sich schon seit den frühen Morgenstunden in die Stadt hineinwälzte, einfach treiben. Man sah den beiden Personen an, dass sie von weit her kamen. Aber nur ein Eingeweihter hätte wissen können, dass es sich bei einer von ihnen um eine Frau handelte. Denn was ihr Äußeres anging, schien sie sich um die von Gott und der Kirche gewollte Ordnung wenig zu scheren, trug sie doch von Kopf bis Fuß männliche Kleidung. Das lange, blonde Haar verbarg sie unter einer zu einem Turban gewickelten Gugel, während ein Schal, um Mund und Nase geschlungen, die Schönheit ihrer Gesichtszüge verhüllte. Allein die großen, ausdrucksstarken Augen, mit denen sie energisch die Umgebung musterte, sowie die vollendet geschwungenen Brauen ließen vermuten, dass sie nicht das war, für was sie sich ausgeben wollte.
Der Begleiter der Frau, groß und kräftig gebaut, mit schwarzem Bart und auffallend blauen Augen, seufzte.
»Wären wir bereits gestern Abend eingetroffen, wäre uns das Ganze hier erspart geblieben; Donnerstag ist immer Hauptwochenmarkt in Steyr«, sagte er und wich einem hinkenden Buckligen aus, der ihn mit seinem Handkarren gegen das Geländer der Brücke zu drücken drohte.
»Ja – hätten dran denken sollen«, entgegnete seine Begleiterin einsilbig. Sie ritt dicht hinter ihm.
Der Mann wandte sich um.
»Du bist heute nicht gerade sehr gesprächig, Liebes. Willst du mir nicht sagen, welche Laus dir über die Leber gelaufen ist?«
Die Frau sah kurz auf.
»Es gibt keine Laus.«
»Bitte, Christine. Du kannst mir nichts vormachen. Was bedrückt dich? Heraus mit der Sprache.«
Es dauerte etwas, bis sich die Frau zu einer Antwort durchrang.
»Also gut. Ich … ich wollte es dir schon heute Morgen sagen, aber …« Sie seufzte.
Ihr Begleiter hob witternd eine Augenbraue.
»Aber was, Christine?«
»Ich wollte dich nicht beunruhigen. Ich mache mir Sorgen, Falk. Heute früh in der Herberge – du warst gerade beim Wirt, um für unsere Übernachtung zu bezahlen, ich wartete im Hof bei den Pferden – da wurde ich zufällig Zeuge eines Gesprächs zwischen zwei Männern. Sie … sie sprachen davon, dass der Inquisitor Petrus Zwicker noch vor Einbruch des Winters in Steyr Quartier nehmen werde.«
Der Mann zügelte augenblicklich sein Pferd. Seine Begleiterin bemerkte, wie er plötzlich die Farbe wechselte.
»Was sagst du da? Der Ketzerjäger? Er kommt nach Steyr?«
Die Frau nickte bedrückt. Sie hatte ihren Falben ebenfalls zum Stehen gebracht.
»Ich habe Angst, Falk. Was, wenn er erfährt, dass du in der Stadt bist?«
Petrus Zwicker. Falks Kiefer begannen zu mahlen. Vor vier Jahren, ein Jahr, bevor er und Christine sich kennengelernt hatten, war er dem berüchtigten Ketzerjäger im Stift zu Melk begegnet. Der Cölestinermönch hatte damals auf dem Weg nach Steyr für einige Tage im Kloster Station gemacht und versucht, ihn, der damals im Dienst des Stiftes stand, in seinen Dienst zu zwingen. Ein Mann wie Falk, der die »scharfen Waffen des Geistes« besitze, so der Inquisitor, sei verpflichtet, seine Fähigkeiten der Mutter Kirche zur Verfügung zu stellen. Es war Bodo von Schachnitz, der Prior von Melk, der der Forderung des Cölestiners erfolgreich Widerstand entgegengesetzt und ihm klargemacht hatte, dass Falk als sein persönlicher Sonderbeauftragter eine Abordnung des Stiftes nach Italien geleiten müsse. So war aus dem Ansinnen des Inquisitors nichts geworden und Falk im letzten Moment seinen Klauen entwischt.
»Was genau sagten die Männer, Christine?«
»Der eine behauptete, er habe gehört, dass Petrus Zwicker noch vor Eintreffen des Winters die Stadt visitieren werde. Worauf der andere entgegnete, das sei nur ein Gerücht, und er gäbe nichts darauf. Schließlich sei Zwicker vor vier Jahren erst hier gewesen.«
Falk atmete auf. »Da siehst du’s. Ein Gerücht. Davon lassen wir uns nicht ins Bockshorn jagen. Wir waren gemeinsam übereingekommen, dem Ternberger beizustehen. Und wir halten uns an diese Abmachung. Das sind wir Klara und ihrer Tochter schuldig.«
»Und wenn das Ganze nun doch kein Gerücht ist?«
Falk schüttelte unwillig den Kopf.
»Es gibt keinen Grund, sich über ungelegte Eier Gedanken zu machen. Außerdem sind wir vor Einbruch des Winters längst wieder im schönen Salerno.«
»Dein Wort in Gottes Ohr«, seufzte Christine.
Knapp eine Stunde später traten sie über die Schwelle des wohl prächtigsten Hauses, das den Stadtplatz zu Steyr säumte. Hier residierte der Mann, der weder Kosten noch Mühe gescheut hatte, sie in die Stadt zu holen. Vor drei Wochen hatte er einen Boten ins ferne Salerno geschickt, um Falkmar und Christine von Falkenstein darüber in Kenntnis zu setzen, dass Klara, seine Frau, einem heimtückischen Mord zum Opfer gefallen war, und Falk darum zu bitten, an der Aufklärung des Falles mitzuwirken. Die Nachricht hatte die beiden außerordentlich erschüttert. Mit der Ehefrau des Ternbergers hatte sie mehr als nur eine oberflächliche Freundschaft verbunden. Vor drei Jahren hatten sie Klara zusammen mit ihrer Tochter Sofia in Salerno kennengelernt. Da war sie noch die angesehene Kaufmannswitwe Chiara dal Como gewesen. Nach dem Tod ihres Gatten Lorenzo hatte sie mit viel Fleiß und Geschick dessen gut gehende Seidenmanufaktur weitergeführt und ausgebaut. Schnell waren weitere Filialen entstanden. Eine davon in Venedig. Dann, vor zwei Jahren, war Wernher von Ternberg in die Lagunenstadt gekommen, um sich des verwaisten Kontors eines ehemaligen Steyrer Handelshauses anzunehmen. Hier hatte er auch Falkmar wiedergetroffen, der ihm bei dieser Gelegenheit sowohl seine Frau Christine als auch Chiara vorgestellt hatte. Was nicht ohne Folgen geblieben war – Wernher und Chiara hatten sich prompt ineinander verliebt. Nur ein halbes Jahr später war Chiara, begleitet von ihrer Tochter Sofia, als Gattin Wernhers in das Ternbergsche Anwesen in Steyr eingezogen und hatte ihren Vornamen in Klara abgeändert …
»Christine! Falk! Seid von ganzem Herzen willkommen. Ich …«, die Stimme Wernhers geriet plötzlich ins Wanken, was ihm das Weitersprechen verwehrte. Hilflos hob er beide Arme.
Falk und Christine hatten den Ternberger stets als stattliche Erscheinung in Erinnerung gehabt. Doch der Mann, der da neben seinem Schreibtisch stand, schien ein völlig anderer zu sein. Fahl und mit eingefallenen Gesichtszügen, wirkte er trotz seiner imposanten Größe erschreckend alt und hinfällig.
Falk reichte ihm die Hand. »Auch uns fehlen die Worte, Wernher. Was gäben wir darum, wäre der Grund, weshalb wir uns sehen, ein freudiger. Nehmt unser aufrichtiges Mitgefühl entgegen«, kondolierte er mit heiserer Stimme.
Christine umarmte ihn. »Das Schicksal hat Euch eine furchtbare Last aufgebürdet, Wernher. Möge Gott Euch helfen, sie zu tragen«, schloss sie sich den Worten ihres Gatten an und wischte sich eine Träne von der Wange.
»Nun ja, mit dem Schicksal ist es so eine Sache«, räsonierte der Ternberger und sah Christine kummervoll an. »Schon als Euer Gatte und ich uns das erste Mal begegnet sind, geschah dies unter dramatischen Umständen, wie Ihr ja wisst. – Aber verzeiht, ich bin ein schlechter Gastgeber. Nehmt doch erst einmal Platz.«
Der Magistrat wies mit einer einladenden Geste auf zwei behäbige Stühle, die vor seinem Schreibtisch standen. Er selbst nahm dahinter Platz.
Mit seiner Bemerkung über das Schicksal spielte er auf ein Ereignis an, das sich vor siebzehn Jahren in einem dichten Waldstück am Fuß des Jauerling in der Wachau zugetragen hatte, etwa zwei Tagesreisen von Steyr und nicht weit vom Stift Melk entfernt. An einem heißen Juninachmittag war der Ternberger in Begleitung des Priors von Melk und dreier weiterer Mönche in einen Hinterhalt geraten und um ein Haar Opfer eines perfiden Mordanschlags geworden – wäre Falkmar von Falkenstein nicht zufällig zur Stelle gewesen. Ohne lange zu überlegen, hatte er sich beherzt in den Kampf gestürzt, der sich bereits zugunsten des mörderischen Gesindels zu neigen drohte, und hatte so mitgeholfen, das Blatt in letzter Minute zu wenden.
»So schmerzlich es ist, Euch unter diesen Umständen begrüßen zu müssen – ich bin froh, dass Ihr den Weg hierher gefunden habt«, sagte Wernher, nachdem man sich gesetzt hatte. »Klara hat Euch beide sehr gemocht. Sie sprach stets sehr gut und mit großer Anhänglichkeit von Euch. Ich denke, Ihr wisst, wie sehr auch ich Euch schätze, Falk. Ohne Euren furchtlosen Einsatz an jenem Tag vor siebzehn Jahren wäre ich wahrscheinlich nicht mehr am Leben.«
»Es war nicht allein mein Verdienst, Wernher. Ihr und der Prior habt Euch tapfer zur Wehr gesetzt«, versuchte Falk abzuwiegeln, doch der Ternberger schüttelte entschieden den Kopf.
»Keine falsche Bescheidenheit, lieber Freund. Prior Beda hatte recht, als er sagte, dass Ihr Eurem Namen alle Ehre gemacht hättet. Schnell und unerbittlich wie ein Falke wart ihr über das verbrecherische Pack gekommen und habt uns herausgehauen. Auch dass die Drahtzieher des Überfalls so schnell ausfindig gemacht werden konnten, hatten wir Euch zu verdanken. Und natürlich Eurem Scharfsinn.«
Falk ließ seine Gedanken schweifen. Er erinnerte sich noch gut an den Vorfall, der nun schon siebzehn Jahre zurücklag. Auch an das Gespräch mit Beda von Schachnitz, dem Prior zu Melk. Auf dessen Frage, wer er sei und welch glücklichem Umstand man seine Anwesenheit verdanke, hatte Falk sich ihm vorgestellt und ihn in kurzen Zügen über sein Schicksal informiert. Hoch oben im Norden läge seine Heimat, doch die habe er verlassen müssen. Ein mächtiger Verwandter seines verstorbenen Vaters habe ihn um sein Erbe gebracht und ihm nach dem Leben getrachtet. Hals über Kopf sei er in einer Gewitternacht geflohen und habe nur das nackte Leben retten können. Jetzt sei er auf der Suche nach neuen Aufgaben und Herausforderungen. Der Prior hatte ihn daraufhin nach Melk eingeladen und ihm die Gastfreundschaft des Stiftes zugesichert, was Falk dankend angenommen hatte. Tage später war es aufgrund einer Beobachtung, die Falk noch am Ort des Überfalls gemacht hatte, gelungen, der Hintermänner des Überfalls habhaft zu werden. Worauf Beda, beeindruckt vom Scharfsinn seines Gastes, diesem angeboten hatte, seine Fähigkeiten in den Dienst des Stiftes zu stellen. Falk hatte zunächst dankend abgelehnt, mit dem Hinweis, er wolle ein freier Mann bleiben. Den wahren Grund verschwieg er. Er hatte mit Klöstern nichts am Hut, alles, was nach Klerus und Kirche roch, war ihm suspekt. Was Gott und die Welt anging, hatte er seine eigenen Vorstellungen entwickelt. Und die waren so gar nicht im Sinne dessen, was die hohe Geistlichkeit von einem braven katholischen Christen erwartete. Doch als der Prior ihm eröffnete, er könne durchaus ein freier Mann bleiben, man werde ihn für seine Dienste bezahlen, wie man einen Kaufmann bezahle, hatte er eingewilligt.
Kurz darauf war Falk das Amt eines Jagd- und Forstaufsehers zu Melk übertragen worden; im Laufe der Jahre wurde er mit weiteren Aufgaben betraut, die Scharfsinn und Mut erforderten. Über vierzehn Jahre hinweg hatte er dem Kloster gedient und auf diese Weise sein Auskommen gehabt. Dann, vor drei Jahren, hatte er Christine kennen und lieben gelernt.
»Werdet Ihr mir dabei helfen, den Mörder meiner Frau zu finden, Falk ?«
Die Frage des Ternbergers riss Falk aus seinen Überlegungen.
»Das werde ich, Wernher«, versicherte er und sandte einen schnellen Blick zu Christine. In ihren Augen glaubte er Zustimmung – aber auch unverhüllte Sorge zu lesen.
»Allerdings … gibt es da noch etwas, was ich Euch fragen möchte«, fügte er darum etwas zögernd hinzu.
»Fragt ruhig zu.«
»Ich will offen zu Euch sein. Wir hörten davon, dass der Inquisitor Petrus Zwicker beabsichtigt, nach Steyr zu kommen. Ihr wisst, dass sich daraus für mich … sagen wir … ein gewisses Problem ergeben könnte. Als wir seinerzeit in Venedig über vergangene Zeiten plauderten, habe ich Euch davon erzählt.«
Der Ternberger runzelte die Stirn. »Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Er wollte Euch als Ketzerjäger verpflichten. Doch was den Zwicker angeht, kann ich Euch beruhigen. Gerüchte, dass er auftaucht, gab es immer wieder, ohne dass sie sich bestätigt hätten. Ich sprach erst vergangene Woche mit Abt Nikolaus von Garsten darüber. Er sagte mir, ihm sei nichts von einem bevorstehenden Besuch bekannt.«
Falk sah erneut zu Christine hinüber. Diesmal sprach Erleichterung aus ihrem Blick.
»Gut. Könnt Ihr mir etwas über den bisherigen Stand der Untersuchungen sagen? Stadtrichter und Burggraf führen sie wohl gemeinsam, wenn ich Eure Nachricht recht verstanden habe?«
»Ja, nachdem ich sie mehr oder weniger dazu zwingen musste. Aber sie sind beide unfähig. In sechs Wochen sind sie mit ihren Ermittlungen nicht einen Schritt vorangekommen. Weder, was den Mord an Klara angeht, noch den an diesem Bürgel.«
»Es gibt noch einen weiteren Mord?«, vergewisserte sich Falk erstaunt.
»Ja. Lamprecht Bürgel. Ein allseits geachteter Handwerker: Fass- und Wagenmacher. Ein Fischer zog ihn aus der Enns, drei Wochen, bevor man Klara fand. Vor ein paar Monaten erst fischte der Mann fast an der gleichen Stelle zwei Mädchenleichen aus dem Fluss.«
»Vier Morde innerhalb so kurzer Zeit? Gibt es Hinweise auf Gemeinsamkeiten?«
Der Ternberger schüttelte den Kopf. »Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die beiden Mädchen wurden erst geschändet, dann erwürgt. Anschließend steckte der Mörder jede in einen Sack, band ihn zu und warf ihn in die Enns. In Steyr geht das Gerücht, dass es Ketzer waren; die Leute sagen, nur wer mit dem Teufel auf Du und Du stehe, könne so etwas tun.«
»Ihre Mörder wurden also bis heute nicht gefunden?«
»Nein.«
»Und dieser Lamprecht Bürgel? Ihr sagtet, er wurde drei Wochen vor Klara getötet. Wie starb er?«
»Man hatte ihm die Kehle durchgeschnitten. Die Leiche lag wahrscheinlich schon mehrere Tage im Wasser. Um den Fuß war ein Strick geknotet, der in einer leeren Schlinge endete. Der Mörder hatte den Leichnam versenkt und wohl ein Gewicht am Fuß des Toten befestigt, aber dieses löste sich, und so kam die Leiche wieder hoch.«
»Das alles habt Ihr mir in Eurer Nachricht aber nicht mitgeteilt.«
»Ich hielt es nicht für wichtig. Das mit den beiden Mädchen geschah schon vor Monaten. Sie dürften den teuflischen Trieben eines Wahnsinnigen zum Opfer gefallen sein; ob Ketzer oder nicht, sei dahingestellt. Was den Bürgel angeht, könnte ich mir vorstellen, dass ein Raubmörder ihn auf dem Gewissen hat. Eine Anfrage bei seiner Witwe ergab immerhin, dass er einen prallen Geldbeutel hätte bei sich haben müssen. Der aber fehlte bereits, als der Fischer die Leiche aus dem Wasser zog. Bei Klara liegt die Sache anders. Obwohl Stadtrichter und Burggraf auch hier von einem Raubmord ausgehen. Aber ich sagte ja schon – sie sind unfähig, die wahren Hintergründe aufzudecken.«
»Wenn ich Euch recht verstehe, wurde also auch Klara beraubt?«
»Sagen wir es so: Man fand zwar ihre Leiche, doch ihre Geldbörse fehlte. Aber glaubt mir, es steckt mehr dahinter als nur Habgier.«
»Ach, und wie kommt Ihr zu dieser Vermutung?«
Wernher starrte einige Augenblicke vor sich hin, bevor er antwortete.
»Klara ahnte ihren Tod voraus«, sagte er schließlich leise.
Falk hob überrascht die Brauen.
»Sie ahnte, dass sie sterben würde?«
Der Ternberger nickte finster.
»Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Es gab da auch gewisse Vorzeichen. Sie machte schon seit geraumer Zeit einen … sagen wir … nun ja, einen etwas eigenartigen Eindruck. Sie war irgendwie nachdenklicher, in sich gekehrter, als sonst. Manchmal schwieg sie tagelang. Ich stritt mich sogar deswegen mit ihr. Natürlich habe ich sie gebeten, mir zu sagen, was sie bedrückt. Anfangs beteuerte sie immer, ich bräuchte mir keine Sorgen zu machen; es sei nur das Heimweh, das sie ab und an überfalle. Aber dann, einige Tage, bevor sie ermordet wurde, stellte sie mir eine Frage, die mich aus allen Wolken fallen ließ.«
Wernher hielt kurz inne, als müsse er sich zuerst sammeln, um weitersprechen zu können.
»Sie fragte mich, ob ich mir vorstellen könne, wenn sie plötzlich und unerwartet das Zeitliche segnen sollte, Sofia zu ehelichen.«
Falk beugte sich vor. »Sie fragte Euch allen Ernstes, ob Ihr bereit wärt, ihre Tochter zu heiraten?«, hakte er nach.
Der Ternberger nickte. »Im Falle ihres plötzlichen Ablebens, wie gesagt.«
»Eine ungewöhnliche Bitte, in der Tat«, murmelte Falk und ließ sich wieder in den Stuhl zurückfallen. »Und wie habt Ihr reagiert?«
Wernhers vor Gram zerfurchte Stirn verdüsterte sich noch mehr. »Ich fürchte, viel zu heftig. Ich war natürlich sehr erregt. Ich schrie sie an, fragte sie, ob sie noch bei Sinnen sei und wie sie auf solche absurden Ideen käme. Überhaupt hätte ich die Nase voll von ihrem seltsamen Verhalten. Dann … dann schlug ich ihr ins Gesicht. Es war das erste Mal, dass ich derart in Harnisch geriet, und es tat mir gleich darauf auch unendlich leid.«
Abrupt erhob sich Wernher und ging zu einem der großen Fenster, die sich zum Marktplatz hin öffneten.
»Klara brach in Tränen aus … und stürzte aus dem Zimmer«, fuhr er, zum Fenster hinaussehend, leise fort. »Es war das letzte Mal, dass ich sie lebend sah. Am darauffolgenden Tag reiste ich, ohne mich von ihr zu verabschieden, nach Passau. Als ich fünf Tage später gegen Mittag zurückkehrte, teilte man mir mit, dass sie am Morgen mit unbekanntem Ziel ausgeritten sei, aber am selbigen Abend noch zurückkehren werde. Doch sie kehrte nicht zurück. Am nächsten Tag fand man ihre Leiche. Ich … ich konnte sie nicht einmal mehr um Verzeihung bitten.«
Wernher hielt inne. Gedankenverloren starrte er auf den Stadtplatz hinunter, auf dem lebhaftes Treiben herrschte.
Christine erhob sich und ging zu ihm hinüber. »Lieber Freund, Ihr solltet Euch nicht über die Maßen damit quälen. Glaubt mir, Klara hätte das nicht gewollt.«
Auch Falk trat an die Seite des Ternbergers. »Christine hat richtig gesprochen, Wernher. Hört auf, Euch deswegen Vorwürfe zu machen. – Sagt: Weiß Sofia vom Ansinnen Eurer Gattin?«
Der Magistrat schüttelte den Kopf. »Nein. Ich wollte sie damit nicht belasten. Im Nachhinein verstehe ich Klaras Wunsch ja auch. Sie wollte ihre Tochter in Sicherheit wissen. Natürlich werde ich dafür Sorge tragen, dass es ihr an nichts mangelt – auch wenn eine Adoption aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist. Eine Heirat kommt ebenso wenig infrage. Das hätte Klara eigentlich wissen müssen. Was ich für Sofia empfinde, ist, was ein Vater für seine Tochter empfindet. Jenes leidenschaftliche Feuer, das im Herzen eines Mannes für eine Frau lodert – es wird wohl nie wieder in mir entfacht werden.«
»Wie hat Sofia das Ganze bewältigt?«, fragte Christine.
»Anfangs war sie natürlich völlig verzweifelt, wollte das Furchtbare einfach nicht wahrhaben. Mittlerweile wirkt sie sehr gefasst.«
»Werden wir sie heute noch sehen?«, wollte Falk wissen.
»Nein. Sofia ist bei einer Freundin zu Besuch. Sie wird erst in einer Woche zurückkehren. Allerdings bitte ich Euch, ihr gegenüber nichts über den Inhalt unseres Gesprächs verlauten zu lassen, insbesondere was den Heiratsgedanken ihrer Mutter angeht. Es würde sie nur verunsichern. Übrigens: Auch Stadtrichter und Burggraf wissen nichts davon. Lediglich darüber, dass Klara ihren Tod vorausgeahnt und ihren Mörder vielleicht gekannt hat, habe ich sie in Kenntnis gesetzt.«
Falk verstand. »Ja, natürlich. – Apropos Stadtrichter und Burggraf: Ich nehme an, sie wissen, dass ich sie in ihren Ermittlungen unterstützen soll?«
Ein grimmiges Lächeln flog über die Miene des Ternbergers.
»Das schon. Aber stellt Euch lieber auf einen kühlen Empfang ein, wenn ich Euch den beiden vorstelle. Begeistert sind sie nicht gerade davon, insbesondere da sie wissen, dass ich Euch für bedeutend geeigneter halte, die schreckliche Angelegenheit aufzuklären. Ungeachtet dessen werden sie mit Euch zusammenarbeiten, auch wenn sie’s zähneknirschend tun, das verspreche ich. Ihr wisst, ich habe einiges zu sagen in dieser Stadt.«
Falk nickte, zweifelte allerdings daran, dass die Vorgehensweise des Ternbergers klug gewesen war. Harsche Kritik an der Art und Weise zu üben, wie die beiden Obrigkeitsvertreter ihre Amtsgeschäfte versahen, und ihnen im gleichen Atemzug jemanden zu nennen, der die Sache angeblich besser machen würde, zeugte nicht gerade von diplomatischem Geschick.
»Wann werde ich die beiden sehen?«
»Morgen am frühen Vormittag, wenn Ihr einverstanden seid. – Ja, was gibt es denn?« Die Frage Wernhers galt einem Klopfen an der Tür.
Eine Magd steckte den Kopf herein. »Verzeiht, Herr, aber die Tafel ist gedeckt, wie Ihr befohlen habt.«
Der Magistrat erhob sich. »Natürlich, fast hätte ich es schon wieder vergessen. Wenn Ihr mir bitte nach nebenan folgt, es ist angerichtet. Nach dem Mahl werde ich Euch Eure Kammer zuweisen lassen. Dort könnt Ihr für den Rest des Tages ausruhen. Ihr seid sicher müde von der Reise.«
Kapitel 3
Donnerstag auf Freitagnacht, 30. / 31. Juli 1388
Erschrocken fuhr Christine aus dem Schlaf. Mit angehaltenem Atem starrte sie zum Fenster hinüber. Unwillkürlich strich sie sich mit der Hand über die Stirn; sie fühlte sich feucht und kalt an. Gleichzeitig spürte sie, wie ihr das Herz bis zum Halse schlug. Du träumst, es ist nur ein böser Traum, versuchte sie sich zu beruhigen und schloss krampfhaft die Augen. Als sie sie wieder öffnete, war die dunkle Gestalt, die sie soeben noch neben dem Fenster zu sehen geglaubt hatte, verschwunden.
Sie spürte, wie die Panik, die sich in ihr festgekrallt hatte, zu weichen begann, und atmete auf. Sie blickte zur Seite. Das Haupt auf beide Hände gebettet, lag Falk neben ihr; ruhige, gleichmäßige Atemzüge verrieten, dass er tief und fest schlief.
Christine lächelte. Sie beugte sich über sein Gesicht und hauchte einen Kuss auf seine Stirn. Vorsichtig schlug sie die mit weißem Linnen überzogene Wolldecke zurück und stieg leise aus dem Bett. Auf Zehenspitzen schlich sie zum Fenster hinüber, öffnete einen der beiden pergamentbespannten Flügel und sah auf den Innenhof hinaus. Selbst jetzt noch, im Dunkeln, ließ sich die Größe des Terbergschen Anwesens erahnen. Es umfasste zwei Gebäude, die jeweils aus einem Vorder- und einem Hinterhaus bestanden und durch den Hof voneinander getrennt waren. Christine und Falk waren in dem Haus untergebracht, das man das »Fondaco« nannte; ein Begriff, den der Ternberger von einer seiner Reisen nach Venedig mitgebracht hatte. Es barg neben einigen Dienstbotenkammern und einer großen Küche vor allem Kontore sowie Laden- und Geschäftsräume, die nicht von ungefähr im ersten Obergeschoss untergebracht waren: Nur so ließen sich Handelserzeugnisse und Waren vor den regelmäßig wiederkehrenden Hochwässern von Enns und Steyr schützen. Auch die Gästekammern befanden sich hier; sie lagen im zweiten Obergeschoss. Das andere Gebäude wurde vom Hausherrn selbst und einigen Dienstboten, allen voran dem Majordomus, bewohnt. Darüber hinaus beherbergte es eine große Empfangshalle sowie weitere Geschäftsräume und die Schreibstube Wernher von Ternbergs. Die Hauptfassaden beider Häuser wandten ihr stolzes Antlitz zum Stadtplatz, während die Rückseiten auf eine etwas mehr als mannshohe Mauer stießen, die sich die ganze Breitseite des Anwesens entlang erstreckte und nur wenige Schritte von der Enns entfernt errichtet worden war. Trat der Fluss über die Ufer, schützte die Mauer – wenn auch unvollkommen und nur vorübergehend – zumindest den Innenhof vor seinen Fluten. Auf den Hof selbst gelangte man durch ein breites zweiflügeliges Tor, das in eine Mauer eingelassen war, welche die auf der Stadtplatzseite gelegenen Fronten beider Gebäude miteinander verband.
Christines Blick richtete sich nach rechts, wo hinter der ennsseitig gelegenen Mauer das schwarzsilberne Band des Flusses glitzerte, und schweifte dann über den Hof, auf dem tagsüber geschäftiges Treiben herrschte. Jetzt lag er einsam und leer und von nächtlicher Stille erfüllt da. Christine gähnte; sie spürte, wie erneut Müdigkeit nach ihr griff, und beschloss, sich wieder aufs Lager zu begeben.
Dann aber drang ein Knacken an ihr Ohr, gefolgt von rhythmisch leisem Klatschen.
Mit einem Mal war sie wieder hellwach. Sie trat zur Seite, um selbst nicht gesehen zu werden, und blickte mit angehaltenem Atem in den Hof hinunter.
Mit schnellen Schritten querte eine dunkel gewandete Person den Hof, blieb kurz stehen und sah sich vorsichtig um, als wollte sie sich vergewissern, dass ihr auch niemand folgte. Dabei hob sie das Haupt – und sah für einen kurzen Augenblick direkt zum Fenster der Gästekammer empor.
Christine stutzte.
Sofia!
Sofia, die Tochter Klaras, die angeblich bei einer Freundin zu Gast war und erst in einer Woche heimkehren würde. Das Licht, das der Mond hergab, genügte Christine, um zweifelsfrei ihr Profil erkennen zu können. Zudem vermochte das Tuch, mit dem die junge Frau ihr Haar verhüllt hatte, nur ansatzweise, die blonde Pracht zu bändigen, die sich darunter verbarg.
Mit schnellen Schritten lief sie weiter, erreichte den Schatten des gegenüberliegenden Hauses und bewegte sich in seinem Schutz in Richtung der am Fluss gelegenen Begrenzungsmauer. Dort verschwand sie hinter einigen Büschen, die an der Mauer entlang wuchsen.
Christine ließ die angestaute Luft mit einem scharfen Zischlaut entweichen. Sie wartete darauf, dass Sofia wieder erschien. Doch das Mädchen blieb verschwunden, als habe sie der Erdboden verschluckt.
Christine blickte zu Falk hinüber. Sollte sie ihn wecken? Nein. Das hatte bis morgen Zeit. Auf Zehenspitzen schlich sie zum Bett zurück und schlüpfte vorsichtig unter die Decke. Geraume Zeit noch floh sie der Schlaf, bevor sie endlich in einen unruhigen Schlummer glitt.
Kapitel 4
Freitag, 31. Juli 1388
Als Christine Stunden später erwachte, stellte sie überrascht fest, dass der Platz neben ihr leer war. Offenbar hatte Falk beschlossen, sie schlafen zu lassen, während er selbst bereits unterwegs war. Sie sah zum Fenster hinüber, durch das bereits die warmen Strahlen der Sonne fielen; vom Hof unten drang verhaltener Lärm ins Zimmer.
Christine gähnte. Sie stieg langsam aus dem Bett und ging nach nebenan in die kleine Ankleidekammer, wo sie eine Schüssel voll frischen Wassers nebst einer duftenden Seifenkugel aus Venedig und einen Stapel sauberer Tücher vorfand.
Wenig später – sie war inzwischen vollständig angekleidet – klopfte es an ihrer Kammertür. Es war Irmingard, die oberste Hausmagd.
»Euer Gemahl ist bereits mit meinem Herrn im Stadtrichterhaus, gnädige Frau. Sie werden um die sechste Stunde zurück sein. Wenn Ihr wollt, dürft Ihr Euch derweil in der Bibliothek umsehen. Der Majordomus, Herr Söhnlein, wird sie Euch zeigen.«
Erfreut hob Christine die Brauen. Dass es im Hause Ternberg einen solchen Raum gab, war ungewöhnlich, gestand man ihn gemeinhin doch lediglich den Klöstern zu.
»Richte dem Majordomus aus, dass es mir ein Vergnügen sein wird.«
Hans Söhnlein war trotz seines Alters von knapp fünfzig Jahren noch immer ein attraktiver Mann. Von hoher Gestalt, mit dunklem, leicht gewelltem Haar und einem Paar hellblauer Augen, die sehr sanft und heiter blickten, und ausgestattet mit ebenmäßigen Gesichtszügen, die der eine oder andere vielleicht als ein wenig zu weich ansehen mochte, bot er einen Anblick, der so mancher Frau das Herz höher schlagen ließ.
»Ich danke für die Mühe, die Ihr Euch mit mir macht«, sagte Christine, nachdem sie einander begrüßt hatten, und lächelte dem Majordomus freundlich zu.
»Aber ich bitte Euch, es ist mir eine Ehre, Frau von Falkenstein.« Die samtene Stimme des Majordomus entsprach ganz seiner äußeren Erscheinung. Er verbeugte sich galant und hielt Christine die Tür zur Bibliothek auf.
Mit Erstaunen registrierte sie die Größe des Saales; er wirkte hell und freundlich, ein Umstand, welcher der mit Butzenglasscheiben ausgestatteten Fensterreihe zu verdanken war, die nach Norden lag. Auf drei Seiten war der Raum mit gewaltigen Regalen versehen, bis zur Decke vollgestopft mit Büchern. Die Mitte beherrschte ein wuchtiger Tisch, in dessen glatt polierte Fläche wertvolle Intarsien eingelassen waren. Auf der Platte selbst thronte ein mächtiger Leuchter; flankiert wurde der Tisch von einigen gut gepolsterten, mit bequemen Armlehnen versehenen Stühlen.
Bewundernd ließ Christine ihren Blick die Regale entlangwandern. Wenn es etwas gab, das sie faszinierte, dann waren es Bücher. Von Kindheit an hatten sie eine geradezu magische Anziehungskraft auf sie ausgeübt. Immer wenn sie eine Bibliothek oder eine Schreibstube betrat, tat sie es mit fast ehrfürchtigem Staunen, obwohl ihr der Anblick von Regalen, gefüllt mit Hunderten von Buchrücken, sowie das Studium eng beschriebener und mit kunstvollen Bildern versehener, pergamentener Seiten von Jugend an vertraut war. Schließlich war sie als Tochter des Vicomte Arnaud de Blois aufgewachsen, eines adeligen Gelehrten, der an der Universität Paris Medizin und Jurisprudenz studiert und schließlich zum Doctor medicinae und Licentiatus iuris avanciert war. Vicomte Arnaud de Blois war ein Mann mit überragender Bildung gewesen, der sehr wohl wusste, dass Bücher Macht besaßen, ja sogar die Welt verändern konnten, sowohl zum Bösen als auch zum Guten. Schon früh hatte er die Geistesgaben seiner Tochter und das Potenzial, das in ihr steckte, erkannt und sie – entgegen aller Regeln – zunächst von klösterlichen Lehrern, die er gut bezahlte, in den sieben freien Künsten unterrichten lassen. Was Sprachen anging, beherrschte Christine außer Latein auch Italienisch und Deutsch. Nachdem sie Trivium und Quadrivium mit Bravour gemeistert hatte, war sie an die Schule von Salerno (an der sogar Frauen studieren durften) gewechselt, wo sie das Studium der Medizin absolviert hatte. Bei der Erinnerung an ihren Vater kamen Christine die Tränen; vor zwei Jahren bereits war er verstorben, das Vermögen, das er ihr hinterlassen hatte, versetzte sie jedoch in die Lage, ein verhältnismäßig unabhängiges und sorgenfreies Leben zu führen. Ein Leben, das sie seit drei Jahren mit Falk von Falkenstein teilte.
»Euer Schweigen lässt erkennen, wie beeindruckt Ihr seid«, sagte der Majordomus lächelnd und riss Christine aus ihren Gedanken.
»Ihr habt recht, Herr Majordomus, ich bitte um Vergebung. Aber Ihr seht mich in der Tat überrascht. Um diese Schätze würde so manches Kloster Herrn von Ternberg beneiden. Ich wusste gar nicht, wie sehr er der Liebe zu den Büchern huldigt«, entgegnete Christine ein wenig verlegen.
»Die Liebe zu den Büchern spiegelt seine Liebe zum Wissen wider.«
»Ja, ich weiß. Auch Klara war sehr wissbegierig. Sie dürfte sich dieser Bücher ebenfalls sehr ausgiebig bedient haben, nicht wahr?«
»Da habt Ihr recht. Sie hat sich sehr oft und sehr gerne hier aufgehalten«, bemerkte der Majordomus, während ein Schatten über seine Miene huschte. »Hier war übrigens ihr Lieblingsplatz.« Er schritt die Wand entlang und blieb vor einem Regal stehen, das sich in einer tiefen Nische befand; der untere Teil war mit einer Holzplatte verschlossen. »Und das hier haben wir auf ihre Anregung hin fertigen lassen«, ergänzte er. Er bückte sich kurz und überraschte Christine damit, dass er die Holzplatte nach oben klappte, bis sie mit hörbarem Klacken in eine Mechanik einrastete. Im Handumdrehen war so eine praktische Schreibfläche entstanden. Jetzt erst nahm Christine auch den zierlichen Hocker wahr, der, hinter der Platte verborgen, von Klara offenbar immer dann hervorgeholt worden war, wenn sie sich an die herausklappbare Tischplatte setzen wollte.
In diesem Moment hörten sie, wie jemand den Saal betrat. Sie wandten sich um und sahen Irmingard, die Obermagd, im Türrahmen stehen.
»Verzeiht, Herr Söhnlein, aber Ihr habt Besuch. Herr van Leyden aus Brügge ist angekommen.«
»Van Leyden? Er wollte doch erst morgen anreisen«, wunderte sich der Majordomus. »Ich bitte um Entschuldigung, Frau von Falkenstein, aber ich muss Euch nun allein lassen; die Geschäfte rufen«, fügte er, an Christine gewandt, hinzu und entfernte sich mit eiligen Schritten.
Nachdenklich betrachtete Christine die Nische, die der Majordomus als Klaras Lieblingsplatz bezeichnet hatte. Sie barg ein Regal, das über eine größere Tiefe zu verfügen schien als die anderen, sodass zu vermuten stand, dass die Bücher darin in zwei hintereinander angeordneten Reihen standen.
Christine nahm einige Bände heraus und legte sie auf die ausgezogene Tischplatte. Sie fand ihre Vermutung bestätigt. Tatsächlich ließ die entstandene Lücke eine zweite Reihe von Büchern erkennen. Was ihr jedoch vor allem ins Auge stach, war ein dickes Buch, das nicht wie die anderen mit dem Buchrücken zum Betrachter im Regal stand, sondern vielmehr aufgeschlagen dalag, ganz so, als hätte jemand erst kürzlich darin gelesen und es dann zur Seite gelegt. Christine nahm es zur Hand und registrierte erstaunt, dass sie eine Ausgabe von Dante Alighieris »Divina Commedia« in italienischer Sprache in Händen hielt. Als sie umblättern wollte, fiel plötzlich ein eng beschriebenes Blatt heraus und flatterte zu Boden. Sie hob es auf und stellte überrascht fest, dass die mit schneller Hand hingeworfenen Zeilen nichts mit hehrer Dicht-, sondern mit deftiger Kochkunst zu tun hatten – es war ein schlichtes Küchenrezept, das die Herstellung eines süßen Backwerks nannte. Allerdings war es nicht auf Pergament, sondern auf Papier notiert; jenem praktischen Beschreibstoff, den man hauptsächlich aus Venedig, Genua oder anderen italienischen Städten importierte. Auch die Rückseite war beschrieben, und zwar mit einem zweizeiligen Vers. Im Gegensatz zu dem Rezept auf der Vorderseite erkannte Christine in den beiden Zeilen eindeutig die Handschrift Klaras. Die Glöckchen aus Akkon, wie lieblich ihr Klang. So nehmt denn ihr Schönen, den Tod in Empfang,las sie. Zuerst runzelte sie die Stirn, dann lächelte sie wehmütig. Sie wusste noch aus Salerno, dass Klara hin und wieder den einen oder anderen Vers geschmiedet und auf dem nächstbesten Beschreibstoff notiert hatte, um ihn nicht zu vergessen. Wahrscheinlich war dies einer davon.
Sie steckte den Zettel wieder zwischen die Seiten und legte das Buch an seinen Platz zurück. Nachdem sie die Regale einer weiteren Inaugenscheinnahme unterzogen hatte, beschloss sie, den Rest des Vormittags damit zu verbringen, in einigen Werken zu stöbern, die sich mit medizinischen Themen beschäftigten. Es würde ihr die Zeit bis zu Falks Rückkehr auf angenehme Weise verkürzen.
Kapitel 5
Der Saal, in dem der Stadtrichter seines Amtes waltete, zeichnete sich zum einen durch seine enorme Größe und zum anderen durch die wuchtigen Schränke aus, die sich an der der Wand gegenüberliegenden Fensterseite entlangreihten. Den Mittelpunkt des Raumes bildete ein beeindruckend großer Tisch, an dem sich an diesem Morgen der Stadtrichter selbst sowie Heinrich von Pogner, Burggraf zu Steyr, und Wernher von Ternberg nebst Falkmar von Falkenstein niedergelassen hatten.
»Wie ich schon sagte, der Graf und ich sind uns in der Beurteilung der Situation einig«, sagte Georg von Panhalm und sah zu Heinrich von Pogner hinüber, der an einer der Stirnseiten des Tisches saß. »Beide Male dürften wir es mit Mord aus Habgier zu tun haben. Allein, ob es gelingen wird, des oder der Täter habhaft zu werden …« Der Stadtrichter ließ den Satz unvollendet und zuckte mit den Schultern.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!