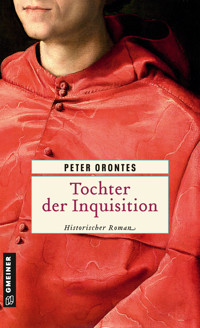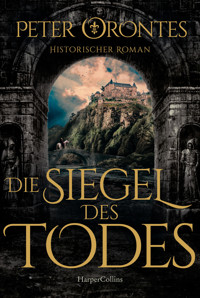9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer Welt wie der ihrigen, können Frauen nicht lange überleben.
Herzogtum Oberösterreich, anno 1405. Adrian von Bitterstedt, gelehrter Benediktinermönch und Spezialist für antike Texte, visitiert die Abtei Ennswalden. Dort soll eine apokryphe Schrift lagern, ein fünftes Evangelium, das, fiele es in unbefugte Hände, der Kirche größten Schaden zufügen kann und deshalb gesichert werden soll. Doch seine wahre Mission ist eine andere. Im Auftrag einer Bewegung, die der Amtskirche den Kampf angesagt hat, forscht er insgeheim nach dem verschollenenBrief des Athanasius, welcher die Kirche in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Adrians Mission ist brandgefährlich, handelt es sich bei ihm doch in Wirklichkeit um Adriana von Bronnen – eine junge Frau, die, als Mönch verkleidet, vor dem gefährlichsten Abenteuer ihres Lebens steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch:
Adrian von Bitterstedt, ein junger Benediktinermönch, Doktor der Theologie und ausgewiesener Kenner des Altgriechischen, ist im Auftrag namhafter Gelehrter der Universität Wien unterwegs nach Ennswalden. Er soll in den kommenden Wochen antike Schriften studieren, die im dortigen Benediktinerstift aufbewahrt werden. Angeblich gibt es Hinweise auf eine apokryphe Schrift des Neuen Testaments, ein Fünftes Evangelium, das er unbedingt beschaffen soll, damit es dem Vatikan übergeben werden kann. So lautet zumindest die offizielle Version seines Auftrags in dem Empfehlungsschreiben, das Adrian dem Abt des Klosters, Florian I., überbringt. Doch seine wahre Mission ist eine andere. Entsandt von seinem Mentor Albert von Kanten, der einer Bewegung angehört, die der Amtskirche den Kampf angesagt hat, forscht er insgeheim nach dem verschollenen »Testament des Athanasius«, welches die Kirche in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Niemand in Ennswalden ahnt, dass auch der junge Mönch nicht ist, was er zu sein scheint …
Zum Autor:
Peter Orontes kam in Venezuela zur Welt. Er wuchs als Sohn eines Ungarn und einer Ostpreußin am Bodensee auf, studierte Grafikdesign und war nach mehreren Jobs in Werbeagenturen und Marketingabteilungen über dreißig Jahre als freier Kommunikationsdesigner tätig. Seit vielen Jahren arbeitet er als freier Autor und lebt mit seiner Familie in der Nähe von Augsburg. 2017 erhielt er für seinen historischen Roman »Tochter der Inquisition« den Literaturpreis GOLDENER HOMER in der Sparte Historischer Krimi / Thriller.
Lieferbare Titel:
Peter Orontes – Die Siegel des Todes
Originalausgabe
© 2023 HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Covergestaltung von Dominic Wilhelm, Schweiz
Coverabbildung von Ihor Bondarenko, Yulcha, jessicahyde / Shutterstock
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783749906147
www.harpercollins.de
ABTEI ENNSWALDEN
PERSONENVERZEICHNIS
Handelnde Personen innerhalb der Abtei
Adriana von Bronnen alias Adrian von Bitterstedt – Denkt das Undenkbare, wagt das Unfassbare und begibt sich auf die Suche nach einer tödlichen Wahrheit
Guillermo von Toledo – Mönch aus dem Kloster Sant Pere de Rodes; unterstützt Adriana bei ihrer Suche
Florian I. Tampek – Abt
Bruder Hartwig – Subprior
Bruder Bertram – Sekretär des Abtes
Bruder Markward – Armarius
Bruder Valentin – Vestiarius
Bruder Nathanael – Botanicus
Bruder Matthias – Kellermeister
Bruder Ortolph – Sakristan
Bruder Firmin – Pförtner
Bruder Cosmas – Vertreter des Pförtners
Bruder Rochus – Ältestes Mitglied des Konvents
Bruder Manfred – Imker und Fischereimeister
Bruder Gottschalk – Cellerar
Bruder Konrad – Hospitarius
Bruder Erasmus – Konversenmeister
Bruder Ansgar – Gehilfe in der Bibliothek und im Skriptorium
Bruder Notker – Leiter der Äußeren Schule
Handelnde Personen außerhalb der Abtei
Bruder Gallus – Eremit; lebt auf der Wolfsklause inmitten seiner Wölfe
Adelheid, die Nonne – Lebt in einem Inklusorium auf dem Kapellenberg
Albert von Kanten – Professor an der Universität zu Wien, Mentor und väterlicher Freund Adriana von Bronnens, Antitrinitarier und ambitionierter Gegner der Amtskirche
Im Roman erwähnte historische Persönlichkeiten mit Bezug zur Handlung Ende 14. / Anfang 15. Jh.
Jan Hus – Böhmischer Reformator
John Wyclif – Englischer Philosoph und Kirchenkritiker
Nikolaus von Dinkelsbühl – Rektor der Universität Wien
Heinrich von Olmütz – Dominikanerpater und Inquisitor
Im Roman erwähnte historische Persönlichkeiten mit Bezug zur Handlung 4. Jh., Konzil zu Nicäa
Konstantin der Große – Kaiser des Römischen Reiches
Arius – Prebyter aus Alexandria
Athanasius – Erzdiakon von Alexandria
Alexander von Alexandria – Bischof, Patriarch
Eustathios von Antiochia – Bischof, Patriarch
Makarios von Jerusalem – Bischof, Patriarch
Ossius von Cordoba – Bischof
Eusebius von Nikomedia – Bischof
Paphnutius von Ägypten – Bischof
Nikolaus von Myra – Bischof
KLOSTERÄMTER IN ENNSWALDEN
Abt – Vorsteher des Klosters, ausgestattet mit umfassenden Machtbefugnissen
Prior – Vertreter des Abtes (kommt in Die Mönchin nicht vor, da er sich auf einer längeren Reise befindet)
Subprior – Vertreter des Priors und damit der Dritte in der Klosterhierarchie
Cellerar – »Geschäftsführer« des Klosters, verantwortlich für sämtliche wirtschaftlichen Belange
Camerarius – Gehilfe des Cellerars
Hospitarius – Zuständig für die Gäste und die Herberge
Vestiarius – Zuständig für Kleidung, Schuhe und Bettwäsche
Armarius – Bibliothekar des Klosters
Botanicus – Zuständig für Heilpflanzen und Arzneien (in Ennswalden auch als Apothecarius tätig)
Sakristan – Verantwortlich für die liturgischen Geräte und Kleider, aber auch für den Reliquienschrein, so vorhanden
Kellermeister – In Ennswalden zuständig für den Weinkeller
Konversenmeister – Zuständig für die Laienbrüder und Knechte
Pförtner – Verantwortlich für die Hauptpforte (Schließen, Öffnen); achtet darauf, wer das Kloster betritt oder verlässt
TAGESZEITEINTEILUNG IN EINEM MITTELALTERLICHEN KLOSTER
(Sommer)
Gebetszeiten (Horen)
Matutin;erster Gottesdienst des neuen Tages
Laudes;Morgengebet bei Beginn der Morgendämmerung
Prim;erste Tagesstunde (nach Sonnenaufgang)
Terz;dritte Tagesstunde
Sext;sechste Tagesstunde
Non;neunte Tagesstunde
Vesper;Abendgebet
Komplet;Nachtgebet
PROLOG
JULI ANNO DOMINI 1385 HERZOGTUM STEIERMARK ENNSTALER ALPEN, BUCHAUER SATTEL
Totenstille!
Ein seltsames Wort. Bis zu diesem Augenblick hatte der kleine Junge nie so richtig verstanden, was die Erwachsenen meinten, wenn sie dieses Wort gebrauchten. Er hatte es hin und wieder gehört, aber damit nie etwas anfangen können. Totenstille, so wusste er nun, ist die Stille, die von den Toten ausgeht. Die Stille, die nie endet.
Zögerlich zunächst, dann immer schneller ausschreitend, trat der Junge auf die einsame vom Mond beschienene und von glitzernder Nässe und absolutem Schweigen erfüllte Lichtung.
Die Lichtung, auf der Vater und Mutter lagen. Tot. Und Johann und Heiner und Lutz, die Bediensteten seines Vaters. Tot. Auch der freundliche Mönch lag dort. Tot. Der Mönch, der ihm, Stunden bevor die bösen Männer gekommen waren, noch eine spannende Geschichte erzählt hatte. Die Geschichte von Kain und Abel. Der böse Kain, so der Mönch, hatte seinen Bruder Abel getötet, obwohl Abel ein guter Mensch gewesen war. Und Gott hatte es zugelassen. Er hatte es nicht verhindert, er hatte Kain nur gewarnt. So hatte es der Mönch erzählt. Auf seine Frage, warum Gott denn zugelassen habe, dass der böse Kain den guten Abel umbrachte, hatte der Mönch keine Antwort gewusst. In der Bibel würde sie stehen, die Geschichte von Kain und Abel, hatte er gesagt. Und da stehe viel, was man nicht verstehen könne.
Ob Gott die bösen Männer, die seine Eltern und den netten Mönch getötet hatten, wohl auch gewarnt hatte, bevor sie gekommen waren?
Langsam ging der Junge weiter. Drei, vier Schritte nur, dann blieb er wieder stehen. Erneut wurde ihm bewusst, wie alleine er war, völlig verlassen. Nachdem sie vorübergehend versiegt waren, liefen wieder Tränen über seine kindlichen Wangen, und ein Schluchzen schüttelte seinen mageren Körper. Wenn wenigstens Hildegard bei ihm gewesen wäre. Seine ältere Schwester. Bis zum Einbruch der Dunkelheit hatte er mit ihr noch Verstecken gespielt. Stunden später, mitten in der Nacht, waren sie von einem Gewitter aus dem Schlaf gerissen worden. Die gesamte Reisegruppe hatte, eng beieinander kauernd, unter einem notdürftig aus Planen und Decken errichteten Unterschlupf Schutz gesucht. Doch kaum war das Unwetter vorbei, waren mehrere mit Messern und Knüppeln bewaffnete Männer auf die Lichtung gestürmt und hatten die Erwachsenen niedergemacht. Ihm und Hildegard war gerade noch rechtzeitig die Flucht in den Wald gelungen, doch in dem ganzen schrecklichen Durcheinander hatten sie sich aus den Augen verloren.
Hildegard. Wo war sie jetzt? Hatte sie sich, als das Furchtbare geschah, auch hinter einem Baumstamm versteckt? So wie er? Wenn ja, hatte sie das, was er beobachtet hatte, auch gesehen? Hatte sie mitbekommen, was die Männer mit seinem Vater und dem netten Mönch gemacht hatten? Was sie mit seiner Mutter gemacht hatten? Wie sie sich, als sie mit der Mutter fertig waren, mit dem Wagen samt den Pferden, die seinem Vater gehört hatten, einfach auf und davon gemacht hatten?
Wenn doch all das Grässliche, das er gesehen hatte, nur ein böser Traum gewesen wäre.
Aber es war kein Traum. Sonst wären seine Eltern und der freundliche Mönch nicht tot, Hildegard nicht verschwunden und er nicht allein.
Ängstlich sah sich der Junge um. Er schniefte. Wischte sich mit dem Ärmel über das tränennasse Gesicht. Noch immer war alles still. Abgesehen von dem Geräusch stetig fallender Tropfen, die in den Bäumen hingen. Sie zeugten von den Regenfluten, die vor Stunden vom Himmel gestürzt waren und die Lichtung fast ertränkt hatten. Ansonsten: Stille. Totenstille. Kein Lüftchen wehte. Nicht ein einziger Vogel zwitscherte. Kein Knacken im Wald, das verraten hätte, dass sich irgendwo etwas Lebendiges bewegte. Der Fuchs, die Maus, die Eidechse, das Reh, alle schliefen sie noch. Nicht einmal der Ruf eines Käuzchens war zu vernehmen.
Erneut sah sich der Junge um. Verzweifelt. Hildegard, wo bist du?
Er legte den Kopf in den Nacken und sah zum Himmel. Ganz weit dort oben, irgendwo hinter den blinkenden Sternen, die vor seinen mit Tränen gefüllten Augen zu unscharfen Flecken verschwammen, waren jetzt Vater und Mutter. Wenn man tot ist, kommt man in den Himmel, so hatten die Erwachsenen es ihm immer erzählt. Vorausgesetzt, man sei ein guter Mensch gewesen. So wie Abel. Schlechte Menschen kämen in die Hölle, wo das ewige Feuer brennt. So wie Kain. Ob er auch in der Hölle war? Und Abel – war er wirklich im Himmel? Bestimmt! Vielleicht unterhielten sich Vater und Mutter gerade mit ihm. Jetzt, da sie doch auch im Himmel waren. Eigentlich hatte er nie begriffen, was die Erwachsenen mit »in den Himmel kommen« meinten. Wie konnte jemand im Himmel sein, wenn sein Körper noch auf der Erde war?
Zögernd einen Fuß vor den anderen setzend, schritt der kleine Junge weiter auf die leblos am Boden liegenden Körper zu. Dunkle Schemen, die den Eindruck erweckten, als lägen große, flache Steine auf der mit Büschen, Gras und Flechten bestandenen Lichtung.
Dann aber blieb er stehen. Nein, er würde Vater und Mutter nicht mehr sehen wollen. Auch nicht den Mönch, der ihm die Geschichte von Kain und Abel erzählt hatte. Und auch die anderen nicht. Der Junge machte einen großen Bogen um die Toten und lief zu dem Erdloch, das der kräftige Regenguss bis zum Rand mit Wasser gefüllt hatte. Ob er seine Puppe noch finden würde? Die hölzerne Puppe, die er auf der Flucht vor den bösen Männern vor lauter Angst in das Wasserloch geworfen hatte.
Ja, da war sie. Inmitten vereinzelter Blätter, die auf der Wasseroberfläche schwammen, dümpelte die hölzerne Puppe träge vor sich hin. Der Junge ging am Rand des Wasserlochs in die Hocke und betrachtete sie im Licht des Mondes. Sein Glanz war blasser geworden; nicht mehr lange, und die Dämmerung würde heraufziehen. Und mit ihr das erste Licht des neuen Tages.
Doch noch spiegelte er sich fahl und rund auf der schwarzen Wasseroberfläche. Ganz versunken war der Junge in den Anblick der Puppe und der blassgelben Scheibe, die den Anschein erweckte, als wäre sie vom Himmel gefallen.
Plötzlich erhob sich ein Windstoß. In den Wipfeln rund um die Lichtung rauschte es. Eine Bö belebte die dunkle Oberfläche des Tümpels, und ein Kräuseln zerhackte den Abglanz der wuchtigen Himmelsscheibe in unzählige glitzernde Splitter. Langsam begann sich die Puppe zu drehen. Ein kleiner Zweig klatschte in das Wasserloch; winzige Fontänen spritzten, und unzählige Tröpfchen netzten das Gesicht der Puppe. Die Nässe verlieh den toten Augen Glanz, und dem Jungen schien, als erwachte die Puppe zum Leben.
Eine weitere Bö fuhr heran. Schneller drehte sich die Puppe, wippte auf und nieder, während Tropfen gleich Tränen über die holzgemaserten Wangen rannen.
Meine Puppe weint, dachte der Junge, ich muss sie trösten.
Er sah sich nach einem Stöckchen um, mit dem er die Puppe zu sich an den Rand des Wasserlochs herziehen könnte.
Augenblicke später drückte er sie an sich, herzte und küsste sie.
Dann erhob er sich und lief einfach los.
VIELE JAHRE SPÄTER HERZOGTUM ÖSTERREICH DAS ENNSTAL BEI STEYR
»HERR, bitte gib, dass sie es ist«, murmelte der Mann leise. Er fror. Bibbernd zog er die Schultern hoch und verwünschte die schneidende Kälte, die zunehmend in seine Knochen kroch.
Angestrengt sah er zu dem schroffen Felsen empor, der sich wie der Finger eines Riesen aus dem Waldberg erhob. Dessen Kuppe war von einer kleinen Kapelle gekrönt, die nur über einen steilen Pfad zu erreichen war. Sie gehörte zu der nicht weit entfernten, an der Enns gelegenen Benediktinerabtei, die sich dort, wo der Fluss einen engen Bogen beschrieb, an dessen Ufer schmiegte.
»Gib, dass sie es ist, HERR! Bitte!«, wiederholte der Mann seine Worte von vorhin noch eine Spur flehentlicher; nach wie vor musterte er den Felsen, auf dem sich die Kapelle befand, mit scharfem Blick.
Sein Interesse galt jedoch nicht der winzigen Kapelle, sondern dem seltsamen Anbau, der sich daran anschloss und der auf eine menschliche Behausung schließen ließ. Zum wiederholten Male rief er sich die Begegnung mit den beiden Männern in Erinnerung, die ihn veranlasst hatte, hierherzukommen und seit Stunden auf diesen Punkt zu starren. Es war der Vorsehung zuzuschreiben, dass sie seinen Weg gekreuzt hatten, das war sicher. Kein bloßer Zufall, sondern ein mahnender Wink des Schicksals, das ihn aufforderte, die heilige Pflicht, die ihm die Gerechtigkeit auferlegte, endlich zu erfüllen. Gerade mal zwei Tage waren vergangen seit jener Bemerkung, die ihn hatte aufhorchen lassen. Aufgeschnappt hatte er sie in seiner Unterkunft, im Gasthaus Zum Eber in der nahen Stadt, wo er in aller Ruhe seinen Würzwein zu trinken gedacht hatte. Er hatte die beiden Fuhrleute am Nebentisch zuerst gar nicht bemerkt. Erst als sie begannen, sich lautstark über eine Inkluse zu unterhalten, eine Einsiedlerin, die ganz in der Nähe in einer Zelle eingemauert lebte, wurde er auf sie aufmerksam. Und als der Ältere der beiden dann auch noch ihre Hände erwähnte, war es vorbei gewesen mit seiner Ruhe. Beschworen die Worte des Mannes doch schlagartig ein Bild aus seiner Vergangenheit herauf – schaurig hässlich, aber auch vertraut und liebenswert zugleich. Eine Ahnung wallte in ihm hoch, gepaart mit einem Gefühl von Hitze, das er immer dann verspürte, wenn höchste Anspannung an ihm zerrte. Unwillkürlich, ohne dass er etwas dagegen tun konnte, fingen seine Hände an zu zittern, was ihn gut die Hälfte des Würzweins verschütten ließ.
Dann mit einem Mal waren die beiden gegangen. Noch bevor er sich von seinem Schreck erholen und sie nach weiteren Einzelheiten fragen konnte. Worauf ihm nichts anderes übrig blieb, als sich in einem Zustand höchster Erregung in seine Kammer zurückzuziehen und sein Lager aufzusuchen. Doch in dieser Nacht floh ihn der Schlaf. Quälend langsam nur waren die dunklen Stunden dahingeschlichen, begleitet von wilden Träumen und ständigen Schweißausbrüchen.
Als am nächsten Morgen die Sonnenstrahlen ein Einsehen mit ihm hatten und seinen Albträumen ein Ende setzten, beschloss er, weitere Erkundigungen über die Inkluse einzuziehen. Also heftete er sich an die Fersen der unterschiedlichsten Leute. Was sie ihm erzählten, ließ seine Ahnung fast zur Gewissheit werden. Doch da ein »fast« noch keine Gewissheit ist, beschloss er, sich diese dadurch zu verschaffen, dass er sich höchstpersönlich vom Aussehen der Hände überzeugte …
Erneut sah er zum Inklusorium hinauf, jenem seltsamen Gebilde aus Felsgestein, Fachwerk und Mauern, innerhalb dessen Adelheid, die Einsiedlerin, ihr kärgliches Dasein zum Lob des HERRN fristete. Noch musste er warten. Noch drängte sich eine ganze Anzahl Leute vor dem Sprechfenster der Nonne. Trotz des Windes und der Kälte und der Graupelschauer, die ab und an vom Himmel rieselten, was um diese Jahreszeit – immerhin stand der Juni vor der Tür – nicht unbedingt zu erwarten war.
»Geht’s dir nich’ gut, Bruder Habenichts, brauchste Hilfe?«
Die heisere Frage des alten Mannes, der, vom Berg herabkommend, vor ihm stehen geblieben war, klang besorgt und kameradschaftlich zugleich. Kein Wunder; das Äußere des Alten glich dem seinen fast aufs Haar. Doch im Gegensatz zu ihm, der sich nur in Lumpen gehüllt hatte, um den Bettler zu mimen, gehörte der Fragesteller definitiv zur Zunft der Schnorrer und Besitzlosen.
»Nein, nein, mach dir keine Sorgen, mir geht’s gut, Alter. ’n bisschen kalt, aber das macht nix. Is’ ganz schön viel los da oben, was?« Er rieb sich die klammen Finger.
Der Mann grinste und entblößte ein paar schwarze Zahnstummel. »Na ja, zugegeben, es dauert ’n bisschen, bis man drankommt. Aber dafür is’ sie heute ganz schön spendabel. Hier, sieh mal!« Seine Rechte fuhr flink unter den durchlöcherten Umhang. Als er sie wieder hervorzog, förderte er zwei runzlige Äpfel und einen trockenen Brotkanten zutage.
»Hm, tatsächlich«, entgegnete »Bruder Habenichts« anerkennend und gab sich den Anschein, als wäre er beeindruckt. »Vielleicht hat sie für mich ja auch noch was übrig.« Er wusste, dass Einsiedlerinnen ihre Aufgabe unter anderem darin sahen, Notleidende mit kleinen Gaben zu unterstützen; Dinge, die sie selbst bekamen, um damit entweder ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen oder diese an andere Notleidende weiterzugeben. Und da eine Inkluse durch ihr Gelübde ein äußerst spartanisches Leben zu führen verpflichtet war, blieb des Öfteren nicht gerade wenig übrig, was sie als Almosen verteilen konnte.
»Ob sie noch was für dich übrig hat? Na ja, übrig vielleicht schon, aber ob du’s bekommst, ich weiß nich.« Der Alte zuckte skeptisch die Schultern.
»Wieso? Glaubst du, dass ihr meine Nase nich’ gefallen könnte?«
Wieder grinste der Alte. »Nee, das nich’. Aber es ist bald Zeit für die Vesper. Dann muss sie beten und so, du weißt schon. Sie hält sich streng an die Regel, und wenn noch jemand vor ihrem Fenster wartet, dann schickt sie ihn einfach weg und sagt ihm, dass er morgen wiederkommen soll.« Der Alte blickte zum Felsen hoch. »Da, sag ich’s doch! Sie kommen alle runter. Alle, die heut nich’ drangekommen sind. Sieh doch nur!« Jetzt deutete er mit der Rechten auf eine kleine Gruppe von Leuten, die im Gänsemarsch den steilen Pfad zum Fuß des Berges herunterschritten.
»Verdammt, du hast recht. Da werde ich mich wohl sputen müssen.« Seine Stimme klang nun ungeduldig. »Also dann, leb wohl. Ich muss nach oben, vielleicht spricht sie ja doch noch mit mir«, verabschiedete er sich hastig und stapfte ohne ein weiteres Wort in Richtung Inklusorium davon.
»Na, das würde mich aber wundern«, hörte er den Bettler noch murmeln.
Während er mit federnden Schritten den vom Regen der vorangegangenen Tage matschig gewordenen Pfad hinaufschritt, bestätigte ihm eine Gruppe entgegenkommender Frauen, was der Bettler bereits vermutet hatte: Die Sprechzeit der Inkluse war tatsächlich zu Ende. Dennoch wollte er es auf einen Versuch ankommen lassen und schritt weiter, was die Frauen mit einem spöttischen Achselzucken quittierten. Noch einen weiteren Tag der Ungewissheit würde er nur schwer ertragen können.
Als er auf dem Plateau ankam, rieselte erneut ein Graupelschauer vom Himmel; Windböen peitschten ihm die harten Körner gleich spitzen Nadeln ins Gesicht und rissen seinen Atem, der in Form weißer Schleier in die kalte Luft entwich, in tausend Fetzen.
Langsam umrundete er die schulterhohe Mauer, die das seltsame Bauwerk, das an die Kapelle anschloss, umgab. Das also war das winzige Reich der Inkluse Adelheid. Der Mann wusste, dass es nur noch ganz wenige von ihrer Sorte gab. Bestimmt war auch sie, weiß gekleidet und ein großes Holzkreuz tragend, einst im Rahmen einer feierlichen Zeremonie durch die kleine Pforte in die Behausung getreten, um diese ihr ganzes Leben lang nicht mehr zu verlassen. So zumindest dürfte sie es dem HERRN gelobt haben. Und zum Zeichen, dass sie willens war, sich fortan an dieses Versprechen zu halten, war die Pforte hinter ihr für alle Zeiten zugemauert worden.
Ein Schauer jagte über seinen Rücken, als er daran dachte.
Er trat durch einen Einlass in der Mauer und entdeckte in dem Anbau eine mit einem hölzernen Laden verschlossene Fensteröffnung. Das musste das Sprechfenster sein, das die Inkluse mit der Außenwelt verband. An diesem Fenster empfing sie ihre Besucher, und hier wurden ihr die für die Bedürfnisse des täglichen Lebens notwendigen Dinge hineingereicht. Er wusste, dass es auch auf der gegenüberliegenden Seite des Inklusoriums ein Fenster geben musste, das sich zum Innenraum der Kapelle hin öffnete, damit sie regelmäßig die Beichte und das Abendmahl empfangen konnte.
Entschlossen trat er an das Sprechfenster heran und spürte, wie trotz der empfindlichen Kälte mit einem Mal wieder jenes Gefühl der Hitze in ihm hochwallte.
Ob sie wohl den Laden nochmals öffnen würde?
Er hob die Rechte – ein kurzes Zögern, während die Hitze in ihm stärker wurde –, dann klopfte er vernehmlich gegen das Holz. Gleichzeitig krampfte sich die Linke, die er unter dem löchrigen Umhang verborgen hielt, um einen Gegenstand – den einzigen, den er aus seiner Vergangenheit gerettet hatte und auch das Einzige, was ihn mit dem Bild aus jenen fernen, weit zurückliegenden Tagen noch verband.
Außer der Erinnerung natürlich.
Und den Träumen, die ihn hin und wieder heimsuchten, um sie in ihm wachzuhalten.
»Lasst das Klopfen! Ich öffne nicht. Ihr kommt zur Unzeit. Diese Stunde gehört dem HERRN.« Die dunkle Stimme hinter dem Fensterladen klang sanft, aber abweisend.
»Verzeiht, ehrwürdige Meisterin, aber ich habe einen langen Weg hinter mich gebracht, nur um Euch zu sehen. Ich bitte Euch, öffnet«, bat der Scheinbettler mit heiserer Stimme.
»Nur um mich zu sehen, seid Ihr gekommen? Einen triftigeren Grund könnt Ihr nicht nennen? Nun, dann sage ich es umso deutlicher: Geht und kommt morgen wieder!«
»Bitte, ehrwürdige Mutter, es ist wichtig. Ich werde es Euch erklären. Aber ich kann es nur, wenn Ihr mir öffnet. Es geht …«
»Wollt Ihr den HERRN erzürnen?«, unterbrach ihn die Stimme hinter dem hölzernen Laden; sie klang jetzt schroff und ungehalten. »Ein jegliches hat seine Zeit. So steht es im Buch Ecclesiastes. Jetzt ist die Zeit des Gebets. Und nun geht endlich!«
Der Mann schloss erschöpft die Augen und lehnte seine Stirn an das Holz des Ladens. »Ich möchte weder den HERRN erzürnen noch Euch, ehrwürdige Meisterin«, sagte er geradezu flehentlich. »Ich möchte nur einen Augenblick Eure Hände sehen. Die Hände … denen eine hölzerne Puppe … ihre Seele verdankt.« Beim letzten Teil des Satzes versagte ihm schier die Stimme.
Schweigen antwortete ihm. Nichts schien sich hinter dem Laden zu regen.
Der Mann spürte, wie sein Herz schneller zu schlagen begann; gleich darauf verriet ein metallenes Schürfen, dass ein eiserner Riegel beiseitegeschoben wurde. Knarrend öffnete sich ein Flügel des Fensterladens, und der Besucher sah in das dämmrige, nur von einer Kerze spärlich erhellte Innere der Zelle Adelheids. Erst beim zweiten Hinsehen bemerkte er die Nonne, die seitlich des Fensters saß. Ein dunkler Schleier verhüllte das Gesicht der in das Habit der Benediktinerinnen gekleideten Frau.
»Wer seid Ihr? Was faselt Ihr von einer hölzernen Puppe?« Die Inkluse bemühte sich, ihre Stimme kühl und beherrscht klingen zu lassen, doch das Vibrieren, das darin lag, strafte die zur Schau gestellte Gelassenheit Lügen.
Der Mann überging die Frage.
»Bitte … ehrwürdige Mutter, wenn Ihr mir … Eure Hände zeigen würdet?«, flüsterte er nur.
Kurz zögerte Adelheid, dann legte sie beide Hände auf das verwitterte Fensterbrett, das vor Nässe glänzte.
Außer einem scharfen Atemlaut, der seine Lungen verließ, verriet nichts die Erregung des Mannes. In andächtigem Schweigen starrte er auf die Hände wie auf eine übernatürliche Offenbarung. Kein Zweifel, sie waren es. Hildegards Hände, die sich anscheinend schon seit Jahren, aus welchem Grund auch immer, Adelheid nannte. Hände allerdings, die manch anderer kaum also solche zu bezeichnen gewagt hätte. Beide Arme der Inkluse endeten jeweils in einem monströsen, von borstigen Haaren besetzten Fleischklumpen. Aus jedem ragten wie zum Hohn vier feingliedrige Finger. Mochten andere diese Hände auch als hässlich und verkrüppelt ansehen, für ihn waren sie der Inbegriff der Liebe und der Zärtlichkeit. Fürsorglich hatten sie ihn umhegt, als er noch ein kleiner Junge gewesen war. Immer wenn die über alles geliebte Mutter sich nicht um ihn kümmern konnte, waren diese Hände eingesprungen, hatten ihn liebkost und ihm das Essen zubereitet. Und wenn die Zeit nahte, da es ans Schlafen ging, hatten diese hässlichen, wunderbaren Hände sich um die seinen geschlossen, und das Mädchen, dem sie gehörten, hatte mit ihm zur Nacht gebetet. Danach hatte sie ihn behutsam zugedeckt, und er war eingeschlafen.
Auch die Puppe hatte sie für ihn geschnitzt. Die Puppe mit dem Lächeln auf den holzgemaserten Zügen. Im Alter von drei Jahren hatte er sie geschenkt bekommen. Von da an begleitete ihn dieses hölzerne Lächeln Tag für Tag, Monat um Monat, Jahreszeit um Jahreszeit, eine kurze glückliche Kindheit hindurch. War er guter Dinge, lächelte auch die Puppe fröhlich, weinte er, war ihr Lächeln traurig. So war es die ganze Zeit über gewesen.
Bis zu jener grauenvollen Nacht …
Der Mann hob den Kopf, Tränen rannen über sein Gesicht.
»Mein Gott, du lebst«, flüsterte er. »Und ich dachte, du seist tot.« In einer impulsiven Geste ergriff er die verkrüppelte Hand der Inkluse und küsste sie voller Zärtlichkeit.
Mit einem unartikulierten Laut des Erschreckens und einem kräftigen Ruck befreite sich die Nonne aus dem Griff ihres Besuchers.
»Wer bist … Wer seid Ihr?«, stieß sie hervor.
Abermals überging der Mann ihre Frage. Stattdessen zog er einen Gegenstand aus seinem Umhang und legte ihn behutsam auf das Fensterbrett – eine hölzerne Puppe, die mit starrem Lächeln und toten Augen in die Dämmernis der kargen Zelle blickte.
Ein Schrei entfuhr der Nonne. Hatte sie bis jetzt fast bewegungslos dagesessen, ließ der Anblick der Puppe sie von ihrem Hocker geradezu hochschnellen. Das verhüllte Haupt fuhr ruckartig nach vorne, beugte sich tief über das Fensterbrett, während die acht Finger ihrer verkrüppelten Hände sich zitternd um die Puppe schlossen.
»Oh, mein Gott, oh, ihr Heiligen, nein, das kann nicht sein«, flüsterte sie. Dann hob sie den Kopf, und trotz des dunklen Schleiers, der ihr Gesicht verbarg, wusste der Mann, der vor ihr stand, dass eine einzige große Frage in ihren Augen brannte.
Er nickte. »Doch, Hildegard, ich bin es. Und ich bin gekommen, dir zu erzählen, wie es mir in jener furchtbaren Nacht erging …«
Noch bevor er weitersprechen konnte, packte die Inkluse zu. Mit eisernem Griff schloss sich die verkrüppelte Hand um das linke Handgelenk ihres Besuchers, so fest, dass der Mann schmerzhaft das Gesicht verzog.
»Du brauchst es mir nicht zu erzählen, ich weiß es längst«, stieß Adelheid hervor.
»Du … Du weißt es?«
»Ja. Und ich wusste auch, dass du irgendwann kommen würdest. Du weißt, welche Aufgabe dich nun erwartet?«
Der Mann schluckte. »Ich … Ich weiß es. Aber ich möchte … dass du es mir sagst. Bitte, sag es mir!« Seine Stimme zitterte.
Ohne den Schleier zu lüften, führte die Inkluse die Hand des Mannes an ihre Lippen. »›Mein ist die Rache, spricht der HERR‹«, raunte sie voller Inbrunst. »Sei du sein Werkzeug!«
Tag 1 – Die Ankunft
DIE ANKUNFT
TAG 1 DIENSTAG, 9. JUNI ANNO DOMINI 1405 HERZOGTUM ÖSTERREICH BENEDIKTINERKLOSTER ENNSWALDEN
Kapitel 1Nach Vesper
Es war einer jener Junitage, die den würzigen Duft des frühen Sommers verströmten und, erfüllt mit mildem Licht und angenehmer Wärme, das Herz jedes Reisenden höherschlagen ließen. In der an der Enns gelegenen Abtei zu Ennswalden harrte man seit Tagen eines hochgelehrten Besuchers. Adrian von Bitterstedt, ein junger Benediktiner, doctor der Theologie und ein ausgewiesener Kenner des Altgriechischen, würde im Laufe dieser Woche eintreffen, so hatte die Botschaft gelautet. Aus Wien kommend, sollte er im Auftrag der dortigen Universität, allem voran der theologischen Fakultät, die kommenden Wochen zu einem Studium alter Schriften nutzen. Man sei auf Hinweise gestoßen, die nahelegten, dass im Bibliotheksbestand des Klosters ein fünftes Evangelium verborgen sei, eine apokryphe Schrift des Neuen Testaments, das den allerheiligsten Glauben verunglimpfe. Fiele es den Feinden der Kirche in die Hände, könnte es die Grundfesten des Christentums erschüttern.
Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die der junge Gelehrte wahrzunehmen gedachte und die der Abt gebeten wurde, nach Kräften zu unterstützen, hülfe sie doch in erhabener Weise, die Autorität der allein seligmachenden Kirche zu bewahren. Allerdings, so die Anweisung an Abt Florian, solle dieser gegenüber dem Konvent Verschwiegenheit an den Tag legen. Offiziell werde der Mönch aus Wien nicht nach einem blasphemischen fünften Evangelium, sondern nach Schriften forschen, die die »Erhabenheit des allerheiligsten katholischen Glaubens aufs Wunderbarste erstrahlen« ließen. Auch sei dem Gelehrten aus Wien nicht gestattet, den Inhalt der blasphemischen Schrift anderen zugänglich zu machen. Die Beschäftigung damit sei nur ihm selbst und dem Gehilfen gestattet, der ihm zur Seite stehen und in wenigen Tagen ebenfalls im Kloster eintreffen werde. Adrian von Bitterstedt sei unter Eid verpflichtet, sich eng an diese Vorgaben zu halten. So zumindest stand es in dem Brief, der den Besuch des Benediktiners ankündigte und mit dem Siegel der Universität zu Wien und einer honorablen Unterschrift versehen war: der des Nikolaus von Dinkelsbühl, Rektor der Universität, Mitglied des Domkapitels, Vertreter der Universität beim Heiligen Stuhl, Berater Herzog Albrechts V. von Habsburg und unerbittlicher Feind jeder häretischen Stimme, die sich gegen die Heilige Mutter Kirche erhob.
»Brav, mein Starker, bist ein feiner Kerl. Hast uns gut hierhergebracht.«
Der Rappe ließ ein leises Schnauben hören und nickte ein paarmal mit dem Kopf – fast als hätte er verstanden, was die sanfte, dunkle Stimme soeben gesagt hatte.
Die gepflegte Hand mit den feingliedrigen Fingern, die seinen Hals klopfte, entsprach ganz der hohen, schlanken Mönchsgestalt, die das Tier ritt. Schon früh am Morgen, kurz nach Prim, hatte der Reiter den letzten Teil seiner Reise angetreten, nachdem er die Nacht in einer Herberge bei Sandberg verbracht hatte. Nur zwei kürzere Pausen hatte er seitdem eingelegt. Mittlerweile auf einem Hügelkamm angekommen, hielt er inne und blickte nachdenklich auf die vom rosigen Dunst des frühen Abends umhüllten Mauern der Abtei zu Ennswalden. Am Ufer der Enns gelegen, in deren trägen Fluten sich das zarte Rosa spiegelte, bot das im Tal gelegene Kloster einen friedlichen und zugleich entrückten Anblick, der so gar nicht zu der Mission passen wollte, die er dort zu erfüllen hatte.
Was, wenn diese misslang? Der Blick des Reiters verschattete sich. Dann aber huschte ein entschlossenes Lächeln über seine Züge und verscheuchte den Hauch des Zweifels, der einen kurzen Moment in den dunklen Augen aufgeglommen war.
»Komm, packen wir’s an«, murmelte er zuversichtlich und lenkte den Rappen den Hügel hinab.
Nur wenig später langte er bei der Klosterpforte an und sprang aus dem Sattel.
In einem der beiden Torflügel öffnete sich eine winzige Luke. »Deus tecum, Bruder. Adrian von Bitterstedt aus Wien, wenn ich nicht irre, nicht wahr?«, grüßte ein feistes, aber freundliches Vollmondgesicht, das Bruder Firmin, dem Pförtner, gehörte.
Ein Lächeln antwortete ihm. Das Lächeln einer in das Habit eines Benediktiners gekleideten Frau von neunundzwanzig Jahren.
»Et cum spiritu tuo, Bruder«, erwiderte Adriana von Bronnen, legte die Rechte auf die Brust und verneigte sich.
Gleich darauf schwang der rechte der beiden Flügel auf und die in die Rolle eines Mönchs geschlüpfte Frau erschauerte leicht, bevor sie sich unwiderruflich anschickte, das wohl gefährlichste Abenteuer ihres Lebens zu bestehen.
Tag 2 – »Bruder Totenschädel«
»BRUDER TOTENSCHÄDEL«
TAG 2 MITTWOCH, 10. JUNI ANNO DOMINI 1405
Kapitel 2Nach Prim
»Clamat nobis scriptura divina, fratres dicens: ›Omnis qui se exaltat humiliabitur et qui se humiliat exaltabitur‹. – Laut ruft uns, Brüder, die Heilige Schrift zu: ›Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden.‹«
Der Mönch, der an diesem sonnigen Morgen zu Beginn der Kapitelversammlung mit der Lesung aus der Regula Benedicti beauftragt war, trachtete offenbar danach, seine Aufgabe so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Seine Stimme klang monoton; das Tempo, das er vorlegte, und die Tatsache, dass sein Blick des Öfteren gelangweilt zur Decke schweifte, ließ den Schluss zu, dass er den Text – es handelte sich um Kapitel sieben der Regel, betitelt »Die Demut« – schon so oft vorgetragen hatte, dass er ihn auswendig kannte.
Über Adrianas Züge huschte den Bruchteil eines Augenblicks ein spöttisches Lächeln. Vor zwei Tagen, auf dem Weg hierher, war sie einem Mönch aus dem Stift Melk begegnet, der sie davon in Kenntnis gesetzt hatte, dass es mit der klösterlichen Disziplin im Kloster zu Ennswalden nicht gerade zum Besten stehe. Florian I. Tampek, Abt des Klosters, lasse die Zügel in einem Maß schleifen, das schon fast skandalös anmuten müsse, hatte er ihr empört berichtet. Anscheinend hatte er nicht übertrieben. Nicht nur die gleichgültige Art, mit der sich der Vorleser seiner offenbar als lästig empfundenen Pflicht zu entledigen suchte, auch andere Seltsamkeiten schienen den abfälligen Kommentar des Melkers zu bestätigen.
Adriana musterte verstohlen die Runde der versammelten Mönche, die, wie sie selbst, auf steinernen Bänken längs der Wände des lang gestreckten Saales saßen. Offensichtlich folgten sie der Vorlesung mit dem gleichen Desinteresse, welches auch der Vorleser an den Tag legte. Die Hände im Schoß gefaltet und die Augen geschlossen, zogen die Worte an ihnen vorbei wie eine warme, einschläfernde Brise. Allerdings gab es auch solche, die ungeniert gähnten, zwei tuschelten gar miteinander, während ein weiterer, der im Schatten einer Säule saß – Adriana glaubte, ihren Augen nicht zu trauen –, irgendetwas aus den Tiefen seiner Kutte hervorkramte, es sich in den Mund schob und genüsslich darauf herumkaute.
Allein der Abt und ein anderer Mönch – der Subprior, wie sie später erfuhr, beide saßen nebeneinander auf Stühlen an der Stirnwand des Saales – schienen jene kontemplative Konzentration zu verraten, welche die geistige Versenkung in die Trinität ermöglicht und zur wahren Einheit mit ihr führt.
»Quae Dominus iam in operarium suum mundum a vitis et peccatis Spiritu Sancto dignabitur demonstrare. – Dies wird der HERR an seinem Arbeiter, der von Fehlern und Sünden rein wird, schon jetzt gütig durch den Heiligen Geist erweisen.«
Der letzte Vers des siebten Kapitels der Regula verklang; erleichtert verließ der Vorleser den Platz hinter dem Lesepult, um in den Kreis seiner auf den Steinbänken sitzenden Mitbrüder zurückzukehren. Auch aus deren Mienen sprach Erleichterung.
Nun war die Reihe an Abt Florian, die morgendliche Versammlung weiterzuführen. Er erhob sich; ein nur mittelgroßer, dafür aber mehr als wohlbeleibter Mittvierziger, dessen äußere Erscheinung – wären Kutte und Tonsur nicht gewesen – eher an einen Bauern denn an ein geistliches Oberhaupt erinnerte. Kurz gestutztes schwarzes Haupthaar rahmte die frisch rasierte Tonsur, während ungewöhnlich buschige Augenbrauen, die wie Gestrüpp aus der Stirn zu ragen schienen, über einem wässrig blauen Augenpaar wucherten. Eingebettet in ein feistwangiges bartloses Gesicht, schweiften sie Aufmerksamkeit heischend in die versammelte Runde.
»Bevor wir mit unserer Versammlung fortfahren, darf ich dem Kapitel unseren hochverehrten Gast vorstellen, der die nächsten Wochen bei uns weilen wird«, hob der Abt mit dünner Stimme an und heftete seinen Blick wohlwollend auf Adriana. »Bruder Adrian von Bitterstedt, Benediktiner wie wir, seines Zeichens doctor der Theologie und ein profunder Kenner der griechischen Sprache, ist zu uns gekommen. Allerdings nicht um Mitglied unseres Konvents zu werden, sondern in seiner Eigenschaft als Gelehrter. Er wird im Auftrag seiner bischöflichen Eminenz, des geschätzten Bischofs zu Passau Georg von Hohenlohe, sowie seiner Magnifizenz Nikolaus von Dinkelsbühl, Rektor der Universität zu Wien, Mitglied des Domkapitels zu St. Stephan und Berater unseres allergnädigsten Herzogs Albrecht, die alten Schriften, die bei uns lagern, in Augenschein nehmen und katalogisieren. Außerdem besitzt er Hinweise auf gewisse Dokumente, die verschollen sind, Schriften, die sich im Bestand unseres Klosters befinden sollen und welche die Erhabenheit unseres allerheiligsten katholischen Glaubens aufs Wunderbarste erstrahlen lassen könnten. Wir wissen diese Ehre zu schätzen. Seid herzlich willkommen, Bruder, in unserer Mitte.«
Der Abt nickte mit dem Kopf in Adrianas Richtung, die nun aufstand, um die freundlichen Willkommensworte zu erwidern. Sie legte die Hand auf die Brust und neigte grüßend das Haupt.
»Habt herzlichen Dank, Eure Erhabenheit«, entgegnete sie mit der ihr eigenen angenehmen Stimme, die an dunklen Samt erinnerte. »Auch ich weiß die Ehre zu schätzen, innerhalb der Mauern Eurer Abtei in den von Euch erwähnten Schriften nach dem forschen zu dürfen, was der Schreiber des Buches Proverbia kostbarer als denn Gold und Silber bezeichnet: die wahre Erkenntnis Gottes. Ich danke Euch für die Gastfreundschaft. Möge der HERR sie Euch vergelten.«
Adriana ließ sich nieder, hoffend, dass das mulmige Gefühl, das in ihr hochkroch, sich nicht in ihrer Miene spiegelte. Denn waren auch die Augen der meisten Anwesenden mit verständlicher Neugier auf sie gerichtet, glaubte sie doch, in dem einen oder anderen Blick unverhohlene Lüsternheit zu entdecken. Zwar war sie sicher, dass die anwesenden Mönche unter der Kutte, die sie trug, niemals den Körper einer Frau vermuteten. Andererseits wusste sie nur zu gut, dass auch ein junger Mann, so er ein hübsches Gesicht und eine anmutige Gestalt besaß, bei dem einen oder anderen seiner Geschlechtsgenossen sündhafte Triebe zu wecken vermochte. Sie beschloss, auf der Hut zu sein.
»Kommen wir nun zu einer Angelegenheit, die uns schon seit einiger Zeit Sorgen bereitet«, fuhr Abt Florian fort.
Er entrollte ein Pergament, an dem ein schweres Siegel hing, und runzelte die Stirn. »Ihr wisst, verehrte Brüder, dass wir unseren Landesherrn schon mehrfach darum baten, uns von der Bürde der uneingeschränkten Gastpflicht zu befreien – wenigstens während der Jagdzeiten. Dies Ersuchen wurde gestellt in Anbetracht der Ritter und anderer edler Herren sowie der landesfürstlichen Jäger, die besonders während der herbstlichen Jagden glauben, die Gastpflicht unserer Abtei in schamloser Weise ausnutzen zu dürfen. Damit lastet eine schwere Bürde auf unserem Kloster. Denn es sind ja nicht nur die Herren, die bewirtet werden wollen, sondern auch die Jagdgehilfen und die Knechte und die Tiere. In dem Schreiben, dass wir dem Herzog sandten, erinnerten wir daran, dass der Vorgänger seiner Durchlaucht Albrechts IV., Albrecht III., Anno Domini 1380 schon einmal eine für das Kloster günstige Entscheidung traf; der HERR möge seiner dafür gedenken. Inzwischen ist die Antwort eingetroffen.« Seine Stimme war immer dünner geworden.
Nun warf der Abt einen kurzen Blick auf das Pergament in seinen Händen und legte eine Pause ein.
»Unser allergnädigster Herzog …«, dem Abt versagte fast die Stimme, »hat die Gastpflicht … unseres Klosters … leider bestätigt.« Er ließ einen tiefen Seufzer hören.
Empörtes Gemurmel erhob sich. Die Entscheidung des Landesherrn war offenbar ein schwerer Schlag für den Konvent.
Der Abt hob beide Arme. »Silentium, bewahrt die Ruhe, Brüder«, beendete er das erregte Raunen. Dann fuhr er fort: »Ich habe mich entschlossen, um oberhirtliche Hilfe bei seiner Eminenz, unserem Bischof in Passau, nachzusuchen. Ich werde Bruder Engelbert, unseren Prior, zu ihm senden, sobald er von seiner Wienreise heimgekehrt ist. Sollte Bruder Engelbert allerdings nichts ausrichten können«, der Abt legte eine erneute Pause ein, »nun … Ich brauche Euch nicht zu sagen, was dies bedeuten würde. Der Gewinn, den die Abtei erwirtschaftet, dürfte beträchtlich schmaler ausfallen. Die geplanten baulichen Maßnahmen, etwa eine neue Wärmestube, ein neues Badhaus sowie die neuen Bänke für das Refektorium oder die längst erforderliche Neuausstattung der Zellen und des Dormitoriums müssten wohl noch eine Weile warten. Ich hoffe, wenigstens die … hrrmm«, der Abt ließ ein Räuspern hören und sandte einen verlegenen Blick zu Adriana, »die kleinen Veränderungen der Speiseregel zur Stärkung des Leibes … und der Seele … aufrechterhalten zu können; ist doch der Leib die Wohnstatt des Geistes, mittels dessen wir den HERRN loben und preisen. ›Mens sana in corpore sano – In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist‹, ruft uns die Schrift zu. Also suchen wir dem Ratschlag des Höchsten zu folgen, indem wir dem Leib geben, was er benötigt, um seiner erhabenen Aufgabe gerecht zu werden.«
Wieder sandte der Abt einen Blick zu Adriana, die sich Mühe geben musste, ernst zu bleiben. Sie wusste sehr wohl, dass der letzte Teil seiner Ansprache indirekt an sie gerichtet war. Die Worte sollten sie auf das vorbereiten, was sie spätestens zur Sext im Refektorium zu sehen bekommen würde – einen reich gedeckten Tisch, der so ganz im Gegensatz stand zu dem bescheidenen Mahl, mit dem sich die Jünger des Heiligen Benedikt gemäß der Regel normalerweise zu begnügen hatten. Der Mönch aus Melk hatte sie davon unterrichtet, dass sich die Tafel des Speisesaals in Ennswalden nicht selten bog unter der Last eines überreichen Angebots an Speisen. Des Öfteren werde sogar an ganz normalen Tagen das Fleisch von Vierfüßlern gereicht, und dies nicht nur den Gästen oder den Schwachen und Kranken, wie es die Regel vorschrieb. Nein, der gesamte Konvent huldige der Völlerei, so der empörte Benediktiner aus Melk. Allerdings hatte sich Adriana nicht des Eindrucks erwehren können, dass in seinen Worten ein beträchtliches Maß an Neid mitschwang. Doch dass der Abt den aus dem Zusammenhang gerissenen Satz des römischen Schriftstellers Juvenal vom gesunden Körper, in dem ein gesunder Geist wohne, als eine Empfehlung der Heiligen Schrift ausgab, setzte dem Ganzen die Krone auf; mit der Bibelfestigkeit des Mannes war es anscheinend nicht weit her.
»Das Wort hat nun Bruder Hartwig, der Subprior. Er wird die Versammlung weiterführen und die notwendigen Arbeitszuteilungen vornehmen. Bruder Cellerar«, er wandte sich an einen Mönch mittleren Alters, »vergiss nicht, den neu angekommenen Laienbrüdern und Knechten die notwendigen Anweisungen zu erteilen. In den nächsten Tagen werden einige Tagelöhner dazukommen.« An Adriana gewandt, fuhr er fort: »Es war mir eine Ehre, Bruder Adrian, Euch dem versammelten Kapitel vorzustellen. Der weitere Verlauf der Versammlung würde Euch nur langweilen. Ich weiß, dass Ihr voller Begierde darauf wartet, Eure Arbeit beginnen zu können. Bruder Markward, unser Armarius, und ich werden Euch nun die Bibliothek und das Skriptorium zeigen. Wenn Ihr uns folgen wollt.«
Adriana sah sich aus ihren Gedanken jäh herausgerissen und erhob sich. Als sie den Mönch bemerkte, der an die Seite des Abtes getreten war, erschrak sie. Er war einer derjenigen, die sie während ihrer Dankesrede mit unverhohlen lüsternen Blicken gemustert hatte. Seine Gestalt bildete einen geradezu diametralen Gegensatz zu der des Abtes. Groß und hager, hatte ihn die Natur mit einem beängstigend mageren, hohlwangigen Gesicht ausgestattet, das unwillkürlich an einen mit Haut überzogenen Totenschädel erinnerte. Dominiert wurde dieses seltsame Antlitz von einer mächtigen Nase, die dem Schnabel eines Geiers glich und den darunter befindlichen schmallippigen Mund lediglich ein Schattendasein fristen ließ. In tiefen Höhlen verborgen, lauerte ein intensiv grünes Augenpaar, dem ein Blick entströmte, in dem eine alles verzehrende Leidenschaft lag, die umso bedrohlicher wirkte, je länger man ihm ausgesetzt war.
Adriana fröstelte. Dieser »Bruder Totenschädel« also war der Bibliothekar, mit dem sie in den folgenden Wochen zusammenarbeiten musste?
Sie beschloss erneut, auf der Hut zu sein.
Tag 3 – Nachtgedanken
NACHTGEDANKEN
TAG 3 DONNERSTAG, 11. JUNI ANNO DOMINI 1405
Kapitel 3Matutin
Bleich und schwer hing der Mond am schwarzblauen Nachthimmel und tauchte Adrianas Zelle in weiches Licht. Sie war im Westflügel des den Kreuzgang umschließenden Gebäudekomplexes untergebracht. Genauer gesagt in einer Zelle im zweiten Obergeschoss des Gästetraktes, der von Klerikern und Mönchen, die auf der Durchreise waren, bewohnt wurde. Das Fenster öffnete sich zum Kreuzgang hin. Die Mehrheit der Angehörigen des Ennswaldener Konvents verbrachte die Nacht im Ostflügel des zur Klausur gehörenden Klosterbereichs. Dort befand sich im ersten Obergeschoss der gemeinsame Schlafsaal, das Dormitorium. Nur wenige besaßen das Privileg, eigene Zellen in dem darüber gelegenen Stockwerk zu bewohnen.
Die Hände hinter dem Kopf verschränkt, ruhte Adriana auf der frisch hergerichteten Bettstatt und starrte durch das vergitterte Fenster hindurch zum bestirnten Himmel.
Wie in Wien, dachte sie und erinnerte sich an die unzähligen Nächte, die sie mit Vorliebe für ihre Studien genutzt hatte. Wie oft hatte der Mond ihr dabei zugesehen, wenn sie, am Fenster vor ihrem Schreibtisch sitzend, im Licht einer Öllampe über Büchern und Schriften grübelte und schrieb.
Der Mond, dein Freund, ging es ihr durch den Kopf, der Gedanke ließ sie versonnen lächeln. Oh ja, der Mensch brauchte Freunde. Freunde, auf die man sich verlassen konnte und die mit einem durch dick und dünn gingen. Ein Gefühl von Wärme breitete sich in ihr aus, als sie daran dachte, dass sie das Glück hatte, solche Freunde zu haben. Albert von Kanten, einer der Professoren an der Universität zu Wien, ein scharfsinniger Theologe und exzellenter Kenner alter Sprachen, war einer von ihnen, vielleicht der beste und großzügigste von allen. Ihm hatte sie ein Privileg zu verdanken, das, wenn überhaupt, nur wenigen Frauen vergönnt war: Wissen. Doch ihn würde sie erst in einigen Wochen wiedersehen, ein Gedanke, der sie mit Wehmut erfüllte. Über die vielen Jahre hinweg war er ihr Mentor gewesen und schließlich so etwas wie ein zweiter Vater für sie geworden.
Weit davon entfernt, eine Frau nach gängigem Maßstab zu beurteilen, war er schon immer ein Mann mit außergewöhnlichem Weitblick gewesen. Die Vorstellungen jener Kirchenlehrer, die das Weib als minderbemittelt und unter dem Manne stehend betrachteten, hatte er stets weit von sich gewiesen. Und so war es nur folgerichtig, dass er Adriana seinerzeit geholfen hatte, die kühne Idee zu verwirklichen, in die Identität eines jungen Burschen zu schlüpfen, um das Studium der sieben freien Künste an der artistischen Fakultät der Universität zu Wien aufnehmen zu können. Anfangs noch als gut bezahlter Privatlehrer vom Vater Adrianas engagiert – die von Bronnens stammten aus einem gut betuchten alteingesessenen Adelsgeschlecht und waren erfolgreiche Kaufleute –, hatte er schnell ihren scharfen Verstand erkannt und nach Kräften gefördert. Vor allem das Studium des Altgriechischen, das sie weiterhin privatim bei Albert absolvierte, hatte sie fasziniert; ihre Fortschritte auf diesem Gebiet waren atemberaubend gewesen.
Dann aber hatte ihr Leben eine schicksalhafte Wendung genommen. Ihr Vater, Harald von Bronnen, wurde Opfer der intriganten Machenschaften seines Vetters Richard, der dem Hof zu Wien nahestand und in Harald einen Konkurrenten um den Posten eines kaiserlichen Beraters witterte. Enge Beziehungen Richards zu hohen klerikalen Kreisen hatten dazu geführt, dass Harald von Bronnen wegen angeblicher ketzerischer Umtriebe von einem Inquisitionstribunal zu einer langjährigen Kerkerhaft verurteilt wurde. Nur zwei Monate nach seiner Verurteilung war er im Kerker verstorben. Man munkelte, er habe seinem Leben mit einem Schierlingsgebräu selbst ein Ende gesetzt.
Es war die bis dahin verstörendste Erfahrung in Adrianas Leben, die mit dem Tod des Vaters zur Vollwaise geworden war. Ihre Mutter war Jahre zuvor nach der Geburt von Zwillingen im Kindbett gestorben, die Zwillinge nur eine Woche später. In die tiefe Trauer Adrianas über den Verlust des Vaters mischte sich von Anfang an abgrundtiefer Hass auf die Inquisition. Von einem Tag auf den anderen völlig auf sich allein gestellt, hatte sie damals mit dem Gedanken gespielt, sich ebenfalls das Leben zu nehmen. Albert von Kanten war es rechtzeitig gelungen, sie davon abzuhalten. Bei ihm fand sie schließlich dauerhaft Halt und Zuflucht. Er nahm sie in seinen Haushalt auf, förderte sie weiter nach Kräften und gewährte ihr eine Anstellung als private Gehilfin. Niemand ahnte, dass viele Vorlesungen, die er an der Universität hielt, aus Adrianas Feder stammten oder zumindest in Teilen von ihr vorbereitet wurden.
Und noch etwas gab es, was sie ihm verdankte. Ein klares Verständnis über die wahre Natur Gottes. Ein Verständnis allerdings, welches die Kirche als zutiefst häretisch einstufen musste. Es gab keine Dreiheit in der Gottheit; Gott war nur einer, Christus, sein eingeborener Sohn, hatte einen Anfang, war eine Schöpfung des Vaters und damit nicht, wie der Vater selbst, von Ewigkeit zu Ewigkeit und ihm somit keineswegs gleich.
Vor zwei Jahren war es gewesen, als Albert sie in seine diesbezüglichen Ansichten eingeweiht hatte. An einem kalten Februarabend, als sie zu vorgerückter Stunde vor dem wärmenden Kaminfeuer in seinem Studierzimmer saßen und beim Schein einer Öllampe ein Problem der Übersetzung aus dem Griechischen diskutierten – den ersten Vers aus dem Johannesevangelium. Er hatte in der vor ihm liegenden Bibel geblättert und noch einen anderen Vers zitiert. Sie erinnerte sich noch gut an das Gespräch, das dann folgte.
»›… der Vater ist größer als ich‹. Weißt du, was diese Worte unseres Herrn Jesus Christus in Wirklichkeit bedeuten, meine Tochter?«, fragte er sie, um gleich darauf selbst die Antwort zu geben. »Unsere Kirche hat eine große Lüge zur Wahrheit erklärt.«
Entsetzt, ja zu Tode erschrocken sah sie ihn an.
»Die Kirche … lügt?«
Albert nickte. »Ja, das tut sie. Indem sie Dinge lehrt, die von der Wahrheit so weit entfernt sind wie der Mond von der Erde!«
»Wie meint Ihr das?«
»So, wie ich es sage. Wenn Christus sagt: ›Der Vater ist größer als ich‹, wie kann er, der Sohn, dem Vater dann gleich sein? Oder nimm ein anderes Beispiel aus dem Evangelium des Matthäus: ›Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater.‹ Warum weiß der Sohn es nicht, wenn er mit dem Vater doch wesensgleich ist, wie es das Dogma von der Trinität uns weismachen will?«
»Ihr … Ihr glaubt also, dass die Lehre von der trinitas eine Lüge ist? Mein Gott!«
»Nun, entweder lügt die Schrift oder die Kirche, meine Tochter. Denk an den ersten Teil deines Studiums zurück. Was hast du da gelernt?«
»Im trivium?«
»Im trivium.« Er nickte. »Logik und Dialektik standen auf dem Lehrplan. Was sagt dir die Logik? Kann beides stimmen? Wenn der Sohn sagt, der Vater wisse mehr als er; wenn er sagt, dass der Vater größer sei als er – wie kann es dann sein, dass die Kirche behauptet, dass Vater und Sohn wesensgleich und eine Person seien? Wer also hat recht? Die Kirche? Die Heilige Schrift? Oder etwa beide?«
»Darüber … habe ich noch nie nachgedacht.«
»Aber wenn du es tust, wozu drängt dich die Logik?«
Adriana spürte, wie die Diskussion mit Albert ihr zunehmend Unbehagen bereitete, zugleich fühlte sie sich auf seltsame Weise erregt – ihr war, als ob sich tief in ihrem Inneren ein Schleier, der über etwas Großem, Erhabenem lag, zu heben begann. Ein Schleier, der dieses Große, Erhabene bis zu diesem Zeitpunkt diffus und konturlos hatte erscheinen lassen. Und doch – war das, was sie hier gerade erörterten, nicht Häresie?
Albert bemerkte ihre Unsicherheit. Er beugte sich über den Tisch und legte sanft seine Hand auf ihren Unterarm.
»Weise den Gedanken nicht von dir, meine Tochter, sosehr er dich auch momentan erschreckt«, bat er leise. »Denk darüber nach und erkenne die Wahrheit. Und sei gewiss, sie wird dich frei machen.«
»Frei machen? Wovon?«
»Von der Vorstellung einer mythischen und geheimnisvollen Dreifaltigkeit, die nichts mit dem Gott zu tun hat, wie die Heilige Schrift ihn uns offenbart. Der Vater, wie ihn der Sohn offenbarte, als er auf der Erde weilte, ist kein geheimnisvoller Gott, der sich hinter einer dreigeteilten Maske verbirgt. Wie sollten wir Vertrauen zu ihm fassen, wenn er uns nicht offen und unverhüllt sein wahres Antlitz zeigte?«
Es war dieser Moment, an den sie sich den Rest ihres Lebens erinnern sollte, ein lichterfüllter Augenblick des Erkennens, in dem der Schleier in ihr zerriss – und doch gab es da etwas in ihr, das sich gegen dieses Erkennen sträubte.
»Aber wie kann es sein, dass die Kirche etwas lehrt, was nicht der Wahrheit entspricht? Sie, die Hüterin des wahren Glaubens! Damit wäre sie doch selbst ein Hort der Häresie.«
Albert nickte. »Ich merke, es fällt dir schwer, dies zu akzeptieren, meine Tochter, auch mir ging es so. Ich habe lange gebraucht, um zu begreifen. Aber je mehr ich forschte, je intensiver ich das Studium alter Dokumente vorantrieb, desto mehr verdichtete sich in mir die Erkenntnis, dass vieles von dem, was die Kirche lehrt, nicht das ist, was wir in den heiligen Schriften finden.«
»Ihr sprecht vom Studium alter Dokumente? Was meint Ihr damit?«
Er ging zu einer Truhe, die unter dem Fenster stand, klappte den Deckel zurück und holte mehrere beschriebene Pergamentbögen hervor, die er auf dem Tisch ausbreitete.
»Das hier ist die Abschrift eines Schreibens Papst Nikolaus IV. aus dem Jahr 1291. Es fußt auf einem Auszug aus dem Liber Extra, der Dekretalensammlung von Gregor IX., und enthält einen Hinweis auf die Passagini, eine von der Kirche als Häretiker angesehene Gruppierung, von der wir nicht viel wissen. Unter anderem vertraten sie die Ansicht, dass es keine biblischen Beweise für eine Trinität gibt. Ich war überrascht, davon zu erfahren, denn ich dachte, dass die letzten Zweifel an diesem Dogma schon vor vielen Jahrhunderten verstummt seien. Was ich las, gab den Anstoß, mich eingehend mit dem Konzil zu Nizäa Anno Domini 325 zu beschäftigen; mit dem Streit zwischen dem Presbyter Arius auf der einen und Alexander, dem Patriarchen von Alexandria, auf der anderen Seite. Dessen Begleiter, der Erzdiakon Athanasius von Alexandria, tat sich durch besonderen Eifer gegen Arius hervor und erwies sich im Verlauf des Konzils als Hauptverfechter der Lehre, gemäß der Jesus Christus als Sohn Gottes und logos mit Gottvater wesensgleich sei. Arius vertrat die Ansicht, dass es keine Wesensgleichheit zwischen dem Vater und dem Sohn geben könne, für ihn war der Sohn nur wesensähnlich. Beachte den Unterschied, meine Tochter!«
»Mit anderen Worten: Sind der Vater und der Sohn eine Person, oder sind sie getrennt voneinander als zwei Personen anzusehen?«
»Du sagst es.«
»Wie ging der Streit aus? Und wer fällte die Entscheidung?«
»Wer die Entscheidung fällte? Man mag es nicht glauben, ein Heide!«, schnaubte Albert, seine Stimme zitterte vor Empörung.
»Ein Heide?«
»Konstantin, der römische Kaiser und Pontifex maximus, der zum Konzil geladen hatte, weil er fürchtete, dass der Streit der Christen dem Reich schaden könnte. Er entschied zugunsten des Athanasius. Auf diesem Konzil, meine Tochter«, er hob den Finger, »wurde die Saat für die ketzerischste aller Lehren gelegt – die Lehre von der Wesensgleichheit Gottes, des Vaters, und Jesu, des Sohnes, die Grundlage für das spätere Dogma der Dreifaltigkeit. Danach dominierten abwechselnd die Lehre des Arius, dann wieder die des Athanasius die Kirche. Bis schließlich auf dem Konzil zu Konstantinopel Anno Domini 381 das Glaubensbekenntnis beschlossen wurde, wie es heute noch in der Kirche zu finden ist. Zugleich wurde festgeschrieben, dass auch der Heilige Geist eine Person und dem Sohn und dem Vater ebenbürtig sei und nicht, wie die Heilige Schrift es lehrt, die Kraft Gottes, und so fügte man dem häretischen Gedanken einen weiteren hinzu.«
»Verzeiht, das ist … Das ist … ein bisschen viel auf einmal. Zuerst sagt Ihr, Christus sei nicht wesensgleich mit dem Vater, er sei nicht Gott, dann sagt Ihr, dass auch der Heilige Geist keine Person, sondern lediglich Gottes Kraft sei – ich … ich …« Sie verstummte. Der helle Lichtschein, der ihr Inneres einen kurzen Moment erfüllt hatte, schien erloschen.
Albert sah sie eine Weile nur schweigend an. Er wirkte aufgewühlt. Mit einem Ruck erhob er sich vom Stuhl, ging zum Fenster und öffnete es. Ein schneidend kalter Lufthauch strömte herein und ließ das Feuer im Kamin unruhig flackern. Der Wind hatte sich gelegt, es schneite; Wege, Gassen und Dächer glitzerten weiß im bläulichen Schimmer der Nacht. Er atmete mehrere Male tief durch, schloss das Fenster und setzte sich wieder.
»Manchmal muss man das Undenkbare denken, um der Wahrheit auf den Grund zu kommen, auch wenn es ein Wagnis ist, meine Tochter«, fuhr er schließlich fort. »Sich aufzulehnen gegen das Festgefügte, das scheinbar Unerschütterliche, kann Bollwerke zum Wanken bringen. Fische, die gegen den Strom schwimmen, tun sich schwer, das ist wahr, aber sie haben einen Vorteil: Sie gelangen zur Quelle.«
Es war dieser letzte Satz, der Adriana faszinierte; weshalb, vermochte sie zunächst nicht zu sagen.
Helles Glockengeläut und das verhaltene Klatschen Dutzender Sandalen drangen durch das zum Kreuzgang gelegene Fenster und rissen Adriana aus ihren Gedanken. Sie drehte sich zum Fenster und stellte sich auf die Zehenspitzen. Durch das Gitter blickte sie auf das vom Mondlicht erhellte, von offenen Arkadengängen umschlossene Kreuzgangsgeviert hinab. Kurz darauf sah sie, wie dunkle Schatten den Wandelgang entlangschritten. Die Mönche gingen zur Kirche, die im Norden an den Kreuzgang anschloss.
Bald danach erhob sich der erste der von feierlichem Ernst getragenen Choräle, ein Vielklang von Stimmen, der zu einer einzigen, die dreieinige Gottheit lobenden Hymne anschwoll, das Kircheninnere verließ und sich mit dem Dunkel der Nacht und dem Licht des Mondes verwob.
Ein kalter Hauch drang in die Zelle und ließ Adriana erschauern. Mit einem Mal schoss eine Welle kalter Angst in ihr hoch. Erste Zweifel nagten an ihr. Hatte sie sich überschätzt, als sie sich erboten hatte, die Mission in Ennswalden zu übernehmen? Fehlte es ihr an der nötigen Demut? War das, was zu tun sie im Begriff stand, tatsächlich im Sinne des HERRN und dem aufrichtigen Interesse an der Wiederherstellung der unverfälschten Lehre geschuldet? Oder nur der maßlosen Eitelkeit eines ehrgeizigen Egos?
Adriana seufzte, sie beschloss, endlich zu schlafen. Fröstelnd faltete sie eine Decke aus grober Wolle auseinander, legte sich nieder und wickelte sich hinein. Bald würde die Dämmerung heraufziehen, helles Tageslicht würde folgen und Kälte und Düsternis aus der Zelle vertreiben.
Und, so Gott es wollte, auch die Zweifel und das Bangen aus ihrer Seele.
Tag 4 – Bruder Gallus
BRUDER GALLUS
TAG 4 FREITAG, 12. JUNI ANNO DOMINI 1405
Kapitel 4Nach Komplet
Seit Beginn der Dämmerung rastete der Mönch nun schon am Ufer der Enns und fasste sich in Geduld. Sein Habit – braune Kutte, weißes Zingulum – wies ihn als Angehörigen des Franziskanerordens aus. Am Fuß einer Felsbarriere, die schroff in die Höhe wuchs, saß er auf einem Baumstumpf neben einer Trauerweide, kaute nachdenklich auf einem Schilfstängel herum und warf hin und wieder Steinchen in die gemächlich dahinströmenden Fluten. In regelmäßigen Abständen nahmen seine scharfen Augen den baufälligen Turm in den Blick, der sich etwa eine halbe Wegstunde entfernt auf einer bewaldeten Anhöhe erhob. Schwarz und abweisend, fast drohend stach seine Kontur in den immer dunkler werdenden Abendhimmel. Das marode Gemäuer dort oben war sein eigentliches Ziel.
»Na, mein Alter, was meinst du – ob du den steilen Pfad da hoch durch den Wald noch hinbekommst?«
Der in die Jahre gekommene Schimmelhengst, den der Mönch an der Trauerweide festgemacht hatte, nickte mit dem Kopf und schnaubte.
»Dann ist es ja gut.« Der Mann lachte leise, liebevoll strich er dem Tier über die Nüstern.
Er legte den Kopf in den Nacken und sah nach oben. Als er hier angekommen war, stand der Mond nur als verwaschener heller Fleck am Himmel. Inzwischen hatte er sich zu einer respektablen runden Scheibe gemausert, die silbern glänzte. Sein kaltes Leuchten würde zunehmen, je weiter der Abend in Richtung Mitternacht voranschritt. Gut so, dachte der Mönch und nickte zufrieden. Das Licht würde ausreichen, um das, was zu tun war, problemlos verrichten zu können. Kein Fackelschein würde sein Kommen dem, der dort oben sein Dasein fristete, verraten. Er würde ihn überraschen.
Das Knurren seines Magens erinnerte den Franziskaner daran, dass er seit den frühen Morgenstunden nichts mehr gegessen hatte. Er erhob sich, öffnete die Satteltasche und entnahm ihr einen Kanten Brot sowie ein Stück Speck, die er genüsslich verspeiste. Um seinen Durst zu stillen, ließ er sich am Flussufer nieder und schöpfte mit der hohlen Hand Wasser, das er in gierigen Schlucken trank. Solcherart gestärkt, machte er sich auf den Weg zu seinem Ziel.
Der Pfad durch den Wald zur Anhöhe hinauf gestaltete sich schwieriger als gedacht. Er war durch ein heftiges Gewitter, das sich am Morgen über der Gegend ausgetobt hatte, teilweise morastig geworden. Auch vom Sturm heruntergeschlagene Äste und Blattwerk sowie armdicke, rutschige Wurzeln erschwerten das Vorwärtskommen. Wie die Tentakel eines Meeresungeheuers versperrten sie den matschigen Weg. Anfangs noch trug das Pferd seinen Reiter ein kurzes Stück, aber dann, als der Pfad steiler und beschwerlicher wurde, stieg er ab und ging, den Schimmel hinter sich herführend, zu Fuß weiter.
Als er die Steigung größtenteils überwunden hatte und sich der Kuppe der Anhöhe näherte, atmete der Franziskaner auf. Zwischen den Stämmen hindurchsehend, bemerkte er, dass sie nahezu baumfrei war: ein weitläufiges, flaches Areal, teils mit niedrigem Strauchwerk, Flechten und hohem Gras bestanden, hie und da trat nackter Fels zutage. Haufen von Steintrümmern kündeten davon, dass hier einst eine befestigte Anlage existiert hatte, die schon vor Jahrzehnten aufgegeben worden und dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen war. Lediglich der hoch aufragende zinnenbewehrte Turm hatte dem Zerfall bis zu einem gewissen Grad getrotzt, wenngleich auch sein Gemäuer einen maroden Eindruck erweckte. Auch wenn er von hier aus noch längst nicht alles im Blick hatte, wusste der Mönch, dass ein breiter, tiefer Graben um den Turm herumführte. Bei dem Gedanken, was er beherbergte, rann ihm ein Schauer über den Rücken.
Vorsichtig schritt er weiter und hatte bald den Rand des Waldes erreicht, dessen dicht an dicht stehende Bäume ihm bis jetzt vollkommenen Sichtschutz gewährt hatten. Im hellen Licht des Mondes präsentierten sich ihm weitere Einzelheiten. Der Graben, der kreisförmig um den Turm lief. Der schmale, zweigeteilte Steg, der über ihn hinwegführte und über den man das Areal erreichte, auf dem der Turm stand. Die toten Augen gleichenden schwarzen Löcher im oberen Bereich des Gemäuers. Und die aus dicken Bohlen grob zusammengehauene Tür im Sockelbereich, die verriet, dass hier jemand hauste, den er gleich anzutreffen hoffte: Bruder Gallus, der Eremit mit dem hölzernen Bein. Der »Gebieter der Wölfe« oder der »Herr der Wolfsklause«, wie ihn die Bewohner der umliegenden Höfe auch nannten.