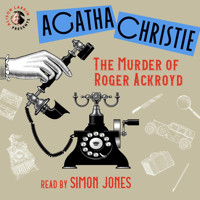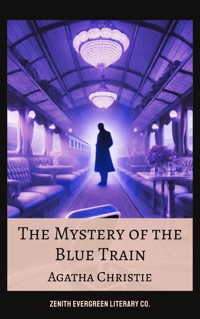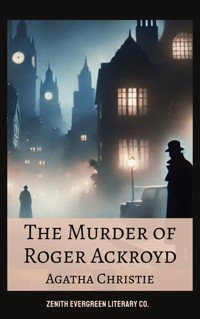9,99 €
Mehr erfahren.
Auf dem Flug über den Ärmelkanal hat Hercule Poirot alle Zeit, seine zehn Mitreisenden und das Bordpersonal in Augenschein zu nehmen. Als aber die schwerreiche Marie Morisot vergiftet in ihrem Sitz aufgefunden wird, muss er seine kleinen grauen Zellen bemühen, um dem Mörder auf die Schliche zu kommen. Denn an Verdächtigen mangelt es nicht, und je näher der Flug seinem Ziel kommt, desto schneller läuft Poirot die Zeit davon.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Agatha Christie
Tod in den Wolken
Ein Fall für Poirot
Aus dem Englischen von Sabine Herting
Atlantik
Für Ormond Beadle
Passagiere
Sitzplan
Nr. 2 Madame Giselle
Nr. 4 James Ryder
Nr. 5 Monsieur Armand Dupont
Nr. 6 Monsieur Jean Dupont
Nr. 8 Daniel Clancy
Nr. 9 Hercule Poirot
Nr. 10 Doktor Bryant
Nr. 12 Norman Gale
Nr. 13 Lady Horbury
Nr. 16 Jane Grey
Nr. 17 Die Ehrenwerte Venetia Kerr
1Von Paris nach Croydon
Die Septembersonne brannte heiß auf den Flughafen Le Bourget, als die Passagiere über das Rollfeld liefen und in die Prometheus stiegen, die in Kürze nach Croydon abheben sollte.
Jane Grey stieg als eine der Letzten ein und setzte sich auf ihren Platz, Nr. 16. Einige Fluggäste waren bereits durch die Tür zum vorderen Bereich, vorbei an der winzigen Pantry-Küche und den zwei Toiletten, gegangen. Die meisten saßen schon. Auf der anderen Seite des Mittelgangs wurde angeregt geplaudert – eine schrille, hohe Frauenstimme stach laut hervor. Janes Lippen kräuselten sich leicht. Sie kannte diesen speziellen Tonfall sehr gut.
»Meine Liebe … ist ja großartig … keine Ahnung. Wo, sagten Sie? Juan-les-Pins? Oh, ja. Nein … Le Pinet. Ja, genau dieselben alten Bekannten … Aber selbstverständlich, setzen Sie sich doch zu mir. Oh, können wir nicht? Wer …? Oh, ich verstehe …«
Und dann eine männliche Stimme, mit ausländischem Akzent und äußerst höflich: »… mit dem allergrößten Vergnügen, Madame.«
Jane schielte aus den Augenwinkeln hinüber.
Ein kleiner älterer Herr mit prächtigem Schnauzbart und eiförmigem Kopf stand höflich auf und raffte auf Janes Höhe jenseits des Gangs seine Habseligkeiten zusammen.
Jane drehte leicht den Kopf und erhaschte einen Blick auf die beiden Frauen, deren unerwartetes Zusammentreffen diese galante Geste des Fremden ausgelöst hatte. Die Erwähnung von Le Pinet hatte Jane neugierig gemacht, denn auch sie war in Le Pinet gewesen.
An eine der Frauen erinnerte sie sich bestens – sie hatte sie erst kürzlich gesehen, am Bakkarat-Tisch, immerzu hatten sich ihre kleinen Hände zu Fäusten geballt und wieder geöffnet; ihr zartes, puppenhaft geschminktes Gesicht war abwechselnd rot und blass geworden. Mit ein bisschen Anstrengung, dachte Jane, könnte mir ihr Name einfallen. Eine Freundin hatte ihn erwähnt, sie hatte gesagt: »Eine Adelige, aber keine richtige … früher war sie Revuetänzerin oder so etwas Ähnliches.«
Tiefe Verachtung in der Stimme der Freundin. Es war Maisie gewesen, die einen erstklassigen Job als Masseurin hatte, bei dem sie Fleisch »wegknetete«. Die andere Frau, dachte Jane flüchtig, das ist eine »richtige«. So eine pferdenärrische Landadelige, dachte Jane und vergaß umgehend die beiden Frauen, da sie nun aufmerksam zum Fenster hinaus auf den Flughafen Le Bourget spähte. Verschiedene andere Flugzeuge standen da. Eines sah aus wie ein großer metallischer Tausendfüßler.
Keinesfalls wollte sie direkt geradeaus schauen, auf den Platz ihr gegenüber, wo ein junger Mann saß.
Er trug einen leuchtend lavendelblauen Pullover. Keinesfalls wollte sie den Blick höher als auf seinen Pullover richten. Denn dann würde sie ihm in die Augen sehen, und das ginge ganz und gar nicht!
Mechaniker riefen etwas auf Französisch – der Motor heulte auf – erstarb – heulte wieder auf – Keile wurden beiseitegerückt – die Maschine setzte sich in Bewegung.
Jane hielt den Atem an. Es war erst ihr zweiter Flug. Sie war noch immer leicht in Unruhe zu versetzen. Es sah so aus, es sah tatsächlich so aus, als rasten sie gleich in diesen Zaun – nein, sie hatten den Boden unter sich gelassen – erhoben sich in die Luft – schwebten – Le Bourget lag unter ihnen.
Die Mittagsmaschine nach Croydon war gestartet. Einundzwanzig Passagiere befanden sich an Bord – zehn im vorderen Bereich, elf im hinteren. Dazu zwei Piloten und zwei Stewards. Da das Motorengeräusch geschickt gedämpft war, bestand keine Veranlassung, sich Watte in die Ohren zu stopfen. Und dennoch war die Lautstärke so, dass sie die Unterhaltung hemmte und das Denken förderte.
Während das Flugzeug auf dem Weg zum Ärmelkanal über Frankreich hinwegröhrte, hingen die Passagiere im hinteren Teil des Flugzeugs ihren Gedanken nach.
Jane Grey dachte: »Ich werde ihn nicht ansehen … auf keinen Fall … Besser ich tue es nicht. Ich schaue einfach weiter aus dem Fenster und denke nach. Ich werde an etwas Bestimmtes denken – das ist immer am besten. Es wird mich beruhigen. Ich werde mit dem Anfang beginnen und alles noch mal genau durchgehen.«
Entschlossen konzentrierte sie sich auf das, was sie den Anfang nannte, den Kauf eines Loses der »Irish Sweep«. Es war zwar eine Vergeudung gewesen, aber eine aufregende Vergeudung.
Viel Gelächter und Neckereien in dem Friseurladen, in dem Jane und fünf andere junge Frauen angestellt waren.
»Was machst du, wenn du ihn gewinnst, Schätzchen?«
»Ich weiß schon, was ich täte.«
Pläne, Luftschlösser, viele Scherze.
Nun ja, »ihn« hatte sie nicht gewonnen – »ihn«, den großen Preis; doch sie hatte einhundert Pfund gewonnen.
Einhundert Pfund.
»Die Hälfte gibst du aus, Schätzchen, und die andere Hälfte legst du für schlechte Zeiten zurück. Man weiß ja nie.«
»Ich an deiner Stelle würde einen Pelzmantel kaufen … einen richtig guten.«
»Wie wäre es mit einer Kreuzfahrt?«
Beim Gedanken an eine Kreuzfahrt war Jane ins Wanken geraten, doch letztendlich war sie ihrer ersten Idee treu geblieben. Eine Woche in Le Pinet. Viele ihre Kundinnen waren gerade nach Le Pinet gefahren oder von dort zurückgekehrt. Während Janes geschickte Finger Wellen betasteten und drapierten und ihr Mund die üblichen Sätze sprach – »Wollen wir mal sehen, wann Sie Ihre letzte Dauerwelle bekommen haben, Madam«, »Ihr Haar hat eine außergewöhnliche Farbe, Madam«, »War es nicht ein wundervoller Sommer, Madam?« –, hatte sie sich gedacht: »Warum zum Teufel kann denn ich nicht einmal nach Le Pinet fahren?« Nun konnte sie es.
Die Kleidung stellte nur ein geringes Problem dar. Wie die meisten Londoner Mädchen, die in eleganten Geschäften angestellt waren, konnte Jane mit lächerlich kleinem Aufwand eine zauberhaft modische Wirkung erzielen. Nägel, Make-up und Haar waren untadelig.
Jane reiste nach Le Pinet.
War es möglich, dass nun in ihren Gedanken zehn Tage in Le Pinet auf ein einziges Ereignis zusammengeschnurrt waren?
Auf ein Ereignis am Roulettetisch. Jane gestattete sich jeden Abend einen gewissen Betrag für das Spielvergnügen und war fest entschlossen, diese Summe niemals zu überschreiten. Entgegen dem weitverbreiteten Aberglauben war Jane das Anfängerglück nicht hold. Es war ihr vierter Tag und der letzte Spieleinsatz an diesem Abend. Bisher hatte sie vorsichtig auf Farbe oder auf eines der Dutzende gesetzt. Ein klein wenig hatte sie gewonnen, doch sehr viel mehr verloren.
Auf zwei Zahlen, die Fünf und die Sechs, hatte bisher niemand gesetzt. Sollte sie ihren letzten Einsatz auf eine dieser Zahlen riskieren? Und wenn ja, auf welche? Auf die Fünf oder die Sechs? Was sagte ihr Gefühl?
Fünf – die Fünf würde gewinnen. Die Kugel wurde geworfen. Jane streckte den Arm aus. Sechs – sie hatte auf die Sechs gesetzt.
Gerade noch rechtzeitig. Sie und ein anderer Spieler ihr gegenüber setzten gleichzeitig, sie auf die Sechs, er auf die Fünf.
»Rien ne va plus«, rief der Croupier.
Die Kugel ratterte und blieb liegen.
»Le numéro cinq, rouge, impair, manque.«
Jane hätte schreien mögen vor Zorn. Der Croupier rechte die Einsätze zusammen und zahlte sie aus. Der Mann ihr gegenüber fragte: »Wollen Sie denn Ihren Gewinn nicht einstecken?«
»Meinen?«
»Ja.«
»Aber ich habe doch auf die Sechs gesetzt.«
»Nein, nicht doch. Ich habe auf die Sechs und Sie auf die Fünf gesetzt.«
Er lächelte – ein sehr anziehendes Lächeln. Weiße Zähne in einem braungebrannten Gesicht, blaue Augen, welliges kurzes Haar.
Eher ungläubig nahm Jane ihren Gewinn entgegen. Entsprach es der Wahrheit? Sie war etwas konfus. Vielleicht hatte sie ihre Jetons tatsächlich auf die Fünf gesetzt. Zweifelnd schaute sie den Fremden an, der ihr ein Lächeln zuwarf.
»Ganz recht«, sagte er. »Lassen Sie ihn einfach liegen, irgendjemand, dem er gar nicht zusteht, wird ihn schon nehmen. Das ist ein alter Trick.«
Dann war er mit einem angedeuteten freundlichen Nicken davongegangen. Auch das war sehr nett von ihm gewesen. Ansonsten hätte sie den Verdacht hegen können, dass er ihr seinen Gewinn zuschanzte, um ihre Bekanntschaft zu machen. Doch so ein Mann war er nicht. Er war nett … (Und nun saß er ihr gegenüber.)
Und jetzt war alles vorbei – das Geld war ausgegeben – zwei letzte (eher enttäuschende) Tage in Paris, und nun der Rückflug nach Hause.
»Und dann? – Halt«, zügelte Jane ihre Gedanken. »Denk nicht daran, was danach geschieht. Das macht dich nur nervös.«
Die beiden Frauen hatten ihr Gespräch beendet.
Sie sah auf die andere Seite des Gangs. Die Frau mit dem Puppengesicht murmelte verdrießlich etwas vor sich hin und betrachtete einen abgebrochenen Fingernagel. Sie läutete, und als der Steward in seinem weißen Jackett erschien, bat sie ihn:
»Schicken Sie mir meine Zofe. Sie sitzt im vorderen Kabinenteil.«
»Ja, Mylady.«
Der sehr höfliche, sehr schnelle und tüchtige Steward verschwand wieder. Eine dunkelhaarige junge Französin, ganz in Schwarz gekleidet, erschien. Sie trug einen kleinen Schmuckkoffer.
Lady Horbury sprach sie auf Französisch an.
»Madeleine, ich möchte mein rotes Saffianlederetui.«
Die Zofe ging durch den Gang bis zum Ende der Flugkabine, wo sich Decken und Koffer stapelten.
Die junge Frau kam mit einem kleinen roten Necessaire zurück.
Cicely Horbury nahm es entgegen und entließ die Zofe.
»Danke, Madeleine. Ich behalte es hier.«
Die Zofe ging wieder. Lady Horbury öffnete das Etui und entnahm dem wunderschön ausgestatteten Inneren eine Nagelfeile. Dann betrachtete sie ausgiebig und ernst ihr Gesicht im kleinen Spiegel und machte hier und da kleine Retouchen – ein bisschen Puder, etwas Lippenstift.
Jane schürzte verächtlich die Lippen; ihr Blick wanderte weiter den Gang entlang.
Hinter den beiden Frauen saß der kleine Ausländer, der seinen Platz der »Landadeligen« überlassen hatte. Dick vermummt in unnötige Schals, schien er tief zu schlafen. Vielleicht durch Janes forschenden Blick irritiert, öffnete er die Augen, sah sie kurz an und schloss sie wieder.
Neben ihm saß ein großer grauhaariger Mann mit herrischem Gesicht, einen geöffneten Flötenkasten vor sich, der mit Hingabe die Flöte polierte. Komisch, dachte Jane, er sieht gar nicht wie ein Musiker aus, eher wie ein Anwalt oder ein Arzt.
Hinter den beiden saßen zwei Franzosen, der eine mit Bart und der andere bedeutend jünger – vielleicht sein Sohn –, die angeregt sprachen und gestikulierten.
Auf ihrer Gangseite war Jane der Blick vom Mann im blauen Pullover verstellt, von dem Mann, den sie aus absurden Gründen keinesfalls ansehen wollte.
»Absurd, so … so … kribbelig zu sein. Als wäre ich siebzehn«, dachte Jane angewidert.
Und Norman Gale ihr gegenüber dachte:
»Sie ist hübsch … wirklich hübsch. Sie erinnert sich ganz genau an mich. Sie sah so enttäuscht aus, als ihr Einsatz weggeschoben wurde. Zu sehen, wie sie sich über den Gewinn freute, war mir bedeutend mehr wert. Das habe ich gut gemacht … Ihr Lächeln ist sehr anziehend … keine Parodontitis, gesundes Zahnfleisch und makellose Zähne … Verdammt, ich bin ziemlich aufgeregt. Ruhig, mein Junge …«
Zu dem Steward, der sich mit der Speisekarte zu ihm hinunterbeugte, sagte er: »Ich hätte gerne die kalte Zunge.«
Lady Horbury dachte: »Mein Gott, was soll ich tun? Ich bin in Teufels Küche … in Teufels Küche. Ich sehe nur einen einzigen Ausweg. Wenn ich doch nur den Mut hätte. Schaffe ich es? Kann ich mich durchmogeln? Ich bin mit den Nerven am Ende. Das ist das Koks. Warum nur habe ich mich je darauf eingelassen? Ich sehe schrecklich aus, einfach schrecklich. Dass diese Schlange Venetia Kerr hier ist, macht es noch schlimmer. Sie sieht mich ständig an, als wäre ich der letzte Dreck. Sie wollte Stephen für sich. Tja, sie hat ihn nicht bekommen! Ihr langes Gesicht geht mir auf die Nerven. Sie sieht wirklich genauso aus wie ein Pferd. Ich hasse diese Landadligen. Mein Gott, was soll ich bloß tun? Ich muss mir etwas einfallen lassen. Das alte Miststück meint, was sie sagt …«
Sie kramte in ihrem Handtäschchen nach dem Zigarettenetui und steckte eine Zigarette in eine lange Spitze. Ihre Hände zitterten leicht.
Die Ehrenwerte Venetia Kerr dachte: »Verdammte kleine Nutte. Ja, genau das ist sie. Sie mag zwar tugendhaft wirken, aber sie ist eine Nutte durch und durch. Armer lieber Stephen … wenn er sie doch nur loswerden könnte …«
Auch sie tastete nach ihrem Zigarettenetui und nahm Cicely Horburys Streichholz entgegen.
Der Steward sagte: »Verzeihen Sie, meine Damen, Rauchen ist hier nicht erlaubt.«
»Mist«, schimpfte Cicely Horbury.
Monsieur Hercule Poirot dachte: »Sie ist hübsch, die Kleine da drüben. Ihr Kinn zeigt Entschlossenheit. Warum nur wirkt sie so beunruhigt? Warum nur will sie keinesfalls den gutaussehenden jungen Mann ihr gegenüber ansehen? Sie ist sich doch seiner Anwesenheit sehr bewusst und er sich ihrer …« Das Flugzeug sackte leicht ab. »Mon estomac«, dachte Hercule Poirot und schloss die Augen wieder.
Dr. Bryant neben ihm, der mit fahrigen Händen über seine Flöte strich, dachte: »Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann es einfach nicht. Das ist der Wendepunkt in meiner Laufbahn …«
Nervös nahm er die Flöte aus ihrem Kasten und streichelte sie liebevoll … Beinahe lächelnd hob er sie nun an die Lippen, dann ließ er sie wieder sinken. Der kleine Mann mit dem Schnurrbart neben ihm war rasch eingeschlafen. Als das Flugzeug etwas ins Schwanken geriet, hatte er ausgesprochen grün ausgesehen. Dr. Bryant war froh, dass er weder im Zug noch auf dem Meer noch in der Luft von Übelkeit geplagt wurde …
Monsieur Dupont père drehte sich aufgeregt auf seinem Platz um und brüllte Monsieur Dupont fils, der neben ihm saß, etwas zu.
»Daran gibt es keinen Zweifel. Sie alle haben unrecht … die Deutschen, die Amerikaner, die Engländer! Sie alle datieren die prähistorische Keramik falsch. Denk doch an die Tonwaren aus Samara …«
Jean Dupont, groß, blond, hielt mit aufgesetzter Gelassenheit dagegen: »Du musst die Beweise aus sämtlichen Quellen heranziehen. Da gibt es Tell Halaf und Sakje Geuze …«
Sie führten ihr Gespräch weiter.
Armand Dupont riss eine abgewetzte Aktentasche auf.
»Sieh dir diese kurdischen Pfeifen an, solche werden heutzutage hergestellt. Sie haben fast das gleiche Dekor wie die Keramik aus der Zeit von 5000 vor Christus.«
Eine beredte Geste fegte beinahe den Teller beiseite, den gerade ein Steward vor ihn hinstellte.
Mr Clancy, ein Krimiautor, stand von seinem Sitz hinter Norman Gale auf und trottete ans Ende der Kabine, zog ein europäisches Kursbuch aus der Tasche seines dort abgelegten Regenmantels und kehrte mit ihm an seinen Platz zurück, um aus beruflichen Gründen ein kompliziertes Alibi auszuarbeiten.
Mr Ryder, auf dem Sitz hinter ihm, dachte: »Ich muss bis zum Ende durchhalten, doch das wird nicht leicht. Ich weiß nicht, wie ich die Kohle für die nächste Dividende zusammenbekommen soll … Zahlen wir die Dividende nicht aus, ist der Teufel los … o Gott!«
Norman Gale stand auf und ging zur Toilette. Kaum war er weg, zog Jane einen Spiegel hervor und betrachtete besorgt ihr Gesicht. Sie legte Puder und Lippenstift auf.
Ein Steward brachte ihr Kaffee.
Jane sah aus dem Fenster. Glitzrig blau lag der Ärmelkanal unter ihr.
Eine Wespe surrte um Mr Clancys Kopf, gerade als er sich mit dem Zug um 19:55 in Zaribrod beschäftigte, gedankenverloren schlug er nach ihr. Die Wespe flog weiter, um die Kaffeetassen der Duponts zu erforschen.
Jean Dupont erschlug sie.
Ruhe senkte sich über die Kabine. Die Gespräche legten sich, doch die Gedanken nahmen weiter ihren Lauf.
Ganz am Ende der Kabine, auf Platz Nummer 2, fiel Madame Giselles Kopf ein wenig nach vorn. Man hätte glauben können, sie schliefe. Doch sie schlief nicht. Und ebenso wenig sprach oder dachte sie.
Madame Giselle war tot …
2Die Entdeckung
Henry Mitchell, der ältere der beiden Stewards, eilte von Tischchen zu Tischchen und verteilte die Rechnungen. In einer halben Stunde würden sie in Croydon landen. Er sammelte Geldscheine und Münzen ein, verbeugte sich und sagte: »Vielen Dank, Sir. Vielen Dank, Madam.« Am Tisch der Franzosen musste er ein, zwei Minuten warten, da die beiden angeregt diskutierten und gestikulierten. Von ihnen war ohnehin kein großes Trinkgeld zu erwarten, dachte er finster. Zwei Passagiere schliefen – der kleine Mann mit dem Schnurrbart und die alte Dame ganz hinten. Sie gab immer ein großzügiges Trinkgeld – er erinnerte sich, sie schon einige Male gesehen zu haben. Darum zögerte er, sie zu wecken.
Der kleine Mann mit dem Schnurrbart wachte auf und bezahlte die Flasche Sodawasser und die dünnen harten Kekse, mehr hatte er nicht zu sich genommen.
Mitchell ließ die Passagierin so lange wie möglich in Ruhe. Etwa fünf Minuten bevor sie Croydon erreichten, stand er neben ihr und beugte sich zu ihr hinunter.
»Verzeihung, Madam, Ihre Rechnung.«
Rücksichtsvoll legte er ihr eine Hand auf die Schulter. Sie wurde nicht wach. Er drückte fester, schüttelte sie leicht, doch das Einzige, was geschah, war, dass ihr Körper unerwartet im Sitz zusammensackte. Mitchell beugte sich über sie, dann richtete er sich mit bleichem Gesicht wieder auf.
Albert Davis, der zweite Steward, sagte:
»Was? Das ist nicht dein Ernst!«
»Doch. Doch.«
Mitchell war kreideweiß und zitterte.
»Bist du sicher, Henry?«
»Todsicher. Letztlich – nun ja, vielleicht ist es ein Anfall.«
»In wenigen Minuten sind wir in Croydon.«
»Und wenn sie sich nur schlecht fühlt …«
Einen kurzen Moment waren die beiden unentschlossen, dann sprachen sie ab, wie sie vorgehen wollten. Mitchell begab sich wieder in den hinteren Teil der Kabine. Er ging von Tisch zu Tisch, beugte sich hinunter und murmelte diskret:
»Verzeihung, Sir, Sie sind nicht zufällig Arzt …?«
Norman Gale antwortete: »Ich bin Zahnarzt. Doch wenn ich irgendetwas tun kann …« Er erhob sich halb aus seinem Sitz.
»Ich bin Arzt«, sagte Dr. Bryant. »Worum geht’s?«
»Da ganz hinten ist eine Lady … wie sie aussieht, gefällt mir nicht.«
Bryant sprang auf und begleitete den Steward. Unbemerkt folgte ihnen der kleine Mann mit dem Schnurrbart.
Dr. Bryant beugte sich über die zusammengesunkene Gestalt auf dem Sitz Nr. 2, eine etwas beleibte, schwarz gekleidete Frau mittleren Alters.
Die Untersuchung des Arztes war kurz.
»Sie ist tot«, sagte er.
Mitchell fragte: »Was glauben Sie, war es ein Anfall?«
»Das kann ich ohne genaue Untersuchung unmöglich sagen. Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen … ich meine, lebendig?«
Mitchell überlegte.
»Als ich ihr den Kaffee servierte, war sie noch wohlauf.«
»Wann war das?«
»Vielleicht vor einer Dreiviertelstunde … so in etwa. Und als ich ihr dann die Rechnung brachte, dachte ich, sie schliefe …«
Bryant erklärte: »Sie ist mindestens seit einer halben Stunde tot.«
Ihr Gespräch weckte allmählich die Neugier der anderen, Köpfe drehten sich zu ihnen, Hälse wurden gereckt, um zu lauschen.
»Es könnte doch so eine Art Anfall gewesen sein«, schlug Mitchell hoffnungsvoll vor.
Er klammerte sich an die Theorie eines Anfalls.
Die Schwester seiner Frau litt unter Anfällen. Er glaubte, Anfälle seien etwas Herkömmliches, das jedermann verstünde.
Dr. Bryant hatte nicht die Absicht, sich festzulegen. Er schüttelt nur verdutzt den Kopf.
Auf der Höhe seines Ellbogens war mit einem Mal eine Stimme zu vernehmen, die Stimme des in den Schal gehüllten Mannes mit dem Schnurrbart.
»Sie hat da«, sagte er, »ein Mal am Hals.«
Er sprach etwas schüchtern, als wüsste er genau, dass er sich an eine fachliche Kapazität wandte.
»Richtig«, bestätigte Bryant.
Der Kopf der Frau hing schlaff zur Seite. Seitlich an ihrem Hals befand sich ein winziger Punkt.
»Entschuldigung«, mischten sich die beiden Duponts ein. Sie hatten die letzten Minuten zugehört. »Die Frau ist tot, sagen Sie, und sie hat ein Mal am Hals?«
Jean, der jüngere Dupont, stellte die Frage.
»Dürfte ich Ihnen einen Hinweis geben? Vorhin flog hier eine Wespe herum. Ich habe sie erschlagen.« Er zeigte ihnen das tote Insekt auf seiner Untertasse. »Wäre es nicht möglich, dass die arme Lady an einem Wespenstich gestorben ist? Ich habe schon mal von so etwas gehört.«
»Ja, wäre möglich«, stimmte Bryant zu. »Ich kenne solche Fälle. Ja, das ist sicherlich eine mögliche Erklärung, insbesondere wenn eine Herzschwäche bestanden haben sollte …«
»Kann ich irgendetwas tun, Sir?«, fragte der Steward. »Wir landen gleich in Croydon.«
»Ach ja«, sagte Dr. Bryant, während er einen kleinen Schritt zurücktrat. »Da gibt es nichts zu tun. Die … äh … Leiche darf nicht berührt werden, Steward.«
»Ja, Sir, ich verstehe.«
Als Dr. Bryant zu seinem Platz zurückkehren wollte, bemerkte er verwundert, dass der kleine Ausländer mit dem Schal ihm im Weg stand.
»Verehrter Sir«, sagte er, »am besten gehen Sie zurück zu Ihrem Platz. Wir sind gleich in Croydon.«
»So ist es, Sir«, bestätigte der Steward. Er hob die Stimme:
»Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie alle wieder Ihre Plätze ein.«
»Pardon«, sagte der kleine Mann. »Da ist etwas …«
»Etwas?«
»Mais oui … das Sie übersehen haben.«
Mit der Spitze seines Lacklederschuhs verdeutlichte er, was er meinte. Der Steward und Dr. Bryant verfolgten aufmerksam seine Geste und entdeckten etwas gelb-schwarz Schimmerndes auf dem Boden, das vom Saum des schwarzen Rocks halb verdeckt war.
»Noch eine Wespe?«, fragte der Doktor überrascht.
Hercule Poirot ging in die Knie. Er zog eine kleine Pinzette aus seiner Tasche und drückte ihre Enden vorsichtig zusammen. Mit der Beute erhob er sich wieder.
»Ja«, sagte er. »Es sieht einer Wespe sehr ähnlich. Aber es ist keine Wespe!«
Er drehte das Objekt hin und her, sodass der Arzt und der Steward es deutlich sehen konnten, eine kleine Fluse aus gerauter Seide, orange und schwarz, an einem langen seltsamen Dorn mit verfärbter Spitze.
»Ach, du meine Güte! Ach, du meine Güte!« Der Ausruf kam von dem kleinen Mr Clancy, der von seinem Platz aufgestanden war und aufgeregt den Kopf über die Schulter des Stewards reckte. »Außerordentlich, wirklich ganz außerordentlich, absolut das Außerordentlichste, das mir je in meinem Leben begegnet ist. Wahrhaftig, das hätte ich nie geglaubt.«
»Könnten Sie sich ein bisschen klarer ausdrücken, Sir?«, bat der Steward. »Wissen Sie, was das ist?«
»Ob ich weiß, was das ist? Und ob ich das weiß.« Mr Clancy blähte sich vor Stolz und Genugtuung. »Dieses Ding, Gentlemen, ist der Dorn, den gewisse Stämme … äh – im Moment kann ich nicht mit Gewissheit sagen, ob es südamerikanische Stämme oder die Ureinwohner Borneos sind – mit einem Blasrohr abschießen. Aber es ist unzweifelhaft ein Pfeil, der sein Ziel mit einem Blasrohr erreicht. Und ich vermute stark, dass sich an der Spitze …«
»… das berühmte Pfeilgift der südamerikanischen Indios befindet«, vollendete Hercule Poirot den Satz. Und er fügte noch hinzu. »Mais enfin! Est-ce que c’est possible?«
»Das ist gewiss ganz außergewöhnlich«, sagte Mr Clancy, noch immer voll seliger Aufregung. »Wie schon gesagt, höchst außergewöhnlich. Ich schreibe Kriminalromane; doch so etwas im wirklichen Leben zu sehen …«
Ihm fehlten die Worte.
Das Flugzeug neigte sich leicht zur Seite, sodass die Stehenden ein wenig ins Schwanken gerieten, und schwebte in einer Schleife hinab zum Flughafen Croydon.
3Croydon
Der Steward und Dr. Bryant trugen nun nicht mehr die Verantwortung für die Situation. Der recht abstrus aussehende kleine Mann mit den Schals hatte sie übernommen. Die Autorität und Bestimmtheit, mit der er sprach, hatten zur Folge, dass man ihm gehorchte und niemand auf den Gedanken kam, sie in Zweifel zu ziehen.
Er flüsterte Mitchell etwas zu, der daraufhin nickte. Und nachdem er sich zwischen den Passagieren hindurchgedrängt hatte, stellte er sich an die Tür, die an den Toiletten vorbei zum vorderen Kabinenteil führte.
Das Flugzeug rollte nun über den Asphalt. Als es schließlich zum Stehen kam, erhob Mitchell die Stimme.
»Ladys und Gentlemen, ich muss Sie bitten, auf Ihren Plätzen zu bleiben und zu warten, bis ein Beamter die Sache in die Hand nimmt. Ich hoffe, Sie werden nicht allzu lange aufgehalten.«
Die meisten Passagiere begrüßten diese sinnvolle Anordnung, nur eine Person protestierte lautstark.
»Unsinn«, rief Lady Horbury ärgerlich. »Wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich bestehe darauf, die Maschine sofort zu verlassen.«
»Es tut mir sehr leid, Mylady. Ich kann keine Ausnahme machen.«
»Aber das ist doch lächerlich, absolut lächerlich.« Cicely stampfte wütend mit dem Fuß auf. »Ich werde mich bei der Fluggesellschaft über Sie beschweren. Es ist ungeheuerlich, dass Sie uns hier mit einer Leiche an Bord festhalten wollen.«
»In der Tat, meine Liebe«, sprach Venetia Kerr in ihrem wohlerzogenen, affektierten Tonfall. »Niederschmetternd, doch ich fürchte, wir müssen uns fügen.« Sie setzte sich wieder und zog ihr Zigarettenetui hervor. »Darf ich jetzt rauchen, Steward?«
Der zermürbte Mitchell entgegnete: »Ich glaube, das ist nun unerheblich.«
Er schaute über die Schulter nach hinten. Davis hatte die Passagiere aus dem vorderen Flugzeugteil durch den Notausgang hinausgeleitet und sich auf die Suche nach neuen Anordnungen begeben.
Sie mussten nicht lange warten – auch wenn es den Passagieren so vorkam, als wäre mindestens eine halbe Stunde vergangen –, bis eine Gestalt in Zivil in strammer Haltung und ein Polizist in Uniform über das Rollfeld eilten und durch die Tür, die Mitchell ihnen offen hielt, in die Maschine stiegen.
»Nun, was ist hier los?«, fragte der eine in forschem, dienstlichem Ton.
Erst hörte er Mitchell zu, dann Dr. Bryant, während sein rascher Blick die zusammengesunkene tote Frau streifte.
Er erteilte dem Polizeibeamten einen Befehl und wandte sich dann an die Passagiere.
»Würden Sie mir bitte folgen, Ladys und Gentlemen.«
Er geleitete sie aus dem Flugzeug und über das Rollfeld, betrat jedoch nicht die übliche Zollabfertigung, sondern führte sie in einen kleinen Raum.
»Ich hoffe, Sie nicht länger aufzuhalten als unbedingt nötig, Ladys und Gentlemen.«
»Hören Sie, Inspektor«, sagte Mr James Ryder, »ich habe einen dringenden Geschäftstermin in London.«
»Tut mir leid, Sir.«
»Ich bin Lady Horbury. Ich empfinde es als höchst empörend, dass ich wegen dieses Falls hier festgehalten werde!«
»Es tut mir aufrichtig leid, Lady Horbury. Aber dies ist eine sehr ernste Angelegenheit. Es sieht nach einem Mordfall aus.«
»Das Pfeilgift südamerikanischer Indios«, murmelte Mr Clancy wie im Delirium mit einem glücklichen Lächeln auf dem Gesicht.
Der Inspektor musterte ihn misstrauisch.
Der französische Archäologe sprach aufgeregt französisch, und der Inspektor antwortete ihm langsam und umsichtig in derselben Sprache.
Venetia Kerr bemerkte: »All das ist grässlich langweilig, doch Sie müssen wohl Ihre Pflicht erfüllen, Inspektor.« Woraufhin ihr jener mit einer gewissen Dankbarkeit erwiderte: »Ich danke Ihnen, Madam.«
Und weiter sagte er:
»Würden Sie, Ladys und Gentlemen, bitte hierbleiben, während ich einige Worte mit Doktor … äh … Doktor …?«
»Mein Name ist Bryant.«
»Danke. Bitte folgen Sie mir, Doktor.«
»Dürfte ich bei Ihrem Gespräch dabei sein?«, fragte der kleine Mann mit dem Schnurrbart.
Der Inspektor drehte sich mit einer scharfen Entgegnung auf der Zunge zu ihm um. Doch plötzlich veränderte sich sein Gesichtsausdruck.
»Oh, Monsieur Poirot«, sagte er. »Sie sind so vermummt, dass ich Sie nicht erkannt habe. Kommen Sie mit, unbedingt.«
Er hielt Bryant und Poirot die Tür auf, während die anderen ihnen argwöhnisch hinterhersahen.
»Und warum darf er hinaus und wir nicht?«, rief Cicely Horbury.
Venetia Kerr setzte sich schicksalsergeben auf eine Bank. »Womöglich jemand von der französischen Polizei oder ein Spitzel vom Zoll«, meinte sie.
Sie zündete sich eine Zigarette an.
Norman Gale sagte recht schüchtern zu Jane: »Ich glaube, ich habe Sie gesehen in … äh … Le Pinet.«
»Ja, ich war in Le Pinet.«
Norman Gale sagte: »Es ist ein äußerst hübsches Örtchen. Ich liebe Pinien.«
Jane sagte: »Ja, sie duften so gut.«
Und dann schwiegen beide eine Weile, da sie nicht wussten, was sie als Nächstes sagen sollten.
Schließlich sagte Gale: »Ich … äh … habe Sie im Flugzeug sofort wiedererkannt.«
Jane zeigte sich sehr überrascht. »Ach, wirklich?«
Gale sagte: »Glauben Sie, dass diese Frau tatsächlich umgebracht wurde?«
»Ja, vermutlich. Es ist ziemlich aufregend, aber auch ziemlich unangenehm.« Sie bebte leicht, und Norman Gale rückte beschützend ein Stückchen näher an sie heran.
Die Duponts unterhielten sich auf Französisch. Mr Ryder notierte Berechnungen in ein kleines Notizbuch und sah von Zeit zu Zeit auf seine Uhr. Cicely Horbury saß da und tippte mit dem Fuß ungeduldig auf den Boden. Mit zitternder Hand zündete sie sich eine Zigarette an.
An der Tür lehnte ein sehr großer, blaugekleideter, teilnahmslos wirkender Polizist. In einem Nebenraum sprach Inspektor Japp mit Dr. Bryant und Hercule Poirot.
»Sie haben die Gabe, stets an den unerwartetsten Orten aufzutauchen, Monsieur Poirot.«
»Liegt der Flughafen Croydon nicht ein wenig außerhalb Ihres Reviers, mein Lieber?«, fragte Poirot.
»Ah, ich bin einem großen Schmuggler auf der Spur. Ein glücklicher Zufall, dass ich gerade hier bin. Das ist das Verrückteste, das mir seit Jahren begegnet ist. Zu erst einmal, Doktor, geben Sie mir vielleicht Ihren vollen Namen und Ihre Adresse an.«
»Roger James Bryant. Ich bin Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten. Meine Adresse ist 329 Harley Street.«
Ein behäbiger Polizeibeamter, der am Tisch saß, nahm diese Angaben zu Protokoll.
»Selbstverständlich wird unser eigener Arzt die Leiche untersuchen«, sagte Japp. »Aber wir hätten Sie gerne bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung dabei, Doktor.«
»Sehr recht, sehr recht.«
»Können Sie uns so ungefähr die Todeszeit nennen?«
»Die Frau muss, als ich sie untersucht habe, schon mindestens eine halbe Stunde tot gewesen sein. Das war wenige Minuten vor der Landung in Croydon. Genaueres kann ich nicht sagen, doch der Steward erzählte, er habe noch eine Stunde zuvor mit ihr gesprochen.«
»Gut, das schränkt die Zeitspanne praktisch ein. Vermutlich ist es sinnlos zu fragen, ob Sie irgendetwas Verdächtiges beobachtet haben.«
Der Doktor schüttelte den Kopf.
»Und ich, ich habe geschlafen«, sagte Poirot höchst bekümmert. »Ich leide in der Luft fast genauso wie auf dem Meer. Darum hülle ich mich immer warm ein und versuche zu schlafen.«
»Irgendeine Idee zur Todesursache, Doktor?«
»Es widerstrebt mir, im Augenblick irgendetwas Definitives zu äußern. Dieser Fall bedarf einer postmortalen Untersuchung und einer Analyse.«
Japp nickte verständnisvoll.
»Gut, Doktor«, sagte er. »Ich glaube nicht, dass wir Sie länger festhalten müssen. Ich fürchte nur, dass Sie … äh … wie alle Passagiere … gewisse Formalitäten über sich ergehen lassen müssen. Wir können keine Ausnahme machen.«
Dr. Bryant lächelte.
»Es wäre mir lieber, Sie würden sicherstellen, dass ich kein … äh … Blasrohr oder eine andere tödliche Waffe am Körper versteckt trage.«
»Rogers hier wird sich das ansehen.« Japp nickte seinem Untergebenen zu. »Ach, übrigens, Doktor, haben Sie eine Ahnung, was das hier sein könnte auf diesem …?«
Er deutete auf den verfärbten Dorn, der in einer kleinen Schachtel vor ihm auf dem Tisch lag.
Dr. Bryant schüttelte den Kopf.
»Schwer zu sagen ohne Analyse. Ich glaube, die Indios verwenden normalerweise Curare.«
»Käme es infrage?«
»Es ist ein sehr rasch wirkendes Gift.«
»Aber nicht leicht zu beschaffen, oder?«
»Nicht für einen Laien.«
»Dann müssen wir Sie besonders sorgsam abtasten«, sagte Japp, der gerne zu scherzen beliebte. »Rogers!«
Der Doktor und der Beamte verließen gemeinsam den Raum.
Japp kippelte mit seinem Stuhl nach hinten und sah Poirot an.
»Komische Geschichte«, meinte er. »Etwas zu sensationell, um wahr zu sein. Ich meine, Blasrohre und vergiftete Pfeile in einem Flugzeug … das ist eine Beleidigung für den Verstand.«
»Das, mein Freund, ist eine tiefgründige Bemerkung«, sagte Poirot.
»Einige meiner Männer durchsuchen das Flugzeug«, sagte Japp. »Wir haben einen Spezialisten für Fingerabdrücke dabei, und ein Fotograf wird auch gleich kommen. Als Nächstes sollten wir mit den Stewards reden.«
Er ging zur Tür und gab eine Anweisung. Die beiden Stewards wurden hereingeführt. Der jüngere hatte seine Fassung wiedergefunden. Er wirkte nur etwas aufgeregt. Der andere war noch immer bleich und verängstigt.
»Alles in Ordnung, meine Herren«, sagte Japp. »Setzen Sie sich. Haben Sie die Pässe dabei? Gut.«
Rasch blätterte er sie durch.
»Ah, da haben wir’s ja. Marie Morisot … ein französischer Pass. Wissen Sie irgendetwas über sie?«
»Ich habe sie schon einige Male gesehen. Sie flog recht oft zwischen England und Frankreich hin und her«, erklärte Mitchell.
»Ah! Sicher wegen irgendwelcher Geschäfte. Sie wissen nicht zufällig, was sie beruflich gemacht hat?«
Mitchell schüttelte den Kopf. Der jüngere Steward sagte: »Auch ich kann mich an sie erinnern. Ich habe sie auf dem Frühflug gesehen – acht Uhr ab Paris.«
»Wer von Ihnen beiden hat sie zuletzt lebend gesehen?«
»Er!« Der Jüngere zeigte auf seinen Kollegen.
»Das ist richtig«, bestätigte Mitchell. »Als ich ihr den Kaffee servierte.«
»Wie hat sie da ausgesehen?«
»Ich kann nicht sagen, dass mir irgendetwas aufgefallen wäre. Ich habe ihr nur den Zucker gereicht und Milch angeboten, die sie ablehnte.«
»Um wie viel Uhr war das?«
»Tja, das kann ich nicht genau sagen. Wir flogen gerade über den Kanal. Es könnte so ungefähr zwei Uhr gewesen sein.«
»Ja, so in etwa«, bestätigte Albert Davis, der andere Steward.
»Wann haben Sie sie das nächste Mal gesehen?«
»Als ich die Rechnungen verteilt habe.«
»Um wie viel Uhr war das?«
»Etwa eine Viertelstunde später. Ich dachte, sie schläft … oh Mann, da muss sie ja schon tot gewesen sein.«
Die Stimme des Stewards klang ehrfurchtsvoll.
»Das hier haben Sie nicht gesehen?« – Japp deutete auf den wespenähnlichen Dorn.
»Nein, Sir.«
»Und wie ist es mit Ihnen, Davis?«
»Das letzte Mal habe ich sie gesehen, als ich die Käsehäppchen reichte. Da war sie wohlauf.«
»Nach welchem System servieren Sie?«, wollte Poirot wissen. »Servieren Sie in verschiedenen Kabinenabschnitten?«
»Nein, Sir, wir arbeiten zusammen. Erst die Suppe, dann Fleisch und Gemüse und Salat, dann den Nachtisch und so weiter. Normalerweise bedienen wir erst im hinteren Abschnitt und gehen dann mit frischen Tellern in den vorderen Kabinenteil.«
Poirot nickte.
»Hat diese Madame Morisot mit irgendjemandem im Flugzeug gesprochen oder gezeigt, dass sie jemanden kannte?«, fragte Japp.
»Nicht dass ich wüsste, Sir.«
»Und Sie, Davis?«
»Nein, Sir.«
»Hat sie während des Flugs ihren Platz verlassen?«
»Ich glaube nicht, Sir.«
»Hat einer von Ihnen irgendetwas bemerkt, das ein wenig Licht ins Dunkel bringen könnte?«
Beide Männer überlegten und schüttelten dann den Kopf.
»Gut, das ist es für den Augenblick. Wir sehen uns später noch.«
Henry Mitchell sagte nüchtern: »Das ist eine üble Geschichte, Sir. Was mir dabei überhaupt nicht gefällt ist, dass ich sozusagen der Verantwortliche gewesen bin.«
»Ich wüsste nicht, was Ihnen vorzuwerfen wäre«, sagte Japp. »Aber ich gebe Ihnen recht, wirklich eine üble Geschichte.« Er wollte die beiden mit einer Handbewegung entlassen, als Poirot sich vorbeugte.
»Erlauben Sie mir eine kleine Frage?«
»Nur zu, Monsieur Poirot.«
»Hat einer von Ihnen beiden eine Wespe im Flugzeug bemerkt?«
Beide Männer schüttelten den Kopf.
»So viel ich weiß, war da keine Wespe«, erwiderte Mitchell.
»Da war eine Wespe«, beharrte Poirot. »Wir haben das tote Insekt auf der Untertasse eines Passagiers sichergestellt.«
»Ich habe keine gesehen, Sir«, sagte Mitchell.
»Ich auch nicht«, sagte Davis.
»Nun gut.«
Nachdem die beiden Stewards den Raum verlassen hatten, warf Japp einen Blick in die Pässe.
»Es war eine Lady an Bord«, sagte er. »Bestimmt war sie es, die sich aufgespielt hat. Am besten befrage ich sie als Erste, bevor sie noch ausrastet und wegen der brutalen Methoden der Polizei eine Eingabe ans Parlament macht.«
»Sie werden doch sicher das Gepäck … das Handgepäck … der Passagiere im hinteren Flugzeugabschnitt sorgfältig durchsuchen lassen?«
Japp zwinkerte vergnügt.
»Warum? Was glauben Sie, Monsieur Poirot? Wir müssen dieses Blasrohr finden … wenn da überhaupt ein Blasrohr ist und wir nicht alle träumen! Kommt mir vor wie ein Albtraum. Ob vielleicht dieser Schreiberling durchgedreht ist und eines seiner Verbrechen tatsächlich im realen Leben statt nur auf dem Papier verübt hat? Diese Sache mit dem Giftpfeil klingt nach ihm.«
Poirot schüttelte zweifelnd den Kopf.
»Ja«, fuhr Japp fort. »Alle müssen durchsucht werden, ob sie sich darüber empören oder nicht; und alles, was sie bei sich haben, muss auch durchsucht werden … und damit basta!«
»Vielleicht könnte man eine detaillierte Liste aufstellen«, schlug Poirot vor, »eine Liste von allem, was diese Leute mit sich führen.«
Japp sah ihn neugierig an. »Wenn Sie es wünschen, Monsieur Poirot. Ich weiß zwar nicht genau, worauf Sie hinauswollen. Aber wir wissen ja, wonach wir suchen.«
»Sie vielleicht, mon ami, ich weiß es nicht so genau. Ich weiß, dass ich etwas suche, doch was genau, weiß ich nicht.«
»Ach, Sie schon wieder, Monsieur Poirot! Es gefällt Ihnen einfach, die Dinge immer komplizierter zu machen. Nun zu unserer Lady, bevor sie mir die Augen auskratzt.«
Doch Lady Horbury war mittlerweile etwas ruhiger geworden. Sie nahm Platz und beantwortete Japps Fragen ohne jedes Zögern. Sie stellte sich als die Ehefrau von Lord Horbury vor und gab ihre Adressen an, Horbury Chase, Sussex, und 315